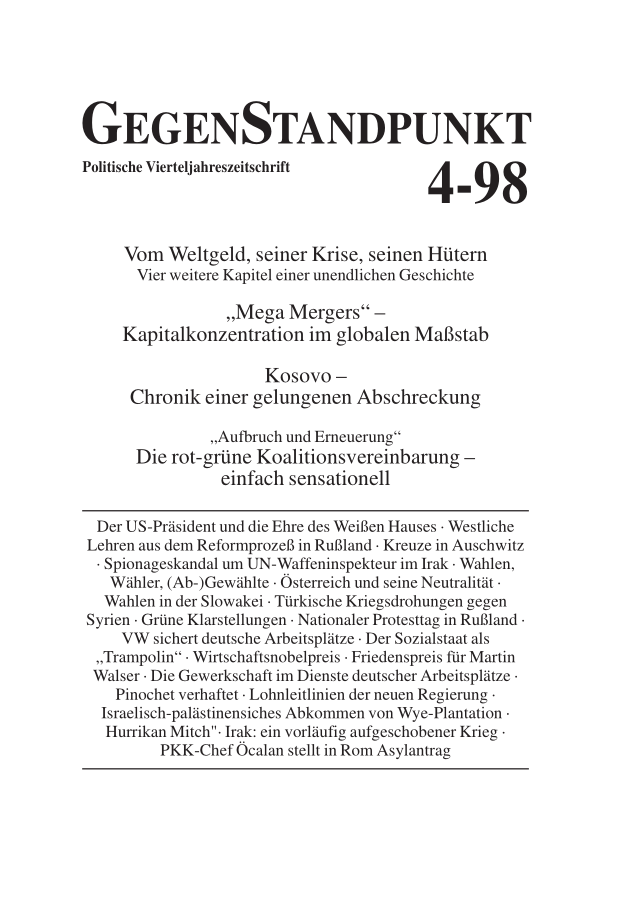„Mega Mergers“ – Kapitalkonzentration im globalen Maßstab
Die Vereinigung zweier Kapitale bezweckt den Einsatz eines vergrößerten Kapitals als entscheidende Waffe in der Konkurrenz, ohne dass Wachstum stattgefunden hätte. Bei der Fusion von Aktiengesellschaften müssen die Maßnahmen, mit denen das produktive Kapital seine Position in der Konkurrenz verbessert, zusätzlich dazu dienen, die Ansprüche des fiktiven Kapitals, also der alten und neuen Aktionäre auf spekulative Vermehrung ihres Geldkapitals, zu befriedigen. Im Unterschied zu den Belegschaften gebührt auch den Nationen, deren Kapitalstandort betroffen ist, ein Recht auf Mitsprache: Sie konkurrieren um den nationalen Nutzen der weltweiten Ausbeutung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- I. Kapitalgröße – das entscheidende Kampfmittel der Konkurrenz
- Das notwendige Wachstum des investierten Kapitals und seine Instrumente
- Die Folgen des Kapitalwachstums: Marktschranken
- Fusionen und Übernahmen – Vergrößerung des Kapitals ohne Wachstum
- Die Zentralisation von Kapitalmacht: eine nützliche Maßnahme
- „Synergie-Effekte“: Kostensenkung als unmittelbare Wirkung der Fusion
- „Kosten-, Preis-, Technologieführerschaft“: die Vergrößerung der Profitmasse als Mittel zur Steigerung der Profitrate
- Konkurrenz mit Fusionen: immer wieder fällig, in der Krise alltäglich und heute in Hinblick auf die globalen Marktschranken unverzichtbare Konkurrenzstrategie für künftige Krisengewinner
- Fusion im Finanzsektor: Größe ist Rendite
- II. Die Vereinigung zweier Profitquellen [4]
- III. Nationale Konkurrenz um den fertigen Weltmarkt: Der staatliche Beitrag zur Zentralisation und Internationalisierung des Kapitals
„Mega Mergers“ – Kapitalkonzentration im globalen Maßstab
Die Wirtschaftsseiten der Zeitungen geben sich – im Takt mit den Börsen – überrascht, begeistert, manchmal auch verunsichert vom „Fusionsfieber“, das die Aktienmärkte und deren „Phantasie“ nach oben treibt: Ob bei Banken und Versicherungen, bei Pharma oder Automobilen: Immer mehr Konzerne, die schon weltweit agieren und zu den Großen ihrer Branchen zählen, schließen sich zu noch größeren Einheiten zusammen, um möglichst der größte der Branche zu werden oder ihm in etwa gleichzukommen. Die Minderheit der Auskenner, die keine Managementmode ausläßt, lernt um: Bis vor kurzem hatte sie sich vom „Downsizing“ beeindruckt gezeigt und kapiert, daß „small beautiful“ ist, „Big Business“ hingegen ein Auslaufmodell, das es mit den hochproduktiven, beweglichen, kleinen Einheiten des 21.Jahrhunderts nicht mehr wird aufnehmen können. Diese Auskenner sind es, die jetzt etwas ganz Neues entdeckt haben wollen: Den Trend zur Größe. Was sie da als gefährliche oder erfreuliche, weil profitsteigernde Neuigkeit ausrufen, ist neu allenfalls in seinen Dimensionen. Die Konkurrenztechnik selbst dagegen, die „Zentralisation des Kapitals“, ist so alt wie der Kapitalismus selbst.
Der Sachverstand, der darin besteht, dem „Markt“ bedingungslos recht zu geben, um sich nachträglich der Vernunft seiner „Entscheidungen“ anzuschließen, ist mit der Sache fertig, sobald er sich ihr zuwendet. Sein Erklärungsbedarf ist gestillt, wenn er Vorteile zitieren kann, die Konzernzentralen sich von Zusammenschlüssen erwarten. Die Banken sind diesen Auskünften zufolge bestrebt, durch Fusionen die teure Automatisierung des Geldverkehrs zu verbilligen, angesichts sinkender Erträge beim klassischen Kreditgeschäft in neue Geschäftsfelder vorzustoßen und Kosten durch Ausdünnen ihrer sich überschneidenden Filialnetze einzusparen. Der neue Autoriese DaimlerChrysler will keine Niederlassungen schließen, heißt es, sondern verspricht sich eine weltweit größere Präsenz beider Marken dadurch, daß der eine Partner in Europa, der andere in den USA ein weit verbreitetes Netz von Niederlassungen einbringt; außerdem überschneidet sich die Modellpaletten beider Partner kaum. Volkswagen, so erfährt man, bemüht sich dagegen, seine Plattformstrategie auf die Modelle weiterer Verkaufsmarken auszudehnen und mit denselben Teilen derselben Zulieferer mehr Fahrzeuge zu bestücken. Dazu sind nun wieder ähnliche Modelle nötig, die sich beim Käufer sogar Konkurrenz machen dürfen, wenn nur insgesamt steigende Stückzahlen herauskommen. Andere Zukäufe und Kooperationen des Wolfsburger Konzerns zielen darauf, sein Angebot auf die gesamte Palette des KFZ-Marktes auszudehnen: Er sucht Partner für den Bau von LKWs und Bussen und kauft mit Rolls Royce und Lamborghini Hersteller der absoluten Luxusklasse. Heute, heißt es dazu, könne ein Autobauer nur als „Komplettanbieter“ überleben. Der Hersteller von Massenautos geht offenbar davon aus, daß die Reichen immer reicher werden und ihr Luxus- und Repräsentationsbedürfnis trotz seines geringen Gewichts im Gesamtumsatz zu einer stabilen, gegenüber der wechselhaften Konjunktur der Massenautos unabhängigen Gewinnquelle taugt. Telekom-Firmen schließen sich rund um den Globus zusammen: Sie wollen weltweite und zugleich ganz eigene Netze anbieten, um keine Konkurrenten beteiligen zu müssen. Airlines ebenso. Pharmafirmen tun sich zusammen, um sich das chancen- und risikoreiche Feld der Gentechnologie mit seinem enormem Forschungsaufwand zu erschließen.
Einmal soll das Filialnetz ausgedehnt, ein anderes Mal
ausgedünnt, einmal die Produktpalette ausgeweitet, ein
anderes Mal gestrafft werden. In einem Fall sollen Kosten
durch „Synergieeffekte“ gesenkt, im anderen die
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung erhöht werden.
Gemeinsam ist all den Geschäftsstrategien, die Firmen mit
einer Fusion verfolgen, aber ein Endzweck, den keiner der
betreffenden Konzerne anzugeben versäumt: Stets geht es
ihnen um die notwendige Positionierung für den
globalen Wettbewerb
, in dem sie zu den
Überlebenden
gehören wollen und dafür nichts weniger
als die Markt- und Preisführerschaft
anstreben.
Was immer sie dafür unternehmen, es geht offenbar
leichter, gerät effektvoller und lohnender durch den
Zusammenschluß: Die Herstellung von Kapitalgröße in einer
Hand ist ein apartes Erfolgsrezept und eine Waffe der
Konkurrenz. Ob sie es wissen oder nicht, mit ihren
Zusammenschlüssen geben die Kapitalisten eine
interessante Auskunft über den Markt und die Gleichheit
der Chancen, die er gewährt:
I. Kapitalgröße – das entscheidende Kampfmittel der Konkurrenz
Den Kampf um den Markt führt der Kapitalist mit seiner Ware. Er muß sie zu einem Preis anbieten, der ihm die Kaufkraft der Kundschaft sichert, und er muß mit diesem Preis Gewinn machen. Das ist schließlich der Grund und Zweck, warum er Waren herstellt. Im Interesse des Gewinns sollte der Verkaufspreis seiner Ware möglichst hoch sein. Konkurrenten aber wollen auch verkaufen und machen ihm mit ihrem Angebot die Kaufkraft der Kunden streitig. Um sein Angebot gegen das ihre durchzusetzen, muß sein Verkaufspreis niedrig sein; nur dann kann er die ganze Masse seines Produkts an den Mann bringen. Sofern er mit dem Preis seiner Ware das Angebot seiner Konkurrenten unattraktiv macht, kann er auf deren Kosten nicht nur ein gegebenes, sondern ein wachsendes Warenquantum absetzen. Die Fähigkeit, mit steigendem Warenabsatz steigende Gewinne zu machen, beruht darauf, daß jede einzelne Ware zu einem Preis verkauft wird, der unter dem marktüblichen liegt und dennoch Gewinn enthält.
Um Konkurrenten zu unterbieten und dabei Gewinn zu machen, muß er durch eine sparsamere Kombination der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit die Kosten senken, die er für die Herstellung der Ware aufwendet. Der Konkurrenzkampf um den Markt wird also in der Fabrik geführt, wo das Kommando des Unternehmers gilt. „Rationalisierung“ nennt der gemeine Verstand all die höchst vernünftigen Veränderungen des Produktionsprozesses, bei denen der Einsatz von verbesserter Maschinerie die Produktivität der Arbeit steigert – damit sie mehr für den Zweck des ganzen Wirtschaftens, den Gewinn des Unternehmers, leistet. Und das tut sie dadurch, daß sie für ihn billiger wird; je mehr Produkt die Arbeit in bestimmter Zeit schafft, desto weniger Arbeit wird pro Produkt bezahlt: Die Lohnstückkosten sinken durch ein steigendes Quantum des Produkts bei gleichbleibender Lohnsumme oder durch eine sinkende Lohnsumme – durch Einsparung von Arbeitskräften – bei einem gegebenen Quantum Produkt. Zum kapitalistischen Nutzeffekt der Produktivitätssteigerung selbst addieren sich sekundäre Wirkungen der Veränderung der Produktion: Neue Maschinerie taugt auch zur Verdichtung der Arbeit – also der Mobilisierung von mehr Arbeit in der Stunde; durch neue Technik vereinfachte Arbeitsabläufe tragen zur Senkung der Stundenlöhne bei, weil vorher gebrauchte und bezahlte Qualifikationen der Belegschaft überflüssig werden. Die „Rationalität“ dieser Produktion ist um so größer, je weniger die Leute, die von Arbeit leben müssen, Lohnkosten verursachen können. Um seinen Betrieb zum Mittel des Erfolgs auf dem Markt herzurichten, effektiviert der Kapitalist die Ausbeutung der Arbeit.
Um auf diese Weise die Stückkosten zu senken, d.h. um weniger Kosten für die Herstellung einer Ware aufzuwenden, muß der Kapitalist insgesamt mehr Kapital anwenden: Die Anschaffung neuer Technik, die die Produktivität der Arbeit erhöht und Lohnkosten spart, kostet Geld und vergrößert den Kapitalvorschuß. Auch Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produktionsverfahren und Produkteigenschaften, die einen einträglichen Verkaufspreis rechtfertigen, verlangen vermehrten Kapitaleinsatz. Die Zielsetzung der Kostensenkung – mehr verkaufen und Marktanteile erobern – wird dadurch zur Notwendigkeit: Der gewachsene Kapitalvorschuß muß sich in eine höhere Zahl von Produkten umsetzen und in mehr Verkäufe münden, damit sich der Aufwand rentiert. Die höhere Stufenleiter der Produktion verlangt dann außerdem einen vermehrten Vorschuß für Rohstoffe und Vorprodukte.
Wenn ein Unternehmen auf diese Weise seine Kosten senkt und die Konkurrenten unterbietet, dann zwingt es diese dazu, es ihm gleichzutun, um „im Markt“ bleiben und zu konkurrenzfähigen Preisen verkaufen zu können. Sie müssen ebenfalls den Kapitalvorschuß, die Rentabilität der Produktion und die Masse des Produkts erhöhen. Ein Kapital, das dazu nicht in der Lage ist, wird als Profitquelle untauglich, also entwertet. Damit zwingen sich die Kapitalisten wechselseitig eine stets steigende Minimalgröße ihres Kapitals auf. Sie müssen ein nach Produktionssphären verschieden großes, stets wachsendes Geldvermögen investieren können, wenn ihr Vermögen überhaupt geeignet sein soll, als Kapital zu fungieren und Profit abzuwerfen.
Das notwendige Wachstum des investierten Kapitals und seine Instrumente
Den Kapitalvorschuß erhöhen Kapitalisten zunächst durch Akkumulation ihrer Gewinne: Diese werden wieder in das Geschäft hineingesteckt, aus dem sie stammen. Wieviel ein Kapitalist schon akkumuliert hat, wie gut seine bisherigen Gewinne ausgefallen sind, entscheidet darüber, ob und wie gut er sich weiterhin an der Konkurrenz um die profitliche Nutzung der Kaufkraft zu beteiligen vermag.
Aber dabei bleibt es nicht: Die Größe des erforderlichen Kapitals wird von der Konkurrenz vorgegeben und darf nicht davon abhängig sein, was als Resultat der Akkumulation schon zustande gekommen ist. Das für seine Behauptung nötige Zusatzkapital mobilisiert ein Unternehmer über die Schranke seiner akkumulierten Gewinne hinaus, indem er einen Kredit aufnimmt. Welchen Kredit die Banken ihm eröffnen, ist einerseits wieder abhängig von seinen bisherigen Erfolgen beim Geldmachen, also von der Größe seines Vermögens, andererseits von der Einschätzung der Erfolgschancen der Erweiterung, Rationalisierung oder Neuausrichtung seines Geschäfts durch die Bank. Der Preis der Unabhängigkeit von den Grenzen seines Vermögens besteht in der Pflicht, der Bank die verlangten Zinsen zu zahlen, und zwar unabhängig vom Gang seines eigenen Geschäfts. Der Markterfolg, den der Kreditnehmer mit dem Einsatz eines Kapitals anstrebt, das ihm nicht gehört, ist deshalb unerläßlich; ein Scheitern führt ja nicht nur zum Ausbleiben des Gewinns, sondern zu einer Enteignung des schlechten Schuldners.
Mit der heute vorherrschenden, bei Großfirmen ausschließlichen Form des Kapitals, der Aktiengesellschaft, handhaben Kapitalisten die notwendige Größe des Kapitals bewußt als eine Waffe der Konkurrenz. Die Aktiengesellschaft entsteht daraus, daß Geldsummen, die für sich zu klein sind, um ein konkurrenzfähiges Unternehmen auf die Beine zu stellen, von ihren Eigentümern zusammengelegt und dadurch erst zu einer einsatzfähigen Kapitalmasse werden. Die Geldbesitzer gründen eine Kapitalgesellschaft und stellen dieser Geld zur Verfügung; diese juristische Person, vertreten durch eingesetzte Geschäftsführer, betätigt nun den Zweck des Kapitals: Profit und Wachstum. Die Geldgeber haben mit dem fungierenden Kapital, das sie geschaffen haben, nichts mehr zu tun; die kapitalistische Benutzung ihres Vermögens ist abgetrennt von den Eigentumstiteln. Die Anteilsscheine am Eigentum führen mit ihrem Anrecht auf eine Dividende ein Eigenleben und sind Grundlage eines ganz anderen Geschäfts, das die Aktionäre betreiben. Die halten, kaufen und verkaufen Aktien diverser Firmen je nach der erwarteten Kursentwicklung. Sie verdienen an der Veränderung des Preises ihrer Anteilscheine, für die der industrielle Profit und seine Zukunftsperspektiven nur eine Bestimmungsgröße sind.
Die Aktiengesellschaft führt ihrerseits ihr Eigenleben und wirtschaftet mit dem ein für alle Mal zur Verfügung gestellten Kapital unabhängig von den Aktionären und von den Preisbewegungen der Aktien. Nur wenn sie ihren Kapitalvorschuß vergrößern will, bezieht sie sich zurück auf die Aktien mit ihrem inzwischen gewonnenen Wert. Sie gibt neue Aktien auf sich heraus – und mobilisiert damit um so mehr Geld, je besser der Kurs ihrer Aktie steht. So wird für das Kapital in dieser Organisationsform der vergangene und der geglaubte zukünftige Erfolg bei der Profitmacherei zur Quelle der Kapitalgröße, also zum entscheidenden Mittel dieses Erfolgs.
Die Folgen des Kapitalwachstums: Marktschranken
Mittels der Größe ihres Kapitals senken Unternehmen ihren Kostpreis und führen ihren Kampf um den Markt. Indem sie ihren Marktanteil vergrößern, machen sie den Markt für den Konkurrenten enger. Sie schießen mehr Kapital vor und bauen damit rentablere Fabriken auf, die immer größere Stückzahlen herstellen und verkaufen müssen, wenn sich der Aufwand für ihre Produktivität auszahlen soll. Mit denselben Methoden, mit denen Kapitalisten ihren individuellen Markt ausweiten und Konkurrenten verdrängen, führen sie deshalb die absoluten Schranken des Marktes herbei, an die ihre stetige Expansion irgendwann stoßen muß. Auf der einen Seite vergrößern sie ihr Warenangebot ohne Rücksicht auf die zahlungsfähigen Bedürfnisse in der Gesellschaft, in Rücksicht nämlich nur auf ihre Konkurrenzbedürfnisse. Auf der anderen Seite kommt ihr wachsendes und kostengünstiger produziertes Warenangebot ja nur dadurch zustande, daß sie pro Produkt weniger Arbeitskräfte an seiner Herstellung arbeiten und davon leben lassen. Die Gewinnspanne, die Kapitalisten interessiert, entsteht bei sinkenden Verkaufspreisen dadurch, daß ihr Geschäft weniger Kaufkraft bei anderen Leuten stiftet. Wenn sie an die Schranken des Marktes stoßen, die ihre Konkurrenz hervorbringt, dann tun sie nichts anderes, als diese immer gleichen Techniken zu intensivieren – oder sie gehen eine Verbindung mit Konkurrenten ein.
Fusionen und Übernahmen – Vergrößerung des Kapitals ohne Wachstum
Der Zusammenschluß von Firmen läßt die Kapitalgröße in einer Hand wachsen, ohne daß neues Kapital investiert wird, also ohne daß das Kapital überhaupt wächst. Durch Zentralisation[1] organisieren sich Unternehmer eine Kapitalgröße und Konkurrenzmacht, die ihr eigenes Kapital und sein Wachstum nicht hergeben. Sie greifen zur dieser Strategie, wenn sie zu dem Schluß kommen, daß ihr Kapital zu klein für die Durchsetzung am Markt ist, die sie sich vorgenommen haben. Um ihr Geschäft zu vergrößern, geben sie den Kampf gegen einen Konkurrenten auf, um gemeinsam mit ihm gegen den Rest der Branche anzutreten. Die beschränkte Tauglichkeit des eigenen Kapitals legt dem Einzelkapitalisten das Aufgeben seiner Selbständigkeit und das Aufgehen seiner Firma in einer größeren Einheit nahe, gleichgültig, worin dieser Mangel seinen Grund hat: Es kann sein, daß die Mittel des Wachstums einschließlich des darauf gegründeten Kredits ausgereizt und nicht zu steigern sind; es kann sein, daß alle diese Mittel zur Verfügung stünden, aber nicht hinreichen, um das Unternehmen in der Größenordnung voranzubringen, die seine Leitung für nötig oder vorteilhaft befindet; es kann sein, daß die Anlage von zusätzlichem Kapital zu riskant erscheint; oder auch, daß die Früchte neuer Investitionen und Kapazitätserweiterung zu lange auf sich warten lassen würden.
Bei Zusammenschlüssen wird das operierende Kapital auf einen Schlag um das Gewicht eines ganzen anderen Unternehmens vergrößert. Ein Rechtsakt fügt einer Firma das laufende Geschäft einer anderen mit all ihren Momenten hinzu: Betriebsvermögen, Produktionsstätten, Umsatz, Kundenstamm. Der Zusammenschluß vereint auch die Gewinne der beteiligten Firmen in einer Hand; und mit dieser Profitmasse läßt sich mehr und anderes anstellen als mit ihren Hälften. Das Verfahren ergänzt die Techniken des Konkurrierens durch Wachstum, indem es deren Ergebnis durch die Gründung eines größeren Kapitals herstellt: Während im einen Fall der Kapitalist mit zusätzlichem Kapitaleinsatz rationalisiert, also seinen Kostpreis senkt und die Rate des Profits steigert, um durch vermehrten Absatz seiner konkurrenzfähigen Produkte auch die Profitmasse zu erhöhen, wird durch Firmenzusammenschlüsse unmittelbar die Masse des Profits eines Unternehmens vergrößert, ohne – zunächst – seine Rate zu steigern. Vorgesehen ist Letzteres allerdings immer.
Die Zentralisation von Kapitalmacht: eine nützliche Maßnahme
Wenn ein Konzern durch Fusion seine Geschäftsfelder „diversifiziert“ und sich neue Branchen erschließt, dann macht er sich auf diese Weise die pure Kapitalgröße zunutze. Eine durch die Vergrößerung erreichte Kombination von mehr und weniger zyklischen, mehr und weniger export- oder konsumabhängigen Geschäften vermindert sein Marktrisiko und erlaubt ihm schrumpfendes Geschäft in einem Sektor mit wachsendem in einem anderen auszugleichen. Die Konzentration der Profitmasse aus einer Vielzahl verschiedener Geschäftsfelder setzt den Mischkonzern außerdem instand, große Kapitalmassen auf aussichtsreiche Felder des Wachstums zu werfen.
Nicht ganz unterschlagen werden soll ein Fall von Zentralisation des Kapitals, der nicht zu den hier besprochenen Großfusionen gehört. Manchmal gilt das Interesse eines Käufers nicht dem ganzen Geschäft, an dem er sich ein Recht erwirbt, sondern nur einem Moment davon. Übernahmen werden getätigt, um ein Produktionsverfahren, ein Patent, den Markennamen oder den Marktanteil eines Konkurrenzunternehmens anzueignen und es dann zu schließen. Der Kaufpreis ist in einem solchen Fall eine Investition in eine bestimmte produktive Fähigkeit oder in einen wachsenden Umsatz, der nicht erst durch Senkung des Kost- und Verkaufspreises erobert werden muß. In Fällen von offensichtlichem Ruin des Übernahmeobjekts sinkt sein Preis so weit, daß sich ein Kaufinteresse allein auf den Wert der Liegenschaften richten kann, auf denen es sitzt. Von dieser Art war das vorherrschende Übernahmeinteresse an den Elementen der DDR-Volkswirtschaft, die von der Treuhand-Anstalt feilgeboten wurden.
„Synergie-Effekte“: Kostensenkung als unmittelbare Wirkung der Fusion
Bei Fusionen zwischen Partnern, die nach Produkt, Verfahren, Forschung und Vertrieb in dieselbe Branche gehören, übersetzt sich Größe unmittelbar in Rentabilität. Allein der Umstand, daß zwei Firmen nicht mehr konkurrieren, sondern ihr Geschäft gemeinsam betreiben, senkt den Kostpreis und verbessert die Profitrate.[2] Der vergrößerte Umfang verkaufter Ware erlaubt größere Losgrößen der Produktion, eine höhere Auslastung der Fabriken des Konzerns und die Schließung von Produktionsstätten, die dadurch überflüssig werden. Das vereinte Kapital braucht nur noch eine Verwaltung, gestattet die Zusammenlegung von Forschung, die Vermeidung von doppelter Entwicklung und legt die Kosten für den Forschungsaufwand auf eine größere Zahl von Endprodukten um. Alles das senkt Produktionskosten und vergrößert die Profitrate, noch ohne daß sich an der Produktion technisch etwas ändern müßte und ohne daß mehr Waren abgesetzt würden, als die Firmen vor ihrer Vereinigung abgesetzt haben.
„Kosten-, Preis-, Technologieführerschaft“: die Vergrößerung der Profitmasse als Mittel zur Steigerung der Profitrate
Natürlich erspart die durch Fusion gewonnene Kapitalgröße nichts von den oben abgehandelten Methoden der Konkurrenz. Sie ist vielmehr der größte Hebel der Rationalisierung und Expansion. Die größere Stufenleiter der Produktion macht Änderungen der Produktionstechnik zur Einsparung von Lohnkosten rentabel, die es auf kleinerer Stufenleiter nicht waren. Der größere Kapitalvorschuß kann Veränderungen des Produkts und Neuentwicklungen finanzieren, die sich auch auszahlen, weil sich die Kosten auf mehr verkaufte Einheiten verteilen. Die dafür nötigen Investitionsmittel macht die addierte Masse des Profits verfügbar – den durch die neue Unternehmensgröße gewachsenen Kredit nicht zu vergessen.
Die Kostensenkung, die sich mittelbar und unmittelbar aus der Fusion ergibt, steigert nicht nur die Rentabilität des von den eingebrachten Umsätzen der Partner vorgegebenen Warenquantums, sondern taugt selbstverständlich dazu, den eigenen Absatz auf Kosten von Konkurrenten auszuweiten, d.h. für den Kampf um den Markt.
Konkurrenz mit Fusionen: immer wieder fällig, in der Krise alltäglich und heute in Hinblick auf die globalen Marktschranken unverzichtbare Konkurrenzstrategie für künftige Krisengewinner
Die Zentralisation des Kapitals ist also eine Konkurrenztechnik, die erstens immer angesagt ist – sei es, um Konkurrenten mit überlegener Konkurrenzfähigkeit zu konfrontieren, sei es, um sich der Konkurrenz größerer Kapitale in der Branche auf neuer Stufenleiter zu stellen. Das Zusammengehen zweier Firmen zielt stets auf dritte, nimmt Maß an deren Potenzen und konfrontiert sie mit einem neuen schlagartig potenteren Konkurrenten. Jede neue Fusion sucht die vorherigen zu übertrumpfen und der jeweils größte Zusammenschluß gibt die Maßstäbe vor, mit denen die anderen zurechtkommen müssen.[3] In jedem Fall schließen sich Unternehmen zusammen mit Blick auf die Schranken des Marktes. Um sich im Kampf um die Zahlungsfähigkeit der Käuferschaft weltweit zu behaupten, erscheint eine Expansion per Zukauf oder Fusion bisweilen risikoärmer, billiger und schneller gewinnbringend als ein Wachstum aus eigener Kraft. In diesem Sinn erläutert VW-Chef Piech den Kauf von Rolls Royce: Der im Bietgefecht mit BMW hochgetriebene Kaufpreis sei zwar enorm, aber noch sehr günstig im Vergleich zu den Kosten, die Entwicklung und Vermarktung einer eigenen Edelmarke, die man technisch natürlich hätte bauen können, verursachen würde. Es hätte Jahrzehnte gedauert, dem eigenen Modell ein ähnliches, extreme Preise rechtfertigendes Prestige zu verschaffen.
Zusammenschlüsse und Übernahmen sind zweitens Methoden der Krisenkonkurrenz: Größe befähigt Kapitalisten, Krisen besser durchzustehen, in denen kleineren Konkurrenten die Mittel ausgehen, zumal die Masse des Kapitals in einer Hand auch die Grundlage einer entsprechend vergrößerten Kreditwürdigkeit abgibt. Wenn sich der Markt absolut nicht ausdehnen läßt, kann ein Krisengewinnler immer noch wachsen und seinen Markt ausdehnen, indem er Verlierer der Konkurrenz billig aufkauft, ihre Kapazitäten, Verfahren, Marken und Kunden übernimmt.
Wenn das Fusionieren aber mitten im guten Geschäftsgang zu einer allgemeinen Mode wird; wenn allenthalben schon zu Großkonzernen gewachsene Unternehmen zu dem Schluß kommen, sie müßten noch viel größer werden, als sie schon sind, um die Konkurrenz bestehen zu können; wenn sie den Einsatz von zusätzlichem Kapital und den Aufbau weiterer Kapazitäten für zu riskant befinden und zweifeln, ob sie ihren Markt durch zusätzliche Kapitalanlage lohnend ausdehnen können – dann antizipieren die Wirtschaftslenker eine Kontraktion des Marktes, für die sie sich bei noch guten Erträgen und noch attraktiven Kursen ihrer Aktien rüsten. Sie wollen „kritische“ Konzern- und Umsatzgrößen erreichen, mit denen sie eine Krise besser durchzustehen hoffen als kleinere Konkurrenten – also auf deren Kosten. Seit längerem schon betreibt wiederum Ferdinand Piech seine „Einkaufstour“ erklärtermaßen als vorbeugende Maßnahme für die absehbare Autokrise: Die Großen der Branche, hört man von ihm, rüsten sich für den Kampf ums Überleben, der ansteht, sobald die Autokonjunktur auch in Europa zurückgeht. Weltweit leidet die Branche schon heute an Überkapazitäten von 40%, und von den ca. 20 noch selbständigen Autobauern werden mittelfristig nur 10 übrig bleiben. Konzerne unter der kritischen Größe von 1 Million Autos pro Jahr haben dazu keine Chance. VW aber will und wird nach Piechs Auskunft dazugehören.
Fusionen und Zukäufe sind aber nicht nur Maßnahmen, mit denen sich Unternehmer rüsten, um Krisen erfolgreich durchzustehen, sie sind selbst ein Beitrag zu ihrer Herbeiführung. Sie vermehren die Potenzen der Akkumulation und beschleunigen sie damit. Je schneller das Kapital wächst, desto schneller stößt es an die Grenzen des Marktes, die es mit seinem Wachstum produziert. Unternehmer kalkulieren geradezu damit, wenn sie den Kampf um einen „absehbar schrumpfenden Markt“ mit einer Fusion aufnehmen und Kapazitäten aufbauen, von denen sie selbst und ihre Konkurrenten wissen, daß sie „insgesamt Überkapazitäten“ bilden. Sie stellen sich der Beschränktheit der Nachfrage, indem sie die Schranke für sich nicht gelten lassen und darauf setzen, mit ihrer Kapitalgröße das Kapital ihrer Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen.
Fusion im Finanzsektor: Größe ist Rendite
In der Industrie ist die strategisch erzielte Kapitalgröße, einmal abgesehen von unmittelbaren „Synergie-Effekten“, das Mittel, das erst zum Einsatz gebracht werden muß, um Produktionskosten zu senken, Profite zu steigern und den Markt zu erweitern. Im Bereich von Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften verhält es sich anders. Der Zusammenschluß solcher Institute bewirkt unmittelbar die Vergrößerung ihrer Kreditmacht: Die Addition von Einlagen und Schulden ihrer Kunden, von Wertpapieren und Forderungen gegenüber anderen Banken führt zu einem neuen Finanzinstitut, das mehr Kredit hat als die Summe des Kredits, den seine Bestandteile für sich hatten. Auf ihren erweiterten Kredit kann die vereinigte Bank mehr Kredite geben und neue Zahlungspflichten eingehen. Und das Problem, erst durch eine Veränderung ihres Produkts und seiner Herstellung den Verkaufspreis wieder gewinnträchtiger gestalten zu müssen, kennt die Sphäre nicht. Für sie ist mehr Umsatz automatisch mehr Gewinn, denn mit jedem Kreditgeschäft ist ein Zins verbunden. Zurecht geben Banken mit ihrer Bilanzsumme nicht nur die Größe ihres Profitmittels, sondern unmittelbar den Grad ihres Geschäftserfolgs an. Je größer das Netz der Kreditbeziehungen einer Bank, desto mehr Gebrauch kann sie von der staatlichen Lizenz machen, den Geldbedarf der Gesellschaft als ihre Profitquelle zu nutzen. Zum Dank dafür verschafft die Ausdehnung ihrer Kreditbeziehungen über die Landesgrenzen hinaus den Geldschöpfungen der Nationalbank einen immer weiteren Kreis lohnender Anwendung.
Global agierende Banken haben dann auch die nötige Größe und die erforderlichen Beziehungen, um grenzüberschreitende Fusionen zu vermitteln und zu finanzieren. Der Handel mit Kapitalgesellschaften ist nämlich ein Finanzgeschäft eigener Art.
II. Die Vereinigung zweier Profitquellen [4]
Die spekulative Festsetzung der neuen Kapitalgröße
Kapitale werden fusioniert, weil sich ihre Geschäftsleitungen von der Addition ihrer Fabriken, Produktionsverfahren, Patente und Umsätze eine Ertragskraft und Konkurrenzmacht versprechen, die größer ist als die Summe der Erträge und Marktanteile der vorher selbständigen Firmen. Den Gebrauchswert ihrer Kapitale, die Fähigkeit, Profit zu produzieren, vereinigen sie durch die Konzentration ihres Werts in der Hand eines Eigentümers: Die „übernommene Firma“, überträgt ihr Vermögen auf eine andere, die „übernehmende“ – oder beide übertragen es auf ihre gemeinsame Neugründung und erlöschen dann. Die Ware, die da den Besitzer wechselt, ist fungierendes Kapital, ein Produktionsprozeß, der Wert schafft und vermehrt. Sein eigener Wert bestimmt sich aus seiner Tauglichkeit für diesen Zweck. Dieser Wert steht nicht fest wie der Preis von Handelswaren. Was die vorhandenen Anlagen als Beitrag zum fusionierten Unternehmen zu leisten versprechen, was sie als Profitquellen also wert sind, setzen die Parteien in einer gemeinsamen Bewertung fest.
In die Beurteilung dieser Tauglichkeit geht der
Geldvorschuß ein, der einmal für die Anlagen der Firma
getätigt wurde und für ihren laufenden Betrieb immer neu
getätigt wird. Der aktuelle Wert des Vermögens, das
die Firma besitzt, muß daraus aber geschätzt werden:
Wieviel von den Investitionen ist noch vorhanden und
weiterhin brauchbar, wieviel verbraucht und
abgeschrieben? Der Substanzwert
– Investitionen
minus Abschreibungen = Zeitwert der Anlagen –, bildet
eine erste Grundlage für die Bestimmung des Werts,
den die Firma für ihren Eigentümer hat – ihren
Ertragswert
. Die Taxierung der Anlagen nach ihrer
Leistungsfähigkeit als Profitquelle kehrt den obigen
Standpunkt um: Zwar ist es der wirkliche, im Geschäft
angewendete Kapitalvorschuß, mit dem der Profit
erwirtschaftet wird; der Wert des Eigentums daran bemißt
sich aber nicht am Aufwand, sondern am Ertrag, den dieser
Aufwand einbringt. Am Maßstab einer durchschnittlichen
Ertragskraft wird vom Profit auf eine Stammsumme
geschlossen, die aufgewendet werden müßte, um
derlei Gewinne zu erzielen.[5]
Wenn fungierendes Kapital den Eigentümer wechselt, dann geht es eben nicht um die Übereignung von Vermögensbestandteilen, sondern um Kapital: Die Anlagen werden als Profitquellen übereignet – gekauft oder übernommen wird die Potenz zu einem Plus. Ihr Gewinn-Potential beweist die einzubringende Firma zuerst mit den Erfolgen, die sie schon erzielt hat. Aber schon deren Feststellung verlangt einen Akt der Bewertung: Die für die Steuer und die Aktionäre – womöglich für beide verschieden – ausgewiesenen Erträge werden auf ihre Aussagekraft hin geprüft, stille Reserven, verheimlichte Risiken und andere Firmengeheimnisse werden vor dem Partner aufgedeckt oder aus gutem Grund verschwiegen. Die früheren Gewinne nützen freilich nichts, wenn sie nur Vergangenheit sind. Weil es um die Aneignung eines Gewinnpotentials geht, sind zweitens die Gewinne entscheidend, die es noch nicht gibt: Die Gewinnerwartung, die sich die Partner zutrauen, bestimmt den Wert, den die Firma zugemessen bekommt. Der aktuelle Geschäftsgang und seine Entwicklung, die Auftragsbücher, die Tendenz der Märkte, auf denen das Unternehmen operiert, sowie die allgemeinen Konjunkturaussichten dienen als Daten dieser Spekulation, die einen aktuellen Firmenwert aus zukünftigen Gewinnen ermittelt. Dabei bleibt es den Partnern überlassen, ob sie die Schätzung des Ertragspotentials ihrer Firmen auf Erträge gründen, die jede der Firmen für sich zu erwirtschaften hofft, oder gleich auf den Beitrag, den sie dem vereinigten Unternehmen leisten könnten. [6] In jedem Fall ist die Eröffnungsbilanz des fusionierten Unternehmens, die sich aus der Addition der eingebrachten Firmenwerte ergibt, ein spekulativer Anspruch auf Geschäftserfolg. Das neue Unternehmen bekommt in seiner Wertgröße eine Profitlichkeit attestiert, die es erst noch rechtfertigen muß. Kapitalentwertung steht an, wenn es die schon bezifferten und im Zusammenschluß praktisch anerkannten Ansprüche nicht rechtfertigen kann.
Der Aktientausch: Die Vereinigung des fiktiven Kapitals beider Firmen
Die Beschlußfassung über die Größe des beiderseits eingebrachten Kapitalwerts ist Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen den Partnern, denn mit ihr wird über das Eigentum der Besitzer entschieden. Die Größe des Kapitalwerts, den sie anerkannt bekommen, bestimmt ihre relativen Anteile an dem neuen Unternehmen und die darauf bezogenen Anrechte auf Teile des zukünftigen Profits. Selbstverständlich versuchen die Vertreter beider Seiten ihrem Kapital auf Kosten des anderen einen möglichst hohen Wert zuzumessen und ihren Eigentümern möglichst große Teile der zukünftigen Profite zu sichern. Streit um die Bewertung gehört zu jedem Kauf und Verkauf von Firmen und zu Zusammenschlüssen von Kapitalen gleichgültig welcher Gesellschaftsform; in jedem Fall wird per Bewertung über die Größe des Eigentums der alten Eigentümer und ihre Ansprüche auf Entschädigung oder ihren Anteil am vereinigten Unternehmen entschieden. So richtig kompliziert aber wird die Bewertung, wenn Aktiengesellschaften fusionieren.
Die Vereinigung des Vermögensbestands der beiden Kapitalgesellschaften kommt nämlich nur als Folge einer Vereinigung der auf sie lautenden Eigentumstitel zustande. Diese existieren als Anrechte auf Gewinnanteile dieser Gesellschaften und führen das erwähnte Eigenleben an der Börse. Die Aktienrechte erlöschen mit dem Einzelkapital, auf dessen Gewinn sie Ansprüche verbriefen; das Eigentum der Aktionäre darf natürlich nicht ebenso erlöschen, es muß entschädigt werden durch die Gewährung einer neuen Geldquelle, durch äquivalente Anrechte auf die Erträge der neuen Firma.
Was aber ist ein äquivalentes Anrecht? Zur Bewertung des fungierenden Kapitals kommt die Bewertung des fiktiven Kapitals der eingebrachten Firmen hinzu. Es muß entschieden werden, wieviel Anrecht auf Dividende der neuen Firma auf die Aktien der alten Firmen entfallen soll. Denn es versteht sich, daß man dazu nicht das nominelle Grundkapital der fusionierenden Firmen addiert und jede alte Aktie eins zu eins gegen neue ersetzt. Auch das sonst übliche Verhältnis der Aktiengesellschaft zu ihren Aktien – sie gibt sie heraus, der Aktienhandel entscheidet, wieviel sie wert sind, – tritt erst nach dem Umtausch wieder ein. In der Umtauschrate setzen die fusionierenden Firmen selbst und per Beschluß fest, was sonst die Spekulation der Aktionäre leistet: sie fixieren einen gültigen, jedenfalls den endgültigen Wert ihrer alten Aktien.
Die Hochrechnung des Werts ihrer Dividendenpapiere aus den vermuteten Erträgen, die sie versprechen, soll auf korrekte und begründete Weise durchgeführt werden und den Widerspruch eines „inneren“ Werts des – fiktiven – Kapitals ermitteln. Diese Bewertung der Aktien sieht aus wie eine kritische Überprüfung der Kurse, die sich an der Börse ergeben haben. Sie sollen beim Umtausch nur insoweit gelten, als sie durch die – geschätzte – Ertragskraft ihrer Firmen gerechtfertigt sind. Wäre es so, dann wäre die Bewertung des Aktienkapitals tatsächlich die rein rechnerische Anwendung der ermittelten Substanz- und Ertragswerte der Firmen auf ihren Aktienbestand, als die sie im Verschmelzungsbericht dargestellt wird.
So ist es aber nicht: In den Umtauschkurs, der den Aktien einen für die Eigentumsübertragung verbindlichen Wert gibt, geht der Wert, den der Börsenhandel mit seinen Kursbewegungen den Aktien zugemessen hat, als eine Bezugsgröße mit ein. Die Bewertung der fusionierenden Kapitale als Teile einer neuen Profitquelle wird durch eine zweite, andere Bewertung des Firmenwerts ergänzt und modifiziert, die Tauglichkeit als Quelle zur Bedienung von Ansprüchen des Finanzkapitals, die in ihrer Aktienkapitalisierung – Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der Aktien – vorliegt. Auch dieser Bewertung muß der Umtausch gerecht werden. Denn die Börsenkapitalisierung ist der Kredit, den eine Firma genießt; sie will ihn nicht durch die Fusion beschädigen, sondern fördern. Der Umtauschkurs muß daher geeignet sein, diesen Wert, den die Aktie mit ihrem Kurs vorstellt, durch den Eigentumsübergang mindestens zu erhalten, möglichst aber zu steigern. Die Fusionspartner anerkennen also den Stand der bisherigen Spekulation auf sich als verbindlichen, den neuen Eigentumsanspruch mitbestimmenden zweiten Wert ihrer Firmen. Und sie spekulieren mit der Festsetzung der Umtauschrate zugleich auf die künftige Spekulation der Börse mit ihren Papieren. Die Rate soll gewährleisten, daß die Börse den Kurs der Papiere beider eingebrachten Firmen bestätigt und die dafür eingetauschten neuen gleich wieder als attraktive Handelsobjekte ergreift.
Die Festsetzung einer angemessenen Umtauschrate ist also nicht so einfach, wie es im Aktienrecht[7] aussieht: Damit der „innere“ Wert der Aktien sich aus dem geschätzten Substanz- und Ertragswert des fungierenden Kapitals „rein rechnerisch“ ergeben kann, geht in diese Schätzung die Börsenkapitalisierung als Bestimmungsgrund mit ein. So werden die beiden gegensätzlichen Bewertungen der Firmen in einem Kompromiß[8] „versöhnt“: Die Umtauschrate der Aktien darf sich nicht zu weit von den zu erwartenden Beiträgen der eingebrachten Firmen zum Profit der neuen, also von den ermittelten Ertragswerten entfernen, damit die neue Firma ihre Dividendenversprechen halten und nicht die Eigentümeransprüche auf ihren Gewinn übermäßig vermehrt. Sie darf sich aber auch nicht so weit von der Bewertung der Aktien entfernen, die in ihrem Börsenkurs vorliegt, daß der Eigentumsübergang die Erhaltung des vorhandenen fiktiven Kapitals nicht leistet.
Über die Angemessenheit der Umtauschrate entscheiden die Aktionäre. Der Eigentumswechsel aktiviert nämlich Banken, Investmentfonds und Privatleute, die gerade Aktien dieser Firma halten, ansonsten aber mit Geschäft und Geschäftsführung nichts zu tun haben, als Eigentümer, deren Wille über die Verwendung der ihnen gehörenden Sache entscheidet. Die Firmen können nicht über das Eigentum an ihnen bestimmen; das ist dem „vertretenen Aktienkapital“ auf der Hauptversammlung vorbehalten, das die Fusion mit einer 75%-Mehrheit beschließt. Die Festlegung des Kurses für den allgemeinen Umtausch der alten Aktien ist nur ein Vorschlag der beteiligten Unternehmen an ihre Aktionäre, der ihrer Zustimmung bedarf. Ihre Erwartungen als Aktionäre müssen also zufriedengestellt werden. Sie prüfen, ob sie sich an der Spekulation auf die größere Konkurrenzmacht des vereinten Unternehmens beteiligen sollen und ob ihr Anteil an dessen Erträgen auch hoch genug ausfällt. Sie vergleichen dabei den Anspruchstitel, den sie bekommen sollen, mit dem, den sie haben und dessen Wertgröße im Börsenkurs feststeht. Sie akzeptieren keinen Umtausch, der ihre Anrechte zu entwerten droht, aber auch keinen, der sie relativ zu den Aktionären der Partnerfirma schlechter stellt. Weicht die Umtauschrate vom Kursverhältnis an den Börsen ab, sind Sonderausschüttungen, Bonusse etc. nötig, um sogenannte „Spitzenbeträge“ auszugleichen und die Aktionäre für die Fusion zu gewinnen. Sobald das Aktionärskollektiv den Fusionsbeschluß gefällt hat, spekuliert der einzelne Aktionär mit diesem Beschluß: Es bleibt nämlich seine Sache, den Aktientausch vorzunehmen oder zu verweigern. Wenn sich genug Aktionäre finden, die nicht tauschen, muß das Unternehmen sein Angebot an sie verbessern; falls das ganze Projekt nicht darüber platzt, daß die 75%-Mehrheit, die auf der Aktionärsversammlung die Fusion beschlossen hat, beim tatsächlichen Umtausch nicht mehr zustande kommt.[9]
Es läuft alles auf das eine hinaus: Das Manöver, mit dem das produktive Kapital seine Konkurrenzposition verbessert, muß dazu taugen, die Ansprüche des fiktiven Kapitals zu befriedigen. Der Kurswert der Aktie und seine Steigerung – also die Zufriedenheit des Finanzkapitals mit der erfolgreichen Profitmacherei und seine Spekulation auf die seinen Ansprüchen genügende segensreiche Fortsetzung des Unternehmenserfolgs – das ist die Meßlatte, an der sich Maßnahmen zur tatsächlichen Verbesserung der Rentabilität bewähren müssen, sollen sie überhaupt zustande kommen.[10]
Die Spekulation auf die Fusion
Fusionen, zumal die der ‚global players‘, mit ihren bisherigen und künftig zu erwartenden Konkurrenzerfolgen sind in der Regel für Banken und Großaktionäre ein besonders attraktives Angebot. Auf sie wird deshalb kräftig spekuliert. Die Ankündigung, ja schon das Gerücht einer Fusion versorgt die Börse mit der berühmten „Zukunft“, die sofort „gehandelt“ werden muß und die das Geschäft mit den einschlägigen Aktien belebt. Jede wirkliche oder vermutete Differenz zwischen dem beschlossenen Umtauschkurs und den aktuellen Börsenkursen läßt sich eben nicht nur beklagen, sondern auch ausnützen.[11] So vermehrt die Fusion das fiktive Kapital schon vor der Vereinigung der beteiligten Firmen und noch ehe das neue Unternehmen den Nutzen der Fusion mit steigenden Gewinnen bewiesen hätte.[12] Diese Wertschätzung in Börsenkreisen ermöglicht es wiederum den Objekten der Spekulation, durch die Ausgabe von neuen Aktien ihren gewachsenen Kapitalbedarf zu decken. Das Fusionsgeschäft, das die Aktienspekulation befördert und benutzt, blüht oder stockt daher je nach dem allgemeinen Stand des Vertrauens an der Börse.[13]
Der letzte Akt der Fusion: Die tatsächliche Zusammenführung der Firmen
Die Zentralisation des Eigentums in einer Hand ist eine Sache, die tatsächliche Zusammenführung der Firmen eine andere. Während dem „shareholder value“ Genüge getan ist, müssen die Einsparungen, „Synergieeffekte“ und Rationalisierungen, die durch Kapitalgröße möglich werden, durch eine Neuorganisation der fusionierten Teilfirmen erst noch durchgesetzt werden. Die Produktion wird auf die nun vorhandenen Produktionsstätten neu verteilt, Abteilungen werden zusammengelegt, Verwaltung eingespart, Fabriken geschlossen. Weil allen Beteiligten klar ist, daß die neue Kapitalgröße diese Folgen zeitigen soll, gehört zu Fusionsverhandlungen auch eine Einigung darüber, was nach der wertmäßigen Verschmelzung der Firmen mit den eingebrachten Produktionsstätten geschehen soll; an ihnen hängen schließlich alle möglichen Interessen, die von den anstehenden Veränderungen betroffen sind. Es ist zu regeln, ob und wie die Beziehungen und Verpflichtungen der alten Firmen im neuen Laden fortgelten. Was wird aus ihren Vertragsbindungen unter der neuen Regie? Werden bisherige Lieferbeziehungen und Kooperationen erhalten oder gekündigt? Belegschaften der verschiedenen Standorte der neuen Firma können die Fusion und ihre „Einsparungen in Milliardenhöhe“ sogleich in Entlassungszahlen umrechnen. Sie interessiert die Frage, ob ihre Fabrik geschlossen wird oder vielleicht eine andere – und je nach Antwort fällt ihre Meinung über die Zentralisation des Kapitals aus. Aber Belegschaften werden sowieso nicht gefragt – sie sind betroffen, aber keine entscheidende Partei im Streit.[14]
Anders verhält es sich da schon mit den von Standortwechseln auch betroffenen politischen Subjekten – der Kommune, dem Bundesland oder im Fall bedeutender Firmen dem Gesamtstaat. Sie alle beurteilen die Reorganisation fusionierter Betriebe wie die Belegschaften: Die Sache ist gut, wenn der Abbau andere Regionen trifft, und schlecht, wenn „uns“. Anders als die Belegschaften mischen sich die politischen Instanzen in den Fusionsprozeß wirklich ein – und zwar mit Angeboten, die der fusionierten Firma ein Festhalten am Produktionsstandort schmackhaft machen sollen, damit der Region oder der Nation die Reichtumsquelle erhalten bleibt. Größeres Kapital kann dem Staat mehr Geschäft geben und nehmen, also auch mehr Protektion und Subvention verlangen. Auch darin ist seine Größe die Quelle von Erträgen.
Der Anspruch der Politik auf Einmischung ist die Ursache dafür, daß feindliche Übernahmen, jedenfalls in Deutschland, kein Streitfall zwischen den beteiligten Firmen bleiben. Die staatlichen Einheiten nehmen es nicht hin, daß ihnen da keine Gelegenheit zum Geltendmachen wirtschafts- und regionalpolitischer Gesichtspunkte eingeräumt wird und daß das politisch gewollte und geförderte brancheninterne und -übergreifende Zusammenwirken der Konkurrenten als Mitglieder der nationalen Industrie gestört wird, wenn Firmen „kalt“ über die Börse angeeignet werden. Als 1997 der kleinere Stahlkonzern Krupp mit Hilfe eines Kredits der Deutschen Bank eine feindliche Übernahme des größeren Konkurrenten Thyssen versuchte, erhob sich in der deutschen Öffentlichkeit ein großes Geschrei; auf Arbeiterdemonstrationen und im Parlament wurden die „amerikanischen Wild-West-Methoden“[15] von Krupp-Chef Cromme angeprangert, die nicht zu den guten Sitten des „rheinischen Kapitalismus“ passen würden. Regierungsstellen in Bonn und Düsseldorf mischten sich daraufhin ein und moderierten einen freiwilligen Zusammenschluß der beiden Konkurrenten. So wurden staatliche Ansprüche an einen deutschen Stahlkonzern und seine Standorttreue berücksichtigt. Keine Rede war mehr davon, ob die freundliche Vereinigung langfristig weniger Personalabbau bewirkt.
III. Nationale Konkurrenz um den fertigen Weltmarkt: Der staatliche Beitrag zur Zentralisation und Internationalisierung des Kapitals
Fusionen sind stets auch politische Affären; das gilt erst recht für die heutigen Zusammenschlüsse, die in vielen Fällen die nationalen Grenzen überschreiten und aus denen nicht selten „Global Players“ von einer Größe hervorgehen, deren Umsatz den Staatshaushalt so manchen Staates übersteigt und die in jedem Fall die Konkurrenzgegebenheiten der nationalen Standorte entscheidend verändern. Also sind die Regierungen der Heimatstaaten dieser Weltmarktakteure herausgefordert, die den Kapitalverbindungen innerhalb ihrer Grenzen und über sie hinaus die Genehmigung erteilen müssen. Daß sie diese nicht nur bekommen, sondern von Seiten der Politik ausdrücklich gefördert werden, verweist auf einen neuen Entwicklungsstand des Weltmarkts und eine neue Stellung der Nationalstaaten dazu. Früher hatte es nämlich häufigere und deutlichere politische Vorbehalte gegen die „übermäßige Konzentration von Kapitalmacht“ sowie gegen „transnationales Kapital“ gegeben. Die Gründe, die der kapitalistische Staat einmal für diese Vorbehalte hatte, gelten offenbar nicht mehr viel.
Keine Angst vor Monopolen – Wettbewerbsaufsicht ist zur internationalen Affäre geworden
Diverse Gesetz zum „Schutz des Wettbewerbs“ zeugen davon, daß es die Politik für eine Aufgabe hält, eine Konzentration des Kapitals zu verhindern, die zur „Marktbeherrschung“ durch eines oder einige wenige Unternehmen führt. Sie geht ganz selbstverständlich davon aus, daß Kapitalisten in ihrem Kampf um den Markt Konkurrenten verdrängen, Marktbeherrschung anstreben und daß ein Monopol die schönste Gewinngarantie für sie wäre. Die Ausbeutung aller anderen Wirtschaftssubjekte zugunsten der Privatbereicherung eines einzigen Kapitals, auf dessen Monopolprodukt die anderen angewiesen sind, ist aber nicht der kapitalistische Konkurrenzerfolg, den der ideelle Gesamtkapitalist im Interesse seines Nationalreichtums haben will. Der Staat schreitet ein, sobald er Anhaltspunkte dafür sieht, daß ein Unternehmen allein durch seine Größe den Vergleich mit Konkurrenten unterbinden kann. Fusionen werden dann verboten, Kartellbildung wird bestraft, Trusts werden entflochten, damit die Geschäftstätigkeit der Wettbewerbsordnung untergeordnet bleibt und keine wirtschaftliche Macht entsteht, die sich dem Recht entzieht.
Diesem staatlichen Standpunkt steht je schon derjenige des Exports gegenüber. Für die Exportkraft einer Firma, für ihre Durchsetzungsfähigkeit in der internationalen Konkurrenz ist eine Kapitalgröße, die in Bezug auf den nationalen Markt dem unerwünschten Monopol ziemlich nahe kommt, nämlich gerade das richtige. Je größer die Ressourcen, je unangreifbarer die Position am Heimatmarkt, desto potenter ist so ein „Wettbewerber“, wenn es darum geht, Märkte jenseits der Landesgrenzen zu erobern, Exporterfolge zu erzielen und die Außenbilanzen des Landes ins Plus zu bringen. Neben die eine Zielsetzung, Monopole zu verhindern, tritt deshalb die andere, erwünschte Monopole zu gestatten und manchmal herzustellen.[16] Welcher der beiden Gesichtspunkte in welchem Fall den Ausschlag gibt, ist eine Frage politischer Zielsetzungen. Deshalb gibt es in der BRD ein Kartellamt, das den Wettbewerb schützt, marktbeherrschende Unternehmen anhand ihres Marktanteils und der Größe ihrer nächsten Konkurrenten ausfindig macht und anklagt – und einen Wirtschaftsminister, der in letzter Instanz entscheidet, ob es im nationalen Interesse liegt, auf das Amt zu hören.
Das nationale Interesse gebietet heute eine klare Gewichtung der beiden Gesichtspunkte: Die Wachsamkeit gegen marktbeherrschende Unternehmen ist zurückgetreten hinter der Sorge, die Nation könnte über solche Unternehmen, die den Weltmarkt zu erobern verstehen und die gegenüber ausländischen Konkurrenten von ähnlicher Potenz bestehen können, eventuell nicht verfügen. Wenn Staaten ihren Markt aber doch einmal von Monopolen bedroht sehen und Wettbewerbsverzerrung bekämpfen wollen, dann ist ihnen klar, daß das eine internationale Affäre ist: Die Mitgliedsländer der EU, die allesamt den gemeinsamen Markt mit ihrem nationalen Geschäft beherrschen wollen, haben die Wettbewerbsaufsicht auf die Brüsseler Kommission übertragen. Man braucht die über-nationale Monopolkontrolle – schon gegen die Monopole der anderen – und beugt sich ihr.[17] In Anerkennung dieser Lage gestatten USA und EU den Wettbewerbshütern des transatlantischen Partners Einspruch gegen Fusionen auf dem eigenen Territorium, sofern die betreffenden Firmen auch auf dessen Markt bedeutende Anteile haben oder gewinnen wollen – tatsächlich brauchen diese Multis ja die Genehmigung der dortigen Behörden, um sich auf deren Hoheitsgebiet breit zu machen. Der EU-Wettbewerbskommissar darf also sein Votum zur Fusion der US-Flugzeugbauer Boeing und McDonnel-Douglas abgeben; US-Stellen dürfen die Beschränkungen, die Brüssel der „Star-Alliance“ – einer Verbindung von Lufthansa, United Airlines und Scandinavian Airlines – in Europa auferlegt, als grundverkehrte Wettbewerbspolitik verurteilen. Wo Fusionen internationale Fragen geworden sind, da gerät der Gegensatz von Vor- und Nachteilen des Monopols, die ein nationaler Wirtschaftsminister bei sich abzuwägen hat, immer auch zur Frage, wie sich die Vor- und Nachteile zwischen den konkurrierenden Nationen verteilen: „Eigene“ weltmarktbeherrschende Unternehmen sind gut und gewollt, Monopole dagegen, die andere Staaten politisch züchten, sind unfair und verderben den freien Wettbewerb, solange jedenfalls, wie sie sich nicht auf dem heimischen Markt ansiedeln und zu seinem Wachstum beitragen.
Die „Multis“ – von der Bedrohung des Vaterlands zum nationalen Lebensmittel
Gewandelt hat sich zweitens die nationale Stellung zu „transnationalem Kapital“. Es gab einmal den Vorwurf, „Multis“ würden sich außerhalb nationaler Jurisdiktion und Kontrolle bewegen, sie würden die Gestaltungsmacht der demokratisch legitimierten Regierung unterhöhlen und die Hebel der Wirtschaftspolitik stumpf machen. Das Vaterland befürchtete einen „Ausverkauf“ und eine „Überfremdung“ der nationalen Wirtschaft, wenn einheimische Unternehmen in ausländischen Besitz übergingen. Man vermutete, die einheimischen Arbeitsstätten könnten dadurch Wertschöpfung und eigenständige Konkurrenzfähigkeit verlieren und zur „verlängerten Werkbank“ der Ausländer werden. Nicht weniger plagte die Patrioten aber auch die entgegengesetzte Sorge, daß dem an sich segensreichen Zustrom von Auslandskapital eine Abhängigkeit des einheimischen Wirtschaftens von auswärtigen Entscheidungen bis hin zum Extrem einer Flucht des heimatlosen Kapitals folgen und der Nation die wirtschaftliche Basis rauben könnte. Alle Vorwürfe liefen auf den einen hinaus: „Multis“ würden das Vaterland benutzen, ohne ihm zugleich zuverlässig als Reichtumsquelle zu dienen.
Spätestens die kritische Debatte über „Chancen und Risiken der Globalisierung“ hat deutlich gemacht, daß Nationalismus in Wirtschaftsfragen heute anders geht. Jenseits aller Chancen und Risiken hat sich die öffentliche Meinung darauf verständigt, daß global operierende Konzerne eine Realität sind, auf die der Nationalstaat und seine Insassen sich einzustellen haben. Die Sorge, das Vaterland könnte von Multis zu seinem Schaden benutzt werden, ist zurückgetreten hinter die entgegengesetzte Sorge, es könnte von ihnen womöglich nicht benutzt werden und selbst keine Weltkonzerne beherbergen.
Das ist kein Wunder. Die „Realität“, auf die die kapitalistischen Nationen mit ihren Korrekturen zu reagieren behaupten, ist nämlich ihr eigenes Interesse und ihr Werk. Sie haben dem Wachstumsbedürfnis ihrer Wirtschaft immer mehr Grenzen seiner territorialen Betätigung niedergerissen, alle Länder der Erde – gewaltsam oder nicht – „geöffnet“ und damit die „Tendenz des Kapitals, den Weltmarkt herzustellen“ vollendet. Der Weltmarkt ist nun offen und erschlossen. Der Mobilität von Ware und Kapital sind keine politischen Grenzen mehr gesetzt. Jede Ware ist Weltmarkt-Ware: Die Bestandteile ihres Kostpreises gehen aus dem alltäglich gewordenen Vergleich des weltweiten Angebots an Maschinerie, Vorprodukten etc. hervor – und natürlich muß sich jeder Lohn, der für ihre Herstellung bezahlt wird, daran messen lassen, ob Arbeit in Portugal oder Korea nicht alles in allem billiger zu haben wäre. Vorbei ist die Zeit, in der der Außenhandel – Import und Export von Ware und Kapital – eine bloße Erweiterung des Geschäfts war, das im Wesentlichen innerhalb der Landesgrenzen und unter der Aufsicht der zuständigen Hoheit zustande kam. Der Weltmarkt ist kein Zusatz mehr zur nationalen Geschäftstätigkeit, sondern von vornherein das Feld, auf dem sie sich bewähren muß. Deshalb ist er auch kein Ausweg mehr, wenn Unternehmen an die Schranken der inländischen Zahlungsfähigkeit stoßen – an bloß die stoßen sie nämlich schon lange nicht mehr. Kapitalistische Firmen, ob klein oder groß, ob nur regional oder international aktiv, haben sich damit auseinanderzusetzen, daß der Markt, den sie nutzen, ein Stück Weltmarkt ist. Sie stehen in Konkurrenz zu Kapitalen aus aller Welt und machen sich für diese Konkurrenz fit, wenn sie Zusammenschlüsse eingehen, mit denen sie sich Unternehmensgrößen verschaffen, die Konkurrenzfähigkeit im Weltmaßstab versprechen.
Diese Grenzüberschreitung ist ihnen zugestanden; die nationale Politik weiß, daß die Bewährung auf dem Weltmarkt Existenzbedingung des Kapitals geworden ist. Ohne globalen Konkurrenzerfolg läuft auch auf dem heimatlichen Markt nichts mehr. Der Nationalismus der Wirtschaftspolitik ist damit nicht ausgestorben. Der Schutz des einheimischen Geschäftslebens besteht nur nicht mehr im defensiven Verbot von Kapitalflucht und protektionistischer Abschottung, sondern in politischen Maßnahmen, die dafür sorgen, daß dieses Geschäftsleben jedem Vergleich mit auswärtigen Konkurrenten gewachsen ist. Die Verteidigung der Reichtumsquellen der Nation geht heute auf in der Eroberung des Weltmarkts durch nationale Konzerne. Das hat nichts Defensives. Die Eroberung des Weltmarkts zielt eben gar nicht auf eine bescheidene Verteidigung der im Land nun einmal vorhandenen Reichtumsquellen, sondern auf deren Mehrung. Dafür fördert die Politik, nicht nur in Deutschland, die Herstellung internationaler Kapitalmacht „ihrer Multis“, schmiedet selbst nationale „Global Player“ und lädt ausländische ein, sich im Land niederzulassen.[18] Die Phrase von der Globalisierung, der sich das Land – leider – stellen müsse, drückt das Verhältnis der Nation zum Weltmarkt insofern sehr verkehrt aus.
Weil internationales Kapital die Reichtumsquelle der kapitalistischen Nation ist, kommen allerdings immer dann, wenn die nationalen Bilanzen zu wünschen übrig lassen, wieder Zweifel auf, ob der Nutzen aus der Geschäftstätigkeit eines „Global Player“ noch national zuzuordnen ist. Die Macher der „Globalisierung“ selbst problematisieren den Rückbezug des internationalen Geschäfts auf die Heimatnation, weil es ihnen nur darum geht: Sie sorgen sich um die Nationalisierung der Erfolge der weltweiten Ausbeutung.
Multis und ihre Heimat: Standortnationalismus – nicht überholt, aber dem Patriotismus des Geldes untergeordnet
Die Frage, ob DaimlerChrysler eigentlich noch ein deutscher Multi sein wird, hat die Öffentlichkeit heftig interessiert; weniger die andere Frage, was ein „deutscher Multi“ überhaupt ist und was sein Erfolg für deutschen Reichtum bedeutet. Man hat sich entschieden, die nationale Frage positiv zu beantworten und die Fusion für eine Art Eingemeindung des amerikanischen in den schwäbischen Renommierkonzern zu halten. Obwohl zwei Firmenzentralen und zwei Vorstandsvorsitzende vereinbart wurden, hält man sich hierzulande daran, daß die neue Firma eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht ist und der Amerikaner in einigen Jahren zugunsten des deutschen Chefs den Sessel räumen wird. Man feiert Symbole der nationalen Zuordnung – aber wie steht es um ihren Gehalt?
Der nationale Standort: Ausbeutung – das erste Lebensmittel der Nation
Ein Beitrag zu deutscher Wirtschaftstätigkeit und wirtschaftlicher Potenz der Nation ist ein Kapital nach wie vor dadurch, daß es im Land produziert, Arbeiter benutzt und bezahlt, Einkommen und Umsatz im Land stiftet, durch Export die Handels- und Zahlungsbilanz des Landes günstig beeinflußt und schließlich mit seinen Steuern die politische Macht finanziert, die ihm das alles ermöglicht. In diesem Sinn sind auch Firmen amerikanischer oder sonstiger Herkunft herzlich willkommen und ein Beitrag zur deutschen Wirtschaft, wenn sie hier Kapital anlegen und Fabriken bauen. In diesem Sinn ist der amerikanische Zuwachs, den sich der deutsche Daimler-Benz-Konzern gesichert hat, dann aber kein Beitrag zu deutschem Geschäft: In Sachen Produktion, Löhne, Steuern und Export ändert sich in Deutschland nichts, wenn Chrysler nun auf seinem Territorium und für seinen Markt als Teil eines deutsch-amerikanischen Gesamtverbands operiert. Weil die internationale Fusion aber die Konkurrenzmacht des auch deutschen Konzerns befördert, ist sie dennoch eine Stärkung der deutschen Wirtschaft, denn nur wenn sich die Firma global durchsetzt, kommt ihr Beitrag zu deutschem Wachstum zustande. Daß für diese Durchsetzung je nach Kalkulation auch Produktion, Löhne und Steuern ins Ausland verlagert werden, ist vom Standpunkt der Nation aus kein Abzug von nationalem Geschäft, sondern Bedingung für es – jedenfalls solange der Multi mit seinem Auslandsengagement insgesamt wächst und nicht auf Kosten des nationalen Standorts nur abwandert.
Der Standortdienst der „global players“: ein tauglicher Nationalkredit
Die politische Macht sichert sich den Beitrag weltweit agierender Kapitale zum nationalen Geschäftsleben dadurch, daß sie ihnen ihrerseits einen besonderen Dienst erweist und sie dadurch an ihre „Heimat“ bindet. Multis genießen von seiten des Staates, in dem sie sich mit großen Unternehmungen engagieren, politische Protektion vor den Fährnissen der Konkurrenz: VW, Daimler, Siemens, aber auch die GM-Tochter Opel läßt „ihr“ Staat nicht mehr kaputt gehen, solange er kann. Sie stiften nämlich nicht nur Umsatz und Einkommen im Land, tragen zu positiven Handelsbilanzen bei und sorgen für Geldzufluß aus dem Ausland. Durch ihre Geschäfte leisten sie zugleich den alles entscheidenden Dienst am Nationalreichtum: den Dienst an der Geldmacht des Staates. Ihre Profitmacherei verschafft den Geldschöpfungen der Nationalbank produktive Verwendung. Ihre Exporterfolge bewirken Nachfrage nach deutschem Geld jenseits der Landesgrenzen; das Gleiche findet statt, wenn sie die Erträge ihrer Tochterfirmen an ihrer Heimatbasis zusammenführen. Mit all dem stiften sie die Nachfrage nach dem Geld der Nation, die es hart macht. Im Maß ihres Erfolgs verdrängen sie das Geld anderer nationaler Geldschöpfer aus dem internationalen Geschäftsverkehr und ersetzen es durch das Geld ihres Staates, dem sie dadurch das Privileg des Geldschöpfens über seinen Hoheitsbereich hinaus verschaffen und reservieren.
Diesen Dienst an der Geldmacht der Nation verkennen Standort-Nationalisten, die in der Internationalisierung des Kapitals seine Ent-Nationalisierung sehen und darüber schimpfen, daß die Kapitalisten das gute Geld in die Welt hinaustragen, anstatt es zu Nutz und Frommen heimatlicher Arbeitsplätze und deutscher Steuern zu verwenden. Die längst gültige Rechnungsweise der Nation setzt ihre Einwände zur kritischen Fußnote des globalen Nationalerfolgs herab. Solche Standortargumente – nur noch ab und an und ohne Nachdruck vorgebracht von den an „Beschäftigung“ interessierten Gewerkschaften – bekommen nicht durchaus Unrecht, finden aber auch kein Gehör, solange die Geldmacht der Nation so glänzend reüssiert.[19]
Der nationale Finanzplatz: Multiplikator nationaler Geldmacht
Wenn in einem Land die industrielle Ausbeutung klappt, wenn sich Kapital vom nationalen Boden aus auf dem Weltmarkt durchsetzt und ausländische Kaufkraft zu nutzen versteht, wenn der grenzüberschreitende Erfolg von Produktion und Handel das nationale Geld hart und nachgefragt macht, dann stellt sich eine zweite Quelle nationalen Reichtums ein, die auf der ersten beruht, sie aber quantitativ in den Schatten stellt. Wo diese Grundlage funktioniert, erblüht das Finanzkapital. Die Verfügung über verläßliches nationales Geld macht die Banken des Landes zu gefragten Kreditgebern keineswegs nur bei einheimischen Geschäftsleuten, sondern überall, wo Kredit gebraucht wird. Während sie an Profitquellen rund um den Globus mit ihren Zinserträgen partizipieren, machen sie diese zugleich zu Anlage- und Verwertungsgelegenheiten ihres nationalen Geldes. Solche Anlage vermehrt und stärkt die Qualität dieses Geldes, zur Vermehrung zu taugen, ebensogut wie seine einheimische Verwendung.
Ein nationales Finanzwesen, das mit zuverlässigem, weltweit nachgefragtem Geld hantieren kann, trägt nicht nur Kredit in die Welt hinaus, es lockt auch fremdes Geld an. Finanzanlagen sind gefragt, wo das Geld selbst wertbeständig ist und womöglich sogar eine stetige Aufwertung gegen andere Gelder erfährt. Finanziers von überall bringen deshalb ihr Vermögen ins Land und kaufen deutsche Aktien und Schuldpapiere. Sie stellen dem Land ihr Geld zur Verfügung, geben dem nationalen Finanzplatz Kredit und vermehren damit die Fähigkeit seiner Banken, ihr Geschäft auszuweiten.[20] In dem Maß, in dem ein nationaler Finanzplatz sich als Ausgangs- und als Zielpunkt der globalen Geschäftstätigkeit etabliert, verdrängt er anderes Nationalgeld und verschafft dem Geld seines Staates eine dauerhafte Sonderstellung in der Weltwirtschaft.
Der Staat, dessen industrielle, kommerzielle und Finanzkapitalisten ihm den besagten Dienst leisten und sein Geld zum unverzichtbaren Medium des weltweiten Geschäftslebens machen, hat selbst Kredit. Er hat die Macht, durch politischen Beschluß, Geld zu schöpfen. Mit ihr kann er immer mehr Geschäft auf sich und sein Geld verpflichten, und mit ihr befriedigt er seine eigenen Finanzbedürfnisse: Seine Staatsschulden sind selbst so gefragt und so sicher wie das Geld, das er schöpft. Die Geldmacht des Staates ist der wahre nationale Reichtum und das definitive Maß des Nationalerfolgs.
Sie hängt ab vom Ausgang der
Konkurrenz um den Anteil des nationalen Geldes am weltweiten Geschäftsleben
Diese Konkurrenz um die Rolle des Kreditstifters und Kreditgebers der ganzen kapitalistischen Welt hat die Staaten sortiert: Ihre große Mehrheit ist zu Schuldnerstaaten und „emerging markets“ geworden. Der nationale Fortschritt, der auch bei ihnen in der Vermehrung des Geld besteht, hängt ganz davon, ob und wie sehr ausländische Geldgeber auf sie setzen mögen. Ihnen gegenüber steht die Handvoll Heimatländer des Kapitals, die das Kapital haben, das die anderen brauchen. Die Praxis, per Hoheit Kredit zu schöpfen, – das Privileg jeder Staatsmacht in Bezug auf die ihr unterworfene Gesellschaft – führt in der offenen Weltwirtschaft, wo alle Nationalkredite durch das weltweit agierende Finanzkapital nach ihrer Tauglichkeit für sein Geschäft, damit als Anlagemedium verglichen und bewertet werden, zu einer fraglosen Hierarchie der Währungen: Nach Einführung des Euro gibt es nur noch drei Gelder, die Weltgeltung genießen und unmittelbar als Geldgestalt allen Reichtums anerkannt sind.
Kein Wunder, daß die nationalen Geldhüter dieser Währungen die Sorge vor Kapitalflucht ad acta gelegt haben. In ihrem Kredit besitzen sie das Kapital der Welt. Ihrer Sicherheit, sich vor Kapitalflucht nicht mehr fürchten zu müssen, entspricht der Seufzer nach Kapitalimport seitens aller übrigen Staaten. Sie haben akzeptiert, daß die drei Währungen das Geld der Welt sind und daß sie – anders als USA, Japan und Europa – Geld nicht stiften können, sondern daß sie sich deren Geld verdienen müssen – und zwar dadurch, daß sie sich mit ihrem nationalen Inventar an den Profitansprüchen des Kapitals aus den Metropolen bewähren. Für die Herkunftsländer des Kapitals aber, deren Geld und Kredit in weltweit jede profitable Affäre eingemischt ist, ist jedes gelingende Geschäft ein Beitrag zu ihrer Geldmacht. Für sie hat sich eine neue Identität von privatem Profit und staatlichem Zuwachs, von internationalem Geschäft und Nationalreichtum ergeben.
Die in wachsenden Mengen geschöpften nationalen Weltgelder brauchen ihre stets wachsende profitbringende Verwendung in jedem Winkel der Erde dann aber auch – sind also von allen Pleiten betroffen. Lächerlich ist die Beruhigung der führenden Nationen, bei ihnen daheim laufe die Konjunktur gut, die Krise treffe nur Ostasien – wo es doch europäische, amerikanische und japanische Geldanlagen sind, die dort entwertet und vernichtet werden. Wenn das Kapital global ist, dann sind es auch seine Krisen. Wenn sich nicht überall und in ausreichendem Maß Gelegenheiten zu lohnender Anlage des Geldes finden, wirkt die Spirale des nationalen Weltwirtschaftserfolgs rückwärts: Dann entfällt für die führenden kapitalistischen Nationen nicht nur ein Zusatzeinkommen, das ihnen die weltweite Verwendung ihres Nationalkredits einspielt, vielmehr wird die Materie ihres Reichtums, ihr Geld selbst, beschädigt. Eine Nation, die dies erleben muß, merkt daran, daß ihr heimatliches Wirtschaften nichts mehr taugt. Es kann die internationale Geldmacht des Staates nicht hinreichend sichern – nur dafür aber ist es da. Damit ihr nationales Geld von weltweiten Einbrüchen nicht oder möglichst wenig betroffen wird und der Gefahr der Entwertung entgeht, suchen die konkurrierenden Weltwirtschaftsmächte daher den Anteil ihres Geldes am weltweiten Geschäftsleben auf Kosten der anderen auszuweiten. Nicht zuletzt deswegen widmen sie sich der Förderung von Großfusionen und machen sich in Absprache mit jeweils anderen Nationen zur Partei im Verdrängungswettbewerb ihrer Privatkonzerne. So kommt die Globalisierung voran.
[1] Marx unterscheidet
zwischen der Konzentration und der Zentralisation des
Kapitals: Zwei Punkte charakterisieren diese Art
Konzentration, welche unmittelbar auf der Akkumulation
beruht oder vielmehr mit ihr identisch ist. Erstens:
Die wachsende Konzentration der gesellschaftlichen
Produktionsmittel in den Händen individueller
Kapitalisten ist, unter sonst gleichbleibenden
Umständen, beschränkt durch den Wachstumsgrad des
gesellschaftlichen Reichtums. Zweitens: Der in jeder
besondren Produktionssphäre ansässige Teil des
gesellschaftlichen Kapitals ist verteilt unter viele
Kapitalisten, welche einander als unabhängige und
miteinander konkurrierende Warenproduzenten
gegenüberstehen.
Die „eigentliche Zentralisation im
Unterschied zur Akkumulation und Konzentration“ ist
Konzentration bereits gebildeter Kapitale, Aufhebung
ihrer individuellen Selbständigkeit, Expropriation von
Kapitalist durch Kapitalist, Verwandlung vieler
kleineren in weniger größere Kapitale. Dieser Prozeß
unterscheidet sich von dem ersten dadurch, daß er nur
veränderte Verteilung der bereits vorhandenen und
funktionierenden Kapitale voraussetzt, sein Spielraum
also durch das absolute Wachstum des gesellschaftlichen
Reichtums oder die absoluten Grenzen der Akkumulation
nicht beschränkt ist. Das Kapital schwillt hier in
einer Hand zu großen Massen, weil es dort in vielen
Händen verlorengeht… Die Gesetze dieser Zentralisation
der Kapitale oder der Attraktion von Kapital durch
Kapital können hier nicht entwickelt werden. Kurze
tatsächliche Andeutung genügt: Der Konkurrenzkampf wird
durch Verwohlfeilerung der Waren geführt. Die
Wohlfeilheit der Waren hängt, ceteris paribus, von der
Produktivität der Arbeit, diese aber von der
Stufenleiter der Produktion ab. Die größeren Kapitale
schlagen daher die kleineren… Die durch Zentralisation
über Nacht zusammengeschweißten Kapitalmassen
reproduzieren und vermehren sich wie die andren, nur
rascher, und werden damit zu neuen mächtigen Hebeln der
gesellschaftlichen Akkumulation.
(Das Kapital, Bd. 1, S. 653ff)
[2] Es gibt aus den Fährnissen der Konkurrenz heraus also sowohl Gründe zum Schmieden eines diversifizierten Mischkonzerns wie zur wachsenden „Konzentration auf Kernfelder“. Beides kommt neben- und nacheinander vor. Managementschulen machen Moden daraus und sehen von der Variante, die gerade mehr von sich reden macht, die Untauglichkeit der anderen bewiesen. Daimler-Benz benutzte in den 80er Jahren die Gewinne aus dem Autogeschäft, um sich weitere Geschäftsfelder mit vielversprechenden Zukunftsaussichten zu erschließen: Flugzeugbau (DASA), Eisenbahn (Adtrans), Nachrichten-, Energie und Elektrotechnik (AEG) und Software (Debis). Der „integrierte Technologiekonzern“ von Edzard Reuter erwirtschaftete in den Krisen zu Anfang dieses Jahrzehnts erhebliche Verluste – vor allem weil sich die Militärtechnik wegen des unerwarteten Endes des Kalten Kriegs viel schlechter als erwartet entwickelte. Seit Schrempp Reuter abgelöst hat, gilt die „Konzentration auf Kernfelder“ – ursprünglich ein negatives Konzept, nämlich ein teurer Rückzug aus Feldern von Überakkumulation – als Königsweg. Sie hat nichts zu tun mit bescheidener Beschränkung, sondern ist, wie sich heute zeigt, die Basis, auf der ein noch viel größerer Weltkonzern geschmiedet wird.
[3] Im Flugzeugbau etwa gibt der gerade mit dem zweitgrößen US-Luftfahrtunternehmen McDonnel-Douglas vereinigte Konzern Boeing die Größe vor, die es braucht, um ihm den Weltmarkt streitig zu machen. Die europäischen Partnerstaaten, die einst ein Airbus-Konsortium bildeten, um überhaupt ein konkurrenzfähiges Produkt ihrer nationalen Luftfahrtunternehmen auf den Markt zu bringen, finden sich nun bereit, eine europäische Airbus AG zu schaffen, die zukünftig von einem einheitlichen Geschäftsinteresse aus mit den nationalen Standort-Hütern um die lokale Verteilung ihrer Produktion streiten wird.
[4] Die vermögens- und gesellschaftsrechtlichen Formen, in denen Zentralisation des Kapitals betrieben wird, sind vielfältig. Sie reichen vom bloßen Kooperationsvertrag zwischen selbständigen Firmen über Gemeinschaftsunternehmen, die ansonsten konkurrierende Kapitale betreiben, bis zur ein- und doppelseitigen Minder- und Mehrheitsbeteiligung am Aktienkapital des Partners, mit und ohne Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Sie reichen ferner von der Eingliederung einer selbständig bleibenden AG in eine übergeordnete Einheit, die entweder selbst industriell tätig ist (Konzern) oder über bloße Finanzverflechtungen verschiedene Firmen koordiniert (Holding), bis hin zur Übernahme und Fusion. Die Vielfalt der Rechtskonstrukte verdankt sich dem Bedürfnis, Kooperation und Konkurrenz in je verschiedener, den Beteiligten nützlich erscheinender Weise zu kombinieren. Schließlich sind es Konkurrenten, die sich auf Kooperation verständigen. Bei jeder engeren oder lockereren Form der „Unternehmensverbindung“ entspricht dem Grad des Rechts zur Einflußnahme auf die Geschäfte des Partners eine juristische Verpflichtung seinen Erträgen und Verbindlichkeiten gegenüber. Manche Konstruktionen sehen Verbindungen auf Zeit vor und erhalten die Identität der verbundenen Bestandteile zwecks späterer Auflösung. Nur Übernahme und Fusion führen zur vollständigen Verschmelzung zweier Firmen, sowohl was ihren Gebrauchs- als auch was ihren Tauschwert betrifft. Diese Form des Zusammenschlusses von Firmen macht gegenwärtig Schlagzeilen; von ihr ist im folgenden die Rede.
[5] Das Aktienrecht akzeptiert und regelt die bei einer Fusion notwendige spekulative Festsetzung der Unternehmenswerte: „ Auf den Verschmelzungsvertrag kommt die Bestimmung des § 310 BGB“ (Verbot von Verträgen über erst zukünftiges Vermögen) „nicht zur Anwendung, d.h. er kann auch über künftiges Vermögen geschlossen werden… Die beiden Unternehmen sind zu bewerten, nicht der Verkaufswert der einzelnen Vermögensgegenstände … Ausgangspunkt ist die Bilanz des maßgeblichen Stichtags, auf den die Verschmelzung vorgenommen werden soll. Die stillen Reserven sind aufzulösen und der Gesellschaftswert (Firmenwert, Goodwill) ist zu bewerten. Dieser ist gleich dem Betrag, um den der Ertragswert den Substanzwert übersteigt (Kapitalisierungsmehrwert). Damit gehen Ertrags- und Substanzwert in die Umtauschbilanz ein. Der Ertragswert beruht auf der Schätzung des nachhaltigen künftigen Ertrags der Gesellschaft. Wenn die Bewertung demnach auch grundsätzlich aus einer Kombination von Substanz- und Ertragswert resultiert, ist es in Ausnahmefällen denkbar, nur die eine oder die andere Bewertungsform zugrunde zu legen. Immer muß jedoch die Bewertung der beiden zu verschmelzenden Unternehmen methodisch gleich sein.“ (Henn, Handbuch des Aktienrechts, 3. Aufl., Heidelberg 1987, S.494/496)
[6] Der
Verschmelzungsbericht für DaimlerChrysler legt der
Bewertung der beiden Unternehmen Gewinn- und
Umsatzschätzungen für die nächsten 3 Jahre zugrunde und
rühmt sich dabei noch eines „konservativen“ Ansatzes,
weil die erhofften Synergieeffekte nicht eingerechnet
sind: Die Stuttgarter Daimler-Benz AG und die
amerikanische Chrysler Corp., Auburn Hills erwarten
gewaltige Gewinnsprünge. Erstmals werden sie nun vorab
aus dem Verschmelzungsbericht beider Unternehmen zur
künftigen DaimlerChrysler AG, Stuttgart bekanntgegeben.
Danach plant der Einzelkonzern Daimler-Benz für das
kommende Jahr ein Ergebnis von 8,6 Mrd. DM nach
geplanten 6,2 Mrd. DM in diesem Jahr. Im Jahr 2000
rechnet Daimler dann mit einer Steigerung auf 10,2 Mrd.
DM. Während bei Daimler ein starker Zuwachs zu
verzeichnen ist, scheint er sich bei Chrysler
abzuflachen: Die Amerikaner rechnen 1999 mit einem
Ergebnis von umgerechnet 10,5 (1998: 9,8) Mrd. DM, im
Jahr darauf soll es bei 10,4 Mrd. stagnieren. Damit
allerdings bleibt der umsatzschwächere Chrysler Konzern
ertragsstärker als der Daimler Konzern… Die Bewertung
der Unternehmen durch unabhängige Wirtschaftsprüfer
legt den Wert der Daimler-Benz AG auf 110 Mrd. DM fest…
Der Unternehmenswert von Chrysler liegt umgerechnet bei
82,3 Mrd. DM. Für die Einschätzung der neuen
DaimlerChrysler AG dürfen diese Werte nicht einfach
addiert werden – die erwarteten Synergieeffekte sind in
den Bewertungen noch nicht enthalten. Sie liegen laut
Bericht bei rund 2,5 Mrd. DM im Jahr 1999 und bei 5,4
Mrd. DM in drei bis fünf Jahren nach der Fusion.
(FAZ, 7.8.98.)
[7] Ignorant gegen den
Gegensatz der Bewertungen, dafür aber sehr liberal
regelt das Recht dieses Feld der Spekulation mit
Unternehmen: Die Gegenleistung für die Veräußerung
des Vermögens an der übertragenden Gesellschaft muß in
Aktien der übernehmenden oder neugebildeten
Gesellschaft bestehen. Die Veräußerung darf also nicht
gegen Zahlung von Geld oder von anderen Vermögenswerten
erfolgen. Lediglich bare Zuzahlungen, insbesondere
zwecks Spitzenausgleich sind zulässig, aber nur bis zu
10% des Gesamtnennbetrags der gewährten Aktien. Die den
Aktionären der übertragenden Gesellschaft gewährten
Aktien müssen ihrem Vermögenswert und ihren
Mitgliedsrechten nach den Aktien entsprechen, die die
Aktionäre bisher besaßen und die durch die
Verschmelzung untergehen… Das Umtauschverhältnis
bestimmt sich nach dem Verhältnis des inneren Werts der
beiden Gesellschaften, das durch ein
Bewertungsgutachten der Verschmelzungsprüfer auf der
Grundlage des Verschmelzungsberichts der Vorstände der
beteiligten Unternehmen ermittelt wird. Der Börsenkurs
kann nur hilfsweise hinzugezogen werden. Durch Teilung
des jeweiligen Vermögenswerts durch die Anzahl der
Aktien wird der Wert der einzelnen Aktie errechnet.
Daraus ergibt sich das Umtauschverhältnis.
(Henn, Handbuch des Aktienrechts
S.493/495) Im dem Fall aber, daß eine Firma
durch Vereinigung ihre Rechtsform und die Einflußrechte
des Aktionärs ändert, hat der außenstehende Aktionär
ausschließlich ein Recht auf Barabfindung, auf das die
herrschende Gesellschaft nur durch Beeinflussung der
Aktionäre über ein besonders günstiges anderweitiges
Angebot einwirken kann, dessen Annahme aber dann auf
dem freiwilligen Entschluß des außenstehenden Aktionärs
beruht. Eine von dem Aktionär nicht für angemessen
erachtete Abfindung in dem Unternehmensvertrag kann
gerichtlich angegriffen werden. Besonders soll hier nur
darauf hingewiesen werden, daß für die Frage der
Angemessenheit einer Abfindung niemals der Börsenkurs,
sondern der Substanz- und Ertragswert der betroffenen
Gesellschaft entscheidend ist. Das führt bei in
Börsenspekulationen verwickelten Aktienpapieren immer
wieder zu bösen Überraschungen für die Inhaber der
börsenmäßig überbewerteten Aktien.
(Sölter/Zimmerer, Handbuch der
Unternehmenszusammenschlüsse, München 1972,
S.227)
[8] Die Darstellung
dieses Kompromisses als saubere Rechnung ist ein
Kunstwerk, dessen Ausgestaltung die Fusionspartner den
Spezialisten von Banken überlassen, die auf
„Mergers&Acquisitions“ spezialisiert sind. Jede
Vertragsseite hat da eine eigene Bank ihres Vertrauens
und beide zusammen einigen sich noch einmal auf einen
unparteiischen dritten Prüfer, der die Fairness der
Bewertung bewertet. Zufrieden zeigen sich beide Seiten
z.B. mit folgender salomonischen Lösung: Die Fusion
von Krupp und Thyssen zum Thyssen-Krupp-Konzern ist mit
der Paraphierung des Verschmelzungsberichts einen
weiteren Schritt vorangekommen. Am Freitag haben die
Spitzen der beiden Unternehmen plangemäß erste
Anhaltspunkte des gemeinsam erarbeiteten
Bewertungsgutachtens bekanntgegeben, wobei die
Bewertungsmethoden in beiden Unternehmen einheitlich
angewandt wurden. Im Gutachten wird der
Unternehmenswert der Thyssen auf 23,67 Mrd. DM
veranschlagt, der Fusionspartner Krupp bringt nach
dieser Einschätzung 11,84 Mrd. DM auf die Waage. Die
Thyssen-Seite wird also zwei Drittel des Werts des
neuen Unternehmens mitbringen, die Krupp-Seite einen
Drittel. Bringt man diese Werte in ein Verhältnis zu
den bestehenden Aktien, so ergibt sich pro
Thyssen-Aktie ein Wert von DM 690,09, während sich in
der Krupp-Aktie ein Wert von DM 543,82 spiegelt. Die
durch die Gutachter ermittelten Unternehmenswerte
liegen deutlich über den Summen, die das Börsenpublikum
den Titeln von Thyssen (Börsenkapitalisierung etwa 12,3
Mrd. DM) und von Krupp (etwa 8,7 Mrd. DM) zurzeit
beimißt. Die in jüngster Zeit beobachteten Verhältnisse
der Aktienkurse lagen nah bei der nun angekündigten
Umtauschrelation von 1 zu 1 für die Aktien von Thyssen
und 1 zu 0,788 für diejenigen von Krupp. … Die beiden
Parteien haben betont, daß die die Fusion begleitenden
Institute J.P.Morgan und die Credit Suisse First Boston
(Thyssen) sowie Merrill Lynch (Krupp) die
Umtauschverhältnisse aus finanzieller Sicht für fair
und angemessen halten.
(NZZ
12./13.9.98) So ein Glück: Die „nach objektiven
Methoden“ ermittelten Unternehmenswerte geteilt durch
die Anzahl der umlaufenden Aktien beider Firma ergeben
„innere Werte“ dieser Aktien, die zwar vom aktuellen
Börsenkurs der Thyssen- und der Krupp-Aktien erheblich
abweichen, aber doch ziemlich genau deren relatives
Kursverhältnis abbilden; das relative Verhältnis ist
entscheidend, denn die Aktien werden ja, anteilig gegen
Aktien des neuen Unternehmens getauscht. Das Wunder
dieser Division – die Teilung der Unternehmenswerte
durch die Anzahl der Aktien – erklärt sich dadurch, daß
ihr eine Multiplikation – der Börsenkurse mit der
Anzahl der Aktien – vorausgegangen ist und so die
idealen Unternehmenswerte gefunden werden konnten, die
sich bis auf die Stelle hinter dem Komma durch einander
teilen lassen.
[9] Anläßlich des
Aufrufs zum Tausch der Aktien der Daimler-Benz AG in
solche der DaimlerChrysler AG kämpfte die
Geschäftsleitung gegen den Aufruf eines „Vereins zur
Förderung der Aktionärsdemokratie“: Achtung Daimler
Aktionäre! Mit einem Umtausch zum jetzigen Zeitpunkt
verzichten sie unwiderruflich auf die einmalige Chance
auf wesentlich mehr Geld. Statistisch ist bei einem
Spruchstellenverfahren eine Zuzahlung von 30-40 DM je
Aktie zu erwarten. Nur Aktionäre, die jetzt nicht
umtauschen, können in den Genuß der gerichtlichen
Nachbesserung kommen!
Die Daimler-Benz AG stellt
diesem Aufruf die geringen Chancen einer Nachbesserung
sowie die Nachteile gegenüber, die den Aktionären aus
einer verzögerten Fusion – Dividenden auf
amerikanischem Niveau erst ein Jahr später – oder aus
einem Scheitern des ganzen Vorhabens erwachsen könnten.
(Innerbetriebliche Information der
Dresdner Bank vom 1.10.98)
[10] Bleibt zu erwähnen, daß sich Unternehmen auch auf eine weniger komplizierte Art zusammenführen lassen. Es geht ohne Bewertungsspezialisten, Publizität, Hauptversammlung und Aktientausch, wenn die Eigentumsfrage vorweg eindeutig geklärt wird: Die Firma, die eine andere übernehmen will, wendet sich erst gar nicht an die Geschäftsleitung der anderen, sondern an deren Aktionäre und kauft ihnen offen oder im stillen so lange Aktien ab, bis sie eine Mehrheit davon besitzt. Das andere Kapital wird über den Erwerb seiner – frei und anonym gehandelten – Dividendenpapiere angeeignet. Diese nicht minder börsengerechte Form der Übernahme, bei der die übernommene Firma keine Vertragspartei ist, nennt man eine feindliche. Aktionäre, die verkauft haben, kommen sich in solchen Fällen gerne betrogen vor, weil sie im Nachhinein merken, wie billig sie ihre Papiere hergegeben haben angesichts des Interesses, das sich auf sie richtet.
[11] Die Kurse der
Daimler-Benz- und der Chrysler-Papiere sind in den
vergangenen Tagen weit auseinandergedriftet. Damit
erscheint die Chrysler-Aktie recht günstig. Zwar
notierte auch die Aktie der Daimler-Benz AG mit 163 DM
zu Kasse gestern deutlich unter dem errechneten
Firmenwert von 188,55 DM je Aktie. Doch die Schere zu
Chrysler (Firmenwert 119,32) geht bei einem Kassakurs
von 89 DM weiter auf.
(FAZ,
9.9.98) Daimler verkaufen und Chrysler
kaufen: Wer diese Doppelstrategie verfolgte, konnte in
den vergangenen sechs Monaten als künftiger Besitzer
von DaimlerChrysler-Aktien bis zu 25% verdienen.
(Der Spiegel, Nr. 44/98)
[12] Die durch
Fusionserwartungen hochgetriebenen Aktienkurse wollen
durch den späteren Geschäftsverlauf gerechtfertigt sein
– und das um so mehr, je größer die Kurseuphorie
ausgefallen ist. Die Anspruchshaltung der Börse schlägt
sich nieder in Theorien, Fusionen seien letztlich doch
keine so lohnende Sache, wie es den Anschein hat, – für
die, die mit ihrer Spekulation die Übernahmekosten in
die Höhe treiben: Zusammenschlüsse schaffen kaum
Wert für Aktionäre. Unternehmenszusammenschlüsse sind
zwar an den Börsen beliebt, führen aber meistens zu
einer ungenügenden Performance für die Aktionäre. … Als
Hauptgrund für die ungenügende finanzielle Entwicklung
von neuvermählten Gesellschaften nennen Auguren die zu
hohen Übernahmepreise. Die Bilanz des Käufers wird
dadurch sehr stark belastet. … Diese Ergebnisse decken
sich mit der Hypothese, daß Manager die Valoren ihrer
Gesellschaft nur dann als ‚Akquisitionsmunition‘
benutzen, wenn sie davon überzeugt sind, daß die Aktien
zu hoch bewertet sind. … Großfusionen werden heutzutage
fast ausschließlich mit Aktien finanziert.
(NZZ 27.8.98)
[13] Die
Börseneinbrüche des Frühherbsts haben der globalen
Fusionswelle vorübergehend einen Dämpfer versetzt:
Die weltweite Finanzkrise und der Sturz der
Aktienkurse ziehen auch den Markt für Unternehmen
zunehmend in ihren Bann. Die weitgehend ausgehandelten,
dann aber gescheiterten oder vertagten
Milliarden-Transaktionen Siemens-Nixdorf/Acer,
Vobis/CHS Electronic und Herberts/KKK-Group sind nur
der sichtbare Beleg für eine Trendwende. Die Zahl der
heimlichen Annullierungen und Stornierungen von
Fusionsvorhaben geht nach Branchenschätzungen weltweit
bereits in die Tausende. … Da sich die Preise für
Unternehmen generell an den jeweiligen Börsenkursen und
Gewinnerwartungen orientieren, sehen sich Verkäufer
seit dem Beginn der Aktienbaisse und den eingetrübten
Gewinn- und Wachstumsaussichten in vielen Teilen der
Welt einem massiven Preisverfall ausgesetzt. Dies hat
die Bereitschaft vieler potentieller Verkäufer
nachhaltig beeinträchtigt, sich von ihren Unternehmen
zu trennen. Zugleich hat auf der Käuferseite der
Aktiencrash auf Raten die Möglichkeiten vieler
börsennotierter Gesellschaften wesentlich geschmälert,
sich neues Eigenkapital für ehrgeizige Firmenkäufe von
ihren Aktionären zu holen.
(SZ
12.10.98)
[14] Aufschlußreich
folgende Rechtsbelehrung über Beschäftigungszusagen bei
Fusionen: Soweit sich in dem Verschmelzungsvertrag
Bestimmungen darüber finden, daß das verschmolzene
Unternehmen in die Verpflichtungen des übertragenden
aus Anstellungs- und Arbeitsverhältnissen eintritt,
kommt dem keine konstitutive Bedeutung zu, da diese
Rechtsfolge gerade das Wesen der bei jeder
Verschmelzung stattfindenden Gesamtrechtsnachfolge
ausmacht. Gleichwohl haben derartige Klauseln eine
gewisse psychologische Bedeutung, da sie
erfahrungsgemäß die anläßlich des Bekanntwerdens einer
Verschmelzung entstehende Unruhe leichter zu beseitigen
helfen.
(Sölter/Zimmerer,
Handbuch der Unternehmenszusammenschlüsse, a.a.O.,
S.238). Das Handbuch schreibt der Bekräftigung
ohnehin weiterbestehender Rechtspflichten gegenüber der
Belegschaft eine wichtige psychologische Funktion zu.
Es hält also Beschwichtigung für angebracht. Beruhigend
wirken soll die Versicherung, daß geltende
Arbeitsverträge weiterhin gelten – als ob die eine
Sicherung gegen Entlassungen wären! Die „Unruhe“
entsteht ja deshalb, weil die Belegschaften wissen, daß
Fusionen Entlassungswellen einleiten und ihnen dagegen
keine Rechtsmittel zur Verfügung stehen. Zu den
betroffenen, aber zur Einmischung berechtigten
Subjekten zählt auch das Management selbst, das die
Fusion plant und durchführt. Von den obersten Managern
ist einer zuviel, und bei gemeinsamer Buchführung,
Controlling, Vertrieb, usw. werden auch manche kleinere
Chefs nicht mehr gebraucht – auch darin besteht ein
Nutzen der Fusion. Die bezahlten Funktionäre des
Aktienkapitals sind die Macher des Geschäfts und eben
auch der Fusion, zugleich haben sie ein persönliches
Interesse an „ihrer“ Firma, den Posten und
Karrierechancen, die sie zu vergeben hat. Die Kollision
ihres Interesses mit ihrer Aufgabe läßt sich mit Geld
lösen – wenn es nur das ist. Entgegengesetzte
Ambitionen ehrgeiziger Betriebsführer haben aber auch
schon manche geplante Fusion zum Scheitern gebracht.
[15] Unter dieser Parole protestieren auch die Belegschaften, die von den absehbaren Entlassungen betroffen sind. Für die öffentliche Anerkennung ihrer Sorgen schließen sie sich dem Einspruchstitel der Politik an, der mehr gilt als ihre Sorgen, und „kämpfen“ gegen die „feindliche Übernahme“. Eine industrielle Strategie, die nicht mit der ihrer Firma übereinstimmt, halten sie für einen Angriff auf ihr Interesse, als ob die Strategie ihrer Firma sich ihren Interessen verdanken oder diese auch nur berücksichtigen würde. Sie wollen auf keinen Fall „in fremde Hände übergehen“. Für die Eigenständigkeit ihrer Firma bringen sie Opfer an Lohn und Leistung; die anfallenden Entlassungen akzeptieren sie als notwendig zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit, letztlich eben der Eigenständigkeit „ihrer“ Firma. Ihr bodenloser Betriebs-Heimatstandpunkt lastet den fremden Managern der neuen Konzernmutter genau die Maßnahmen als Ausdruck „rücksichtsloser Profitmaximierung“ an, die sie den Leitern „ihres“ Betriebs als unumgängliche Schritte der betrieblichen Existenzsicherung abnehmen. Dabei ist – jedenfalls in den betrachteten Fällen der Vereinigung funktionsfähiger und für einander attraktiver Großkonzerne – nichts dran an der Furcht, in feindlich übernommenen Betrieben werde rücksichtsloser rationalisiert als in den Werken der expandierenden Muttergesellschaft. So berechtigt die Sorge der Belegschaften vor neuen Rationalisierungswellen ist, so unberechtigt ist die Furcht, die zugekauften Fabriken, Büros, Belegschaften würden schlechter behandelt als die alteingesessenen: Sie sind durch die Übernahme Teil des kaufenden Kapitals geworden, werden als Beitrag zu Geschäft und Gewinn des Gesamtkonzerns begutachtet und nach Leistungsfähigkeit, Standort und anderen Kriterien mit den alten Konzernteilen verglichen.
[16] In den USA wird z.B. der Versuch der Antitrust Kommission, Microsoft offene, mit anderer Software kompatible Programme abzufordern, mit dem Argument angegriffen, die Firma trage dank ihrer Monopolstellung erheblich zum Außenerfolg der amerikanischen Wirtschaft bei; die Regierung dürfe ihre großen Geldquellen nicht beschädigen Auch in Fällen, wo nationale Produktionsgrundlagen allgemeiner Natur geschaffen und gesichert werden sollen, fördern oder stiften Staaten, wo sie es vermögen, nationale Unternehmen mit einer mehr oder weniger weit reichenden Monopolstellung, so bei Energie, Telekommunikation. Erst unter den heutigen Weltmarktbedingungen, wo deren Dienste für die kapitalistische Akkumulation gesichert und die Geschäfte internationalisiert sind, setzen Regierungen diese Monopole dann auch auf dem nationalen Markt wieder der internationalen Konkurrenz aus – auch das ein Motor für länderübergreifende Fusionen in diesen Bereichen!
[17] Das hindert die Partner nicht, jede einzelne Entscheidung des zuständigen Kommissars als Anschlag auf ihre nationale Wirtschaft anzufeinden. Als van Miert Bertelsmann und Kirch, Europas größten privaten Fernsehanbietern, verbot, ein Monopol zur Einführung des digitalen Fernsehens zu errichten, hieß es in Deutschland: Hier hätte Europa einmal die Nase vorn gehabt und der Welt einen Standard vorsetzen können..
[18] Es fehlt nicht an Beispielen für die initiative Rolle der Politik: Der deutsche Wirtschaftsminister macht die Fusion von Krupp und Thyssen zu seiner Sache, fordert die Gründung einer europäischen Airbus-AG und entläßt ganze staatliche Infrastrukturbetriebe – Telekom, Post – als Privatfirmen in die internationale Konkurrenz, nicht ohne sie vorher mit umfangreicher Entschuldung auf Kosten der Staatskasse sowie mit der Erlaubnis, ihre Noch-Monopolstellung zu vorteilhafter Preisgestaltung auszunutzen, aufgerüstet zu haben. Mit einer vorerst nur angekündigten Rechtsänderung gibt die US-Regierung den Startschuß zu Großfusionen bei ihren Banken: Sie hat die in der großen Depression zum Schutz der Spareinlagen eingeführte Trennung von Spar- und Kreditbanken als Konkurrenzhindernis gegenüber europäischen Universalbanken entdeckt und plant, dieses überkommene Instrument der Sicherung des Kreditsystems zu demontieren: Sparbanken sollen mit Kredithändlern, Aktienbrokern und Versicherungen fusionieren und ihr Handicap ablegen – und sie tun es, noch ehe das Gesetz gefallen ist.
[19] Die Profitmacherei innerhalb der Landesgrenzen ist eben nur Grundlage und erster Gesichtspunkt des nationalen Reichtums, nicht aber auch schon sein letzter. Eroberung und Verteidigung der außerordentlichen Position in der imperialistischen Rangordnung braucht zwar die Leistungen des Standorts: Heimische Gewinne, die dauerhaft günstige Außenhandelsbilanz und der nationale Anteil am Sozialprodukt der Welt leisten die notwendige Bestätigung und Versicherung der Qualität des nationalen Geldes. Daß einheimische Ausbeutung zugunsten internationaler Finanzanlagen ausfallen, daß eine Weltgeldmacht nur noch aus Finanzplatz, Blaupausen und Rentiers bestehen könnte, die De-Industrialisierung also, die die Freunde der lokalen Ausbeutung an die Wand malen, ist aber auch nicht zu fürchten, solange ein Staat Weltgeld emittiert. Denn der verschafft den beim ihm operierenden Kapitalisten damit auch den Kredit, den sie zu ihrer Behauptung in der Konkurrenz brauchen; er verfügt ferner selbst über die nötige Finanzkraft, um seine Gesellschaft zum attraktiven Kapitalstandort zu entwickeln und Kapital bei sich heimisch zu machen. Was die Standortfanatiker als Vernachlässigung der heimischen Basis und als Verzicht auf deutsches Investieren beklagen, ist vielmehr die Sorte Benutzung dieser Basis, die zu einer Weltgeldmacht gehört. Das Wirtschaften auf dem Standort muß dazu taugen, das nationale Geld hart zu machen. Alles Produzieren, das am Maßstab der auf dem Weltmarkt gültigen Rentabilität versagt, leistet dafür nichts. Entweder es wird konkurrenzfähig, oder es darf untergehen, damit es den Staatshaushalt und darüber das Geld der Nation nicht belastet. Geschäftsfelder, die als national unverzichtbar galten wie der Bergbau oder in gewissem Maße auch die Landwirtschaft, gelten als Belastung und werden zurückgefahren, weil ihr Betrieb staatliche Unkosten verursacht, die als – nicht mehr zeitgemäße – „Erhaltungs-Subventionen“ gelten. Die Versorgung mit den notwendigen Gütern wie Energie, Rohstoffe, Lebensmittel ist mit nationaler Beteiligung internationalisiert – und damit für die erfolgreichen Nationen lohnend gemacht. Ganz anders verhält es sich mit dem Transrapid, dem Airbus etc.: Subventionen, mit denen zukünftige Weltmarktschlager zur Marktreife gebracht werden, sind nötig und nützlich. Reformen, die auf dem Standort Deutschland manches brachlegen, die Arbeitslosenzahlen in die Höhe treiben, die Arbeit der Beschäftigten verbilligen und die Sozialsysteme „umbauen“, haben nichts zu tun mit einer Vernachlässigung der einheimischen Wirtschaft und auch nichts mit einer Ohnmacht der Politik gegenüber dem grenzüberschreitenden Treiben des Kapitals. So macht eine Weltgeldmacht ihr heimisches Wirtschaften eben zur Grundlage ihres nationalen Geldes.
[20] Dasselbe findet übrigens statt, wenn deutsche Multis wie Daimler oder SAP ihre Aktien in New York notieren lassen: Sie weiten den Kreis ihrer Aktionäre aus, verschaffen ihrer Firma besseren Zugang zu neuem Kapital und beweisen umgekehrt die Attraktivität der Geldanlage in deutschen Titeln.