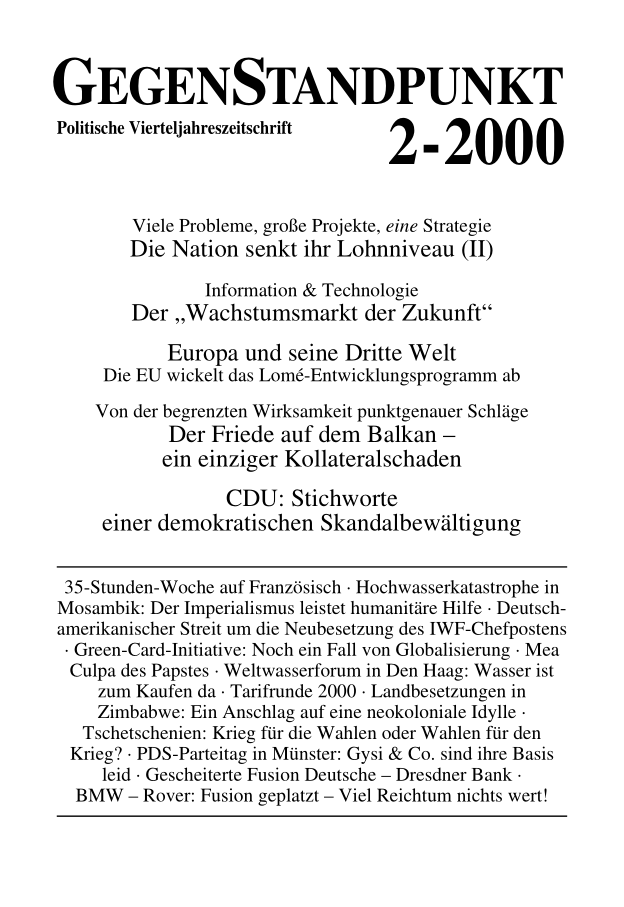Von der begrenzten Wirksamkeit punktgenauer Schläge
Der Friede auf dem Balkan – ein einziger Kollateralschaden
Von keinem so gewollt – deswegen von niemandem anerkannt – also auch gar nicht gesichert
Die militärische Aufgabe der Nato ist mit dem Sieg über Serbien erfüllt – doch der Westen ist mit der Bewältigung der Widersprüche seiner Mission unzufrieden, während er sie weiter forciert: Milosevics Herrschaft gehört „von innen heraus“ beendet, ohne dass der Westen eine alternative nationale Perspektive verspricht; Montenegro wird als Sprengsatz in Rest-Jugoslawien benutzt, ohne dessen Selbstständigkeitsstreben ins Recht zu setzen; im Kosovo sollen die verfeindeten Volksgruppen endlich Grund zum „friedlichen“ Zusammenleben haben, weil die Nato die serbische Hoheit beseitigt hat und auf der anderen Seite eine Übergabe der Macht an die Albaner auch nicht ohne Weiteres in Frage kommt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Der Winter und die Opposition in Serbien
- Die Sezessionspolitik in Montenegro
- Das Kosovo: Ein Protektorat von seltener Schönheit
- Das Kosovo-Dilemma der Nato
- Die Nato erklärt den bisherigen Status für unhaltbar und arbeitet an der Lösung des Problems
- Die neue Front, eine Analogie zum Kosovo – nur ist man dieses Mal schon vor Ort
- Euro-atlantische Streitigkeiten
- Fazit: Warum der Balkan „nicht zur Ruhe kommt“
Von der begrenzten Wirksamkeit
punktgenauer Schläge
Der Friede auf dem Balkan – ein
einziger Kollateralschaden
Von keinem so gewollt – deswegen von
niemandem anerkannt – also auch gar nicht
gesichert
Zum Jahrestag der ersten Bombennacht verteidigen Politik
und Öffentlichkeit den guten Ruf des gelaufenen Kriegs,
als gelte es schon wieder, Kriegsgegner mundtot zu
machen. Von solchen aber ist nichts zu sehen. Verteidigt
wird der Waffengang, weil seine Betreiber und
Parteigänger selber mit den Ergebnissen nicht zufrieden
sind und sich deswegen mit nachträglichen Zweifeln am
Sinn dieses Kriegs herumschlagen. Prompt fürchten sie,
dass ihre eigene Unzufriedenheit mit der Nachkriegslage
rückblickend ein schlechtes Licht auf die ganze
glorreiche Nato-Aktion werfen könnte, und sehen sich zur
Differenzierung genötigt: Zwar haben die Nato-Bomber
die mörderische Militärmaschine des Serben-Herrschers
Slobodan Milosevic vertrieben, sind über 800000
albanische Flüchtlinge aus eigener Kraft in die Heimat
zurückgekehrt – eine bewunderungswürdige Leistung. Aber
nun droht der Westen seinen militärischen und moralischen
Sieg zu verspielen.
(Der Spiegel
17.4.) Denn davon geht die kritische
Öffentlichkeit felsenfest aus, dass die
„bewunderungswürdige Leistung“ der Nato sie nun auch
berechtigt und verpflichtet, eine alle westlichen
Ansprüche zufrieden stellende Nachkriegsordnung zu
befehligen. Und damit steht es nicht zum Besten:
Milosevic regiert immer noch. Und im Kosovo will einfach
nicht die erhoffte Ruhe und Ordnung einkehren. Wie sollte
auch! Die Nationalisten vor Ort, Serben wie Albaner,
haben überhaupt keine Gründe, sich mit ihrer Lage
abzufinden.
Sie bekommen durch das Kriegsprogramm und den Kriegserfolg der Nato auch keine geliefert. Für notwendig befunden wurde der Waffengang nämlich aus einem einzigen, negativen Grund: Milosevic sollte mit seinem störenden Anspruch, die Hinterlassenschaft Titos zu beerben, in die Schranken gewiesen, sein Staatsanspruch auf den Kosovo deshalb beschnitten und damit seine Herrschaft erledigt werden. Darüber wurden sich die Nato-Partner einig, das haben sie als dringliche Aufgabe auf die weltpolitische Tagesordnung gesetzt und mit gehörigem Aufwand erfolgreich durchgekämpft. Die serbische Macht ist gebrochen. Stattdessen hat die Nato die Aufsicht übernommen und befindet direkt und indirekt über die Staatenverhältnisse und nationalen Ambitionen in der Region. Keine nationale Bestrebung, kein Staatsprogramm kommt zum Zuge, es sei denn es ist von den Nato-Machern beschlossen, zugelassen, unmittelbar oder mittelbar gefördert und durchgesetzt. Sie haben die Rolle des Schiedsrichters und mit dem Krieg dann auch die Position der vor Ort präsenten Vormacht übernommen. Diese Hoheit zu erobern, war der Kriegszweck, den haben die Nato-Mächte dank überlegener Gewalt erreicht, und diese machtvolle Zuständigkeit für die Herrschaftsverhältnisse der Balkan-Völker geben sie nicht mehr aus der Hand.
Dieser Erfolg hat allerdings eine andere, für die Kriegsveranstalter mehr als unbefriedigende Seite. Mit der Hoheit ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die Mannschaften dort unten sich nach den Gesichtspunkten sortieren und einordnen, die für ihr nationales Zusammenleben von auswärts ausgegeben werden. Für die Organisation eines „friedlichen Zusammenlebens“ fehlt es an Willen, an Perspektiven und an Mitteln – und zwar nicht bloß bei denen, die dieses Leben führen sollen, sondern auch bei den Nato-Mächten, die als Einzige über die Mittel gebieten, die für einen solchen staatlichen „Neubeginn“ erforderlich wären. Auch die haben nichts im Angebot, was für eine stabile Friedensordnung auf dem Balkan taugt. Die Kriegsherren aus den westlichen Metropolen wissen nämlich nichts weiter anzustellen mit der Region, für die sie sich zuständig gemacht haben. Die Balkan-Mannschaften, denen man mit seiner Gewalt die ‚Selbstbestimmung‘ beschert, sind weder als Handelspartner, noch als Anlagesphäre oder sonst wie nützliche Staatsgebilde verplant. An Hilfen für eine ‚Transformation‘ der inkriminierten ‚Staatswirtschafts‘-Relikte etwa, an ökonomischen Aufbau, oder gar an so etwas wie ein ‚Schaufenster des Westens‘ – also an irgendeine Sorte materieller Überzeugungsarbeit für die Nationalisten vor Ort, dass sich das Ein- und Unterordnen lohnt – ist deshalb nicht gedacht. Das wäre ‚Bevormundung‘, weil den auswärtigen Mächten zu viel Aufwand für das ‚Vielvölkergemisch‘.
Die Losung „friedliches Zusammenleben“ ist leicht ausgegeben. Nur taugt sie überhaupt nichts, solange sowohl den führenden wie den geführten Nationalisten vor Ort keiner ihrer Ansprüche zugestanden wird und nichts von dem gefördert wird, was sie sich vorgenommen haben; solange diejenigen, die die Aufsicht an sich gerissen haben, aber auch keine besseren Alternativen in die Wege leiten und bereit sind, dafür etwas zu leisten. Das sehen die Nato-Aufseher ganz anders: Serben wie Albaner sollen sich ohne all das nach ihrem Kommando richten und einrichten; worin eigentlich und wie, mit welchen materiellen Grundlagen und Perspektiven, darüber haben die Zuständigen aus Europa und den USA sich nicht verständigt und das auch nicht für nötig, weil nicht lohnend befunden. Die Durchschlagskraft ihrer Militärmaschinerie gegen Serbien und die Präsenz ihrer Aufsichtsgewalt im Kosovo soll allein den funktionierenden Gehorsam stiften, der die Ergebnisse ihrer Kriegsaktionen wie eine Stiftung brauchbarer Lebensbedingungen erscheinen lässt. Dieser Anspruch ist schon das ganze Friedensprogramm; und das ist in allem das Gegenteil einer materiell untermauerten Balkan-Ordnung, in der die so Angesprochenen sich einrichten oder gar sich aufgehoben fühlen könnten. Es ist eben einfacher, weltordnerisch die Überlegenheit der eigenen Kriegsmacht zu beweisen, als eine Ordnung zu exportieren, in der das berühmte „zivile Leben“ gedeiht.
Weniger für die Ex-Gegner des Krieges als für seine Fanatiker ist die so erzeugte Lage eine einzige Ansammlung von ungewollten Herausforderungen und Verlegenheiten, weil sich die nationalen Gegensätze nicht nach Bedarf aufrühren und abstellen lassen. Das lasten die Veranstalter der „humanitären Intervention“ den Objekten ihres Eingreifen an und ziehen daraus die Lehre, dass sie ihr gewaltsames Sortierungswerk noch zu keinem ordentlichen Ende gebracht haben. Von den Nationalisten vor Ort verlangen sie jetzt erst recht, all das zu erledigen, was der Krieg ihrer Auffassung nach unerledigt gelassen hat: Die serbische Bevölkerung soll ihrer nationalen Sache abschwören und gefälligst Milosevic stürzen; Montenegro soll einen Beitrag dazu leisten; die Albaner im Kosovo sollen sich zum multi-ethnischen Zusammenleben in einem Nato-Protektorat bereitfinden … – und das alles aus keinem anderen Grund als dem, dass dies den Machtkalkülen in Washington, Paris, London und Berlin entspricht. So kommen sicher nicht die verordneten zivilen, weil stabilen Verhältnisse und der verlangte automatische Gehorsam zustande; wirkungslos bleibt das Fordern und militärische Fördern aber nicht. Die Nato-Bündnispartner rühren auf diese Weise laufend neue Konflikte auf und stiften neue Kriegslagen. Vor Ort werden die Anträge und Maßnahmen nämlich durchaus verstanden; die verfeindeten Nationalisten versuchen, daraus das jeweils Beste für sich zu machen.
Der Winter und die Opposition in Serbien
haben alle in sie gesetzten Hoffnungen, dass sie das Kriegswerk selbstbestimmt im Sinne der Kriegsherren vollenden würden, bitter enttäuscht.
Es hätte so schön ausgehen sollen – das Spektakel „Öl für Demokratie“: Heizung und Licht nur in den Kommunen, die von der Opposition geführt werden, Erfrieren und Elend in Milosevics sonstigem Reich, Aufruhr, Sturz Milosevics und dessen Ablieferung in Den Haag … Aber nein:
„Entgegen westlichen Voraussagen hat es das Regime in dem Winter nach den Nato-Bomben fertig gebracht, einen Zusammenbruch von Fernheizung und Stromnetz zu vermeiden.“ (SZ 23.2.)
Man
, d.h. der einschlägig humanitär gesonnene
Beobachter von der FAZ fragt sich
, warum sein
kann, was nicht sein darf: Wie Serbien bisher zu
überleben vermochte
? (FAZ
6.3.) Schließlich hat das mächtigste
Staatenbündnis aller Zeiten doch sein Bestes dafür getan,
mit Embargo und Bomben das Land von seiner Ökonomie zu
befreien. Dem Regime gelang es wider Erwarten, das
Land durch den Winter zu bringen – mit Gas und Öl aus
Russland, mit Geld aus China.
(FAZ 7.3.) Dazu kommen nach Recherchen
der FAZ noch Libyen und der Irak, womit die Liste der
üblichen Verdächtigen fast schon komplett ist.
Das Nachkriegselend in Serbien ist zwar nicht von schlechten Eltern; was alles an Produktion, Infrastruktur und Lebensunterhalt der Massen zusammengebrochen ist, wird bei Gelegenheit erwähnt – die Wissenschaft streitet noch um den genauen historischen Level, auf den man Serbien zurückgebombt hat –, aber das genügt eben nicht, und insofern sind die betreffenden Erkenntnisse auch ziemlich uninteressant. Die gebieterische Forderung von Politik und Öffentlichkeit läuft darauf hinaus, dass das Elend in Serbien erst dann zufrieden stellend ausfällt, wenn es zum Zusammenbruch des Regimes führt. Vor diesem Hintergrund wird ein neuer Skandal ausgerufen. Der besteht darin, dass das Regime nicht nur nicht zusammengebrochen ist, sondern sogar – uns zum Trotz und zum Hohn – einen gewissen Wiederaufbau hinbekommen hat!
Schäden von Graphitbomben am Stromverteilungssystem
wurden behoben. Das Regime feiert im Fernsehen Abend für
Abend die ‚obnova‘, den Wiederaufbau von zerbombten
Werksanlagen, Brücken, Straßen und Wohnhäusern ‚aus
eigener Kraft‘.
(SZ
23.2.) Tatsächlich wurde bei der Instandsetzung
der Infrastruktur vieles geleistet …
, daneben aber
leistet sich das Regime schon wieder eine unverschämte
Provokation und lässt einige Ruinen zu Denkmalszwecken
stehen: Doch manches Memento der Bombenangriffe wurde
denkmalpflegerisch erhalten
, was den deutschen
Experten in Sachen Denkmalswissenschaft schon wieder
alles sagt: Die Ruinen erinnern an eine Zeit der
extremen Zuspitzung, während der alle Menschen unter der
gemeinsamen Bedrohung eins und einig waren … Die
permanente Krise und der fast permanente Krieg sind seit
je das politische Lebenselixier für Milosevic.
(FAZ 24.3.) Der Ärger, dass
der Winter die Kriegsleistungen der Nato nicht belohnt
und Milosevic das Genick gebrochen hat, lässt sich aber
nicht wegdiskutieren.
Was Serbien betrifft, ist die Lage also die: Die militärische Aufgabe der Nato ist mit dem Sieg über Milosevic und der Vertreibung seiner Armee aus dem Kosovo erledigt – aber Milosevic ist noch an der Macht. Die Siegermächte bestehen aber darauf, dass auch mit seiner Herrschaft über Serbien und mit der von ihm verkörperten Linie serbischer Selbstbehauptung ein Ende sein muss. Ihre Erwartung, dass sich dieser politische Zweck mit der ihm beigebrachten Niederlage mehr oder weniger – von den Sanktionen unterstützt – von selbst erledigen würde, hat sich nicht erfüllt. Selber hinzugehen und Milosevics Herrschaft in einem erneuten Krieg gegen Serbien zu beenden, ist derzeit nicht im Programm. Eines aber schon: Seit Kriegsende steht die Forderung an die Opposition im Lande, sie solle die Sache für die Nato erledigen. Das freilich ist ein wenig viel verlangt. Die Opposition soll sich zum Helfershelfer der Nato machen, die ihr Land niedergebombt hat und mit Sanktionen zermürbt, und sich damit dem serbischen Volk erfolgreich als künftige Führung anpreisen. Zwar weiß man bei der Nato, dass die fortdauernden Sanktionen gegen Serbien alles andere als einen Beitrag zur Stärkung der Opposition in Serbien darstellen, dass sie die vielmehr in die Rolle einer 5. Kolonne der Nato und von Landesverrätern rückt; die Opposition beklagt sich ja laut genug darüber. Man ist dort aber auch der Auffassung, dass die serbische Opposition selbst zusehen muss, wie sie mit diesem Widerspruch fertig wird. Die Nato jedenfalls hält ihre Sanktionen unbeirrt aufrecht, weil sie das Land nach wie vor auf diesem Weg in die Knie zwingen will. Ihre Beendigung kommt für sie erst in Frage, wenn die Opposition die Vorleistung dafür erbracht, d.h. ihren Part erfüllt und Milosevic gestürzt hat. Die Dienstleistung der so genannten Demokratisierung Serbiens, die die serbische Opposition für die Aufsichtsmächte erledigen soll, ist also eine komplexe Aufgabe.
Das führt zu interessanten Verhandlungen, bei denen, was die Nato-Diplomatie angeht, eigentlich gar nichts zu verhandeln ist, stattdessen der Bedarf überprüft wird, wie man die Chefs der serbischen Opposition besser in Szene setzen könnte. Die zeigen sich nämlich willig – an die Macht kommen möchten sie schon auch –, fordern aber ein Entgegenkommen der EU, damit sie nicht nur als Parteigänger der Bombenwerfer dastehen, sondern sich ein wenig als Retter der Nation profilieren können:
„Djindjic … bezeichnete die Zusammenarbeit mit der EU als ‚Katastrophe‘ für die serbische Opposition. Damit kritisierte er, dass die EU sich bei ihrem Treffen am Wochenbeginn nicht auf die Lockerungen der Sanktionen gegen Serbien hatte einigen können. Nach der Einigung der Opposition vor 2 Wochen habe man sich darauf verlassen, dass die EU die Aufhebung des Öl-Embargos beschließe und das Flugverbot aufhebe.“ (FAZ 28.1.)
„Bei dem Treffen in Szeged forderten die Bürgermeister der serbischen Opposition abermals raschere Hilfe beim Wiederaufbau … Doch müsse die Hilfe möglichst rasch und in jedem Fall vor den Wahlen erfolgen, um der serbischen Bevölkerung zu zeigen, dass die Opposition mehr zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen leisten könne als die Regierung.“ (FAZ 25.3.)
„Hilfe beim Wiederaufbau“ ist so ziemlich das Letzte, was der EU zu Serbien einfallen würde, aber sie zeigt bedingt Verständnis für die Forderungen der Opposition und schickt im Winter ein paar Laster mit Heizöl in die von der Opposition regierten Kommunen, damit folgende Botschaft ankommt:
„Die EU verbindet mit der Initiierung ihres Hilfsprogrammes auch die Absicht, der serbischen Bevölkerung zu zeigen, dass die internationalen Sanktionen nicht gegen die Bevölkerung gerichtet sind und dass die Hinwendung der Serben zu oppositionellen Politikern deren Lebensbedingungen spürbar verbessern kann.“ (ÖMZ 1/2000)
Die daneben weiter aufrecht erhaltenen Sanktionen mögen das serbische Volk zwar treffen, dennoch will die Nato nur sein Bestes; und wenn die westliche Politik sich bemüht, das Nachkriegselend in Serbien zu verschärfen, sollen die Opfer das als gut gemeinte Aufforderung zum richtigen Wählen begreifen. Behauptet wird jedenfalls ab sofort bei jeder Gelegenheit, dass sich jede Stimme für die Opposition in wohltäterischen Zuwendungen von Seiten der EU auszahlen werde; zur Unterstreichung lassen sich die Pressionen auch ein bisschen variieren:
„Die EU wird mit amerikanischem Einverständnis ihr Verbot des Flugverkehrs mit Belgrad zwar nicht aufheben, aber doch für sechs Monate aussetzen. Die Außenminister werden dies ausdrücklich der Opposition und deren Argument zuschreiben, dass diese Sanktionen eher die Bevölkerung als das Regime treffe.“ (SZ 11.2.)
„EU setzt Flugverbot gegen Jugoslawien aus. Im Gegenzug plant Brüssel eine Verschärfung der Finanz-Sanktionen.“ (SZ 21.3.)
Die Erpressung der Regierung darf schließlich nicht
nachlassen, wenn die Nato sich in Sachen Flugverkehr
großzügig zeigt, und die spürbare Verbesserung der
Lage der Bevölkerung
lässt sich auch rein
deklamatorisch herstellen. Die Finanzzusagen an Serbien
wachsen im Konditional:
„Im Mitarbeiterstab Pattens heißt es, dass die Gemeinschaft in ihren bevorstehenden Haushaltsbeschlüssen der Bevölkerung und der Opposition in Belgrad kein falsches Zeichen geben dürfe. Die politische und wirtschaftliche Stabilisierung des gesamten Balkan könne auf Dauer nicht gelingen, wenn Serbien ausgeschlossen bleibe. Für die nächsten sieben Jahre hält die Brüsseler Behörde allein für Serbien einen EU-Beitrag von 4,6 Milliarden Mark für erforderlich … Diese Gelder sollen jedoch erst dann fließen, wenn die Ära Milosevic überwunden ist und in Belgrad demokratische Verhältnisse einziehen.“ (FAZ 18.4.)
Wann die Verhältnisse dort demokratisch heißen dürfen,
liegt im Übrigen trotz noch so vieler Wahlen und Parteien
in Serbien weit in der Zukunft. Schließlich ist noch
nicht einmal mit einem Sieg der Opposition die Demokratie
garantiert. Bei Gelegenheit wird nämlich mitgeteilt, dass
sich unsere zurzeit als Demokraten komplimentierten
Oppositionschefs in nationalen Fragen gar nicht groß von
Milosevic unterscheiden, dass in der Kosovo-Frage
buchstäblich alle oppositionellen Gruppen und Parteien in
Serbien auf der Seite Milosevics stehen. Für sie ist es
schon nahezu Staatsverrat, die Wiederherstellung der
Autonomie nach dem Stand vor 1989 zu verlangen
.
(FR 24.3.) Man weiß also
jetzt schon, dass man es auch da mit dem ungehörigen
serbischen Nationalismus zu tun hat, der den
demokratischen Sinn der Verkleinerung des eigenen Staats
nicht verstehen will. Wie allerdings ein alternatives
Staatsprogramm überhaupt aussehen sollte, das dem
serbischen Wähler außer der fortgesetzten Kapitulation
eine Perspektive zu bieten hätte, das ist nicht das
Problem der EU. Was sie aber nicht daran hindert, von der
Opposition eine „Zusammenarbeit“ zu verlangen, bei der
die Opposition als Vorleistung den Sturz des jetzigen
Präsidenten zu besorgen hat. Die EU sagt ihrerseits zu,
nach Kräften zur Entzweiung von Führung und Volk
beizutragen:
„Da sich die Lage in Jugoslawien verschärfe und die ‚Unterdrückung konstant zunimmt‘, empfehlen Solana und Patten, einerseits verstärkt mit oppositionellen Kräften zusammenzuarbeiten und die Sanktionen andererseits punktgenauer auf Milosevic und seinen Machtapparat zu zielen.“ (Solana-Patten-Bericht für den EU-Gipfel in Lissabon, FR 24.3.)
Weitere Ideen für Sanktionen sind also in Arbeit. Die vordringliche Entwicklungshilfe für Serbien leistet die amerikanische Außenministerin und erteilt der Opposition Unterricht in demokratischem Verhalten. „Es muss einen einzigen Oppositionsführer geben, nicht vier“ und eine einzige „Plattform“, deren Inhalt Albright auch noch vorbuchstabiert:
„Die serbische Bevölkerung selber müsse sich des jugoslawischen Präsidenten Milosevic entledigen, sagte Albright und erinnerte dabei auch an Rumänien. Dort war 89 der kommunistische Diktator Ceausescu gewaltsam gestürzt und hingerichtet worden.“ (SZ 16.3.)
Eine klare Auskunft: Zur garantierten Herstellung von
Frieden, Demokratie & Stabilität auf dem Balkan darf kein
Instrument vom Bürgerkrieg bis zum Tyrannenmord
ausgelassen werden. Dass Albright damit die Serie von
Attentaten anregen wollte, der regelmäßig
Milosevic-Vertraute und hohe jugoslawische Funktionäre
zum Opfer fallen, ist noch nicht bestätigt worden. Die
Öffentlichkeit findet ohnehin viel mehr Gefallen an der
gehässigen Auskunft, dass das System
sich
selbst zerfleischt
. (Mittagsmagazin ARD) Welche merkwürdige
Logik das „System“ damit befolgt, was es sich davon
verspricht, wenn es seine Funktionäre zur Strecke bringt,
bleibt zwar dunkel. Aber mit dem Argument „System“ ist ja
eigentlich schon alles gesagt.
Für den Fall, dass auf die Perspektive weiterer Selbstzerfleischung kein Verlass ist und auch die Opposition weiterhin an der ihr vom Westen zugeteilten Aufgabe versagt, stehen noch weitere Hebel zur Demokratisierung Serbiens zur Verfügung; z.B. die Option, an der auch schon gearbeitet wird, den widerspenstigen Staat noch weiter zu zersetzen:
„Der Solana-Patten-Bericht identifiziert jenseits Jugoslawiens im Wesentlichen zwei Gefahrenherde: Die Lage in der jugoslawischen Provinz Montenegro sei wegen gezielter ‚Destabilisierung‘ aus Belgrad weiter spannungsgeladen. Und im Kosovo … zeichnet sich eine Remilitarisierung einiger albanischer Widerstandsgruppen im Bereich des Presevo-Tales an der südöstlichen Grenze zwischen Kosovo und Serbien ab …“ (FR 24.3.)
Das Programm der Nato-Mächte steht also fest: Milosevic weg. Das lässt sich natürlich auch positiv ausdrücken als Demokratisierung Serbiens, bleibt aber genauso negativ und destruktiv: Über die Entmachtung der jetzigen Herrschaft geht der Anspruch gar nicht hinaus. Die ewige Leier, dass dort angeblich immer noch irgendwelche Reste von Kommunismus zu beseitigen wären, geht zwar hierzulande als zureichender Grund für die Unhaltbarkeit des ‚Milosevic-Regimes‘ durch, aber was man denn Besseres für Serbien im Sinn hat, darüber schweigt man sich aus. Sollen da etwa die Zustände in Rumänien als Vorbild dienen? Wie eine korrekte Herrschaft aussehen, worauf sie sich stützen, woraus ihre Mittel beziehen soll, solche Fragen sind für die Öffentlichkeit belanglos. Und die stellen sich auch die Aufsichtsmächte nicht. Von irgendeinem Plan für die Ära nach Milosevic ist nichts zu hören, schließlich hat man genug zu tun mit der Durchsetzung der Forderung: Milosevic weg! Wie danach in Serbien Staat gemacht werden soll, darüber steht nur soviel fest, dass sich das Land in der Rolle eines Kleinstaats von imperialistischen Gnaden zurecht finden soll, dass es sich zufrieden geben soll mit dem Status eines total verfügbaren Landes, ohne dass abzusehen wäre, wofür es dann dienlich sein soll, geschweige denn, wie es davon leben kann. Etwas anderes haben die Aufsichtsmächte nicht im Programm
Die Sezessionspolitik in Montenegro
wird zwar nicht gebilligt, aber tatkräftig gefördert. Bei dieser rest-jugoslawischen Provinz können sich die auswärtigen Stabilitätspolitiker nämlich auf die Kooperationsbereitschaft der Regierung verlassen. Die jedenfalls hat die per Krieg verabreichte Demokratie-Lektion kapiert: Rette sich wer kann, bloß weg von Serbien! – und produziert bei der Verwirklichung dieses Programms in ihrem Machtbereich fleißig neuen Kriegs- und Bürgerkriegsstoff.
In allen Hoheitsfragen schafft sie halbe bzw. ganze
Tatsachen gegen Belgrad. Erst die Einführung der DM; dann
ein eigenes Staatsbürgerschaftsgesetz, das der
montenegrinischen Staatsbürgerschaft Vorrang gegenüber
der jugoslawischen gibt
(ÖMZ
1/2000). Die loyale Polizei
ist inzwischen
von den USA zum Paramilitär ausgebildet worden, die
loyale Truppe Djukanovics soll schon 20000 Mann stark
sein
(FR 17.3.). Nach
einem neuen Gesetz sind die Flughäfen fortan Eigentum der
Republik. Bisher gehörten alle der staatlichen
jugoslawischen Fluggesellschaft
(FAZ 10.12.) Seitdem stehen sich dort
jugoslawisches Militär und montenegrinische
Polizei
gegenüber. Auch das Kommando über die
nationale freie Meinung wird in Angriff genommen:
Milosevic baut ein paralleles Fernsehangebot zur
Verbreitung von Propaganda auf
, nachdem nämlich
vorher Djukanovic die Sendestationen okkupiert hatte. Und
schließlich benötigt Montenegro auch ein selbstbestimmtes
Grenzregime:
„Spannungen: Montenegro öffnet eigenmächtig die Grenze zu Albanien, Belgrad verstärkt Truppenpräsenz… Die eigenmächtige Grenzöffnung ist ein weiterer Schritt auf der Suche Montenegros nach neuen Handelspartnern, einschließlich des völlig darniederliegenden Tourismusgeschäfts, (das zweifelsohne von Albanien aus blendend anzukurbeln geht). Denn als Reaktion auf die Einführung der DM hat Serbien gegen Montenegro ein Handels-Embargo verhängt.“ (FAZ 6.3.)
Also völlig klar, wer hier wen „destabilisiert“!
Auch an der bisherigen Geschichte der Einführung der DM
in Montenegro ist klar abzulesen, auf welcher Seite hier
demokratische Vernunft und wo aggressive Kriegsstimmung
herrscht. Der für Wirtschaft zuständige Vizepremier
Krgovic resümiert: Die Einführung der D-Mark (als
Parallelwährung) habe die montenegrinische Wirtschaft von
den inflationären Tendenzen in Serbien abgekoppelt und
auf diese Weise stabilisiert.
Die Tatsache, dass
im November und im Dezember die Preise in Montenegro
zusammen um rund 50% gestiegen sind
, beeinträchtigt
die Erfolgsmeldung nicht, weil sie sich ausschließlich im
serbischen Dinar abspielt:
„Bei Einführung der D-Mark hatten die Initiatoren damit gerechnet, das gute Geld (D-Mark) werde das schlechte Geld (Dinar) in spätestens drei Monaten vom Markt vertreiben. Zwar lauten die Preisangaben für alle Waren und Dienstleistungen auf D-Mark, aber die harte Mark wird von den skeptischen Montenegrinern gehortet, so dass für die Einkäufe des täglichen Bedarfs der schwache Dinar unverändert im Geldumlauf ist.“ (FAZ 6.3.)
Mit der DM hat man also auch die Bevölkerung
„abgekoppelt“. Dem bekannt skeptischen Montenegriner, der
sicherlich gerne DM horten würde, wenn er nur an sie
herankäme, sind nach Embargo und Krieg mit der
ökonomischen Abtrennung von Serbien die Mittel für ein
Erwerbsleben nun noch weitgehender abhanden gekommen.
Eine „EC-Monitoring Mission“, die auch schon vor Ort ist
und die Kosten der Freiheit berechnet, sieht in einem
unabhängigen Montenegro einen ‚wirtschaftlichen
Pflegefall für viele Jahre‘
: Sie rechnet mit
monatlich 5 Millionen DM, die die im Ausland lebenden
Montenegriner nach Hause schicken
, gegenüber einem
geschätzten jährlichen Handelsbilanzdefizit von etwa 150
Millionen Dollar und einem nur leicht geringeren
Leistungsbilanzdefizit
. (FAZ
6.3.) Aber immerhin – die DM in Montenegro ist
schon enorm stabil! Und für sein nationalökonomisches
Experiment der Vertreibung schlechten Geldes durch gutes
darf der „wirtschaftliche Pflegefall“ mit Zuwendungen von
Seiten der Eigner des guten Geldes rechnen:
„Der Kleinstaat kann bisher nur dank Finanzhilfe aus dem Ausland überleben. 1999 haben allein die USA 55 Millionen Dollar an Soforthilfe geleistet.“ (FR 10.3.) „Deutschland sagt Montenegro einen Kredit in Höhe von 40 Millionen DM zu.“ (FAZ 3.3.
Und schon wieder ist klar, wer hier destabilisiert
– Serbien, das den montenegrinischen Angriff auf das
gemeinsame Geld mit einer Handelsbeschränkung kontert,
ein Exportverbot verhängt und dasselbe mit
Grenzkontrollen absichert, auch um die nationale
Versorgung gegen den eingerissenen Schmuggel
sicherzustellen:
„Tatsächlich sind in Serbien Nahrungsmittel wie Brot, Speiseöl, Zucker oder Milch extrem billig – aber nur sporadisch verfügbar.“ (FAZ 6.3.) „Die aus Slowenien und Kroatien nach Montenegro importierten Produkte sind bis zu viermal teurer als vergleichbare Ware aus Serbien. Angesichts der Gehälter von durchschnittlich 150 Mark pro Monat ist die Preissteigerung für die 650000 Einwohner ein schwerer Schlag.“ (FR 10.3.)
Gänzlich ungerührt von der Tatsache, dass der freie
Westen seit Jahren ein Embargo gegen Rest-Jugoslawien
unterhält, mit dem erklärten Ziel, dort Notstände zu
schaffen, die die Regierenden zur Aufgabe zwingen, wird
die serbische Reaktion auf die montenegrinischen
Separationsbemühungen verurteilt
:
„Robertson verurteilte die Haltung der jugoslawischen Führung gegenüber der Teilrepublik Montenegro. Deren Präsident habe die Autorität, die Angelegenheiten Montenegros zu führen. Der Versuch Belgrads, diese Autorität zu unterlaufen, sei eine ‚Provokation‘. Das Wirtschaftsembargo Belgrads gegen Montenegro müsse ‚unverzüglich‘ aufgehoben werden.“ (SZ 18.3.)
Die Belgrader Regierung möchte also bitte den
Sezessionsschritten Montenegros zuschauen und
darüberhinaus die dortige Lebensmittelversorgung
aufrechterhalten, die Djukanovic mit seinem DM-Experiment
aufs Spiel setzt – alles andere wird ihr von der Nato als
Provokation
ausgelegt.
Dass umgekehrt Djukanovic mit seiner anti-serbischen
Politik goldrichtig liegt, bestätigen ihm Nato- und
EU-Vertreter ein ums andere Mal mit der ständig
wiederholten Feind-Definition. Albright habe gelobt,
dass Djukanovic Belgrad keinen Anlass gegeben habe, mit
Gewalt gegen Montenegro vorzugehen.
(SZ 10.3.) Ebenso regelmäßig ergeht in
Richtung Belgrad die Drohung mit militärischer Gewalt:
„Clark … warnt die jugoslawische Bundesregierung, Druck auf Montenegro auszuüben… Aus dem Fehlen von Äußerungen der Nato zu den Vorgängen könnten keine Schlüsse gezogen werden. Die Allianz werde eventuell notwendige Maßnahmen zur gegebenen Zeit nach eigenem Ermessen einleiten.“ (FAZ 14.3.) Dann ist wieder Solana mit Warnen an der Reihe und warnt „Serbien vor einem Konflikt in Montenegro… Er hoffe sehr, dass kein weiterer Konflikt beginne. ‚Doch wenn das passiert, ist der Verantwortliche ohne Zweifel Milosevic‘.“ ( SZ 20.3.) Noch einmal Solana: „Wir haben Milosevic deutlich gesagt, dass wir das Auftauchen welchen Problems auch immer in Montenegro nicht dulden werden.“ (SZ 23.3.)
So erhält Djukanovic einerseits viel Rückenstärkung bei der Destruktion des jugoslawischen Staatszusammenhangs, andererseits aber einfach keine Sicherheitsgarantie durch die Nato:
„Solana und Patten üben sich im Spagat. Die Union müsse die demokratischen und wirtschaftlichen Reformen in Montenegro unterstützen, zugleich aber die Unabhängigkeitsbestrebungen bremsen, heißt es in ihren Empfehlungen an die Staats- und Regierungschefs. Das Überleben einer Reform-Regierung in Montenegro hänge von einer zügigen und wirksamen Hilfe der internationalen Gemeinschaft ab. Und die Union müsse ‚klare Signale an Belgrad senden, dass die Destabilisierung Montenegros nicht akzeptiert wird‘. Mehr als Wirtschaftshilfe und starke Worte sollen die 600000 Montenegriner nicht erwarten. Offiziell mag es niemand aussprechen, aber Sicherheitsgarantien für Montenegro wird es nicht geben.“ (FAZ 24.3.)
Na klar, am schwersten haben es wieder einmal die Imperialisten mit ihrem Spagat. Für seine Rolle als Sprengsatz im noch gemeinsamen Rest-Jugoslawien ermutigen sie Montenegro und halten es zeitweilig sogar aus, aber mit montenegrinischen Selbständigkeitsbestrebungen wollen sie sich einfach nicht belasten. An noch so einem eigenen Staat besteht nun einmal kein positives Interesse. Gewollt ist wieder bloß der negative Dienst, die Herrschaft in Belgrad weiter zu zermürben. Daran wird unbeirrt festgehalten, bei vollem Bewusstsein, dass damit schon wieder ein Kapitel Bürgerkrieg vorbereitet wird und der montenegrinische Landesteil die Unabhängigkeit, auf die seine Führung aus ist, gar nicht durchsetzen und aushalten kann. So wird nicht nur das Land in eine Sackgasse hineinmanövriert; auch der westliche Anspruch auf Aufsicht schafft sich damit einen weiteren Dauerfall „mangelnder Stabilität“ auf dem Balkan.
In Montenegro selbst ist nicht ganz unbekannt, wofür man instrumentalisiert werden soll:
„Wir müssen tun, was unseren eigenen grundlegenden Interessen entspricht. Aber Montenegro kann keineswegs die Aufgabe akzeptieren, Serbien zu demokratisieren.“ (Ein Sozialdemokrat Rakzevic, RFE/RL Balkan report 3.3)
Um eine Entscheidung in ihrem Sinne voranzutreiben, peilt
die Regierung immer wieder ein Referendum über die
Unabhängigkeit an. Bei der Gelegenheit erfährt man dann
so ganz nebenbei, dass unsere demokratischen Freunde in
Podgorica gar nicht nur Milosevic, sondern auch große
Teile ihres Volkes gegen sich haben. Deshalb hat auch
Musterschüler Djukanovic Nachhilfe bekommen, was den
demokratischen Grundsatz angeht, nach dem man keine
Abstimmungen anzettelt, die man nicht mit Sicherheit
gewinnt: Ein mehrmals angekündigtes Referendum über
die Unabhängigkeit von Serbien hat die Regierung in
Podgorica auf Anraten der USA und der EU vorerst auf Eis
gelegt. Ein Referendum würde Montenegro spalten und
vermutlich zum Bürgerkrieg führen.
(FR 10.3.) Man strebe keine staatliche
Unabhängigkeit an, versichert Vizepremier Krgovic; die
Mehrheit der Bevölkerung sei dagegen.
(FAZ 6.3.) Aber Djukanovic hat kapiert,
dass die Politik dazu da ist, Mehrheiten zu schaffen und
weiß 10 Tage später die schweigende Mehrheit im Prinzip
schon hinter sich versammelt: Auch die Bürger
Montenegros sind geteilter Meinung. Das proeuropäische
Denken dominiert aber immer stärker. Diejenigen, die
heute in der Minderheit sind, brauchen noch Zeit, um die
Vorteile unserer Politik zu erkennen. Die öffentliche
Meinung bei uns muss reifen…
(FR
20.3.) Und die „loyale Polizei“ braucht auch noch
Training und weitere Ausrüstung.
Das Schlachtross der europäischen Kriegsberichterstattung, Scholl-Latour, zum Kriegsjubiläum vor Ort, verspricht nach Sondierung der Lage – der Norden hält voraussichtlich zu Serbien, der Süden zu Djukanovic, das Kräfteverhältnis steht ungefähr 50: 50 – gute Aussichten auf einen Bürgerkrieg. Die Schuldfrage ist von den hiesigen Medien bereits entschieden, laut der geläufigen Doktrin, nach der Milosevic von verlorenen Kriegen lebt:
„Der Konflikt mit der einstigen Schwesterrepublik Montenegro, wo in diesem Jahr eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit abgehalten werden soll, könnte zum nächsten Krieg führen. Denn warum sollte Milosevic nicht den fünften Krieg beginnen – und verlieren, wo er doch die vorangegangenen vier politisch unbeschadet überstanden hat? Die öffentliche Meinung in Serbien ist übrigens entschieden gegen einen Austritt Montenegros aus dem gemeinsamen Staat – und wäre damit neuerdings kriegsbereit.“ (FAZ 11.1.)
Den Befreiungskrieg hat das Kosovo schon hinter sich und genießt den Frieden, den die Nato auf dem ganzen Balkan verankern möchte.
Das Kosovo: Ein Protektorat von seltener Schönheit
Die kosovarische Volkswirtschaft
besteht aus einem Schlachtfeld, das nach wie vor mit Kriegsschäden und explosiven Hinterlassenschaften der punktgenauen Nato-Schläge übersät ist, und aus einem Haushalt, der auf auswärtige Spenden verwiesen ist. Lokale Quellen sind dank Krieg und dank der Abtrennung von Jugoslawien kaum zu verzeichnen. Aber der Krieg hat für ein paar neue Jobs gesorgt:
„Die USA lehnen es ab, ihren Truppen die Erlaubnis zu erteilen, die Tausende nicht-explodierter Cluster-Bomben zu entfernen, die die Nato-Bomber letztes Jahr über dem Kosovo abgeworfen haben. Da nun der Schnee schmilzt und die erste Aussaatperiode nach den Luftschlägen näherrückt, befürchten albanische und internationale Vertreter, dass nun die Todesrate von Bombenopfern ansteigt, wenn die Bauern das Pflügen anfangen, Kinder auf den Feldern spielen und die Leute in die Wälder gehen, um Brennmaterial zu sammeln. Cluster-Bomben sind weitaus gefährlicher als Landminen, und ungefähr 10% davon sind Blindgänger. Aber aus Angst vor dem „bodybag-Syndrom“ – US-Opfer pflegt man auf diese Weise nach Hause zurückzuschaffen – hat das Pentagon entschieden, dass seine Spezialisten nicht mit dem Entschärfen der Bomben beauftragt werden. Der Job wird auf schlecht ausgestattete zivile Teams abgewälzt, die hauptsächlich mit Albanern bestückt werden. … Die Nato will keinen Präzedenzfall schaffen, was das Aufräumen in Nachkriegslagen betrifft. Das hat sie das erste Mal im Golfkrieg klargestellt.“ (Guardian 14.3.)
Neben diesen Arbeitsplätzen und der verbreiteten,
allerdings durch die Kriegsfolgen etwas eingeschränkten
Subsistenzwirtschaft existiert eine Wachstumsbranche:
Dolmetscher bei der UNMIK.[1] Nach den bekannten Gesetzen
der so genannten „Transformation“ entwickelt sich daneben
die „Schattenwirtschaft“, allerdings mit einer besonderen
kosovarischen Note: Nach dem ersatzlosen Verschwinden des
serbischen Staatsapparats hat sich die Provinz in ein
Schmuggelparadies
verwandelt, das 40% von dem
Heroin liefert, das in Europa und Nordamerika verkauft
wird… Man hat ein ganzes Land vor sich ohne eine Polizei,
die wüsste, was läuft…
(Guardian
13.3.) Dazu kommen noch Frauen- und Waffenhandel,
Geschäftssphären, in denen die UÇK zurzeit noch mit
Konkurrenten aus Albanien um die Vorherrschaft zu kämpfen
hat.
Insofern besteht die gesamte Ökonomie des Kosovo
eigentlich aus nichts anderem als dem Haushalt der
Protektoratsverwaltung. Der muss über längere Strecken
ohne Geld manövrieren. Bis Anfang Februar ist nichts
angekommen. Koenigs: Was wir brauchen, sind vier
Tonnen Bargeld in kleinen und mittleren Scheinen.
Die
UN-Verwaltung müsse 60000 Leuten kleine Scheine in die
Hand geben.
Der Zahlungsverkehr erfordere daher
größere logistische Operationen, und das in einer
Gegend, die für den Geldtransport nicht geeignet
sei.
(SZ 7.2.) Im März ist auch
noch kein Geld da. Rund 600 Millionen Mark braucht
Unmik in diesem Jahr, um Lehrer, Ärzte und Polizisten zu
bezahlen, Kläranlagen, Stromnetz und Ampeln wieder
instand zu setzen, Strafvollzug und Justizsystem zu
installieren… Unmik-Chef Kouchner muss betteln gehen,
weil die Kasse leer ist.
(Die
Zeit 23.3.) Denn mit dem Recht, das Land zu
okkupieren, will man in den Nato-Hauptstädten noch lange
nicht die Pflicht übernommen haben, dort das Überleben zu
ermöglichen: EU-Vertreter sprechen mit wachsender
Sorge über übertriebene Erwartungen und die Gefahr, eine
‚Kultur der Abhängigkeit‘ zu stiften…
(Guardian 14.3.) Im Griff haben will man
das Land schon, aber etwas dafür leisten, dass es auch
nur halbwegs funktioniert, will man nicht. Entsprechende
Erwartungen werden entschieden zurückgewiesen. Die EU
hat klargestellt, dass sie das Kosovo als eine typische
kommunistische Volkswirtschaft in der
‚Transformationsphase‘ betrachtet. Das alte Sozialsystem
muss verschwinden und durch ein System von Beihilfen für
die wirklich Bedürftigen ersetzt werden, sagt Joly Dixon,
der EU-Bevollmächtigte für Fragen der Wirtschaft.
(Guardian 17.3.) Auch dem
Protektorat samt unseren hilfsbedürftigen Flüchtlingen
wird also die „Transformations“-Kur verordnet. Nachdem
sich das Missverständnis erledigt hat, dass damit der
Einstieg in die fetten Jahre der Marktwirtschaft gemeint
ist – die einschlägigen Erfahrungen der Länder, die das
Rezept ausprobiert haben, insbesondere auch auf dem
Balkan, sprechen da für sich –, kennzeichnet der Titel
heute eine eindeutige Absage: Sollen die sich
doch erst einmal transformieren – und das, nachdem die
Nato das Land kurz und klein bombardiert hat. Wirtschaft
ist keine mehr vorhanden, aber Elemente einer „typisch
kommunistischen Volkswirtschaft“ schon – vor allem eine
Anspruchshaltung gegenüber den Besatzungsmächten, die
diese überhaupt nicht leiden können; z.B. Rentner, die
ihre Rente brauchen und damit der Protektoratsverwaltung
und letztlich der EU zur Last fallen. Daran denkt der
Mann von der EU offenkundig mit seinem
transformationsbedürftigen „Sozialsystem“. Oder daran,
dass serbische Rentner in Mitrovica aus Belgrad das
Doppelte von dem erhalten, was die Kfor ihren Rentnern
zusagt, aber wegen Geldmangel nicht auszahlt. Für die
zynische Absage an die Vorstellung, dass mit der
Übernahme der Herrschaft die Nato womöglich auch noch für
das Überleben der Leute zuständig sein sollte, gibt es
auch noch andere schöne Formulierungen:
Mittelfristig
, so eine offizielle Stellungnahme
der deutschen Diplomatie, werden erhebliche
strukturelle und wirtschaftliche Reformen notwendig sein,
bis das Kosovo wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein wird
und Märkte gewinnen kann…
(Kosovo – Herausforderung auf dem Weg des Balkan
nach Europa, Veröffentlichung der deutschen Botschaft in
Moskau, 27.3.) „Mittelfristig“ und „strukturelle
Reformen“ ist nie verkehrt.[2]
Das politische Leben im Kosovo
wird nunmehr nach demokratischen Grundsätzen gestaltet, und der Grundsatz Nr. 1 lautet, dass jetzt gefälligst multi-ethnisch zusammengelebt wird. Niemand im Kosovo außer der Nato verfolgt diesen Zweck, und auch die Nato hat das Programm nicht deshalb aufgelegt, weil das Zusammenleben in ihren Heimatländern so schön multi-kulturell organisiert wäre. Eine geradezu abwegige Vorstellung, dass die führenden Nationen in ihren eigenen Grenzen ein Nationalismusverbot einführen und die gesunde Abneigung ihrer Untertanen gegen alles Ausländische ausrotten wollten. Der Anspruch, den sie gegenüber ihrem Protektorat aufmachen, hat auch gar nichts mit den bewährten Methoden guten Regierens in zivilisierten Ländern zu tun, sondern folgt pur aus dem Prinzip, das die Balkan-Aufseher von Anfang an verfolgt haben: Wir lassen ethnische Streitigkeiten nur so weit gelten, wie wir sie genehmigen! Weil sich die Nato auf den ethnischen Konflikt im Kosovo berufen hat, um sich zu ihrem Krieg gegen den Milosevic-Staat zu ermächtigen, verhängt sie das Prinzip nun über das Kosovo als Quasi-Regierungsprogramm: Unter unserer Herrschaft wird der ethnische Gegensatz schlicht verboten! Ein Programm für die Protektoratsinsassen, wie ein halbwegs gedeihliches Zusammenleben ermöglicht und wie etwa für die Beseitigung der Kriegsschäden gesorgt werden soll, oder gar so etwas wie einen Plan für einen wirtschaftlichen (Wieder-)Aufbau hat die Protektoratsverwaltung nicht im Angebot. Aber den Grundsatz des ethnischen Zusammenlebens hängt sie ganz hoch. Schließlich ist der Krieg nicht dafür geführt worden, damit die albanischen Nationalisten dort unten Recht bekommen und an die Stelle der einen ethnischen Säuberung eine andere tritt, sondern damit die Nato als Schiedsrichter über den Konflikt einrückt. In der Position entscheidet nunmehr sie über die gebotene Toleranz der verfeindeten Volksmitglieder und ordnet ein friedliches Mit- und Nebeneinander an, was noch nicht einmal bei den Nato-Mächten zuhause, unter der Aufsicht einer effektiven Polizeimacht, in Kreuzberg etwa oder in den französischen Vorstädten funktioniert.
Das Gebot des „Zusammenlebens“ setzt ein Gewaltprogramm erster Güte gegen die gesamte Bevölkerung auf die Tagesordnung: Immerhin wird den Kosovo-Albanern damit ein Wunsch erfüllt, den sie gar nicht haben, und den Serben eine Auflage, die sie nicht erfüllen können. Die Rollen der Volksteile aus dem früheren Bürgerkrieg sind jetzt umgekehrt besetzt – die albanische Mehrheit dringt auf die Vertreibung aller Serben, die Serben kämpfen als Minderheit um ihr Heimatrecht –, beide Seiten sollen sich aber nach Vorgabe der Nato bremsen. Allerdings weiß man zwischen den Bevölkerungsgruppen Unterschiede zu machen. Die Albaner haben wegen ihrer Gegnerschaft zu Milosevic die Nato auf ihrer Seite gehabt und genießen deren Unterstützung immer noch so weit, wie der Feind nicht erledigt ist; und aus demselben Grund wird den Serben abverlangt, dass sie sich mit Entschiedenheit von ihrer Staatsmacht lossagen und tätige Reue beweisen, indem sie sich am Protektoratsleben beteiligen – auch wenn das ohne ständige Nato-Leibwache gar nicht zu machen ist.
„Ethnische“ Kriminalität ist verboten – Ein Erlass der
UN-Mission sieht Haftstrafen bis zu fünf Jahren für
Auftritte vor, die zu nationalem, rassistischem,
religiösem oder ethnischem Hass aufstacheln.
(SZ 10.2.) – und stellt den
Normalzustand in der Provinz dar. Seit Kriegsende
flohen etwa 240000 Serben, Roma, Juden, Bosniaken und
andere Nicht-Albaner aus der Provinz. Mehr als 600 Serben
wurden erschossen oder erschlagen… 80 Kirchen haben
albanische Sprengkommandos im Kosovo bereits in die Luft
gejagt.
(Spiegel 17.4.)
Die UÇK zeigt sich nämlich der neuen Freiheit gewachsen.
Sie bewegt sich als künftige und, wo immer es geht,
de-facto-Staatsmacht und nimmt die von den
Aufsichtsmächten eingerichteten Staatsposten konsequent
in nationalem Geist wahr. Freilich mangelt es noch an
„Qualifikationen“ und ausreichenden beruflichen
Rehabilitierungsprogrammen:
„Im Rahmen des Aufbaus des Justizwesens sind bislang 400 kosovarische Richter und Staatsanwälte aus allen ethnischen Gruppen ernannt worden… Viele dieser Richter verfügen aber über mangelnde Qualifikation; noch zu oft kommt es zu ethnisch motivierten Entscheidungen.“ (Deutsche Botschaft, Moskau)
„Angesichts der schwierigen sozialen und wirtschaftlichen Lage tausender ehemaliger UÇK-Kämpfer bestand die Gefahr, dass viele von ihnen in den extremistischen Untergrund abtauchen oder sich kriminellen Vereinigungen anschließen. Sie stellen damit ein Potential, das die Sicherheitslage erheblich beeinträchtigen, wenn nicht den Erfolg der gesamten UN-Mission gefährden kann. Um diesen Männern eine Perspektive für eine berufliche Zukunft sowie die Integration in das Zivilleben zu bieten, wurde zunächst vorläufig das Kosovo-Schutzkorps als eine zivile, THW-ähnliche Organisation eingerichtet … Zehn Prozent des KPC-Personals soll aus Minderheitengruppen kommen … Daneben ein Programm zur schulischen und beruflichen Förderung sowie eine Berufsvermittlung… in hervorragender Weise bewährt. Dennoch besteht weiterhin die Gefahr, dass ehemalige UÇK-Angehörige illegalen Tätigkeiten nachgehen.“ (ebd.)
Die 10 Prozent der Stellen sind wegen serbischer
Politikverdrossenheit immer noch nicht besetzt; und auch
die Zusammenarbeit mit den von der UNO gestellten
Polizeikräften leidet an gewissen Reibungsverlusten. Von
der Kfor gefangene „Verbrecher“ stellen sich immer wieder
als Mitglieder des Schutzkorps heraus, und die
ausländische Polizei hat mit Anschlägen zu rechnen, wenn
sie sich zu sehr einmischt. Kritisch aufgelegte Gemüter
befürchten sogar eine „Unterwanderung“ der albanischen
Truppe durch die UÇK. In einem vertraulichen Bericht an
UN-Generalsekretär Annan wird die TMK krimineller
Aktivitäten
beschuldigt: „Mord, Folter, illegale
Ausübung von Polizeiaufgaben, Amtsmissbrauch,
Einschüchterung, Bruch der politischen Neutralität und
Hassreden… Eine 5000 Mann-Truppe mit einem 30
Millionen-Pfund-Budget von der UN bezahlt…“
(Observer 12.3.) Andere
Stimmen versichern jedoch glaubhaft, dass die
entscheidenden politischen Kräfte immer noch in der UÇK
und den von ihr aufrechterhaltenen
Parallelstrukturen
anzutreffen sind. Im sicheren
Bewusstsein, dass sich das Kosovo früher oder später doch
selbst regieren muss, haben die UÇK-Kräfte bei ihrer so
genannten Entwaffnung nämlich nur Ausschussware
abgeliefert. Sie haben sich nicht sehr anstrengen müssen,
um zu begreifen, dass sie mit Obstruktionspolitik am
weitesten kommen. Je mehr Schwierigkeiten man den
Nato-Repräsentanten bei der Durchsetzung ihres
multi-ethnischen Prinzips bereitet, desto eher legen die
sich die Frage vor, ob eine stabile Ordnung nicht erst
dann zustandekommt, wenn sie die Herrschaft an die
albanische Mehrheit abtreten. So hat die
Protektoratsverwaltung schon Ende letzten Jahres
eingesehen, dass man den kosovarischen Bemühungen um ein
neues staatliches Zusammenleben keine allzu lebensfremden
Vorschriften machen darf:
„Kouchner legte eine Agenda für Koexistenz vor, die vorerst eine Abkehr vom Aufbau einer multi-ethnischen Gesellschaft bedeutet … ‚Unglücklicherweise sind Versöhnung und der Aufbau einer multiethnischen Gesellschaft heute nicht möglich, sondern müssen auf ein Morgen warten.‘ Er warb um Verständnis für eine Bevölkerung, die von ‚40 Jahren Kommunismus und 10 Jahren Apartheid‘ traumatisiert sei. Von den Richtern der Provinz nun zu verlangen, nach jugoslawischem Recht zu urteilen, wäre genau so, als würde von ‚Nelson Mandela gefordert, er müsste die Gesetze des Apartheidregimes übernehmen‘.“ (SZ 14.12.99)
Das „multi-ethnische Zusammenleben“ organisiert seitdem
die Kfor solo – durch die gewaltsam abgesicherte Trennung
der Ethnien. Sie stellt Leibwachen – Auch Serben
bewähren sich als Dolmetscher. Es ist ungefähr der
einzige Job, den sie bekommen können, wenn sie auch zur
Arbeit mit einer bewaffneten Eskorte anreisen müssen
(Guardian 16.3.) –; sie
postiert Schutztruppen rund um die in Enklaven
verbarrikadierten Reste serbischer Bevölkerung und sie
unterhält einen regelmäßigen militärisch abgesicherten
Busverkehr, um Minderheiten wie Serben und Roma
Bewegungsfreiheit zu ermöglichen
. (SZ 3.2.) Was die Leute am Leben hält,
ist die Kfor, die sie bewacht und alle paar Wochen einen
Konvoi für Einkäufe und Verwandtschaftsbesuche nach
Serbien eskortiert.
(Die Zeit
23.3.)
Dass der Frieden im Kosovo ziemlich unschöne Begleiterscheinungen hat, wird schon seit einigen Monaten kritisch angemerkt. Anlässlich der Eskalation in Mitrovica aber ist eine neue Sorge aufgekommen. Die Kfor wird dort selbst zum Gegenstand von Angriffen, von serbischer, aber vor allem von albanischer Seite. Infolge der nun von den Kosovo-Albanern betriebenen ethnischen Säuberung ist im Norden des Kosovo, angrenzend an Serbien, die größte serbische Enklave entstanden, deren Führung sich im Nordteil der Stadt Mitrovica verschanzt und den Fluss als Frontlinie im Bürgerkrieg verteidigt. Den Übergang zur militärischen Selbstorganisation will einerseits die Kfor nicht dulden und startet mehrere exemplarische Expeditionen, um dort Waffen einzusammeln, albanische Familien in den Nordteil der Stadt „zurückzuführen“ und die wunderschöne Einrichtung einer „Zone des Vertrauens“ durchzufechten, die mit Stacheldraht ausgerüstet ist und in der vorher auf Schusswaffen durchsuchte Serben und Albaner ein multi-ethnisches Promenieren üben sollen. Auf der anderen Seite behandelt auch die UÇK Mitrovica als Präzedenzfall, den sie nicht hinzunehmen gedenkt. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen marschieren 75000 Albaner nach Mitrovica, um den serbischen Nordteil zu stürmen; es kommt zu Feuerwechseln zwischen albanischen und serbischen Scharfschützen und der Kfor mit Toten und Verletzten auch auf Seiten der Kfor. Seitdem bewachen Kfor-Truppen eine unerklärte Demarkationslinie und kommen regelmäßig von beiden Seiten unter Beschuss.
Das Kosovo-Dilemma der Nato
Wenn solche Konstellationen eintreten und die Nato-Truppe so gar nicht dem anspruchsvollen Bild einer souveränen Ordnungsmacht entspricht, dann kommt Unzufriedenheit auf bei den Veranstaltern, und die Öffentlichkeit fühlt sich zur kritischen Politik-Beratung aufgerufen. Sie nimmt die von oben vermeldeten Probleme zur Kenntnis, macht sich die Problemdefinitionen bereitwillig zu Eigen und entsprechende Sorgen, warnt eindringlich vor einer Blamage, stellt Forderungen auf und entwirft Lösungen, die sie den Nato-Zuständigen dringlich ans Herz legt. Der rege Meinungsaustausch, der so zwischen Öffentlichkeit und Politik zustandegekommen ist, bezeugt die Problemlage, in die die Nato sich hineinmanövriert hat.
„Die Nato-Partner wissen, dass sie am Ende für die Lage und den Erfolg im Kosovo verantwortlich sind … Die 45000 Soldaten im Kosovo, in Mazedonien und Albanien sowie in der griechischen Etappe reichen eben aus, um die Lage im Kosovo einigermaßen unter Kontrolle zu halten … Schwierigkeiten der Befriedungspolitik gegen die Provokationen auf albanischer wie auf serbischer Seite… Die Nato ist nicht nur militärisch, sondern auch politisch und administrativ-technisch engagiert, also de facto verantwortlich für die Verwirklichung der UN-Resolution, ohne doch die politische Kontrolle zu haben.“ (Lothar Rühl, FAZ 13.3.)
Die Nato wollte mit ihrem Krieg Milosevic aus dem Kosovo
vertreiben und hat das erfolgreich geschafft. Es ist ihr
gelungen, Rest-Jugoslawien ein weiteres Mal zu
verkleinern und sich selbst auf dem Balkan militärisch
festzusetzen. Mit dem Sieg hat sie auch die Hoheit über
das Kosovo samt Insassen eingeheimst sowie die
Notwendigkeit, die als Ersatz der verschwundenen
serbischen Obrigkeit auch irgendwie zu
gebrauchen. Ohne dass sie diese Rolle gewollt
hätte, weil sie damit etwas anzufangen wüsste, ist sie
auf einmal nicht nur militärisch, sondern auch
politisch und administrativ-technisch engagiert
. Die
Herrschaft über die Provinz aufzugeben, kommt aber nicht
Frage, weil man damit ja das, was man Milosevic
abgerungen hat, wieder seinem Zugriff überlassen würde.
Die Übergabe an die Albaner kommt auch nicht ohne weiteres in Frage. Zum Helfershelfer eines kosovo-albanischen Nationalismus und seiner Staatsgründungsambitionen will sich die Nato nicht machen lassen; da gelten nach wie vor die Bedenklichkeiten gegenüber einem möglichen „Groß-Albanien“. Außerdem steht noch ein Rechtsgut eigener Art auf dem Spiel, das Recht auf „humanitäre Intervention der Nato“, wie dem Streit darüber zu entnehmen ist, ob das Nato-Eingreifen im Namen der Menschenrechte als Erfolg zu bewerten ist oder nicht:
„Die Nato sollte nach Ansicht des UN-Menschenrechtsbeauftragten für das frühere Jugoslawien, Jiri Dienstbier, den Fehlschlag ihrer Luftangriffe eingestehen und Extremisten im Kosovo mit Bodentruppen bekämpfen. Das Bombardement habe keine Probleme gelöst, sondern die bestehenden vervielfacht und neue geschaffen, sagte Dienstbier nach der Vorstellung seines Berichts vor der UN-Menschenrechtskommission. Darin zog der frühere tschechische Außenminister eine vernichtende Bilanz des Luftkriegs: ‚Die jugoslawische Wirtschaft wurde vernichtet. Der Kosovo ist zerstört. Es gibt jetzt Hunderttausende Arbeitslose. Eine ethnische Säuberung wurde durch eine andere ersetzt‘.“ (SZ 30.3.)
Der deutsche Außenminister hält dagegen am Erfolg der Nato kategorisch fest, und auch die Gleichsetzung, die Dienstbier vornimmt, erklärt er für unzulässig:
„Der Minister sagte, seit dem Ende des Krieges sei im Kosovo vieles geleistet worden. Fast alle Flüchtlinge seien in ihre Häuser zurückgekehrt, die Polizei sorge für Recht und Ordnung. Es habe sich niemand der Illusion hingeben können, dass der Kosovo im Verlaufe eines Jahres zu einer prosperierenden und friedlichen Region werde … Dennoch wolle er die gegenwärtige Vertreibung von Serben nicht mit der von Kosovo-Albanern vor einem Jahr gleichsetzen, weil damals die Gewalttätigkeit vom Staat ausgegangen sei.“ (FAZ 6.4.)
Dabei geht es allerdings weniger um ein Glaubwürdigkeitsproblem der Nato, also darum, ob ihr die hehren Grundsätze, derentwegen sie im Kosovo angetreten sein soll, auch weiterhin abgenommen werden, wie die kritische Öffentlichkeit mit ihrer einfühlsamen Sorge um das schöne neue Instrument der Aufsichtsmächte suggeriert:
„Der Einsatz ist hoch. Nachdem die Nato die Verantwortung für das Kosovo übernommen hat, muss sie daraus einen Erfolg machen. Eine Niederlage dort würde eine Niederlage an einer viel größeren Front bedeuten, mit Sicherheit auf dem ganzen Balkan, wahrscheinlich auch darüberhinaus: Die Zukunft der bewaffneten Intervention für humanitäre Zwecke, egal wo, würde um Jahre zurückgeworfen.“ (Economist 18.3.)
Die Öffentlichkeit lässt sich alle Mal durch eine Neu-Interpretation der Lage überzeugen bzw. überzeugt sich selbst davon, was für die Nato im Kosovo aus „humanitären“ Gründen jeweils geboten ist. In Frage steht vielmehr die Völkerrechtskonstruktion, auf die die Nato andere Mächte, und darüber auch die UNO, verpflichtet und sich deren Anerkennung für den Feldzug verschafft hat. Eine Umdefinition der Kosovo-Mission kündigt diese Konstruktion und rührt damit Machtfragen – im Verhältnis zur Staatenwelt auf dem Balkan, bündnis-intern und im Verhältnis zu dritten Mächten – neu auf. Das will wohl überlegt sein.
Also sitzt die Nato vorerst als Besatzungsmacht im Kosovo
fest, die Nato-Truppe vor Ort leistet ihren Einsatz für
die verordnete Sorte Völkerverständigung, aber eine
Befriedung unter dem multi-ethnischen Diktat kommt nicht
zustande. Die Protektoratsverwaltung bekommt zu spüren,
dass es ein Widerspruch ist, einen Landstrich zu
besetzen, ohne ihn benutzen bzw. benutzbar machen zu
wollen. Ohne irgendwie funktionierende Verhältnisse ist
das Besetzt-Halten eine leidige Angelegenheit, aber zur
Herstellung solcher Verhältnisse ist man nicht willens.
Mangels kraftvoller Träger eines zivilen Aufbaus und
ausreichender wirtschaftlicher Mittel von Seiten der EU
und der UN
(Rühl) sieht
sich die Protektoratsverwaltung im Stich gelassen – von
ihren Auftraggebern, die jede Verantwortung für einen
Wiederaufbau ablehnen und es bei ihren negativen Vorgaben
belassen: Die Position gegen den nach wie vor existenten
Gebietsanspruch Serbiens muss gehalten werden, und auch
die Absage an den Kosovo-Nationalismus gilt weiterhin.
Also halten Nato-Truppen mit Gewalt die Aufsicht aufrecht. Der Aufwand ist erheblich, und ein Ende, die Überführung in geregelte Verhältnisse einfach nicht abzusehen, so dass die Verantwortlichen auf die Sinnfrage stoßen:
„Jeder zweite Kfor-Soldat wird mittlerweile für den Schutz von Minderheiten eingesetzt … Kfor hat weitgehend alle erforderlichen Kräfte und Mittel, um seinen Auftrag auszuführen. Allerdings bindet die Unterstützung UNMIKs bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erheblich Personal.“ (Deutsche Botschaft)
Praktisch nahe gebracht wird den Verantwortlichen die Frage, wozu das alles gut sein soll, von der Obstruktionspolitik, die die Kosovo-Albaner betreiben. Das von der Nato zum Schutzobjekt deklarierte Albanervolk, das nun seinen Feind in Gestalt der serbischen Hoheit los ist, besteht jetzt erst recht auf der von der Nato ausgegebenen berechnenden Verwechslung von Kriegstitel und Kriegsgrund und nimmt die nationale Sache in die eigene Hand – gegen die serbischen Hinterlassenschaften und gegen die Protektoratsverwaltung. Auf diese Weise wird ständig die Entscheidung der Kfor- und UN-Häuptlinge herausgefordert, wie viel Gewalt ihnen die Klarstellung der Nato-Hoheit im Kosovo auch gegen Albaner wert ist.
„In der Theorie müsste die Nato mit ihren 40000 Mann, ihren Panzern, Helikoptern und moderner Elektronik unbeschränkter Herr der Lage sein. In der Praxis besteht eine der unausgesprochenen Regeln der internationalen Politik darin, jede Konfrontation mit dem albanischen Bevölkerungsteil und dessen Führern zu vermeiden. Die Schutzherren der Provinz wissen, dass sie, wenn sie in eine Konfrontation mit der gesamten kosovari-schen Gemeinschaft hineingezogen würden, politisch wie physisch nicht überleben würden.
Die Nato setzt massive Kräfte dafür ein, die nicht-albanischen Minderheiten und ihre Kulturdenkmäler zu schützen. In der Stadt Podujevo z.B. verbringt ein Dutzend britischer Soldaten seine Zeit damit, auf zwei serbische Großmütter aufzupassen (der Rest einer serbischen Gemeinde von früher 800 Personen). Und noch einmal so viele schützen eine kleine orthodoxe Kirche. Aber zur Enttäuschung der Minderheiten gibt sich die Nato wenig Mühe, die vermutlichen Angreifer zu stellen oder die Gruppen zu zerschlagen, die die Gewaltaktionen planen.“ (Economist 18.3.)[3]
Die Notwendigkeit, eine „Befriedung“ auch gegen die Albaner durchzusetzen, ist zwar einerseits als permanenter Kleinkrieg präsent. Wollte man aber die Protektoratskonstruktion eines „multi-ethnischen Zusammenlebens“ unter Nato-Hoheit auch gegen die albanische Mehrheit erzwingen, wäre ein regelrechtes Besatzungsregime gegen die gesamte Kosovo-Bevölkerung und entsprechend mehr militärischer Aufwand verlangt. Die Nato als das gewaltigste Kriegsbündnis aller Zeiten dürfte durchaus über genügend Mittel und eigene Erfahrungen im Niederhalten aufsässiger Volksteile oder Völker verfügen. Aber in einem solchen Unterwerfungsprogramm kann sie einfach keinen imperialistischen Nutzen entdecken. Auf der anderen Seite gerät aber auch der partielle Besatzungszustand, der im Kosovo mittlerweile hergestellt worden ist, die mit Gewalt durchgesetzte Trennung der Volksteile und die militärische Sicherung der serbischen Enklaven, unter den Verdacht einer unsinnigen Verschwendung von Mitteln.
Es steht also die Güterabwägung an, ob der Nato die eigene Konstruktion einer per Uno-Resolution legitimierten, darüber aber auf das multi-ethnische Prinzip festgelegten Herrschaft über das Kosovo die Unkosten eines zunehmend aufwendigen und vor allem nicht effektiven Besatzungsregimes wert ist.
„Grotesker geht es nicht. Um dem absurden Prinzip der Multiethnizität und den Vorschriften der UN-Resolution 1244 zu genügen, verzettelt sich die Nato-Truppe, büßt jede Schlagkraft im Falle einer Krisen-Eskalation ein und verliert allmählich ihre Kampftauglichkeit.“ (Scholl-Latour, Welt am Sonntag 9.4.)
„Das faktisch schon bestehende UN-Nato-EU-Protektorat wird formell bekräftigt und personell verstärkt werden müssen, wenn das Kosovo nicht im Blut versinken soll. Gleichzeitig muss dort eine demokratisch legitimierte Selbstverwaltung aufgebaut werden, auch wenn klar ist, in welche Richtung sie führen wird.“ Wenn nur demokratisch legitimiert, dann versinkt nichts mehr im Blut. „Denn das Recht auf Selbstbestimmung kann man den Kosovo-Albanern auch dann nicht verweigern, wenn sie es nicht entlang wohlmeinender Ratschläge aus dem Westen und aus Russland ausüben wollen.“ (FAZ 8.3.)
Die Stimmen mehren sich also, dass man auf die Dauer an einer Übergabe an die Kosovo-Albaner nicht vorbeikommen wird. Wenn man diese Perspektive ins Auge fasst, heißt es aber auch, die Bedenken in Rechnung zu stellen und zu gewichten.
Die Nato erklärt den bisherigen Status für unhaltbar und arbeitet an der Lösung des Problems
Die öffentlichen Ratgeber tun sich einerseits leicht, für
schnelle Lösungen zu plädieren: Lässt man die Frage der
Durchsetzung gegen dritte Mächte einmal beiseite, sind
die Beweise für die Unhaltbarkeit
der Lage im
Protektorat schlagend. In direkter Umkehrung von Ursache
und Wirkung wird die Nato zum Opfer der von ihr
geschaffenen Protektoratskonstruktion erklärt: Die
Ökonomie kann ja gar nicht funktionieren – nicht deshalb,
weil sie zerstört ist, sondern wegen mangelnder
Rechtssicherheit:
„Ein rechtlich gesehen herrenloses Land … Alle Anstrengungen der UN auf dem Gebiet des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und des social engineering werden gelähmt durch den tiefen Widerwillen der Staatenwelt zu entscheiden, wie die Zukunft des Kosovo aussehen soll. Zurzeit befindet sich das ganze Gebiet in einem merkwürdigen rechtlichen Vakuum, weil es formell, aber nicht wirklich ein Teil Jugoslawiens ist. Der Zustand stellt alles in Zweifel bis hin zu wirtschaftlichen Regulierungen und der Klärung der Eigentumsverhältnisse.“ (Economist 18.3.)
„Der Zustand des Provisorischen, der im Kosovo alle Lösungen erschwert: angefangen von der Registrierung der Einwohner für die avisierten Wahlen bis zum Amselfelder Rotwein, der nicht exportiert werden kann, weil auf dem Etikett das Herkunftsland stehen muss. Lieber kippen die kosovarischen Winzer ihre Ernte in den Fluss, als ‚Bundesrepublik Jugoslawien‘ auf die Etiketten zu drucken.“ (Die Zeit 23.3.)
Das Zusammenleben kann nicht funktionieren – jedenfalls solange nicht, wie die Kosovo-Albaner nicht politisch saturiert werden:
„Es spricht vieles dafür, dass die noch im Kosovo lebenden Serben so lange nicht sicher sind, wie den Albanern das Recht auf Unabhängigkeit vorenthalten wird.“ (FAZ 23.3.)
Überhaupt, völkisch betrachtet, steht die Nato heute
zwischen zwei Stämmen
, und von beiden ist nicht
viel zu halten. So besehen ist die Nato-Herrschaft
eigentlich ein viel zu großmütiges Geschenk an das
Albaner-Pack:
„Die Unabhängigkeit würde die Kosovaren dazu zwingen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Zurzeit können sie sich, was ihre Sicherheit betrifft, auf die Nato verlassen und auf die UN, was die Verwaltung angeht. Währenddessen handeln viele von ihnen mit Drogen und anderer Konterbande und alle profitieren von der gesetzlichen Grauzone, in der sie leben.“ (Economist 18.3.)
Gegenüber den Kosovaren lässt sich – wie man sieht – die menschenrechtliche Hochachtung des ‚freiheitsliebenden geknechteten Volkes‘ leicht wieder aus dem Verkehr ziehen, wenn man darüber nachdenkt, wie man sich das Problem vom Hals schaffen kann, sie regieren zu müssen. Aber auch die Folgewirkungen einer Neuziehung von Grenzen für die weitere Lage auf dem Balkan wollen bedacht sein:
„Da befassen sich Dutzende von Gipfeltreffen mit dem permanenten Desaster, zigtausende Soldaten werden in eine Grauzone zwischen Krieg und Frieden geschickt, zig Milliarden Dollar als Füllmasse in die Gräben zwischen den Ethnien gekippt“. (Das stimmt zwar nicht ganz, aber darauf kommt es hier nicht an.) „Doch trotz guten Willens im Westen und immensen Aufwands gibt es weit mehr Rückschläge zu vermelden als Erfolge. Das schreit nach radikalen Lösungen. Und das Lösungswort heißt Trennung … Wenn man das Kosovo auseinander dividiert, wird dies an anderen Ecken des Balkans die Probleme potenzieren. Bosnien … wäre nicht mehr zu halten. Mazedonien stünde vor einer Zerreißprobe … Auch die verbliebenen Serben in Kroatien dürften mit Fug und Recht wieder auf Eigenständigkeit pochen … Die Rechtfertigung für all die Aktivitäten, bei denen ein so krasses Missverhältnis besteht zwischen Aufwand und Ertrag, liegt schlicht in der Angst vor noch schlimmeren Zuständen.“ (SZ 7.4.)
Das ist doch mal eine ehrliche Bilanz, was die westlichen Leistungen bei der Auflösung von Titos schrecklichem Vielvölkerstaat angeht, zu was das Aufstacheln und Benützen des dortigen Nationalismus getaugt haben. Aber so wenig, wie der SZ-Kommentator eine westliche Zuständigkeit für das Anrichten des „Desasters“ zugeben würde, so sehr kommt es ihm darauf an, die durch den Krieg errungene Oberhoheit als Abwendung „noch schlimmerer“ Verhältnisse zu rechtfertigen. Andere denken gleich weiter, weil die Unzufriedenheit mit dem Ertrag der eroberten Aufsicht zu zukunftsweisenden Lösungen beflügelt. Außenpolitik verlangt eben zuweilen nach großen Visionen. Lamers von der CDU hat sie und legt ein Programm vor, das alle Gesichtspunkte, von den offenkundig notwendigen „ethnischen Trennungen“ – wohlverstanden: keine Säuberungen! – bis hin zum „multi-ethnischen Zusammenleben“, vereint, indem die EU die Herrschaft gleich über den gesamten Balkan übernimmt:
„Er plädierte dafür, Abschied von der Illusion zu nehmen, man könne wider den Willen der Menschen im Kosovo, in Bosnien und anderswo die Trennung und das nach Ethnien separierte Leben verhindern. Allerdings ist ihm auch bewusst, dass die Anerkennung dieser ‚Kantonalisierung‘ neue Gelüste fördert und eine Vielzahl nationaler, wenn nicht nationalistischer Grenzen fördert oder zementiert. Aber: ‚Separation ist wohl die Voraussetzung für Versöhnung.‘… ‚Ich will jetzt nachdenken, wie man die Separierung zumindest friedlicher gestalten kann‘.“ (SZ 24.3.)
Einerseits, so die Empfehlung, sollte sich die Nato ihre Ohnmacht im Umgang mit dem Balkan-Nationalismus – nachdem sie ihn benutzt und angefacht hat – eingestehen. Andererseits sollte sie ihre Sorge vor dem Präzedenzfall einer Veränderung von Grenzen aufgeben und gegenstandslos machen, indem sie aus eigener Machtvollkommenheit neue Grenzziehungen vornimmt und eine komplett neu geregelte Staatenwelt in EU-Gewahrsam übernimmt. Nach Lamers Auffassung
„… werde die internationale Gemeinschaft mittelfristig ‚nicht umhin kommen, Grenzen neu zu ziehen‘ und damit das ‚Selbstbestimmungsrecht‘ von Volksgruppen anzuerkennen, die ‚für sich allein‘ leben wollten. Lamers schlug vor, den gesamten Balkan zu einer ‚europäischen Region‘ im Rahmen der EU zu machen, deren ‚autonome Gebiete‘ auch ‚durch die EU regiert‘ würden und in der dadurch ‚den Grenzen ihr trennender Charakter genommen‘ werde.“ (FR 24.3.)
Das ist kühn vorausgedacht, wie die EU in Zukunft ihren Menschenzoo auf dem Balkan durch geschickteres Aufteilen und Einzäunen besser unter Kontrolle bringen kann. Man möchte sich fast erkundigen, wo Lamers die serbischen Reservate anlegen möchte. Noch ist es aber nicht so weit, dass sich die „Volksgruppen, die für sich allein leben wollen,“ deshalb ausgerechnet europäischen Gewaltphantasien unterstellen. Vorerst sind also andere Lösungen gefragt. Wenn sich im Kosovo die aufsässigen Kräfte nicht von alleine befrieden – und das tun sie ja offenkundig nicht –, warum schafft man sich dann nicht die nutzlose Last vom Hals, indem man selber die „substantielle Autonomie“ für diese Provinz ausgreifender definiert, die Kosovo-Albaner durch eine zumindest halb-offizielle Ermächtigung „befriedet“ und die verbliebenen Serben irgendwie entsorgt? Auf diese Weise wird die Status-Frage, die die Nato noch im Sommer in der UNO-Resolution vertraglich definiert hat, im Winter zur offenen Frage erklärt.
„Kouchner sprach sich dafür aus, angesichts der nicht enden wollenden Spannungen im Kosovo über den künftigen Status der Provinz zu sprechen. Es sei nun nötig, über ‚die Ziele und den endgültigen Status zu diskutieren‘.“ (SZ 22.2.) „Kouchner forderte eine Diskussion über die politische Zukunft des Kosovo und über Art und Umfang der in der UN-Resolution zugesagten weitreichenden Selbstverwaltung der Provinz.“ (FAZ 8.3.)
Die Vereinigten Staaten fordern, dass der Wiederaufbau
des Kosovo nicht länger durch Überlegungen oder Hemmnisse
in Bezug auf dessen künftigen Status behindert werde
(FAZ 24.2.), plädieren also
dafür, Fakten zu schaffen. Das Verfahren, die
völkerrechtliche Zugehörigkeit des Kosovo zu
Rest-Jugoslawien prinzipiell anzuerkennen, aber praktisch
zu ignorieren und außer Kraft zu setzen, lässt sich auf
jeden Fall weiter fortsetzen. Die EU wiederum beschließt:
Es sei Zeit, die Kosovo-Politik zu überprüfen und
einen Fahrplan für die politische Entwicklung des Kosovo
auszuarbeiten
. (Bericht von
Patten und Solana für das EU-Gipfeltreffen in Lissabon,
SZ 24.3.) Beide sind sich darin einig, dass man so
oder so, entweder durch eine neue Definition oder durch
praktisches Handeln, eine neue Lage hinbekommen muss – am
besten durch beides.
Die völkerrechtliche Konstruktion, nach der sich die Nato nur zur Abwendung menschenrechtlicher Verbrechen auf dem Balkan einpflanzt und damit die souveränen Rechte Jugoslawiens nicht verletzt, war zwar unter anderem auch darauf berechnet, dass man keinen Präzedenzfall für ein eigenmächtiges Verändern von Grenzen durch die lokale Staatenwelt schaffen möchte. Aber das Risiko würden die Aufsichtsmächte offensichtlich in Kauf nehmen, wenn sie die Zugehörigkeit zu Rest-Jugoslawien für unhaltbar erklären, die sie unter dem Titel „ungeklärter Status der Provinz“ für die Unregierbarkeit der Gegend verantwortlich machen. Was scheren uns unsere Verträge von gestern, wenn der Feind und Vertragspartner Milosevic ohnehin nichts mehr zu sagen hat. Zumal man sich bekanntlich – man erinnere sich an die eigene Kriegshetze – auf dessen Zusagen und Unterschrift unter Verträge noch nie verlassen konnte. Weil man am Status des Kosovo heftig „rüttelt“, sind einschlägige Dementis vonnöten:
„Eine Auflösung der verschiedenen nationalen Fragen im zerfallenen Jugoslawien hält er (der deutsche Außenminister) allein durch eine ‚gemeinsame europäische Lösung‘ für die gesamte Region, einschließlich eines demokratischen Serbien, für denkbar … Bis in diese ferne Zukunft will die Bundesregierung am Grundkonzept eines formell immer noch zu Jugoslawien gehörenden Kosovo, wie es in der UN-Resolution 1244 festgeschrieben ist, nicht rütteln. Vor einem Umbruch in Belgrad die Zustimmung Russlands und Chinas zu anderen Modellen zu erhalten, hält man in Berlin für aussichtslos. Aber in der unübersichtlichen Gegenwart zeigt sich deshalb, so Erler, ‚eine gewisse Hilflosigkeit‘.“ (FR 24.3.)
Sich über Einsprüche aus Belgrad hinwegzusetzen, wäre
zwar kein Problem, denn, wie Scharping dekretiert, hat
dieser Staat ohnehin nichts zu sagen, solange er falsch
regiert wird. Damit das Kosovo im serbischen
Staatsverband bleiben könne, müsse Serbien eben eine
Demokratie werden, befindet Scharping.
(FAZ 23.3.) Aber China und Russland, die
Mächte, die man während und nach dem Krieg via UNO in die
eigene Rechtskonstruktion „eingebunden“ hat, lassen sich
nicht so einfach übergehen, jedenfalls dann nicht, wenn
man sie weiterhin auf die Logik humanitärer Aktionen der
Weltaufsichtsmächte verpflichten will:
„Die Nato-Partner sind sich einig darüber, dass das Mandat der UN-Resolution 1244 des Weltsicherheitsrates, das 1999 mit Moskau vereinbart und in Peking akzeptiert worden war, zumindest einer einvernehmlichen Auslegung bedarf, um es im Sinne einer Befriedung der de facto von Serbien abgetrennten, aber rechtlich noch immer zu ‚Jugoslawien‘ gehörenden Provinz anzuwenden. Einer solchen konstruktiven, konkreter als bisher gefassten Mandatsausübung im zentralen Terminus ‚substantial autonomy‘ für das Kosovo sind aber vom Mandat selber und von Moskau enge Grenzen gezogen … So wird es vorläufig bei der Ambivalenz zwischen Autonomie im serbisch-jugoslawischen Staatsverband und der von den Kosovaren erstrebten, von den Serben verweigerten und von der Nato bisher nicht gewollten Unabhängigkeit des Kosovo bleiben. Dies aber lähmt die Nato politisch, schafft Konfusion an Ort und Stelle sowie gegenüber Belgrad und ermutigt die Extremisten beider Seiten.“ (Rühl)
Russland wird zwar schon oberdeutlich daraufhin befragt,
ob es sich bei der Einführung neuer Modelle
im
Kosovo noch einmal in den Weg stellen möchte. Zwar hat
die Kfor die vorgesehene Stationierung des russischen
Truppenkontingents in Orahovac bis heute nicht
durchgesetzt – an der Stelle war der Beweis, wer im
Kosovo die Hoheit ausübt, offenkundig nicht gefragt –,
aber Russland soll weiterhin eingebunden werden; z.B. mit
der Aufforderung, weitere Beiträge zur Befriedung der
Provinz zu spendieren und den auf Völkerversöhnung
bedachten Albanern slawisch redende Zivilpolizisten vor
die Flinte zu stellen. Darauf reagiert man im Kreml
allerdings völlig unkonstruktiv:
„Zugleich lehnte Moskau es ab, Zivilpolizei in das Krisengebiet zu entsenden. Stattdessen wurde in einer Erklärung des russischen Außenministeriums kritisiert, dass weder Unmik noch Kfor ihre Vollmachten zur Stabilisierung der Region ausschöpften. ‚Wenn die Teilung Jugoslawiens zur Realität wird und wir sehen, dass unsere Bemühungen in der politischen Regelung keine Ergebnisse bringen, bleibt das russische Kontingent nicht im Kosovo.‘ Russland wolle ‚nicht die Verantwortung für die nächste Tragödie‘ auf dem Balkan teilen.“ (Iwanow, FAZ 24.3.)
Die Botschaft, wie man in Moskau das Verhältnis von
Aufwand und Ertrag des vergangenen Balkan-Einsatzes
kalkuliert, ist klar. Sich vor Ort für ein anderes
Ordnungskonzept zu engagieren und in ernsthaften
Gegensatz zur Nato zu stellen, hat Russland offenkundig
nicht vor. Deshalb fordert die russische Regierung auch
die jugoslawische Führung auf, sich im Umgang mit der
internationalen Gemeinschaft im Kosovo-Konflikt flexibel
und kooperativ zu verhalten.
(NZZ 3.4.) Aber andererseits lässt sie es
sich nicht nehmen, der Nato die Verantwortung für die
Lage und die „nächste Tragödie“ vorzurechnen, aus der sie
Russland herausgedrängt hat. Und erst recht nicht denkt
Moskau als Vetomacht im Sicherheitsrat, die die
UNO-Resolution mit verfasst hat und für deren Einhaltung
mitzuständig ist, daran, der Nato eine eigenmächtige
Veränderung der Lage und den Präzedenzfall einer
Veränderung von Grenzen offiziell zuzugestehen.
Bei den Plänen, wie sich die Nato ihres
Aufsichts-Dilemmas entledigen könnte, sind insofern
vielerlei Bedenken zu berücksichtigen; und in letzter
Instanz ist es wieder einmal Russland, das die Nato
politisch lähmt
. Bei allen Problemen, auf die sie
stoßen, kommen die Nato-Vordenker aber bombensicher
wieder auf ihren elementaren Ausweg zurück: Milosevic
muss weg. Eine Antwort auf die Lage steht
unerschütterlich fest: Milosevic ist schuld
. Wenn
Albaner spontan zu 75000 auf Mitrovica marschieren,
können wir deren autonome Gefühle nicht billigen, aber
gut verstehen bei ihrer Lage vor Ort. Die serbische
Aufsässigkeit hingegen entbehrt jedes glaubwürdigen
Anlasses in ihrer Lage vor Ort; sie wird einwandfrei von
Belgrad gesteuert
. Denn wenn es Milosevic nicht
gäbe, müssten sie schließlich die Schnauze halten:
„Kouchner sieht nach den jüngsten Unruhen Kräfte am Werk, die ein Interesse an Instabilität haben… Die Gewalttaten würden von denen verübt, die keinen Fortschritt im Kosovo wollten… Regierung in Belgrad…“ (SZ 8.2.) „Nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Robertson steht der jugoslawische Präsident Milosevic hinter einem Teil der ‚serbischen Provokationen‘ in Mitrovica. Es bestehe kein Zweifel, dass Milosevic seine Hand im Spiel habe.“ (SZ 22.2.) Holbrooke: „Belgrad schürt die Unruhen… Robertson sagte, die Kfor werde in Mitrovica hart und unparteiisch vorgehen. Zugleich wies er auf serbische Truppenbewegungen in jenen Gebieten Südserbiens hin, die mehrheitlich von Albanern bewohnt werden. Zwei Kompanien der Sonderpolizei seien in die Gemeindebezirke Bujanovac, Presevo und Medvedja verlegt worden.“ (FAZ 23.2.) Clark: „‚Mitrovica wird multi-ethnisch sein, und das bedeutet, dass man den Einschüchterungsmethoden der militärischen Einheiten, Banden und Aufrührer ein Ende setzen muss, die von Belgrad geschickt wurden.‘ Vor allem befürchte er einen Schlag Belgrads gegen die pro-westliche Führung in Montenegro. Auch die im Presevo-Tal an der Grenze zum Kosovo ansässigen 100000 gebürtigen Albaner seien durch Belgrad bedroht.“ (SZ 25.2.)
Nach umfassender Würdigung der Problemlage steht eines
jedenfalls fest: Erst einmal muss die Kontrolle über das
Kosovo sichergestellt werden, und dafür sind mehr Geld,
Polizisten, sonstiges Staatspersonal und vor allem mehr
Soldaten vonnöten. Die Nato schickt 2000 Soldaten zu
Manövern in das Kosovo
(FAZ
29.2.); England schickt Richter, Staatsanwälte,
Zollexperten; Franzosen und Italiener stocken ihre
Truppen auf, Anfang April auch die USA. So etwas wie in
Mitrovica soll sich nicht mehr wiederholen. So treibt man
die Sache auf die Weise voran, die der Nato zukommt: mit
militärischen Drohungen und Erpressungen.
Die neue Front, eine Analogie zum Kosovo – nur ist man dieses Mal schon vor Ort
So wenig, wie sich die Nato damit belasten will, ihr Protektorat zu sanieren – es aus ihrem Zugriff zu entlassen, kommt nicht in Frage. Im Gegenteil: Wenn sich eine neue Mannschaft nach bewährtem Vorbild erhebt, ist man schon wieder mit großer Sorge um Leib und Leben und Menschenrechte seiner Insassen zur Stelle.
Noch während anlässlich der Eskalation in Mitrovica das
Problem der Kontrolle der Lage im Kosovo ventiliert wird,
taucht eine neue Gefahr
im südserbischen
Grenzgebiet zum Kosovo auf, eine neue albanische
Mannschaft, die für Aufruhr sorgt. Zu Beginn wird sie
noch ein bisschen in die Terroristenecke gerückt;
schließlich weiß man genau, welche Herausforderung an
Serbien mit diesem Operationsgebiet vorhanden ist:
„Die ominöse UÇPMB, die Befreiungsarmee Presevo, Medvedja und Bujanovac, will zwar nach eigenen Angaben die Albaner vor Übergriffen der serbischen Polizei schützen. Sie beansprucht aber auch – wie einst die UÇK – schon ‚befreite Gebiete‘, in welchen die serbische Polizei angegriffen wird. Das albanisch dominierte Presevo liegt unmittelbar an der Hauptverkehrsstraße von Belgrad nach Skopje. Ziel der UÇPMB ist es offensichtlich, den Konflikt anzuheizen, um die Staatengemeinschaft zum Eingreifen zu zwingen, wenn wieder Zehntausende Albaner vertrieben werden.“ (FAZ 10.3.)
Aber das kann natürlich nicht das letzte Wort sein. Die Nato dementiert jede Absicht, die serbische Hoheit völkerrechtswidrig zu verletzen, definiert aber die höheren Gründe, aus denen sie menschenrechtskonform eingreifen müsste, wenn …
„Ein amerikanischer Kfor-Offizier hat zuhanden der albanischen Guerillagruppe UÇPMB in Südostserbien klargestellt, dass Aufstandsbestrebungen nicht unterstützt würden. Die internationalen Truppen ließen sich nicht in Kampfhandlungen außerhalb Kosovos verwickeln. Eine Intervention könnte jedoch angezeigt sein, falls Zivilisten ermordet würden … In der 5-Kilometerzone darf nur serbische Polizei mit leichter Bewaffnung auftreten. Falls stärkere Verbände anfahren sollten, werde man alle nötigen Gegenmaßnahmen treffen, um das zu verhindern, betonte Snow.“ (NZZ 6.3.)
Die USA heben demonstrativ Waffenlager der UÇPMB aus, zum Beweis der garantierten Überparteilichkeit der USA, aus deren Zone heraus die Mannschaft agiert, und auch zur Klarstellung gegenüber der nach Serbien hinein verlängerten UÇK, dass sich die US-Truppen nicht instrumentalisieren lassen. Bald darauf steht in Umkehrung des Ausgangspunktes fest, wer bloß Vorwand und wer wirklicher Urheber der Gewalt in Südserbien ist:
„In den Razzien dokumentiert sich die wachsende westliche Sorge über albanische Extremisten, die nach Serbien einsickern und den jugoslawischen Streitkräften den Vorwand liefern, um die lokale Bevölkerung zu drangsalieren und einzuschüchtern. Im Presevo-Tal sind mindestens 60000 Albaner angesiedelt.“ (Guardian 17.3.)
Dann vollzieht die US-Diplomatie die bedingte Anerkennung der neuen Befreiungsarmee – wie sich die Bilder gleichen!
„Dort fanden sich die Kommandeure der UÇPMB nach langen Verhandlungen mit dem Führer der aufgelösten Befreiungsarmee Kosovo (UÇK), Thaci, und einem amerikanischen Diplomaten zum Gewaltverzicht bereit. Ein UÇPMB-Sprecher sagte, die Albaner im Presevo-Tal in Südserbien seien gegen eine bewaffnete Konfrontation mit den Serben. Die UÇPMB soll – wie ihr Vorbild UÇK im Kosovo – aufgelöst werden und in einer Art Rat für die Albaner im Presevo-Tal aufgehen. Man wolle eine politische Lösung des Konflikts erreichen… Dem Treffen in Gnjiljane war erheblicher Druck der Staatengemeinschaft auf Thaci und die UÇPMB vorausgegangen. Zudem hatten amerikanische Soldaten mit Razzien gegen Helfershelfer der UÇPMB im Kosovo und mit verschärften Kontrollen der Demarkationslinie zwischen Kosovo und Südserbien deutlich gemacht, dass sie die gefährlichen Aktivitäten der UÇPMB nicht dulden würden. Ob sich alle Kämpfer und lokalen Kommandanten der UÇPMB an die Verpflichtung zum Gewaltverzicht halten werden, steht freilich dahin… Schließlich bleibt die Frage, ob das Belgrader Regime überhaupt an einer Beruhigung der Lage in Südserbien interessiert ist. Bisher ist nur eine Seite – bzw. lediglich deren Führung – zum Gewaltverzicht bereit… Die politischen Vertreter der Albaner sind vorerst an das Referendum vom März 1992 gebunden. Damals hatte sich die Mehrheit der Albaner in den drei südserbischen Bezirken für die Forderung nach weitgehender Autonomie ausgesprochen – und auch einen späteren Anschluss an das Kosovo (das damals zwar noch serbische Provinz war, aber der Albaner denkt eben vorausschauend!) nicht ausgeschlossen.“ (FAZ 25.3.)
Angesichts der zunehmenden Spannungen im Grenzgebiet
zwischen Serbien und Kosovo
(FAZ
1.4.) hat der amerikanische Kommandeur der Zone
schon einmal Verstärkung durch Soldaten, Panzer und
Artilleriegeschütze angefordert, die Anfang April
eintreffen. Das ist eben der Vorteil der heutigen Lage im
Unterschied zur Aufbereitung des Schlachtfelds im Kosovo
mit Hilfe der UÇK vor einem Jahr: Nato-Militär steht
schon neben den Spannungen
. Die Auflage des
Friedensabkommens, nach der sich das serbische Militär
aus einer Sicherheitszone an der Grenze zurückziehen
muss, verschafft dem UÇK-Flügel Raum für seine Spannungen
– für die serbische Polizei ist es gefährlich, in
diesen Gebieten Kontrollfahrten zu unternehmen
(FAZ 6.3.) – und der Nato den
Rechtstitel, jede serbische Gegenwehr als
Vertragsverletzung zu definieren: Ein britischer
General hat mit militärisch-demonstrativem Aplomb eine
Inspektion in serbischem Gebiet jenseits der Grenze
vorgenommen… Vor wenigen Tagen hatten Kfor-Posten
serbische Truppenbewegungen mit schweren Fahrzeugen in
Grenznähe festgestellt…
(NZZ
31.3.)
Die kritische Öffentlichkeit reicht gerade, passend zum
Jahrestag des Beginns der Bombardierungen, die
aufklärerischen Nachträge zum letzten Krieg nach:
Berichte über das gefälschte Massaker von Racak,
offiziöse Zweifel an der überhauptigen Existenz des
Hufeisen-Plans, mit dem vor allem Scharping die
Nato-Angriffe gerechtfertigt
(FAZ 24.3.) hatte, die von Scharping
völlig passend zurückgewiesen werden – wozu brauchen wir
eigentlich noch Beweise?! Währenddessen wird an der neuen
Front genau dasselbe Szenario eröffnet: erst demonstrativ
bekundeter eigener Wille zur Zurückhaltung, dann
Drohungen an die Adresse des Gegners, sich jeder Gewalt
zu enthalten, dann die Feststellung unerträglicher
Provokationen der anderen Seite, auf die man schließlich
reagieren muss. Auch die Öffentlichkeit
registriert bass erstaunt, dass es schon wieder genauso
aussieht. Das liegt aber keineswegs am unerschütterlichen
Willen der eigenen Seite, die serbische Hoheit in die
Schranken zu weisen; das liegt am Starrsinn von Milosevic
– schließlich wissen wir alle, dass er vom Krieg lebt!
Euro-atlantische Streitigkeiten
Was ihr Protektorat angeht, haben die Besatzungsmächte feststellen müssen, dass den Krieg zu gewinnen und nachher einen irgendwie befriedeten Zustand zu garantieren, zwei verschiedene Sachen sind. Mit ihrem Erfolg haben sie sich aber das Problem geschaffen, wie sie ihre Zuständigkeit für die Provinz wahrnehmen und was sie dafür leisten wollen, die Lage haltbar zu machen. Auf diese Frage wissen die USA seit neuestem die passende Antwort: Der Krieg und dessen Erfolg ist voll und ganz Verdienst und Leistung der USA. Aber dass der Frieden im Kosovo nicht funktioniert, das geht voll und ganz auf das Konto der EU; die leistet und zahlt nicht genug für die Organisation von so viel Staats- und Wirtschaftsleben im Kosovo, dass die Provinz einigermaßen kontrollierbar wird. Zwar hat keine der an der Kriegsallianz beteiligten Mächte ernstlich eine Kalkulation angestellt, wie die Aufräumarbeiten nach dem Krieg aussehen sollten; und es war auch nie etwas davon zu hören, dass sich die USA und die EU gewissermaßen auf eine Arbeitsteilung geeinigt hätten, in der Amerika für den militärischen Teil und die EU für die Nachkriegsbetreuung zuständig sein sollte. Aber die gemeinsame Unzufriedenheit mit dem eroberten Aufsichtsobjekt taugt aus amerikanischer Sicht hervorragend dazu, die von Europa aus beanspruchte Handlungsfähigkeit und -freiheit unter Beschuss zu nehmen. Der Vorwurf trifft nämlich – auf das konkurrierende europäische Bemühen, bei der Regelung der Nachkriegslage die europäische Befähigung zur Ordnungsmacht unter Beweis zu stellen. Deswegen haben sich die europäischen Nato-Partner, Deutschland vorneweg, für die Friedensarbeit ganz besonders zuständig erklärt und entsprechende Positionen besetzt. Gegen diese Ambitionen ziehen die USA jetzt diplomatisch zu Felde. Die amerikanische Regierung, die genauso wenig wie die EU auch nur entfernt daran denkt, den Balkan als einen Fall für Entwicklungshilfe zu behandeln, zeigt sich deshalb brennend daran interessiert, dass sich die EU ihr Engagement auch genügend kosten lässt, und konstatiert prompt: Fehlanzeige! Die US-Außenministerin definiert das Kosovo-Dilemma ausdrücklich als europäisches, legt die EU-Mächte darauf fest, die nötigen Unkosten zu tragen, und rechnet ihnen ihre mangelnde Leistungsfähigkeit vor. Sie verspielen die amerikanischen Kriegserfolge:
„Washington fordert, dass die EU-Staaten bei der kommenden Geberkonferenz endlich Cash herausrücken. Es sieht danach aus, als würde vor aller Öffentlichkeit ein Test auf den Widerspruch zwischen Rhetorik und Wirklichkeit angestellt – und die transatlantischen Spannungen wachsen. In einem scharfen privaten Brief an die EU-Außenminister sagte Albright 350 Millionen Dollar für „Quick-Start“ und „First priority“-Projekte zu und ungefähr 400 Millionen für das nächste Jahr – warnte allerdings, dass die Auszahlung dieser Summen davon abhängt, was andere Nationen zu spenden bereit seien. ‚Wir sind höchst interessiert, im Einzelnen zu erfahren, welche Verpflichtungen Sie zu übernehmen bereit sind‘, fügte Albright bissig hinzu … England, Belgien und Spanien haben ihre ursprünglichen Zusagen im Rahmen des Stabilitätspakts nicht eingehalten… Montenegro… ist wahrscheinlich ein wichtiger Testfall für die westliche Entschlusskraft. Weil es noch Bestandteil der jugoslawischen Föderation ist, kann die bergige Republik keine Weltbank- oder IWF-Kredite erhalten. EU-Hilfe ist also entscheidend, wie Mrs. Albright erklärte.“ (Guardian 14.3.)
„Es sei unhaltbar, die Kfor-Soldaten weiter zur Erfüllung ziviler Aufgaben einzusetzen. Albright wies darauf hin, dass bisher erst 3000 der vorgesehenen 4 700 Polizisten im Kosovo im Einsatz seien. Sie bat die Regierungsvertreter, die nach dem Krieg zugesagte Finanzhilfe zu erhöhen und weitere Polizisten in die serbische Provinz zu schicken… Albright sagte, Washington sei in Sorge, dass die EU, die sich um eine einheitliche Außen- und Sicherheitspolitik bemühe, nicht mit einer Stimme spreche. Das Kosovo sei der wichtigste Test für die EU, eine Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben, die auch effizient sei.“ (SZ 20.3.)
Entweder Europa übernimmt gefälligst die notwendigen
Lasten, oder es blamiert sich mit seinem Anspruch auf
einen europäisch dominierten Balkan-Hinterhof. Die
US-Provokation wird in Europa bestens verstanden, weil
man selber die Aufgabe genauso definiert hat. Europa
erklärt seine Bereitschaft, sich verstärkt zu engagieren.
Damit will man sich auch des amerikanischen Beitrags und
der weiteren gemeinsamen Betreuung der Region versichern.
So kommt dann auf der „Geber-Konferenz“ eine Einigung auf
gewisse Projekte zustande, die ganz dem Frieden
verpflichtet sind: Grenzüberschreitende Transportwege
und andere Infrastruktur-Projekte stehen im
Stabilitätspakt an erster Stelle; dem liegt die Idee
zugrunde, dass Länder, die miteinander Handel treiben,
nicht ohne weiteres gegeneinander Krieg führen
werden.
(Guardian 14.3.)
In diesem Sinne nimmt man die verkehrstechnischen Schwachstellen in Angriff, die das Embargo gegen Rest-Jugoslawien verursacht, und treibt damit dessen Isolierung voran. Nachdem das Land, das ja bekanntlich nur „Krieg führen“ und keinen „Handel treiben“ will, mitten auf dem Balkan liegt, wird einiges zu seiner Umgehung geplant. In Kroatien wird das Autobahnnetz ausgebaut. Albanien kommt in den Genuss einer Eisenbahnlinie über Mazedonien nach Bulgarien bis ans Schwarze Meer. Rumänien und Bulgarien werden mit einer Donaubrücke versorgt, für die serbischen Donaubrücken gibt es dagegen kein Geld. Montenegro wird mit der Herrichtung seiner Verkehrswege in Richtung Kroatien und Albanien und dem Neubau einer Stromleitung nach Albanien bedacht, um es vom Zwang zu befreien, weiter mit Serbien „Handel treiben“ zu müssen. Und im Kosovo werden die Straße zur mazedonischen Grenze und der Grenzübergang ausgebaut; im letzten Krieg hat man schließlich gelernt, wie wenig die lokale Infrastruktur für die Nato-Logistik geeignet ist, und auch der Frieden benötigt praktikable Verkehrswege für den Nato-Nachschub.
Was das Kosovo betrifft, leuchtet Europa der Vorwurf mangelnder imperialistischer Leistungsfähigkeit nur zu gut ein und es verspricht auf seine Weise Abhilfe zu schaffen: Die Waffenbrüderschaft mit den USA soll um eine europäische Spezialtruppe ergänzt werden, um Europas Gewicht beim Aufsichtswesen dauerhaft zu stärken.[4] Was dort gebraucht wird, ist eine Besatzungstruppe. Die soll zwar nicht so heißen, sondern als Friedenstruppe gelten. Aber solange die Kfor das Kosovo regiert und Bedarf an Kontrolle und Einschüchterung auch gegenüber unseren albanischen Flüchtlingen vom letzten Jahr besteht, ist eine spezielle Mannschaft für die Aufrechterhaltung der Ordnung unerlässlich, nicht zuletzt deshalb, um dem Militär den Rücken für seine eigentlichen Aufgaben frei zu halten.
Fazit: Warum der Balkan „nicht zur Ruhe kommt“
Die beteiligten Aufsichtsinstanzen haben also alle Hände voll zu tun mit den Anforderungen, die ihnen aus ihrer imperialistischen Mission erwachsen. Weil sie keine Grundlagen für ein neues tragfähiges Gewaltmonopol schaffen, sondern nur das, das allenfalls existiert hat, untergraben haben und weiterhin bekämpfen, weil sie also das Gegenteil einer haltbaren staatlichen Ordnung stiften, wird ihr gewaltsames Kommando auch nicht überflüssig. Die eigene Präsenz als Ordnungsmacht ist dauernd verlangt, und der Bedarf nach entschiedenem Durchgreifen erneuert sich laufend. Ohne eigene Gewalt kommt nichts zustande; mit ihr alleine aber auch nichts rechtes. Das ist die Konsequenz davon, dass die Freunde menschenrechtlichen Eingreifens außer dem Interesse, die Machtverhältnisse auf dem Balkan zu kommandieren, keine Gesichtspunkte verfolgen, die einen Einsatz für eine zivile Ordnung und irgendwelche ökonomischen Benutzungsverhältnisse lohnend machen würden.
Daher empfinden die Nato-Mächte, die beim Krieg keinen Aufwand gescheut haben, ihre heutige Mission als eine einzige Last. Was sie den Nationalisten vor Ort mit ihrem Aufsichtswesen zumuten, das stellt sich für sie als Ungehorsam und Undankbarkeit seitens der Aufsichtsobjekte dar. Und bei der Beratung darüber, wie dem unerträglichen Missstand abzuhelfen sei, legen sie sich wechselseitig auf eine verbesserte Fortführung ihres Aufsichtswesens fest. Dabei fällt den einen unter den Exporteuren von Menschenrechten auf, dass die anderen ihre Pflichten vernachlässigen, und den anderen fällt ein, dass sie viel zu wenig Aufsichtsrechte haben. In diesem Geist konkurrieren die Nato-Partner – um eine national zufrieden stellende Verteilung der beiden Seiten des Widerspruch ihres Unternehmens. Sie bemühen sich, die für nicht lohnend befundenen Lasten der Aufsicht nach Möglichkeit den anderen aufzunötigen, sich selber aber möglichst viel Zuständigkeiten zu sichern, also nur die Aufwendungen zu übernehmen, die, wenn sie schon nicht für eine brauchbare Ordnung taugen, wenigstens den eigenen Einfluss vergrößern. Für Unzufriedenheit unter den Veranstaltern des Friedens ist also reichlich gesorgt, und sie mündet konsequent in die Frage nach dem eigenen Gewicht in diesem erlauchten Kreis. Dass die versammelten Friedensstifter bei diesem „Ringen um eine Nachkriegsordnung“ nicht die Parteien vor Ort befragen, ist nur gerecht. Denn wer die Richtlinienkompetenz in Sachen Weltaufsicht ausstreitet, macht zwar eine Region dauerhaft zum „Pulverfass“, orientiert sich aber deswegen noch lange nicht an den nützlichen Idioten und Opfern seines Eingreifens.
[1] Ein paar
unfreiwillige Eingeständnisse, was die ehemalige
kommunistische Schreckensherrschaft betrifft, kommen
bei der Besichtigung des kosovarischen Arbeitsmarkts
auch vor: Währenddessen muss der neue Fernsehsender
die Forderungen eines Komitees ehemaliger (albanischer)
Rundfunkangestellter abwehren, die wieder 1600 Menschen
angestellt sehen wollen – wie zu
friedlich-sozialistischen Zeiten, als es noch 2
Orchester, einen Fahr- und Gebührendienst gab.
(Die Zeit 23.3.)
[2] Deutschland kümmert
sich auch auf anderen Gebieten rührend um den
entwicklungspolitischen Bedarf des Kosovo, wie der
Debatte um die Abschiebungen zu entnehmen ist: Knapp
die Hälfte von 400000 Kosovo-Albanern in Deutschland
sind abgelehnte Asylbewerber. Sie sollen von Ende März
an zurück geschickt werden… Dies ist heute möglich,
trotz aller Gewalt, die dort herrscht. Denn die Gewalt
konzentriert sich auf bestimmte Brennpunkte, vor allem
auf die Stadt Mitrovica. Und sie richtet sich gegen
bestimmte Volksgruppen – die Minderheiten der Serben
und Roma… man mag kein Serbe mehr sein im Kosovo. Den
Albanern jedoch droht grundsätzlich keine Gefahr bei
der Heimkehr, es sei denn, sie werden als
Kollaborateure verfolgt
. Ja dann, wenn die Gewalt
nur gegen Serben und Roma geht, dann können wir guten
Mutes abschieben! Und genügen damit auch noch einer
entwicklungspolitischen Pflicht und Schuldigkeit:
Und vor allem kann es sich auch der kleine Kosovo
mit seinen 2 Millionen Einwohnern auf Dauer nicht
leisten, dass fast jeder zehnte Bürger in einer
unsicheren Warteposition in Deutschland verharrt. Die
Aufgabe der Kosovaren ist es nun, ihr Land wieder
aufzubauen. Geboten wird ihnen dafür internationaler
Schutz und internationale Hilfe. Was sie liefern
müssen, ist nationale Solidarität.
(Peter Münch, SZ 17.3.)
[3] Dass die Nato eine
Konfrontation mit Thacis Mannschaften nicht überleben
könnte, ist ein bißchen übertrieben. So rührt die
Mißstimmung zwischen dem französischen Militär und
Protektoratschef Kouchner ja offenkundig daher, daß die
an der Frontlinie in Mitrovica eingesetzte Truppe nicht
einsehen will, warum sie sich bei ihrer
Ordnungsstiftung gegenüber der albanischen Seite
Zurückhaltung auferlegen muss, auch wenn die sich
mindestens so störend bemerkbar macht wie die
serbische. ‚Krieg‘ zwischen Kouchner und der
französischen Armeeführung… Dokumente, in denen
französische Kfor-Offiziere ihren Ärger zum Ausdruck
brachten. Kouchner sei ‚antiserbisch‘ eingestellt und
setze sich übermäßig für die Albaner ein. Ein leitender
französischer Offizier warf Kouchner vor, keine ‚klaren
Ideen‘ zu haben und ständig die Serben für Mißstände
verantwortlich zu machen.
(FAZ
3.4.) Auch der Streit zwischen Kouchner und dem
Innenminister hat weniger mit einer proserbischen
französischen Linie zu tun, wie die deutsche Presse
prompt hetzt, als damit, dass Chevènement – wie die
anderen Innenminister übrigens auch – nicht recht
einsieht, Polizisten für einen Job abzukommandieren,
bei dem es sich nicht gerade um Polizeiarbeit im
üblichen Sinn handelt. Kouchner: Alle wichtigen
Länder haben sich an die Abmachung gehalten und
Polizisten zur Verfügung gestellt. Nur Frankreich
nicht.
Chevènement: Ich bin mir nicht sicher,
dass es nützlich ist, Polizisten in eine Region zu
senden, in der auf Soldaten geschossen wird. Hier in
Roubaix sind die Polizisten nützlicher.
(FAZ 17.2.)
[4] Auf diesem Gebiet hat England seinen Euro-Kollegen ein Stück praktische Erfahrung voraus und kann auf die Erfolge der Truppe verweisen, die das nötige „Training“ in Nordirland hinter sich hat: „Patten: Ich denke, das Problem der Polizeiarbeit im Kosovo unterstreicht einen Mangel, den wir in Europa haben – wahrscheinlich nicht nur in Europa. Ein Mangel bei unserer Fähigkeit zur Krisenregelung und zur Konfliktverhinderung, und das ist die Fähigkeit, Kräfte zum Einsatz zu bringen, die irgendwo zwischen der normalen Polizei und Militärpräsenz angesiedelt sind. Humphrys: Paramilitär? Patten: Ja… gewissermaßen so etwas wie die RUC (Royal Ulster Constablery)… Die RUC, das muss einmal gesagt werden, hat Leute in das Kosovo geschickt und leistet dort sehr gute Arbeit. Sie sind besser trainiert für die Aufgaben, die in der gegenwärtigen Situation im Kosovo anfallen. Sie haben Erfahrung im Umgang mit Problemen der inneren Sicherheit, sie haben Erfahrung im Umgang mit Schußwaffen, sie besitzen tatsächlich mehr von den Fähigkeiten, die aktuell nötig sind. Und wenn wir als Europäer uns darauf einstellen müssen, für ein Krisenmanagement nicht nur mehr militärische Kräfte zu stellen, sondern auch mehr nicht-militärische Kräfte, dann müssen wir uns mit diesem Problem der Polizeiarbeit befassen. Denn das ist zur Zeit eine wirkliche Lücke. Wir haben mehr Polizisten in das Kosovo geschickt, England hat das getan, Spanien und Deutschland haben angekündigt, dass sie es tun werden, aber es ist schwierig, ich wiederhole das noch einmal, die Qualität von Polizeikräften zu finden, die dort gebraucht wird.“ (BBC-Interview 27.3.)