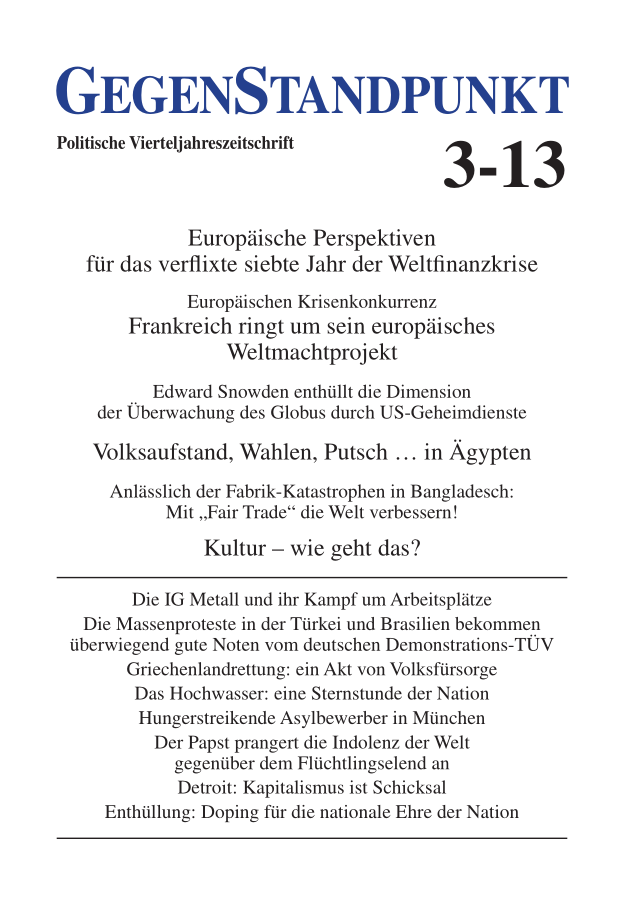Noch ein Aktivist und Leidtragender der europäischen Krisenkonkurrenz
Frankreich ringt um sein europäisches Weltmachtprojekt
Die Weltfinanzkrise hat inzwischen in Europa – in unterschiedlichem Maß – die Staaten beschädigt. Die Masse an Euro ist, das ist kein Geheimnis, kein Ausweis gelungener kapitalistischer Geschäfte. Sie verdankt sich hoheitlicher Kreditmacht, die die fallierenden Vermögen der Banken gerettet hat. Im Gefolge davon leiden viele Euro-Staaten unter einer untragbaren Schuldenlast und drohen ihren Kredit zu verlieren. Mindestens genauso bzw. in ihren Augen viel mehr leiden sie allerdings im Europa des gemeinsamen Geldes an der von Deutschland als Konkurrenzgewinnler in Europa dominierten Krisenpolitik. Schon gleich die zweite Führungsmacht, Frankreich sieht sich in seinem Europa-Programm durch Deutschland betroffen und herausgefordert. Frankreichs Europa-Politik zielt nämlich seit je auf eine weltpolitische Machtrolle Europas unter der Regie Frankreichs in Alternative zum Projekt einer europäischen Wirtschaftsmacht unter deutsche Führung. Dafür braucht und strapaziert die ‚Grande Nation‘ ihren Kredit, plädiert für einen freieren hoheitlichen Gebrauch staatlicher Kreditmacht und das alles mit der Perspektive, Europa durch die Wahrnehmung militärischer ‚Verantwortung‘ als ein globales Machtzentrum zu etablieren. Damit stößt Paris an die Schranken einer deutschen Krisenpolitik, die die Staaten auf ‚Solidität‘, die Beglaubigung ihres Kredits durch das Finanzkapital, und damit auf eine restriktive Haushaltspolitik festlegt, die sich strikt an dessen Ansprüchen ausrichtet. Und seine europäische Machtambition beißt sich an einem Deutschland, das sich strategisch nach wie vor am Bündnis mit den USA ausrichtet.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Das französische Europa-Programm: der Aufstieg zur Führungsmacht mit und gegen Deutschland
- Französische Waffen im Dienst der europäischen Emanzipation von der US-Vormundschaft
- Eine mühsame Aufgabe: Deutschlands Einhegung und Anwerbung für den französischen Antiamerikanismus
- Eine neue Herausforderung: die Einbindung des größer gewordenen Deutschland
- Das bleibende strategische Leiden: Die deutsche NATO-Räson entwertet Frankreichs Status als militärische Führungsmacht in Europa
- Die wenig taugliche Alternative: Kriegskooperation mit dem britischen Juniorpartner Amerikas
- II. Die ökonomische Basis des französischen Machtprogramms: die Erfolgsgeschichte der EU-Binnenkonkurrenz
- III. Die Gefährdung der französischen Führungsrolle durch die Krise und die deutsche Krisenpolitik
Noch ein Aktivist und Leidtragender
der europäischen Krisenkonkurrenz
Frankreich ringt um sein europäisches
Weltmachtprojekt
Eine deutsche Regierungspartei erklärt auf ihrem Parteitag, assistiert von der Öffentlichkeit, Frankreich ausdrücklich „zum Problem“, weil der Chef des Landes ein „autoritätsarmer Zauderer“ ist, der zu viele Schulden macht, Frankreich nicht die nötigen „Strukturreformen“ aufherrscht, die dem verwöhnten Volk endlich konkurrenzfähige Sozial- und Lohnkosten bescheren, die Rezession beenden und den „schleichenden Niedergang Frankreichs“ aufhalten.
Die sozialistische Partei des Präsidenten kritisiert im Gegenzug die Kanzlerin scharf für ihren „egoistischen Starrsinn“, der nur an „deutsche Bilanzen und die nächsten Wahlen denkt“, und die französische Presse von Libération bis Figaro stellt sich einträchtig vor die deutsche Kanzlerin, wegen der „Gefährlichkeit“ eines deutsch-französischen Zerwürfnisses „für den Zusammenhalt Europas“. Während sich der französische Präsident von Deutschland und der EU bei aller notwendigen Haushaltskonsolidierung „mehr Wachstumspolitik“ gegen die Arbeitslosigkeit wünscht, wird der Ton, begleitet von Demonstrationen der Eintracht, immer wieder ein wenig giftig zwischen den Führungsmächten der EU. Von der prinzipiellen deutsch-französischen Gemeinsamkeit, die bis gestern noch als unverzichtbar für den Fortgang der europäischen Einigungsbewegung galt, ist nicht viel übrig. In beiden Ländern besteht aber weiterhin Einigkeit, dass man für den Fortbestand von Union und Euro aufeinander angewiesen ist.
I. Das französische Europa-Programm: der Aufstieg zur Führungsmacht mit und gegen Deutschland
Immerhin ist der Adressat der drängenden deutschen Anträge die zweite Führungsmacht der EU. Die beansprucht von jeher, als maßgebliches Subjekt für das europäische Projekt einzustehen und den Erfolg der Union mit zu garantieren. Nun ist die Nation in einem Zustand, in dem sie selbst und andere bezweifeln, ob sie es überhaupt vermag, die Bedingungen dieses Erfolges zu setzen, von dem sie die eigene imperialistische Zukunft in und mit Europa abhängig gemacht hat; ob Frankreich nicht immer mehr in eine Lage gerät, die seinem Status nicht angemessen ist und unvereinbar mit dem Weg zu einer französisch geführten europäischen Weltmacht. Auf dem sind die Franzosen aber seit der Neueröffnung der Staatenkonkurrenz nach dem Krieg schon viel zu weit – und ihrer Auffassung nach keineswegs erfolglos – fortgeschritten, als dass die staatstragenden politischen Lager ihn sich von einer Finanzkrise und deutschem Fiskalfundamentalismus verlegen lassen wollten. Damals haben die Führer Frankreichs im Bestreben, der Nation eine unanfechtbar selbständige Position zu sichern, ihr Land zwar auf der Seite der Sieger, aber als zu klein vorgefunden, um in der Konkurrenz der feindlichen Weltmachtblöcke selbständig eine bestimmende Rolle spielen zu können. Daraus hat Frankreich mit Blick auf sein künftiges Schicksal in einer neu sortierten Welt militär- und politstrategische Konsequenzen gezogen.
Französische Waffen im Dienst der europäischen Emanzipation von der US-Vormundschaft
Schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts legt sich das Land in einer gewaltigen Anstrengung des französischen Kredits als nicht übergehbare Bedingung „nationaler Unabhängigkeit“ ein eigenes Atomwaffenarsenal – force de dissuasion nucléaire, vulgo force de frappe – zu und baut dieses über Jahrzehnte auf geschätzte zweihundertfünfzig land-, see- und luftgestützte Sprengköpfe aus. Der Bestand an nuklearen Waffen dient erklärtermaßen dazu, Frankreich eine ungeteilte nationale Abschreckungskapazität außerhalb der strategischen Berechnungen der NATO zu sichern und die Abhängigkeit von den USA in den Fragen von Krieg und Frieden zu verringern. Die Dominanz der USA in der NATO und deren Rücksichtslosigkeit gegenüber französischen Interessen hält Präsident de Gaulle 1966 dann endgültig für unvereinbar mit einer wirklich nationalen Atomstrategie: Frankreich bleibt zwar Mitglied im antisowjetischen Kriegsbündnis, tritt aber aus dem „integrierten Militärkommando“ des Bündnisses aus.
Politisch ist Frankreich einer der Hauptinitiatoren der „europäischen Einigungsbewegung“. 1958, im Jahr des Inkrafttretens der Römischen Verträge zur Gründung der EWG, erklärt es offiziell seinen Status als Atommacht und ist von Beginn an die militärische Vormacht der Gemeinschaft. Diese Stellung stützt sich nicht nur auf die nationale Atomwaffe, sondern auf die französische Bereitschaft und Fähigkeit, den nationalen imperialistischen Anspruch im Umfeld seiner Kolonien – bzw. dessen, was davon nach der Entkolonialisierung als seine „speziellen Einflussgebiete“ übrig geblieben ist – und darüber hinaus so geltend zu machen, wie es sich für eine Macht mit Sitz im Weltsicherheitsrat gehört. Auf dieser Grundlage sieht Frankreich sich als geborener Inhaber auch der politischen Führerschaft des zukunftsträchtigen Vereins, der den Ambitionen der französischen Machtentfaltung als strategisches Umfeld und politische wie ökonomische Grundlage dienen soll.
Bei aller innereuropäischen Sonderstellung als Atommacht und Mitglied des Weltsicherheitsrates, die nach französischer Auffassung ganz von selbst die Richtlinienkompetenz für den Weg der Gemeinschaft verleiht, versäumt Frankreich nie darauf hinzuweisen, dass seine atomare und konventionelle Militärmacht auch als europäische zu verstehen sei und den Kern einer künftigen, irgendwann auch gemeinschaftlichen Militärmacht mit Weltgeltung bilden soll. Denn das ist für Frankreich seit den Anfängen der EWG bis heute eine unumstößliche imperialistische Richtlinie: Der schönste gemeinsame Markt, die wuchtigste kapitalistische Akkumulation und der feinste nationale und supranationale Kredit taugen auf Dauer nichts, wenn die zuständige politische Gewalt nicht für den Ausbau der militärischen sorgt. Mit der allein kann sie in letzter Instanz die Einspruchstitel anderer Staaten entwerten und eigenen Rechten, die sich mit ihrem kapitalistischen Ausgreifen vervielfachen, Geltung verschaffen. Dass Frankreich Europa damit auf das Feld der Machtkonkurrenz mit den USA führt, ist unvermeidlich und soll so sein: Die Mitglieder der EU müssen einsehen, dass ihre Souveränität ebenso wie die eines neuen weltpolitischen Subjekts Europa mit der Unterordnung unter die USA nicht vereinbar ist – so viel Antiamerikanismus muss sein. Aus französischer Sicht stellt sich die Sache mit Europa ganz alternativlos dar: Will Frankreich sich dauerhaft als Macht auf Augenhöhe mit den USA etablieren, dann bleibt ihm nur die Chance, die im Aufbau einer auf Frankreich hin orientierten europäischen Machtbasis liegt.
Eine mühsame Aufgabe: Deutschlands Einhegung und Anwerbung für den französischen Antiamerikanismus
Dass das nicht ohne Einvernehmen mit den europäischen Ambitionen der wachstumsstarken deutschen Exportnation, dem kapitalistischen Schwergewicht Nachkriegseuropas bis heute, ins Werk zu setzen ist, hat bekanntlich die deutsch-französische Freundschaft stark befördert. Für das franko-europäische Projekt ist eine Instrumentalisierung Deutschlands und seiner ökonomischen Potenzen unverzichtbar und seine Einbindung in die projektierte Entwicklung zur antiamerikanischen Gemeinschaftsgroßmacht notwendige Bedingung des Gelingens. So versteht sich die große Nation dazu, den Deutschen zu verzeihen, dass sie auf dem Schlachtfeld nur dank der ungeliebten Amis und Bolschewisten und nicht eigenhändig besiegt wurden, reicht ihnen über den Gräbern der alten Erbfeindschaft die Hand zu künftig gemeinsamen Unternehmungen und adelt das neue imperialistische Duo zur europäischen Doppel-Friedensmacht.
Die politische und militärische Betreuung und Bearbeitung deren deutscher Hälfte stellt sich fortan und bis zum heutigen Tag für die französische Seite als Daueraufgabe dar.
Die französische Führung betreibt die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft von Anfang an mit der Perspektive strategischer Machtkonkurrenz mit Amerika und lanciert schon 1952 einen Plan zur Gründung einer europäischen Armee, getragen von Frankreich, Deutschland und den Benelux-Staaten, im Rahmen einer „Europäischen Verteidigungsgemeinschaft“, die von Deutschlands Konservativen wegen des damit verbundenen vorzeitigen Endes des Besatzungsstatuts und der Chance zur „Wiederbewaffnung“ unterstützt wird. Nach dem Scheitern dieser Initiative im französischen Parlament - wegen Bedenken der Gaullisten, ob eine ausreichende Kontrolle über die nationalen Streitkräfte im Rahmen einer Gemeinschaftsarmee wirklich gewährleistet sei - wird Deutschland im Zuge seines NATO-Beitrittes wieder zu einer bewaffneten Macht. Seitdem stoßen neue französische Bemühungen um eine europäische Streitkraft, etwa im Rahmen der WEU oder der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP), beim großen europäischen Nachbarn auf den ambivalenten Bescheid, dass der „wirtschaftliche Riese“ im „Zentrum Europas“ zwar die Perspektive von mehr weltpolitischer Eigenständigkeit Europas teilt, dass ihm das französische Leiden an der Unterordnung unter die US-Weltmacht aber demonstrativ fremd ist und er von einem unverträglichen Gegensatz zwischen Souveränität und Gefolgschaft gegenüber USA und NATO nichts wissen will. In den Zeiten des globalen Blockgegensatzes ist Deutschland für ernsthafte Schritte in Richtung einer „europäischen Verteidigungsidentität“ und einer Lockerung seiner NATO-Mitgliedschaft überhaupt nicht zu haben. Denn auf die Zugehörigkeit zum stärksten Kriegsbündnis der Geschichte stützt die BRD ihre politische Bedeutung: die eines, auch wegen seines wichtigen militärischen Bündnisbeitrags und seiner Bündnistreue, anerkannten imperialistischen Frontstaates. Der erwirbt sich in der Konfrontation mit dem feindlichen Block eine Anwartschaft auf die Revision eines Kriegsergebnisses, die nur mit dem Wohlwollen des amerikanischen Lagers erfolgen kann – die Rückabwicklung der deutschen Teilung, sei es in einem neuen Krieg gegen die Sowjetunion, sei es auf dem Verhandlungsweg, der sich dann unvermutet durch die Selbstaufgabe des feindlichen Blocks auftut.
Eine neue Herausforderung: die Einbindung des größer gewordenen Deutschland
Nach dem Wegfall der Konfrontation mit dem östlichen „Systemfeind“ und dem Anschluss der DDR, den Frankreich zunächst eher mit zögerlichem Misstrauen begleitet, sieht die Regierung in Paris eine neue Gelegenheit, aber auch eine neue Dringlichkeit, das größer gewordene Deutschland für die Entwicklung eines imperialistischen europäischen Standpunkts anzuwerben und es gerade wegen seines erwartbar weiter wachsenden politischen und ökonomischen Gewichts in diese Entwicklung einzubinden: Aus französischer Sicht bräuchte Deutschland nach dem Ende der permanenten Weltkriegsdrohung die übereifrige und alternativlose Integration in die NATO nicht mehr als sein militärstrategisches und politisches Lebensmittel und hätte damit neue Handlungsfreiheit für den Aufbau Europas als wichtiger Mitspieler einer neuen, postsowjetischen, nicht mehr nur amerikanisch dominierten Weltordnung gewonnen. Damit sollte auch das anmaßende Hineinregieren der sich nach Osten erweiternden NATO und der USA in die Angelegenheiten der EU beendet werden, der aus diesen Kreisen immer wieder nicht bestellte Empfehlungen zur dringend erwünschten Aufnahme osteuropäischer Länder zugehen. Obwohl sich nach französischer Auffassung deutsche Souveränität mit einer subalternen Existenz am After der Supermacht so wenig vertragen sollte wie französische, den Deutschen der Weg der Emanzipation von der selbstsüchtigen US-Weltmacht unter europäisch-französischer Anleitung also willkommen sein sollte, begegnen die deutschen Adressaten den Angeboten aus Paris zum Aufbau eines gemeinsamen praktischen Gewaltstandpunktes der Union gegenüber dem Rest der Welt immer wieder auf „halbherzige“, wenn nicht sogar obstruktive Weise:
Deutsche Politiker geben bei Gelegenheit zwar durchaus zu erkennen, dass solche Überlegungen auch bundesrepublikanischen Staatsmännern geläufig sind, und lassen verlauten, man brauche auf Dauer schon eine „unabhängige europäische Atommacht“, sparen sich aber auch nicht den Hinweis auf die dann fällige Enteignung der französischen Atomwaffen: In so einem Fall müsse es endgültig aus sein mit einer „autonomen Atompolitik“ Frankreichs, weil die mit einer „europäischen Verteidigungsidentität unvereinbar“ sei (so z.B. CDU-Lamers und Schäuble im Jahr 1995). Und die praktischen französischen Anstrengungen, mit militärischem Einsatz eine europäische strategische Führungsrolle im Bosnienkrieg zu erobern, werden von Berlin untergraben. Als Paris und London mit einer französisch-englischen Eingreiftruppe den Serben klarmachen wollen, dass Europa seine berühmte Friedensordnung auch militärisch auszuweiten gedenkt und unwilligen Resten des zerlegten Jugoslawien, vor allem den Serben, mit Waffengewalt der Weg zur Unterordnung unter das „europäische Kraftzentrum“ EU als „Option“ für die Zukunft gewiesen werden soll, da will die deutsche Führung von der stellvertretend von Frankreich und Großbritannien auf dem Balkan wahrgenommenen „Verteidigungsidentität“ Europas dann doch nichts wissen: Sie boykottiert diesen Versuch einer europäischen Ordnungsstiftung ihrer innereuropäischen Konkurrenten, stellt sich auf die Seite der überlegenen amerikanischen Waffen und zeigt sich solidarisch mit den USA, die nichts anderes als die bedingungslose Kapitulation oder eine Zerstörung Serbiens per Luftkrieg zulassen wollen. Damit wird die von Frankreich und Großbritannien reklamierte Zuständigkeit dementiert und das französisch-britische Eingreifen blamiert. Im zweiten Irakkrieg – am ersten hatte Frankreich noch mit einem eigenen Kontingent teilgenommen – kommt es einmal zu einer gemeinsamen Haltung zwischen Deutschland und Frankreich, die sich beide von der durch Präsident Bush eingeforderten „Koalition der Willigen“ fern halten: Deutschland mit ausdrücklicher Ablehnung, Frankreich mit der Androhung eines Veto gegen eine legitimierende Resolution des Weltsicherheitsrates, ohne dass aus dieser antiamerikanischen Solidarität irgendein Schub für die von Frankreich so vermisste europäische Kriegs-Union ausgegangen wäre.
Auch die ebenfalls Mitte der 90er Jahre unter Chirac begonnene und von Sarkozy abgeschlossene „Wiederannäherung Frankreichs an die NATO“ bringt nicht den erhofften Fortschritt in der Angelegenheit. Frankreich begründet den Schritt schon 1995 mit der „als unzureichend empfundenen Unterstützung“ europäischer Verteidigungsbemühungen, beginnt deswegen, den Weg zu einer europäischen Militärmacht durch Veränderung der NATO „von innen heraus“ zu verfolgen: Es macht sich für eine „Stärkung des europäischen Pfeilers“ in der NATO stark, und spekuliert sogar – auch wegen der Knappheit der Mittel – auf die Verfügbarkeit von NATO-Ressourcen für eine separate europäische „Sicherheitspolitik“. Sarkozy erklärt Frankreichs Rückkehr in die NATO-Organisation zu einem „wichtigen Element der deutsch-französischen Freundschaft“. Auch Hollande will den Schritt nicht rückgängig machen, äußert aber Zweifel, ob der wirklich einen Vorteil für „eine stärkere europäische Verteidigung“ darstellt, will aber jedenfalls auch und vor allem dieses europäische Vorhaben „mit neuem Schwung vorantreiben“. Die umworbenen „deutschen Freunde“ weisen das französische Vorhaben nach wie vor nicht offen zurück, beharren aber kühl darauf, keine „doppelten Strukturen“ oder „Konkurrenzmodelle“ zur NATO zu wollen, und torpedieren es damit, so dass es wieder einmal gar nicht erst in Fahrt kommt. Sogar ein „eigenwilliger Vorschlag“ von Sarkozy kann „nach SPIEGEL-Informationen“ (Spiegel-online, 15.9.07) die Deutschen nicht umstimmen: Wenn schon die Force de Frappe auch Deutschland beschütze, könne Deutschland sich doch auch an der „Entscheidungsgewalt über die Atomwaffe beteiligen.“ Merkel und Steinmeier sollen das Angebot ohne jede nähere Prüfung abgelehnt und den Präsidenten darauf verwiesen haben, dass Deutschland den Besitz von Atomwaffen nicht anstrebe.
Derlei Angebote, den Deutschen zur Befreiung aus amerikanischer Vormundschaft zu verhelfen, halten deutsche Regierungen nicht nur für anmaßend, was die militärische Sicherheit und Schlagkraft des vergleichsweise kleinen französischen Atom-„Schutzschirms“ für die großen deutschen Interessen betrifft; sondern auch für die Offerte einer alternativen Abhängigkeit von einem innereuropäischen Machtkonkurrenten, die sie sich aufgrund ihrer nationalen Berechnungen gar nicht bestellt haben. Wo Frankreich an dem amerikanischen Vormachtanspruch in Europa und der Welt leidet, konstatiert Deutschland, dass es seinen ganzen Erfolg im Zustand der Ein- und Unterordnung unter amerikanische Bündnisautorität erreicht hat. Und es besteht darauf, dass für Deutschland die Zeiten nicht so sind, dass es auf Grundlage des gegenwärtigen Euro-Imperialismus als Teilhaber des NATO-Bündnisses auf dessen weltumspannenden Ordnungsleistungen verzichten wollte, auch wenn Frankreich noch so oft darauf pocht, dass ohne eigene europäische Militärmacht dieser Euro-Imperialismus nie „fertig“ werden könne.
Das bleibende strategische Leiden: Die deutsche NATO-Räson entwertet Frankreichs Status als militärische Führungsmacht in Europa
So muss Frankreich zusehen, wie Deutschland, der unverzichtbare Mitmacher, sich seinen Anträgen verweigert, sich gar nicht herbeilässt, die Bedingungen einer wirklich schlagkräftigen Kooperation auf dem Feld des Militärs zu prüfen, sondern jede Form substantieller strategischer Zusammenarbeit mit Frankreich dem Verdacht unerwünschter Abhängigkeit und Unterordnung ausgesetzt ist. Deutschland zieht es vor, sich in dem Widerspruch zwischen eigenständiger europäischer Militärstrategie und nationalem NATO-Vasallentum auch weiterhin praktisch für die Seite seines höchst erfolgreichen Parasitierens an der Weltfriedensordnung der USA zu entscheiden. Zuerst hat deren permanente Weltkriegsbereitschaft gegenüber der Sowjetunion, dann die folgende militärische Oberaufsicht über das globale Wirken von Kapitalismus und Demokratie im Europa der ausgreifenden EU Bedingungen geschaffen, die vor allem Deutschland als die ökonomische Vormacht der EU zu nutzen wusste und weiß: Die Bequemlichkeit, ihren bewaffneten Imperialismus einfach von sich abzutrennen, ihn in die NATO zu verlagern, dort an den Diensten aller anderen zu schmarotzen – im Übrigen, trotz erheblicher eigener Aufrüstung, doch auch mit durchaus günstigen Kostenfolgen – und dennoch auf die Leistungen weltweiter Gewaltandrohung im Namen von Kapitalismus und Demokratie nicht verzichten zu müssen. Beim Aufbau der supranationalen EU, bei der Zurichtung der wachsenden Mitgliedschaft und der vertraglichen Formierung des Kontinents zu einem neuen imperialistischen Subjekt eigener Art kann sich das notorisch friedliebende Deutschland nicht nur auf die Selbstverständlichkeit einer kapitalistischen Staatsräson und rechtsstaatlich verbindlicher Herrschaftsformen verlassen. Es kann dabei auch ganz auf die Mittel des politischen Drucks und der ökonomischen Erpressung setzen, ganz so, als wäre die elementare Art staatlicher Interessenwahrung mit dem letzten Mittel der Militärgewalt in Europa tatsächlich abgeschafft und nicht, wegen der verbliebenen supranationalen NATO-Zuständigkeit für Krieg und Frieden auch innerhalb der Allianz, den Unions-Europäern derzeit als Option einfach nicht verfügbar. Von diesem Weg lässt sich Deutschland durch Frankreichs Angebote vorderhand nicht abbringen, nicht zuletzt deshalb, weil es so seine ökonomische Überlegenheit als maßgebliche Waffe im Kampf um die politische Rangordnung in Europa auch und gerade gegenüber Frankreich ausspielen kann.
Die wenig taugliche Alternative: Kriegskooperation mit dem britischen Juniorpartner Amerikas
Die fallweise Zusammenarbeit mit Großbritannien ist dafür aus der Sicht Frankreichs kein Ersatz. Großbritannien, Frankreichs zeitweiliger militärischer Kooperationspartner bei diversen Eingreifkommandos, wird zwar in die EU aufgenommen mit der französischen Erwartung, es könne in Europa bei der Entwicklung der Qualitäten unterstützend wirken, die Frankreich zum Tragen bringen will: den militärischen Fähigkeiten einer strategisch agierenden Weltmacht. Großbritannien erweist sich aber während der Zeit seiner Mitgliedschaft durch die Betonung seiner exzentrischen Stellung in der EU als wenig hilfreich in dieser Frage, erst recht nicht seit Beginn der Finanzkrise, da von Teilen des konservativen Lagers sogar ein Referendum über den Austritt aus der EU auf die Tagesordnung gesetzt wird. Als positiver Beitrag zu einer Weltmacht Europa könnte Großbritannien nach französischer Auffassung ohnehin nur wirken, wenn es sich von seiner „Schoßhundrolle“ gegenüber den USA emanzipiert und sich vom Brückenkopf der USA in und neben der EU zum nationalen Interessenten an einer supranationalen Europa-Macht entwickeln würde. Die dauerhafte Einordnung in eine solche Kooperation hat Großbritannien aber offenbar immer als Beschränkung bei der nationalen Nutzung seiner eigenen beachtlichen politischen und militärischen Fähigkeiten betrachtet, mit denen es, anders als Deutschland, vor allem in der Frage der Atomwaffen nicht auf französische Beteiligungsangebote angewiesen ist; während es in großformatigen Fragen der imperialistischen Weltordnung entschieden an seiner Zusammenarbeit mit den USA festhält. Folglich kommen für Frankreich mit Großbritannien immer nur Kooperationen in Einzelfällen zustande, die sich aber nicht in das übergreifende französische Interesse einfügen. So scheitert Frankreich mit seinen europäischen Plänen an Großbritannien wie an Deutschland, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Gründen: Wenn mit Großbritannien Zusammenarbeit stattfindet, dann mit einem weltpolitischen Akteur, der zwar als militärische Ordnungsmacht antritt, aber ohne die Perspektive eines in der strategischen Konkurrenz ‚handlungsfähigen Europas‘, während Deutschland zwar auf Europa setzt, nicht aber in militärischer Hinsicht.
II. Die ökonomische Basis des französischen Machtprogramms: die Erfolgsgeschichte der EU-Binnenkonkurrenz
Dabei handelt es sich bei Frankreichs Kampf um ein Europa, das um den einen, für Frankreich unverzichtbaren Schritt hin zu einem auch militärisch präsenten Subjekt der Weltpolitik vorankommen muss, keineswegs um ein politisches Hirngespinst: Er bezieht sich durchaus auf schon erreichte Erfolge der politischen und ökonomischen Vereinheitlichung des EU-Kontinents, die sich trotz dieser von Frankreich diagnostizierten prinzipiellen Schwäche längst in eine mitentscheidende Rolle der EU bei der Festlegung der internationalen Geschäftsordnung übersetzt haben. Die Macher der Union haben es geschafft, einen Staatenblock zu schaffen, dessen innere Konkurrenz in einem vertragsförmigen Geflecht von politischer und wirtschaftlicher Abhängigkeit stattfindet und der nach außen den gesamten Kontinent, einschließlich der Zerfallsprodukte der Sowjetunion bis an die Grenzen Russlands auf sich hin orientiert und an sich bindet – und das selbst gegenüber dem großen Russland versucht. Allen Interessenten und Antragstellern werden Bedingungen diktiert und Funktionen zugewiesen, die sich gar nicht mehr nur dem ökonomischen Interesse der Unionsstaaten verdanken – und schon gleich nicht dem der Kandidaten. Da wird die Türkei als „Brücke in den asiatischen Raum“ gewürdigt, werden Slowenien und Kroatien zur „Stabilisierung des westlichen Balkan“ aufgenommen und den baltischen Staaten in der EU „Sicherheit im Vorfeld Russlands“ gestiftet … Die EU agiert politisch bisweilen wie eine Weltmacht mit einer hegemonialen Einflusssphäre, ungeachtet dessen, dass die Führungsnationen um die politische Federführung konkurrieren und ihr militärisches Potential unter nationaler Kontrolle halten.
Frankreichs Standortpolitik: Kapitalwachstum in Staatsregie mit europäischer Perspektive
Der Aufbau ökonomischer Potenzen, der europäischen wie der eigenen, ist für Frankreich von jeher dem strategischen Ziel der nationalen Weltgeltung subsumiert. Für diesen Standpunkt geht es darum, aus Frankreich und Europa einen konkurrenzfähigen Standort zu machen, der eine politische Mission hat: eine solide, also wachstumstüchtige Basis für die ehrgeizigen politischen Vorhaben der Nation darzustellen und den dafür nötigen kapitalistischen Reichtum samt der zugehörigen Kreditmacht verfügbar zu machen. Deshalb überlässt Frankreich den Aufwuchs seiner ökonomischen Verfügungsmacht in Europa von Anfang an nicht dem Zufall des Geschäftsgangs. Unabhängig von ihrer „weltanschaulichen“ und parteipolitischen Zuordnung haben konservative und sozialistische Regierungen stets darauf bestanden, die größten Profitquellen und die politisch wichtigsten Gebrauchswertproduzenten des Landes durch mehr oder weniger direkte politische Anleitung und Kontrolle zu kapitalistischem Erfolg für die Nation zu führen: Unmittelbar nach dem Krieg, in den Jahren 1945 und 46, verstaatlicht das Regime de Gaulle den gesamten Kohlebergbau, die Elektrizitäts- und Gaswirtschaft, die Luftfahrtindustrie, vier Großbanken, die größten Versicherer und die Renault-Autowerke. Diese Verstaatlichungen werden z.T. erst nach Jahrzehnten rückgängig gemacht, als man die betreffenden Firmen nach ihrer Förderung mit Staatsgeld und politisch verfügten Schuldenerlassen für konkurrenzfähig hält; 1981/82, zur Bekämpfung einer Krise mit hohen Arbeitslosenzahlen und fast 15 % Inflation, verstaatlicht eine sozialistische Regierung weitere Großkonzerne und in ausländischer Hand befindliche Betriebe aus dem IT-Bereich, der Rüstungs-, Chemie- und Stahlindustrie und kontrolliert als Eigentümer direkt mehr als 30 % des Industrieumsatzes und über 91 % des Bankengeschäftes. Die Mitterrand-Regierung erklärt ausdrücklich, den „verstaatlichten Sektor zum Motor der Industrie“ machen, vor ausländischen Übernahmen schützen und so die Krise aktiv überwinden zu wollen, statt sich durch staatliche Passivität – „wie im Großbritannien von Margret Thatcher“ – immer tiefer in sie zu „verstricken“. Und bei den Reprivatisierungen konservativer Nachfolgeregierungen versäumen diese es nie, die neuen privaten Eigentümerstrukturen der national wichtigen Unternehmen höchstselbst sorgfältig mit den immer gleichen „institutionellen Anlegern“ und „stabilen Aktionärskernen“ politisch zu organisieren, und – wo nötig – sich staatliche Kontrollbeteiligungen vorzubehalten, nicht zuletzt, um stets in der Lage zu sein, in „sensiblen“ Bereichen unerwünschte ausländische Beteiligungen zu verhindern. So wird etwa die Insolvenz des Technik- und Nuklear-Konzerns Alstom mittels des staatlichen Ankaufs von 31 % des Aktienkapitals abgewendet und die Übernahme durch Siemens blockiert; dagegen die von Hoechst-Aventis durch die französische Sanofi organisiert oder die feindliche Übernahme des Energieversorgers Suez durch die italienische ENEL mittels einer regierungsseitig angezettelten innerfranzösischen Großfusion torpediert; und der gegenwärtige Industrieminister der Regierung Hollande droht dem Stahlkonzern Arcelor-Mittal mit Verstaatlichung der französischen Werke, wenn diese seitens der Firmenleitung tatsächlich, wie angekündigt, geschlossen werden sollten.
So hält Frankreich auch und erst recht die gemeinschaftliche Organisation eines nach innen auf kapitalistisches Wachstum ausgerichteten und nach außen protektionistisch abgegrenzten europäischen Standortes für eine politische Aufgabe erster Ordnung, bei der Frankreich seinen ganzen wirtschaftsstrategischen Ehrgeiz in Anschlag bringt. Schließlich gilt es ja, den kompletten alten Kontinent zu vereinnahmen und zuzurichten, und vor allem Deutschlands wachsende Potenzen für die europäische Entwicklung zu nutzen, um damit die in der Staatenkonkurrenz nötige imperialistische Größe zu erwirtschaften. Deshalb werden gemeinsame Märkte für essentielle Güter in Form vertraglich eingegangener supranationaler „Gemeinschaften“ organisiert: eine „Montan-Union“ (1951), die den französischen, aber auch den Zugriff der anderen Vertragsstaaten auf zollfreie Kohle und Stahl sichert; und eine „Europäische Atomgemeinschaft“ (Euratom-Vertrag von 1957), die den Aufbau einer technologisch führenden europäischen Nuklearindustrie fördern und die einschlägigen nationalen Anstrengungen ergänzen und gesamteuropäisch produktiv machen soll, die der Versorgung mit dem vor allem für Frankreichs Armee und seine führenden Atomfirmen lebenswichtigen Bomben- und Brennstoff und der Unabhängigkeit von auswärtiger Energiezufuhr dienen. Zusammen mit Deutschland und einigen anderen Staaten wird die Gründung einer weltmarkttüchtigen europäischen Luftfahrtindustrie für den Zivil- und Militärbereich betrieben, um deren Beteiligungsverhältnisse und Geschäftsführung bis zum heutigen Tag politisch eifersüchtig konkurriert wird, während Frankreich sich zusätzlich mit Thales und Dassault – für sich genommen zu klein für die französischen Zukunftspläne – eine beachtliche nationale Rüstungs- und Flugzeugindustrie unter seiner exklusiven Kontrolle hält. Nach Gründung der EWG, die später „in Anerkennung der erweiterten Aufgaben“ in EG, dann in EU umbenannt wird, richten die Mitgliedsstaaten, wiederum angeführt von Frankreich und Deutschland, dem wichtigsten „Nettozahler“ der europäischen Gemeinschaftshaushalte, ein vom Nationalkredit der Teilnehmer gespeistes System von Agrar-, Struktur-, und Regionalfonds ein. Aus dem soll mittels eines komplizierten, politisch stets wüst umstrittenen Geldverteilungssystems der Ausgleich der extrem unterschiedlichen „Wettbewerbsfähigkeit“ der Standorte finanziert werden. Das ändert auf längere Sicht dann aber doch nichts daran, dass auf den neu gebauten europäischen Straßen und Bahnstrecken, in neu eingerichteten Industriegebieten und auf europäischen Finanzplätzen die Kapitale der großen Standorte ihre vorhandenen Konkurrenzvorteile nutzen und ausbauen, während an der Peripherie Handelsdefizite, periodische Währungskrisen und zugehörige Schulden akkumuliert werden, die wiederum zu politischen Betreuungsgegenständen der Gemeinschaft und ihrer Anführer werden.
Der zwiespältige Fortschritt: das Euro-Regime
Die Einführung der gemeinsamen Währung als „Krönung“ der ökonomischen Entwicklung Europas ist aus Frankreichs Sicht eine notwendige Reaktion darauf, dass diese Entwicklung als harte interne Konkurrenz der Gemeinschaftsstaaten stattfindet und entsprechende Folgen zeitigt.
Die Freisetzung der Konkurrenz auf dem Binnenmarkt führt schnell zu einigem Kahlschlag unter dem nun von Zoll- und Handelsschranken nicht mehr geschützten Gewerbe in weniger produktiven Gegenden, andererseits zu baldigen Überakkumulationskrisen in allen wichtigen Wirtschaftsbereichen mit der Folge politisch verwalteter, europaweiter Säuberungsaktionen bei Kohle, Stahl, Werften und Textilproduzenten; und drittens zum Weiterwachsen der schon international wettbewerbsfähigen Kapitalgrößen bei den Siegern der Konkurrenz mit zunehmend eindeutiger Konzentration in Deutschland und der Nordschiene der Gemeinschaft. Angesichts der wachsenden Finanzmacht des deutschen Exportmeisters mit seiner Deutschmark, die zunehmend die Konkurrenz- und Kreditbedingungen in Europa bestimmt, muss Frankreich zur Kenntnis nehmen, dass die vorgesehene ökonomische Instrumentalisierung Deutschlands unter strategischer französischer Direktionskompetenz sich mit der jeder Kontrolle entwachsenden deutschen Wirtschaftsmacht ziemlich schwer tut. Der Siegeszug der DM nötigt Frankreich einen Konkurrenzkampf auf, der Paris wachsende Handelsbilanzdefizite beschert und den sein Kredit nicht gut aushält: Die Exporterfolge Deutschlands werten die DM auf, während sich Frankreich immer wieder genötigt sieht, zur Förderung des Exports abzuwerten, den Außenhandel darüber hinaus teuer zu subventionieren und dabei in der Konkurrenz um den Kredit des Finanzkapitals höhere Zinsen als Deutschland zu bezahlen. Mehrfache Interventionen der Bundesbank zur Wahrung der Franc-Parität machen die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den europäischen Währungen auf peinliche Weise publik.
Eine Gemeinschaftswährung, so die französische Spekulation im Vorfeld der Euro-Einführung, nähme Deutschland das exklusive Mittel der friedlichen Eroberung Europas zu Lasten Frankreichs, würde den französischen Kredit entlasten und die Konkurrenz auf dem Binnen- und dem Weltmarkt zum Gegenstand gemeinsamer politischer Planung machen und insoweit entschärfen. Das Projekt der gemeinsamen Währung soll also aus französischer Sicht die Einbindung Deutschlands mit seinem nach der Wiedervereinigung - die man im Gegenzug „zugesteht“ - noch einmal bedrohlich vergrößerten ökonomischen Gewicht dauerhaft sicherstellen. Paris verspricht sich von diesem Projekt die Verallgemeinerung der deutschen Erfolgswährung für alle ‚solide wirtschaftenden‘ Mitgliedsländer, die Einebnung des deutschen Sondervorteils in Form seiner überlegenen Währung und die dann zweifellos notwendige politische Verwaltung der neuen Währung als europäische Gemeinschaftsangelegenheit. Dafür konzediert Frankreich mit der rechtlichen Unabhängigkeit der EZB und deren Verpflichtung auf „Preisstabilität“ als Hauptaufgabe einen Verlust von Haushalts- und Währungshoheit, der auch in der Maastrichter Geschäftsordnung über den Gebrauch der gemeinsamen Währung festgeschrieben wird. Diese Zugeständnisse macht Frankreich in der Überzeugung, dass es bei wichtigen Entscheidungen über das neue Geld ohnehin nicht übergangen werden könne und die politischen Betreuungsbedürfnisse des Euro bei den Deutschen endlich die Einsicht in die Notwendigkeit einer europäischen „Wirtschaftsregierung“ befördern werde, die von deutscher Seite so lange mit Verweis auf das geltende „Subsidiaritätsprinzip“ abgelehnt wurde. Für besonders zukunftsweisend werden die Auswirkungen der Gemeinschaftswährung auf den Kredit der EU-Nationen gehalten: Als Teilhaber an dem nun von Deutschland mit garantierten Kollektivgeld würde sich der Kredit für alle verbilligen, unweigerlich Wachstum in allen Euro-Staaten in Gang bringen und eine Weltmacht-Ökonomie schaffen, in der die politische und militärische Vormacht Frankreich die ökonomische Euromacht Deutschland endlich zu ihrem gemeinsamen imperialistischen Glück zwingt.
Die Konkurrenz zwischen Frankreich und Deutschland um den Euro-Kredit
Die Verbilligung des europäischen Kredits, fast ohne Ansehen der Nation, ist bekanntlich tatsächlich für einige Jahre eingetreten und hat es, wie man heute erfährt, manchen von diesen Gemeinwesen erlaubt, „auf Pump“ und „über ihre Verhältnisse“ zu leben, also im Zuge ihres Zurückfallens in der Konkurrenz ihre Importe, Haushalte und Zahlungsbilanzen zu finanzieren, gegenüber den Siegern des Wettbewerbs zahlungsfähig zu bleiben und den Fortgang von deren erfolgreichen Geschäften zu gewährleisten. Diese Art finanzpolitischer „Entspannung“ tritt nach der Einführung des Euro auch für Frankreich ein, das für seine weltpolitische Rolle seinen Kredit immer strapaziert und seine Unternehmungen, wenn irgend möglich, nicht von seinem Schuldenstand abhängig gemacht hat. Seinem Vorhaben, die wirtschaftliche Entwicklung Europas unter dem Euro zum Sorgegegenstand der europäischen Politik unter französisch-deutscher Führung zu machen und sie so für den imperialistischen Fortschritt der Gemeinschaft wirksam zu instrumentalisieren, verweigert sich Deutschland allerdings auch nach der Einführung der neuen Währung und setzt im Gegensatz dazu ganz auf die in den Maastricht-Kriterien vereinbarten finanzkapitalistischen Kriterien des „guten Geldes“ in der Tradition der DM. Mit der Zurückweisung des französischen Ansinnens, den Euro zum politisch nach Bedarf verfügbaren Hebel europäischen Regierens zu machen, besteht Deutschland auf der Bewährung des Euro-Geldes als vermehrungsfähigem Wertstoff in allen Sparten der Wirtschaft: Das Finanzkapital muss die Währung als Mittel und Zweck seines globalen Wachstums benutzen und damit bestätigen, die Teilnehmerstaaten müssen sich deswegen unter Androhung von Vertragsstrafen verpflichten, ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik an diesem Zweck auszurichten und alles zu vermeiden, was dem Renommee der Währung an den Geldmärkten schaden könnte. Die nationalen Bedürfnisse der Euro-Staaten sind nach dieser Auffassung, die in den Maastricht-Kriterien statuiert ist, am besten bedient mit einer maßvollen Schuldenpolitik zugunsten einer stabilen Währung, die nicht das Objekt politischer Berechnung oder gar Mittel sozialer Rücksichtnahme sein darf, und mit einer Politik, die strikt auf die Förderung kapitalistischer Rentabilität ausgerichtet ist. Diese Prioritätensetzung führt im Erfolgsfall ganz von selbst, eben über das vorgängig notwendige Wachstum des Finanzkapitals, zu einer größeren, dann aber grundsoliden Freiheit der Verschuldung – und Europa zu einer weltmächtig „vertieften Zusammenarbeit“, mit der allein es sich unter deutscher Anleitung, ohne Unterordnung unter französische Vormachtansprüche, in Zukunft auf Augenhöhe mit Chinesen, BRICS und Amerikanern „behaupten“ kann, selbstverständlich ohne Konfrontation mit der Supermacht -: so die deutsche Erfolgsdirektive für Europa.
So macht der deutsche Standpunkt die von Frankreich politisch angestrebte Weltmachtrolle Europas zu einer Frage des Kredits – und die Unterstützung der deutschen Forderungen nach einem strengen Haushaltsregime zur Voraussetzung und Richtschnur für Fortschritte der europäischen Vergemeinschaftung: Wenn, aber auch nur wenn die Euro-Staaten alles tun für den finanzkapitalistischen Erfolg ihrer Währung, dann wird Europa ganz von selbst zum globalen Schwergewicht in der amerikanisch dominierten Weltordnung, das sich dann auch irgendwann zu noch mehr politischem Zusammenwirken verstehen wird. Das ist so ziemlich das Gegenteil der politisch-strategischen Vorstellungen der Franzosen vom vereinten Kredit der Europäer und einem gemeinsamen Weltgeld, das auf dem Feld der finanzkapitalistischen Konkurrenz dem machtpolitischen Anspruch seiner Schöpfer zu dienen hat. Deutschland weist die französische Version eines euroimperialistischen Aufbruchs nicht offen zurück, teilt sie aber auch nicht und lässt die zweite Führungsmacht Europas, die sich auf die Abhängigkeiten des Euro-Systems aus ihren Berechnungen eingelassen hat, die Abhängigkeit der europäischen Entwicklung von deutscher Wirtschaftsmacht spüren.
Die französischen Regierungen sehen ihren immer wieder aufgewärmten Vorschlag, mittels Wirtschaftsregierung Europas Ökonomie und seinen Kredit im Sinne ihres politischen Ziels zu steuern, behandelt wie einen etatistischen Spleen. Und sie müssen nach und nach feststellen, dass sie mit ihrer Vorstellung von einem auf die Ziele der Nation hin organisierten Kapitalismus im Euro-System ohne freien nationalen Zugriff auf das gemeinsame Geld dastehen, vielmehr die Verfügung über das ökonomische Mittel ihrer souveränen Gewalt von den Spekulationen privater „Marktteilnehmer“ abhängt. An der Spitze derer, die sich als Sachwalter der Notwendigkeiten des neuen Geldes gerieren, das seine Stärke nur aus seiner Anerkennung als unschlagbares Mittel des Kapitals beziehen dürfe, tritt dem französischen Staatskapitalismus der ökonomisch mächtige Nachbar entgegen, auf dessen funktionelle Einordnung Frankreich auf seinem Weg zur französisch-europäischen Weltmacht als sein stärkstes Pfund gesetzt hat und mit dem zusammen es in Jahrzehnten konkurrierender Kooperation schon ein beachtliches Stück politischer und wirtschaftlicher Substanz der neuen Subjektrolle Europas realisiert hat. Eingebunden in die Vertragsverhältnisse, die dieses Subjekt völkerrechtlich konstituieren, einsortiert in die Logik des Euro-Kredits, in dem alle wirtschaftlichen Mittel seiner Macht gezählt werden, und ohne die Option, die Bedingungen seines Nationalkredits souverän zu bestimmen, beharrt Frankreich auf seinem Anspruch an die imperialistische Fortentwicklung Europas, von der es die Einlösung seiner politischen Räson abhängig gemacht hat.
III. Die Gefährdung der französischen Führungsrolle durch die Krise und die deutsche Krisenpolitik
An der Herstellung der großen Finanzkrise hat der französische Standort standesgemäß mitgewirkt: Im Zuge des rasanten Wachstums des europäischen Finanzsektors auf Grundlage der Eurowährung hat auch Frankreich seinen nationalen Finanzunternehmen auf allen Etagen des globalen Leih-, Investment- und Derivategeschäftes so umfangreiche Geschäftsgelegenheiten eröffnet, dass diese dementsprechend von den Konsequenzen ihrer Erfolge hart betroffen sind, als sich in der Krise herausstellt, dass auch die französischen Marktteilnehmer so viel Kapital akkumuliert haben, dass niemand mehr auf seine weitere Vermehrung vertrauen will. Die Rekapitalisierung illiquider, aber höchst „systemrelevanter“ Institute und der Ersatz ausfallenden Kredits zwischen den Banken und für den Rest der Ökonomie treiben in Frankreich wie im gesamten Euroland die Schuldenstände der öffentlichen Haushalte gewaltig in die Höhe. Die „wirtschaftlich starken“ Länder Europas bewerkstelligen das unter dem prüfenden Blick des soeben geretteten Finanzkapitals zunächst einigermaßen. Die anderen bekommen bekanntlich die Staatsschuldenkrise und kriegen sie seitdem nicht wieder los. Sie sind durch den Sanierungsbedarf ihrer Bankensysteme überfordert und verfügen nicht über vertrauensstiftende ökonomische Ressourcen, die weiteren Kredit für ihre defizitären Haushalte rechtfertigen würden – derlei verpfändbare „Sicherheiten“ haben ihnen die starken Länder in Jahrzehnten europäischer „Konvergenzpolitik“ längst wegkonkurriert. Jetzt fällt auf, dass sie die Lücken ihrer nationalen Einkommen, die ihre anhaltenden Konkurrenzniederlagen gerissen haben, schon seit längerer Zeit mit billigem Euro-Kredit finanziert haben. Der wird ihnen von den „Märkten“, für die seit der Krise kein Staatskredit nur mehr deswegen gut ist, weil er Teil des großen Euro-Kredits ist, nach und nach unerschwinglich gemacht, was die betroffenen Länder an den Rand des Staatsbankrotts bringt: Sie bringen nicht nur das Geld zur Bestreitung ihrer inneren Hoheitsaufgaben nicht mehr auf, sondern können ihre Zahlungspflichten gegenüber ihren Gläubigern nicht mehr erfüllen, die dann selbst zu Gliedern einer nicht absehbaren Kette von Zahlungsunfähigkeiten zu werden drohen. Das bringt nach dem nationalen Bankenretten das supranationale Staatenretten in Gang.
Frankreich, selbst von der Krise betroffen, von nationalen Bankenrettungsprogrammen belastet und abhängig von der Aufrechterhaltung des Euro-Kredits, den es allein nicht kontrollieren kann, trägt die Programme zur Finanzierung der überschuldeten Staaten der Eurozone mit, die sich nicht oder nur mehr zu untragbaren Zinsen am Kapitalmarkt finanzieren können. Zum einen, weil die Engagements der französischen, gerade vor dem Bankrott bewahrten Finanzinstitute in zahlungsunfähigen Staaten nicht vollständig zuschanden werden sollen. Zum anderen, weil auch Frankreich – ebenso wie Deutschland u.a. – sich den Verlust nicht leisten will und kann, den eine Entwertung der bei der EZB liegenden Staatsanleihen und die Verwandlung negativer Salden in dreistelliger Milliardenhöhe im europäischen Zahlungsverkehr in fällige und uneinbringliche Schulden mit sich brächte; und weil eine Staatspleite im Euro-Raum oder gleich eine ganze Reihe davon von Frankreich als inakzeptabler politischer Rückschlag für sein europäisch-imperialistisches Projekt verstanden würde.
Das Krisenregime in Euro-Land: die etwas andere Wirtschaftsregierung
Auch Frankreich steht wegen seiner wachsenden Schulden, wegen Rezession und zunehmender Arbeitslosigkeit – die Verkaufszahlen der großen französischen Autoindustrie befinden sich im Sommer 2013 im freien Fall und ein halbes Prozent Wachstum des BIP im zweiten Quartal gilt schon als Anlass zum Optimismus – unter misstrauischer Beobachtung der Finanzmärkte, deren Agenturen ihm schon das „Top-Rating“ aberkannt haben. Es unterstützt stets die Mobilisierung von gemeinschaftlichem Euro-Kredit für Staaten und Banken, die von Kaufprogrammen für Staatsanleihen und Bankenrefinanzierung seitens der EZB begleitet wird. Das entspricht der französischen Auffassung von einem vernünftigen Gebrauch staatlicher Schulden: Wozu sonst sollten sie gut sein, wenn nicht zur Behebung von Drangsalen, in die die Politik bei der systemrelevanten Fürsorge für den Standort geraten ist, von dem sie lebt? Die französische Politik trägt aber auch die strengen Auflagen zur „Haushaltsdisziplin“ mit, auf die vor allem Deutschland als Gegenleistung für die Inanspruchnahme der europäischen Finanzhilfen drängt. Das tut sie zum Ende der Regierung Sarkozy ganz so, als ob das Regime von „Rettungsfonds“, „Schuldenbremse“, „Fiskalpakt“, „Bankenaufsicht“ und überhaupt Abtretung von Haushaltssouveränität an die Aufsichtsinstanzen des Gemeinschaftskredits endlich den alten französischen Antrag zur Schaffung einer europäischen „Wirtschaftsregierung“ wahrmachen würde, den man heute eben um ein paar krisenspezifische Maßnahmen ergänzen müsste: Sarkozy schlägt europäische Fonds vor, mit denen Regierungen bei börsennotierten Unternehmen einsteigen und sie vor dem „Ausverkauf an ausländische staatliche Investoren“ bewahren könnten; er regt einen dauernden „Diskussionsprozess“ zwischen – selbstverständlich ‚unabhängiger‘ – EZB und europäischer Wirtschaftsregierung und die beschleunigte Gründung einer europäischen Ratingagentur an – und verlangt mit allen Ideen zum politischen Einsatz vergemeinschafteten europäischen Kredits von Deutschland die Preisgabe eines Stücks des Konkurrenzerfolges, den es gegen seine europäischen „Partner“ errungen hat und auf den es seine dominierende Stellung in der Krise stützt.
Tatsächlich ist das deutsch animierte wirkliche Krisenregime dabei, eine politische Steuerung des europäischen Kredits zu installieren, nur eben mit dem gegenteiligen Ausgangspunkt und Zweck, den französische Regierungen mit ihren Vorstellungen von einer politischen Funktionalisierung von Geld und Kredit stets im Auge hatten: Die Auflagen für die Pleiteländer unterwerfen umgekehrt die betroffenen Nationen dem Kriterium der „Konsolidierung“ ihrer Schulden durch radikale Anpassung ihrer Ausgaben an die darnieder liegenden Einkünfte zwecks Zertifizierung dieses Verhältnisses durch die Finanzmärkte; sie organisieren und lokalisieren den dort durch die Entwertung von Kredit angefallenen Schaden, halten mit Gemeinschaftskredit die Zahlungsfähigkeit zugunsten der Gläubiger aufrecht, beteiligen auch diese nach Maßgabe der zypriotischen „Blaupause“ in gewissem Umfang an den Ausfällen und lassen die Objekte der Rettung mit der Abtretung von fiskalischer Freiheit, also Souveränität, bezahlen. Die Umsetzung der Sparauflagen, die den kreditnehmenden Staaten unter Führung Deutschlands mit französischer Unterstützung aufgenötigt werden, bringt in wenigen Jahren eine Umwälzung ihres staatlichen Innenlebens nach den Kriterien einer rigoros verbilligten Haushaltsführung mit sich; die führt beim sozialstaatlich gewährleisteten Lebensunterhalt unmittelbar, und mittelbar auf dem Weg allgemeiner Geschäftseinschränkungen infolge des Ausfalls staatlicher Kaufkraft und daraus folgender Arbeitslosigkeit nun schon seit ein paar Jahren zur galoppierenden Verarmung der Bevölkerung und zum Niedergang kapitalistischer Wirtschaftstätigkeit überhaupt. Diejenigen Staaten, die bis zur Krise ihre Konkurrenznachteile durch Schuldenaufnahme „kompensiert“ haben, sollen sich in Zukunft „ehrlich“ der Härte des Wettbewerbs stellen: Sie sollen, so lautet die dogmatische Sinngebung der politisch durchgedrückten Austeritätspolitik zur Wiederherstellung des europäischen Kredits, unter der Kontrolle ihrer „Retter“ an der „Konkurrenzfähigkeit“ dessen arbeiten, was nach der Zerstörung der alten Verhältnisse an ihren Standorten übrig bleibt.
Das französische Ringen um Richtlinienkompetenz in der europäischen Krisenpolitik
Das ökonomische Zurückfallen Frankreichs hinter den deutschen Führungskonkurrenten wird im Verlauf der Krise immer deutlicher. Frankreich trägt bislang die deutsche Krisenpolitik mit, hält aber deren Folgen immer weniger aus und wird insoweit aus deutscher Sicht – neben Italien – ökonomisch immer mehr zum Problem. Das bringt Paris von diesseits des Rheins immer drängendere Aufrufe zur Reform seiner nach deutschem Dafürhalten unfassbar komfortablen, also untragbaren Arbeits- und Sozialverhältnisse nach dem Vorbild deutscher Agenda-Politik ein; nur halbwegs diplomatisch von Seiten der Politik, unverhohlen und unverschämt von Seiten der Öffentlichkeit, die auch von Frankreich mehr „Konkurrenzfähigkeit“ fordert, während die deutsche Automobilindustrie – unter dem Beifall des deutschen Publikums und heuchlerischer Sorge um die Konkurrenz – die französische in immer größere Bedrängnis bringt. Gemeint ist mit der Ermahnung der Anspruch, Frankreich solle den von Deutschland geführten „Beweis“ gefälligst einsehen, dass es gerade in der Krise nicht auf seine immer wieder lancierten Machtperspektiven für Europas ‚Zukunft‘ ankommt, sondern allein auf die ökonomische Konsolidierung und die Restaurierung des Euro-Kredits, des eigentlichen Felds europäischer Stärke.
Dass Frankreich gegenüber Deutschland ökonomisch so ins Hintertreffen geraten ist und nun auch politisch vorgeführt zu werden droht, macht in der Regierungspartei des neuen Präsidenten Hollande und über sie hinaus die Fiktion von der gemeinsamen französisch-deutschen Regie über die europäische Krisenpolitik, in der die französischen Ambitionen aufgehoben wären, zweifelhaft. Die Frage kommt neu auf, ob man sich die deutsche Krisenkonkurrenz wirklich bieten lassen müsse, die absehbar in die Unterordnung der europäischen Staaten mündet und in den Neuzuschnitt ihrer politischen Macht in der EU nach Maßgabe der nationalen Kreditmacht, die sie über die Krise retten können. Mit Blick auf Griechenland, Portugal, Irland und Spanien befürchtet Frankreich ernste Folgen auch für den heimischen Standort, durch ein Spar- und Kontrollregime, das den Staaten nur mehr den Kredit zubilligen will, der sich garantiert in geschäftlichen Erfolg verwandeln lässt, dabei den politökonomischen Bestand der betroffenen Nationen gefährdet und ihnen politisch für Frankreich inakzeptable Fesseln anlegt. Wenn also die Sozialisten der Merkel-Regierung „Egoismus“ zugunsten deutscher Interessen vorhalten, Hollande immer stärker auf gemeinsam finanzierte „Wachstumsimpulse“ drängt und vor dem „Kaputtsparen“ der Krisenländer warnt, dann erkennen sie einerseits die Notwendigkeit der Haushaltssanierung an, wohl wissend, dass ihnen Deutschland auch in Zukunft die Konkurrenz um den Kredit nicht ersparen wird. Andererseits stellen sie sich kritisch zum deutschen Standpunkt und halten dafür – als sozial bewegte Sozialisten und als besorgte und stolze Nationalisten –, dass Frankreich es eigentlich nicht nur nicht nötig habe, sein Volk mehr zu verarmen, als seine eigenen Interessen es gerade erfordern; in ihren Augen wäre es ein Fehler, eine Sünde gegen die Freiheit der nationalen Politik und den schon erreichten supranationalen Bestand Europas, die Mittel der politischen Macht, die arbeitenden Klassen und den europäischen Produktionsapparat, und darüber hinaus die Zustimmung der Völker zum europäischen Imperialismus um des Geldes willen zu beschädigen. Das Geld sollte schließlich ein klug gehandhabtes Instrument des europäischen Fortschritts sein, wie Frankreich ihn versteht, und nicht sein Herr.
Das französische Bestreben, die europäische Ökonomie verfügbar zu machen für den Aufbau des Kontinents zum anerkannten imperialistischen Mitspieler in der obersten Etage der Staatenkonkurrenz, geht in der Krise über in einen Kampf um den Erhalt des Bestandes an imperialistischer Gemeinsamkeit, der in der EU bislang entwickelt wurde und den Paris durch die deutsche Krisenpolitik bedroht sieht. Die Länder des europäischen Südens und Frankreich als ihr in dieser Frage wichtigster Mitstreiter berufen sich gegen den deutschen Standpunkt auf die Konsequenzen der bisherigen „Konsolidierungspolitik“, die sie um ihrer weiteren Finanzierung willen auf Kosten ihrer Völker in ihren Ländern durchsetzen, aber ökonomisch nicht aushalten, und deren Ausweglosigkeit sie im Sommer 2013 einmal mehr bewiesen sehen: Nach sechs Jahren Krisenpolitik sind die Schuldenquoten in Europa im Verhältnis zu den „nationalen Wirtschaftsleistungen so hoch wie nie und wachsen ungebremst weiter“, und markieren „einen neuen Rekord in der Geschichte der Währungsunion.“ (SZ, 23.7.2013)
Frankreich sucht aber nach wie vor nicht den offenen Konflikt mit Deutschland. Es macht seinen alternativen imperialistischen Standpunkt weiter im Rahmen des fortdauernden diplomatischen, europapolitischen Gezerres um die Staatsfinanzierung durch die EZB, die Konditionen der Bankenunion oder die nächsten Notkredite bzw. den nächsten Schuldenschnitt für Griechenland geltend, den die Bundesregierung halb dementiert, halb ankündigt, während ihn die öffentliche Fachwelt für – nach der Wahl – selbstverständlich unausweichlich erklärt. Dabei wird Frankreich laufend darauf gestoßen, dass Deutschland als der unverzichtbare Garant des alten Kredits, der gerettet werden, und des neuen, der Europa aus der Krise bringen soll, sich weiterhin jedes Zugeständnis politisch abkaufen lässt, nicht vom Dogma der nur durch Sparsamkeit erreichbaren Konkurrenzfähigkeit abweicht und die Währungsunion und das gesamte Europa-Projekt damit für die Teilnehmerstaaten am Rande des für sie ökonomisch und politisch Erträglichen hält.
Wo es für Deutschland in der Krise um eine ernste Währungskrise geht, deren Bestehen durchaus die imperialistischen Zukunftsperspektiven der Nation berührt, geht es für Frankreich um eine Krise des europäischen Subjekts, von dem seine einzige akzeptable Perspektive als Weltmacht, also „alles“ abhängt. Deutschland verlässt sich vorderhand darauf, sein europäisches Machtprojekt auf dem Feld der Ökonomie zu betreiben und wirft von dort aus, aus einer „Position der Stärke“, immer mehr Fragen der politischen Souveränität der europäischen Staaten auf. Frankreich dagegen sieht sich bei der Verfolgung seiner ehrgeizigen Staatsräson ohne andere Option darauf angewiesen, Europa und vor allem Deutschland für seinen Weg zu gewinnen, oder an seiner Ambition zu scheitern. Frankreich und Deutschland brauchen einander also nach wie vor, jeder den anderen, aber möglichst ohne dessen Interessen.
Frankreich dringt weiter auf ein kriegsfähiges Europa – mit Krieg
In der europäischen Krisenkonkurrenz, unter dem Druck des deutschen Schuldenregimes, das Frankreich immer noch mitträgt, hat der französische Verteidigungsminister die Höhe des nationalen Schuldenstandes im Frühjahr 2013 durchaus auch als „Bedrohung der Souveränität“ entdeckt. Frankreich hat aber andererseits schon immer darauf bestanden, seine strategischen Vorhaben nicht von der Kassenlage und dem Stand der Spekulation mit seinen Staatsanleihen abhängig zu machen, und rückt davon schon gleich nicht ab, wenn in der europäischen Krise Gegenwart und Zukunft seiner weltpolitischen Rolle auf dem Spiel stehen: „nämlich die Rolle einer großen Nation, die das Gleichgewicht der Welt beeinflussen kann.“ (Hollande zum Mali-Einsatz, Der Spiegel, 23/2013) Wegen der Wichtigkeit Europas dafür, wegen der Erfolglosigkeit des französischen Werbens für eine europäische „Verteidigungsidentität“, auch wegen der zersetzenden Wirkung der Krisenpolitik auf die politische Zustimmung zur „europäischen Einigung“ insgesamt, ergänzt Frankreich seine politische Werbung durch praktische Beweise und Demonstrationen der unverzichtbaren Notwendigkeit, sich als vereintes Europa auch militärisch vereint zu zeigen, anstatt immer wieder Frankreich – und ausgerechnet den „Außenseiter Großbritannien“ – an seiner Stelle handeln zu lassen. In Libyen und Mali nimmt Paris mit seinem militärischen Eingreifen europäische ‚ordnungspolitische Verantwortung‘ wahr und hält es auch für nötig, sich in Syrien stärker zu engagieren. Frankreich besteht auch in der Krise darauf, Europa müsse unabhängig von den USA Willen und Fähigkeit zur eigenständigen Interessenwahrnehmung zeigen. Tut es das nicht, so wird es die weltpolitischen Zuständigkeiten, die es sich allein schon wegen seines wirtschaftlichen Einflusses über Jahrzehnte erworben hat, in der Staatenkonkurrenz unweigerlich verlieren. Frankreich ist nicht gewillt, tatenlos zuzusehen, wie einmal erreichte französische oder europäische Positionen aufgegeben werden. Das gilt gerade rund ums Mittelmeer, das Frankreich als europäisches Meer betrachtet und ökonomisch und strategisch für die Machtentfaltung Europas für wichtig hält. Die Umstürze der nordafrikanischen Anrainer des Mittelmeers sind aus französischer Sicht als europäische Ordnungsfälle zu betrachten, die entsprechend europäischen Interessen zu betreuen sind, was allein schon eine angemessene EU-Militärmacht erfordert. Angesichts der Zurückhaltung Deutschlands und anderer Staaten, die sich auf ihre eigenen, parasitären Rechnungen im Bündnis mit der amerikanischen Weltaufsichtsmacht zurückziehen, und sich nicht in die französischen militärischen Berechnungen einsortieren lassen wollen, trachtet Frankreich immer wieder danach, den zögerlichen Europäern die Frage aufzudrängen, ob sie wirklich zusehen wollen, wie sich Paris zusammen mit London zum alleinigen Repräsentanten und Exekutor europäischer Sicherheits- und Eingreifpolitik macht; und ob sie wirklich die afrikanischen, nahöstlichen oder asiatischen Interessenfelder anderen Mächten überlassen wollen, um auf ewig „globale Hinterbänkler“ (SZ, 29.5.13) zu bleiben.
So verfolgt Frankreich sein Programm einer eigenen europäischen Weltordnungszuständigkeit weiter. Das behält trotz aller Rückschläge immer auch die Zielrichtung, Deutschland in dieses Programm mit hinein zu ziehen, ihm jedenfalls den Entzug möglichst schwer zu machen durch die Schaffung vollendeter Tatsachen. Die jüngsten französischen Kriegseinsätze sind Fälle, in denen Frankreich seine ‚Kompetenz‘ auf militärischem Gebiet ausspielt, auf seine Kriegsfähigkeit und seinen Kriegswillen und auf seine Führungsrolle als umfassend potente Atom- und Militärmach pocht, um darüber die europäischen Mächte zum Mitmachen zu nötigen und hinter sich zu versammeln, auf die es für sein imperialistisches Konkurrenzprogramm angewiesen ist.