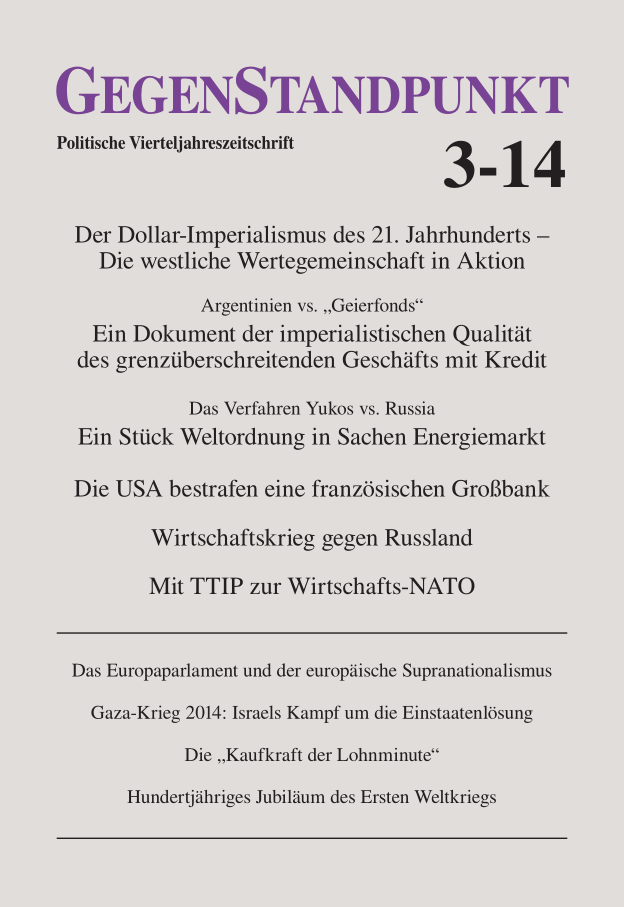Das Europaparlament, seine Spitzenkandidaten und der europäische Supranationalismus
Ideelle und praktische Beiträge zur politischen Willensbildung Europas
Der diesjährige Aufruf zur Wahl des neuen Europäischen Parlaments ist mit einer besonderen Offerte an die aktiv Wahlberechtigten verbunden. Sie haben nicht nur Gelegenheit, die von ihren nationalen Parteien aufgestellten Abgeordneten zu wählen, sondern damit zugleich einem der länderübergreifend angebotenen Spitzenkandidaten des Parlaments für das Amt des Chefs der künftigen EU-Kommission ins Amt zu verhelfen. So können sie auf Initiative des Europaparlaments dabei mithelfen, das viel beklagte „Demokratiedefizit der EU“ zu bekämpfen und damit den Parlamentarismus in Europa gegen die Übermacht der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat und der Kommissions-Bürokratie stärken. Die Beteiligung des europäischen Wählers ist – wie immer, wenn er nicht nur zur Bestellung seiner nationalen Chefs antreten soll – quantitativ überschaubar, aber qualitativ hinreichend: Auch in Europa kann weiter regiert werden. Am Ende hat das konservative Merkel-Lager gewonnen, der verfügbare deutsche Kandidat kann aber natürlich nicht Kommissionschef werden, weil er von der SPD ist; das Parlament bekommt vom Rat Juncker als seinen Kandidaten zugestanden und wählt ihn; der Brite Cameron, den wir nicht recht leiden können, hat wenigstens auch irgendwie verloren, mit seinem Widerstand gegen Juncker, der nach anfänglichen Unklarheiten doch noch Merkels Kandidat geworden ist; und eine ganze Reihe europakritischer oder europafeindlicher Parteien ist ins Parlament eingezogen. Heißt das jetzt irgendwas?
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Das Europaparlament, seine
Spitzenkandidaten und der europäische
Supranationalismus
Ideelle und praktische Beiträge zur
politischen Willensbildung Europas
Der diesjährige Aufruf zur Wahl des neuen Europäischen Parlaments ist mit einer besonderen Offerte an die aktiv Wahlberechtigten verbunden. Sie haben nicht nur Gelegenheit, die von ihren nationalen Parteien aufgestellten Abgeordneten zu wählen, sondern damit zugleich einem der länderübergreifend angebotenen Spitzenkandidaten des Parlaments für das Amt des Chefs der künftigen EU-Kommission ins Amt zu verhelfen. So können sie auf Initiative des Europaparlaments dabei mithelfen, das viel beklagte „Demokratiedefizit der EU“ zu bekämpfen und damit den Parlamentarismus in Europa gegen die Übermacht der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat und der Kommissions-Bürokratie stärken. Die Beteiligung des europäischen Wählers ist – wie immer, wenn er nicht nur zur Bestellung seiner nationalen Chefs antreten soll – quantitativ überschaubar, aber qualitativ hinreichend: Auch in Europa kann weiter regiert werden. Am Ende hat das konservative Merkel-Lager gewonnen, der verfügbare deutsche Kandidat kann aber natürlich nicht Kommissionschef werden, weil er von der SPD ist; das Parlament bekommt vom Rat Juncker als seinen Kandidaten zugestanden und wählt ihn; der Brite Cameron, den wir nicht recht leiden können, hat wenigstens auch irgendwie verloren, mit seinem Widerstand gegen Juncker, der nach anfänglichen Unklarheiten doch noch Merkels Kandidat geworden ist; und eine ganze Reihe europakritischer oder europafeindlicher Parteien ist ins Parlament eingezogen. Heißt das jetzt irgendwas?
Das Europaparlament – die widersprüchliche Heimstatt des ideellen Supranationalismus
Was die Vertreter des Europäischen Parlaments im Zuge des eurodemokratischen Prozesses deutlich machen wollen, daran lassen sie keinen Zweifel. Mit ihrem Vorstoß zur Präsentation von Spitzenkandidaten aus der Mitte der Parlamentsfraktionen, und zwar ohne vorherige Beauftragung oder Genehmigung durch den Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs, präsentieren sie ihre Versammlung der europäischen Öffentlichkeit und dem wählenden Publikum als das Organ eines irgendwie zusammengefassten, parlamentarisch einheitlich dargestellten Willens der europäischen Völker – als Repräsentant des europäischen Supranationalismus. Unbekümmert darum, dass die Mitglieder des Parlaments in nationalen Wahlen, mit nationalen Themen in jedem Mitgliedsland und als Kandidaten nationaler Parteien bestimmt werden, nehmen sie das Votum dieser Völker in aller Freiheit so, als habe ihnen schon eine Art europäisches Gesamtvolk ihre Mandate verschafft. In den Debatten, insbesondere mit dem letztlich entscheidungsbefugten Rat, um die Präsentation von Spitzenkandidaten treten die Mitglieder des Parlaments als politische Fraktionen auf, als europäische Konservative, Sozialdemokraten oder Liberale, und nicht als nationale Abgeordnete; ganz so, als gebe es einen europäischen Sozialismus oder Konservativismus, als spiele der nationale gegenüber dem europäisch-politischen Standpunkt gar keine Rolle. Im Widerspruch zwischen Nationalismus und neuem Supranationalismus, der dem Parlament durch die nationale Auswahl seiner Mitglieder und seiner Rolle im europäischen Institutionengefüge innewohnt, schlägt sich das Parlament demonstrativ auf die Seite des Supranationalismus: Ganz Sachwalter eines neu gegründeten europäischen Nationalismus tritt das Parlament als die Körperschaft auf, die wegen dieser Rolle um größere Kompetenzen kämpft, die ihr einfach zustehen.
Das hat seinen Grund im Wettbewerb der Institutionen, die das Bündnis der konkurrierenden Nationen Europas für die Betreuung seiner Gegensätze und Gemeinsamkeiten erfunden hat. Dem Supranationalismus ist in den vertraglichen Befugnissen des Parlaments nur ein begrenzter Stellenwert eingeräumt. Zwar hat es viel zu beschließen, aber ein souveränes Organ demokratischer Macht, das mit seinen Mehrheiten Regierungen bestellt und aus eigener Machtzuständigkeit Gesetze erlässt und ändert, wie es Parlamente sonst tun, ist dieses Parlament nicht. Die europafreundlichen Kandidaten des Europäischen Parlaments werben zwar ganz im Stil einer gewöhnlichen, nationalen Wahl beim Wahlvolk um die demokratische Delegation seiner Hoheit. Sie versprechen, die eingesammelten und zu Mehrheiten aggregierten Stimmen pflichtgemäß zur Grundlage ihrer parlamentarischen Amtsausübung im Sinne der jeweiligen Nation und eben auch des noch größeren Ganzen, i.e. Europas, zu machen. Das gleicht aber der Sache nach den Mangel des Europäischen Parlaments und seiner herrschaftlichen Befugnisse nicht aus: Bei nationalen Wahlen leiten die passiv Wahlberechtigten aus der dem Volk zugeschriebenen Souveränität ihre wirkliche und souveräne Regierungsmacht ab, indem sie sich auf die den Wählern aufgegebene freie Auswahl zwischen den Kandidaten berufen und die als den verfassungsgemäßen Akt der Begründung ihrer eigenen politischen Handlungsfreiheit interpretieren. Bei den Wahlen zum Europaparlament fehlt dagegen nicht nur die reklamierte Quelle souveräner parlamentarischer Regierungsmacht, sondern es erweist sich auch diese selbst als vergleichsweis defizitär: Es handelt sich ja um eine interessierte Fiktion, wenn so getan wird, als ob die europäischen Völker in einem neuen politischen Subjekt namens Europa bereits einen neuen Herrn gefunden hätten, dem sie im Wahlakt die Regierungsgewalt über sich einräumten. Auch wenn die schon erreichte praktische Vergemeinschaftung der EU gesetzgeberische Folgen für die Mitgliedsstaaten hat, EU-Verordnungen mit unmittelbarer Gültigkeit nationales Recht verdrängen, EU-Richtlinien in nationales Recht inkorporiert werden und EU-Bürger Klagerechte bei supranationalen Gerichtshöfen eingeräumt bekommen: Die europäischen Völker sind und bleiben vorderhand Basis und Manövriermasse in der exklusiven Zuständigkeit ihrer nationalen Herrschaften.
So verschafft die Wahl zum EU-Parlament den Gewählten zwar ein Amt in dieser Körperschaft, nicht aber die Stellung tatsächlicher souveräner Regierungsmacht über die Wähler. Art und Umfang der Kompetenzen des Parlaments sind vertraglich zwischen den nationalen Regierungen vereinbart und in der Hierarchie der Institutionen dem Rat der Regierungschefs untergeordnet: Im Rahmen der eingeräumten Zuständigkeiten ist das Parlament das Kontrollorgan einer getrennt von ihm zustande gekommenen Quasi-Regierung, der Europäischen Kommission; es hat lediglich unter schwer zu erfüllenden Bedingungen die Möglichkeit, europäische Rechtsakte zu verhindern, nicht aber das Recht zur Einbringung eigener Gesetzesinitiativen. Seine zahlreichen sonstigen Mitwirkungs- und Zustimmungsrechte macht es mit dem eifrigem Egoismus der Institution gegen Rat und Kommission geltend.
Wo das Europäische Parlament sein institutionelles Interesse unter der Fahne des demokratischen Supranationalismus geltend macht, findet das stets mit dem Charakter eines fortwährenden „Als ob“ statt: Als ob dieses Parlament wirklich ganz das Nämliche darstellte wie die Volksvertetungen der europäischen Nationalstaaten; als ob es wirklich der Repräsentant eines einheitlichen Volkswillens wäre und in dessen Auftrag unterwegs. Dabei ist das Unwahre der Bemühung stets erkennbar und führt den unaufgelösten Widerspruch des Gremiums vor. Das europäische Volk, das es zu repräsentieren behauptet, gibt es nicht; die wirklichen Souveräne sind die Regierungschefs als Europäischer Rat und damit die Instanz, die als das tatsächliche Moment des europäischen Supranationalismus fungiert.
*
Der widersprüchliche Idealismus des Parlaments wird ihm von den nationalen Regierungen und ihrem Rat durchaus zugestanden, ohne ihn aber, wie vom Parlament immer wieder gefordert, durch die Erweiterung seiner Rechte praktisch werden zu lassen. Der Supranationalismus des Parlaments basiert ja darauf, dass alle Mitgliedsstaaten aus freien Stücken und mit der Berechnung ihres Vorteils Teilnehmer der EU sind und diese Berechnungen trotz aller krisenhaften und national so unterschiedlich ausfallenden Folgen der Mitgliedschaft bis heute Bestand haben. Wenn die Abgeordneten im Parlament tätig werden, tun sie das als Vertreter ihrer Nationen in Europa; d.h. sie nehmen den Standpunkt des größeren Subjekts in ihre Berechnungen auf, bei denen sie aber den Nutzen ihrer Nationen stets unterstellen. So stoßen bei Differenzen mit Rat oder Kommission keine fundamentalistischen Gegensätze aufeinander, sondern Alternativen einer zwischen den Nationen und den EU-Instanzen strittigen Europapolitik. Dabei kombiniert das Parlament dauerhaft den Stoff europäischer Politik, wie er aus nationalen Interessen entsteht und sein Verhältnis zu den Mehrheitsverhältnissen im Parlament, zum Rat der Chefs und zur Kommission findet, mit der Demonstration des gesamteuropäischen Idealismus. Auf diese Weise begleiten gestandene Parlamentarier mit Bereitschaft zum Kompromiss die laufende praktische Konkurrenz der Nationen, die über die Jahre schon einiges an realem Supranationalismus zustande gebracht hat. Die Streitlust, die ihr europäischer Idealismus und ihr institutioneller Egoismus hervorrufen, findet sein von nationalen Gesichtspunkten weitgehend freies Betätigungsfeld in der politischen Konkurrenz um Rechte und Kompetenzen des Parlaments.
Die Parteien – Teilhaber, realpolitische Verwalter und Gegner der europäischen Supernation
Die nationalen Parteien beziehen sich auf ihre Weise auf dieses widersprüchliche Konstrukt des Europäischen Parlaments und sind selbst Teil davon: Sie verfolgen neben- und durcheinander ihre Belange als Parteien innerhalb ihrer Nationen, die ihrer Nationen im europäischen Rahmen und bisweilen eben die eines europäisch-parlamentarischen Fraktionsstandpunktes. So werden sie einmal tätig als Transporteure der Interessen ihrer heimischen Regierungen und einmal als politische Gruppierungen des Parlaments, das wiederum seine eigenen, eben manchmal europäisch-supranationalen Interessen wahrt.
Die Frage, wie denn eine gemeinsame, einheitliche europäische Räson aussehen könnte, der alle europäischen Nationen zustimmen könnten, kann und mag auch aus dem Kreis der europafreundlichen Parteien niemand genauer beantworten. Die Befürworter der Einheit Europas versichern sich gegenseitig, dass es dieses Europa im Prinzip geben solle und man ja eifrig an seinen einzelnen Elementen baue, ohne dass dabei aber die „Finalität“ der EU definiert oder gar umgesetzt würde. So halten sich die tragenden Parteien des Parlaments an eine Verfahrensweise, die die Überlegungen zum europäischen Weiß-warum im Ungefähren lässt, weil ihnen nicht daran gelegen ist, ausdrücklich die Zustimmung zur oder Ablehnung der Union auf die Tagesordnung zu setzen, was den in der Krise ohnehin prekär gewordenen Bestand an Gemeinsamkeit sprengen könnte. Schließlich haben die letzten Jahre der Krisenbewältigung besonders drastisch die schon immer gültige Tatsache vorgeführt, dass europäische Sachfragen nicht anders denn als Machtfragen auszutragen sind. Dabei hat die europäische Krisenpolitik im Zuge der Abwicklung dieser Machtfragen die EU einer europäischen Staatsräson schon ein ganzes Stück praktisch näher gebracht; formelle Beschlüsse über eine solche Räson oder ihre Institutionalisierung werden jedoch tunlichst vermieden; denn je mehr die wirkliche Vereinheitlichung der europäischen Politik vorankommt, desto eklatanter wird der Widerspruch zwischen dem gerade praktisch erreichten Stand der supranationalen Integration und der nationalistischen Ablehnung ihrer verbindlichen Formalisierung als Rechtsbestand der Union.
So lebt der ganze praktische Supranationalismus des laufenden Europa gerade davon, dass diese Frage offenbleibt; und der ideelle pflegt seine institutionelle Unehrlichkeit: Parlament und europafreundliche Parteien feiern das Ideal des geeinten Europa und einer gemeinsamen Staatsräson, die nur das Wahre, Gute und Schöne kennt, belassen es aber bei Aufrufen zum „Zusammenwachsen“, ohne genauer zu elaborieren, wie und wohin da was wachsen soll. Wo die Parteien ihren vertraglich vorgesehenen parlamentarischen Beitrag zum praktischen Betrieb der EU erbringen, werden die Idealisten Europas ganz realistisch hinsichtlich der Rolle in ihrer faktisch untergeordneten parlamentarischen Versammlung, gerieren sich weniger als Fahnenträger eines neuen europäischen Nationalismus, sondern setzen darauf, die „Europäische Idee“ durch „praktische politische Arbeit“ hochzuhalten. Den Vortrag ihrer europäischen Visionen beschränken sie dann auf geeignete festliche Anlässe und allfällige Kompetenzstreitigkeiten über die Verfasstheit der Gemeinschaft.
*
In der Ambivalenz der Parteien, die „konstruktiv“ an supranationalen Europawahlen teilnehmen, sich aber in ihren heimischen Wahlkämpfen auf das „Projekt Europa“ zur Bedienung des volkseigenen Nationalismus mit einem entschieden kritischen „ja - aber“ beziehen, entdecken die europakritischen Parteien immer nur das Eine: Sie sehen einen für das Wohl der eigenen Nation und am Ende für ihren Bestand zerstörerischen Supranationalismus unterwegs. Ihnen, die sich deswegen die Absage an Europa zum Anliegen gemacht haben, ist sowohl der emphatische Idealismus als auch der praktische Gang der europäischen Integration zuwider, die beide gleichermaßen ihr Feindbild beleben. Sie pflegen eine entschiedene Gegnerschaft gegenüber einem vereinten Europa als neuem supranationalem Subjekt, erklären – in ihren radikalen Varianten – die Absicht, den erreichten Stand der Vergemeinschaftung einschließlich der zugehörigen Institutionen zu beseitigen, und lassen sich ins Parlament wählen mit dem Versprechen, alles dafür zu tun, dass der europäische Laden einfach aufgelöst, zumindest aber auf ein für gute Patrioten erträgliches Maß zurückgestutzt werde. Dass dieser radikal europafeindliche Standpunkt als konkurrierende politische Bewegung durchgeht, die zwar versuchsweise mit politischer Ächtung, nicht aber mit den Mitteln des polizeilichen Staatsschutzes bekämpft wird, wirft ein Licht darauf, dass es die europäische Staatsräson noch nicht einmal so weit gebracht hat, dass sie von den Instanzen der wehrhaften Demokratie als schutzwürdig angesehen wird, wie dies mit rechtlichen Konsequenzen im Fall ähnlich kämpferisch staatsfeindlicher Ansagen im Rahmen der europäischen Nationalstaaten der Fall wäre.
Zum Beweis der Schädlichkeit des europäischen Supranationalismus für ihre Heimatländer beziehen die Europagegner den angeblichen Nutzen der EU auf die Souveränitätsrechte ihrer Nationen als entscheidendes Prüfkriterium und kommen – wenig überraschend – zu einem vernichtenden Urteil: Wenn sie den krisenhaften Zustand ihrer Völker und die Stellung ihrer Staaten in der politischen Machtkonkurrenz betrachten, insbesondere nach der Inanspruchnahme der öffentlichen Finanzen und der Verarmung ganzer Völker für die Rettung des europäischen Finanzkapitals, blamiert sich für einen gestandenen Nationalisten jeder behauptete Vorteil der Gemeinschaft am beklagenswerten Zustand der nationalen Handlungsfreiheit unter dem Regime der europäischen Krisenpolitik. Ein europäisches Staatsprogramm, das es einer freien Nation empfehlenswert erscheinen ließe, sich um der Vorteile willen dem damit verbundenen Schaden zu fügen, können sie weit und breit nicht entdecken. So kämpfen sie ausdauernd gegen den – wenn auch undefinierten – supranationalen Kurs der Institutionen und lassen sich in das Europäische Parlament wählen, um „Obstruktionspolitik“ zu betreiben, ganz ungerührt davon, dass sie als europäische Abgeordnete gar nicht die Kompetenzen haben, ihre Kündigungswünsche zu realisieren. Die Konkurrenz von Befürwortern und Gegnern der EU im Parlament entscheidet ja dort gar nicht über Bestand oder Nichtbestand der europäischen Institutionen. Sie zielt deswegen auf den innenpolitischen Streit der Nationen über nationale Vor- und Nachteile Europas, wo auf der Ebene der Mitgliedsstaaten mit wirklichen Folgen über deren Europapolitik entschieden wird. Dort agitieren die Gegner Europas gegen die Einordnung in einen europäischen Supranationalismus mit dem Idealismus der eigenstaatlich organisierten Nation, die allein im Stand wäre, ihren Völkern Wohlstand und Sicherheit zu stiften.
Bei allen Unterschieden zwischen den europakritischen Parteien – anders als der Front National oder die UKIP will die FPÖ nicht umstandslos die europäische Einheit beerdigen, leidet aber furchtbar unter der „Bürokratie in Brüssel“; der Front National beherrscht auch antikapitalistische und antisemitische Töne gegen den angloamerikanischen Finanzkapitalismus, den die UKIP eher gut – weil anglo – findet –, herrscht Einigkeit bei der Sprachregelung, mit der sie die Souveränitätsfrage in ein Problem der Demokratie übersetzen, in deren Namen sie den Völkern das Selbstbestimmungsrecht zurückgeben wollen. Den Widerspruch, in diesem Parlament zu sitzen und damit die Institution, die sie bekämpfen, über ihre wirklichen Kompetenzen hinaus für wichtig zu erklären, werden sie dabei nicht los. Das lässt sie reichlich kalt: Als Parteien subsumieren sie den ganzen Gehalt ihrer Politik unter ihre Gegnerschaft zu Europa, führen alle Leiden ihrer kapitalistischen Konkurrenznationen auf deren politische Verfasstheit in der und durch die EU zurück, und lassen den Vorwurf programmatischer Beschränktheit nicht gelten. Die demokratische Souveränität der Nationen und ihre Gefährdung durch die EU sei eben der alles entscheidende Punkt, von dem sich alles kleiner Gedruckte der praktischen demokratischen Parteipolitik zur Rettung von Volk und Nationalstaat abzuleiten habe. Deshalb können sie, bisweilen mit dem Gestus separatistischer Befreiungsbewegungen, locker ganze Parteiprogramme gegen Europa zusammenschreiben.
Der Europäische Rat und sein praktischer Supranationalismus
Während das Parlament das offene Ideal einer europäischen Staatsräson repräsentiert, in dem – irgendwie – unter Abstraktion von der laufenden Staatenkonkurrenz und ihren Folgen alle Nationen zu ihrem Recht kommen und sich wiederfinden können, existiert im Europäischen Rat die tätige Fassung dieses Ideals: als real existierende Konkurrenz der Staats- und Regierungschefs um den Nutzen ihrer Vergemeinschaftung und um das relative politische Gewicht, also den Stellenwert jeder Nation in der Union; allerdings müssen sie dabei immer wieder die ökonomische und politische Vormacht Deutschlands zur Kenntnis nehmen. Der Widerstand von EU-Mitgliedsstaaten, allen voran Großbritanniens, gegen eine weitere „Vertiefung“ der europäischen Integration und die Abgabe von Souveränitätsrechten zu Gunsten der Union bezieht sich materiell auf den in der EU eingerichteten Supranationalismus der praktischen Subsumtion der europäischen Nationen unter politische „Sachzwänge“ nach deutschen Maßstäben. Die Regierung Cameron erlebt mit dem Vorstoß des Parlaments, mit eigenen Figuren für den Kommissionsvorstand den Fortschritt des europäischen Volkswillens zu demonstrieren, darüber hinaus an der Front der supranationalen Symbolpolitik eine weitere Provokation. Während London die Initiative entschieden ablehnt, beschließt die politische Führung in Berlin nach anfänglich indigniertem Zögern angesichts der Amts- und Kompetenzanmaßung, die sich das Europäische Parlament mit den vom Rat gar nicht bestellten Spitzenkandidaten geleistet hat, der Affäre Zukunftsweisendes abzugewinnen.
In souveräner Abweichung vom Buchstaben der Europäischen Verträge, die dem Rat die Entscheidung über die Besetzung der Kommissionspräsidentschaft zusprechen, wird dem Parlament vom Rat unter deutscher Führung und gegen die Stimme Großbritanniens sein siegreicher Kandidat Juncker zugestanden. Das unterstreicht aufs Vorteilhafteste die Unterstützung, die Deutschland der demokratischen Idee von Europa angedeihen lässt, wie offen die Führungsmacht dem Fortschritt einer Beteiligung des Wahlvolkes an der Regierung über sich selbst gegenübersteht, und wie unhaltbar der Vorwurf ist, die Begeisterung für die europäische Demokratie leide unter dem Druck deutscher Vorschriften und deutscher Führung. Deutschland leidet jedenfalls gar nicht, sondern demonstriert, wie sehr ihm am Abbau des europäischen „Demokratiedefizits“ gelegen ist und wie gut es mit der „Stärkung des Parlaments“ leben kann – solange damit keine Relativierung deutscher Bestimmungsmacht im Rat der Chefs verbunden ist. Und das ist sichergestellt durch den ausdrücklichen Hinweis, die Anerkennung des Parlamentskandidaten stelle keinen Präzedenzfall für die Zukunft dar und der Europäische Rat behalte selbstverständlich seine nach den Europäischen Verträgen entscheidende Stellung.
So kommt die deutsche Europapolitik der Vergemeinschaftung durch Unterordnung zur ideellen Übereinstimmung mit dem demokratischen Fortschritt der Gemeinschaftsinstitutionen näher und definiert die praktische Subsumtion der Mitgliedstaaten unter die nach deutschen Maßstäben angeleitete Staatenkonkurrenz als einen Schritt hin zum Ideal der freien Vergemeinschaftung Europas.
*
Den Briten, die sich dieser Praxis und ihrer ideologischen Verklärung im Fall Juncker entgegenstellen, treten die deutschen Stimmführer des Rates entgegen: England wird, entgegen den bislang gültigen politischen Gepflogenheiten, im Zuge einer nach der Rechtslage erlaubten Mehrheitsentscheidung in dieser wichtigen Frage in die Minderheit gebracht, trotz ernsthafter Androhung von Konsequenzen hinsichtlich einer weiteren Mitgliedschaft Großbritanniens. Der britische Einwand wird im Ergebnis für irrelevant, Camerons Widerstand für übergehbar erklärt und der Europäische Rat für die Briten zu einem Gremium europäischer Statuszuweisung fortentwickelt: Insoweit wird von der deutschen Kanzlerin die Sprachregelung in Umlauf gebracht, auch für die Zukunft sei fehlende Einstimmigkeit im Rat zwar als bedauerlich, keineswegs aber als politische Katastrophe zu betrachten. So erwirtschaftet sich die deutsche Politik am Fall Juncker auch noch die schöne Gelegenheit für die Demonstration, von England nicht erpressbar zu sein, Cameron seine Isolierung in der EU – nur die demokratisch dubiosen Ungarn halten ihm die Stange – vorzuführen und das gleich noch mit entsprechenden Aussichten auf die Zukunft in einem Rat, der von nun an „ganz unaufgeregt“ und ohne jede Änderung an der Vertragsgrundlage mit Mehrheitsvoten funktionieren soll; selbstverständlich hält man dabei als deutsche Bundesregierung auch weiterhin die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU für „unverzichtbar“. Ergänzt wird das alles um die vergiftete Einverständniserklärung an Cameron und zugleich an die Adresse des Parlaments und seines Kandidaten, man sei mit Großbritanniens Führung ganz einig in der Frage, dass der Rat selbstverständlich auch weiterhin die Zuständigkeit habe, der Kommission und ihrem von Deutschland gegen Cameron durchgesetzten Präsidenten die Richtlinien der Politik vorzugeben.
*
So stellt sich die deutsche Europapolitik ganz instrumentell zum Europa-Idealismus des Parlaments, indem sie diesen bekräftigt und ihr Interesse an einer „Stärkung Europas“ demonstriert, deren Ausgestaltung für die deutschen Macher Europas selbstverständlich eine Durchsetzungsfrage bleibt, die Deutschland von Fall zu Fall für sich zu entscheiden gedenkt. Aus der Angelegenheit mit den europäischen Spitzenkandidaten soll Europa jedenfalls lernen, dass Deutschland keinesfalls Europa nach seinen Vorstellungen kommandiert und sich gerade daran als die wohlwollende Führungsmacht der EU erweist. Dieses Dementi richtet sich an die Adresse des aufgeregten europäischen Nationalismus der Mitgliedsstaaten, die an den Folgen deutscher Konkurrenzsiege, der bei ihnen lokalisierten Krisenfolgen und der wiederum maßgeblich von Deutschland durchgedrückten Austeritätspolitik zur Wiederherstellung des europäischen Kredits leiden. Sie erleben heftige soziale und ökonomische Folgen, die sie nicht anders denn als Bestreitung ihrer nationalen Handlungsfreiheit verstehen, um ihres finanzpolitischen Überlebens willen aber hinnehmen, weil sie den von Berlin garantierten EU-Kredit brauchen. Die Mitgliedsstaaten, die im Prozess der fortschreitenden Integration der EU um ihre souveränen Rechte fürchten und den Kampf um ihre politische Selbstbehauptung führen, verstehen sich aber ebenso gut wie die Deutschen auf die Instrumentalisierung supranationaler Demokratie-Ideale für ihre politischen Bedürfnisse, wenn sie um Finanzmittel zur Bekämpfung ihrer Arbeitslosigkeit fechten, die Vergemeinschaftung des europäischen Kredits auf deutsche Kosten oder Gerechtigkeit bei den Lasten der Flüchtlingsfrage einklagen. Der Fortschritt Europas zu einem integrierten imperialistischen Subjekt soll eben, darauf legt die europäische Führungsmacht wert, keinesfalls als Werk deutscher Kommandomacht gelten, und umgekehrt die Widerstände gegen die Ausgestaltung dieses Fortschritts – das geben Franzosen, Italiener und andere gern zu Protokoll – keineswegs von ihrem eigensüchtigen Staatsmaterialismus bestimmt sein. Am Ende soll als Resultat und immer neuer Ausgangspunkt der europäischen Staatenkonkurrenz nichts anderes als der wohlverstandene Wille der europäischen Völker zur Gemeinschaft zum Tragen kommen. Solange die europäischen Völker das nicht dementieren, kann man ihnen viel erzählen.