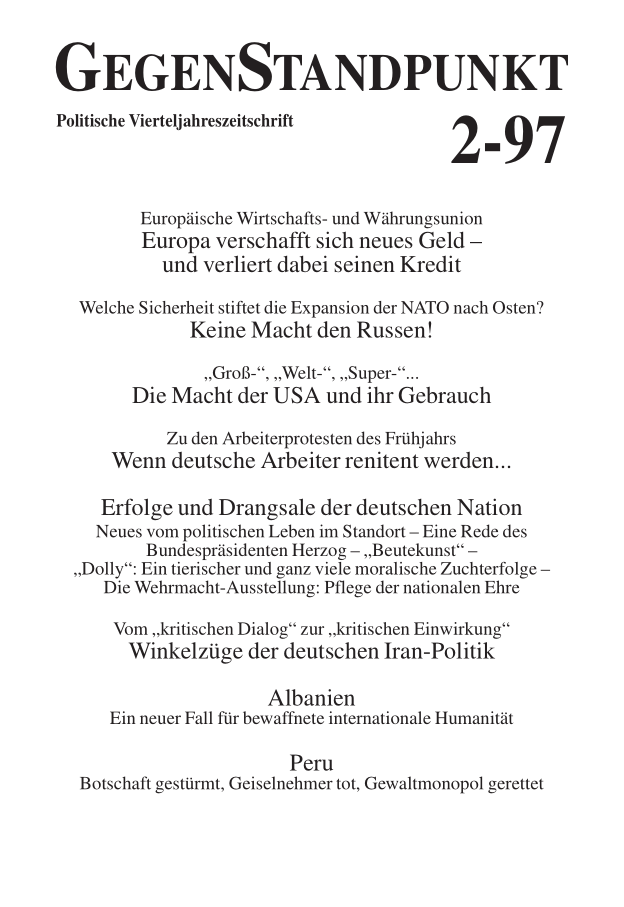Erfolge und Drangsale der deutschen Nation
Unter Berufung auf die Arbeitslosenzahlen wird der Standort auf Vordermann gebracht. „Reform“ steht für den Willen der Politik, alle Schranken für den Konkurrenzerfolg des Kapitals einzureißen. Die Untertanen übersetzen ihre Schädigung in Pflichtvergessenheit und Unfähigkeit der Regierenden bei der Beförderung des nationalen Wohls. Statt tatsächlicher Kritik pflegt die Nation eine Streitkultur – dargestellt an den Themen Bundespräsidentenrede „Aufbruch ins 21. Jh.“, „Beutekunst“, Klon-Schaf „Dolly“ und Wehrmachtsausstellung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
Erfolge und Drangsale der deutschen Nation
Neues vom politischen Leben im Standort
Im Standort Deutschland geht alles seinen Gang. Die Arbeitslosenzahlen steigen, ebenso die Börsenkurse; die Zahl der Pleiten der erfolglosen Betriebe steigt, ebenso steigen die Umsätze und Gewinne der erfolgreichen, und die der Banken sowieso. Die Nation hat ein Jahr mehr ihren zweiten Platz in der Weltrangliste der bedeutendsten Exportländer nach den großen USA verteidigt, und ihre politischen Führer treiben die weitere Anpassung von Land und Leuten an die harten Anforderungen der „globalisierten Konkurrenz“ voran.
In diesen Zusammenhang gehören die Pläne der Regierung für eine Große Steuerreform, mit der zugleich die im Lande tätigen Unternehmen entlastet, Deutschland als internationaler Investitionsstandort anziehender, Wachstum und damit Beschäftigung befördert und die Staatskasse langfristig saniert werden soll. Sie wurden mit der SPD erörtert, um die Verabschiedung der im SPD-dominierten Bundesrat „zustimmungspflichtigen“ Gesetze zu beschleunigen. Obwohl Einigkeit zwischen den Parteien darüber bestand, daß zur „Gegenfinanzierung“ des wachstumsfördernden Vorhabens, Steuerabgaben und Lohnkosten der Betriebe zu senken, die Einkommen der weniger wichtigen Bürger heranzuziehen sind, kam eine Einigung auf dem angestrebten außerparlamentarischen Weg zunächst nicht zustande: Die SPD mochte von der regierungsseitig in Aussicht gestellten „Nettoentlastung“ nichts wissen: Das staatliche Steueraufkommen schmälern – eine unmögliche Vorstellung für echte Sozis. Im übrigen fand sie die Steigerung der Staatseinnahmen über die Erhöhung der Mehrwert- und Mineralölsteuer anstelle der von der Regierung beabsichtigten Besteuerung von Mehrarbeitszuschlägen einfach sozialdemokratischer. Die Regierung mochte noch nicht von ihrem sorgfältig ausgerechneten niedrigen Spitzensteuersatz für gewerbliche Einkünfte lassen; im übrigen wollte sie sich nicht schon bis 1.7.97 zu der von der SPD vorgeschlagenen Senkung der Lohnnebenkosten drängen lassen.
Nachdem auch die Grünen ungefragt mit einem eigenen Steuerreform-Vorschlag – „sozialer als die SPD, radikaler als die FDP und haushaltspolitisch solider als die Union“ – den Beweis ihrer Seriosität und Regierungsfähigkeit als Partei der verantwortungsbewußten, fachkompetenten Besserverdiener abgeliefert hatten und dabei vor lauter Begeisterung über ihr staatstragendes Gesellenstück ganz vergaßen, den ökologischen Nutzen einer Besteuerung von Überstunden und von Mehrwertsteuerpunkten mitzuteilen, wurde die Einigung zwischen den Parteien vorerst verschoben – mit der Aussicht, sie spätestens im parlamentarischen Vermittlungsverfahren im Herbst nachzuholen.
Des weiteren wurde auf einem kleinen Parteitag der CDU und in nachfolgenden Gesprächen mit der SPD eine nicht minder Große Rentenreform auf den Weg gebracht. Trotz zahlreicher Maßnahmen zur Senkung des allgemeinen Rentenniveaus in der Vergangenheit – Nettolohnanbindung, Abschaffung des vorgezogenen Altersruhegeldes, Erschwerung der Berufsunfähigkeitsrenten, usw. – werden die Alten nämlich noch immer älter und auch noch mehr, was zur Folge hat, daß die – relativ und absolut – immer wenigeren berufstätigen Beitragszahler mit steigenden Beitragssätzen zur Kasse gebeten werden. Das hat zur Folge, wie man hören mußte, daß die hälftig am Beitrag beteiligten Betriebe kostenmäßig schwer hinter die koreanisch-tschechisch-englische Konkurrenz zurückgeworfen werden, und das konnte natürlich auch nicht folgenlos bleiben. Gemäß den Geboten der sozialen Gerechtigkeit wurde der Senkung der künftigen Renten auf ein angemessenes Prozentverhältnis zu den laufenden Netto-Durchschnittseinkommen (von 70 auf 64%) der Weg bereitet, das mit stabilen Beitragssätzen finanzierbar sein soll.
Daß in den Genuß dieser 64% bestenfalls die Minderheit der Blümschen „Eckrentner“ mit 45 Beitragsjahren kommen wird; daß der real existierende Durchschnitts-Alte bei allenfalls 50% und damit im Bereich der Sozialhilfebedürftigkeit landet, ist dabei schon weise mitbedacht worden. Der staatlichen Armenfürsorge wird derzeit ein gebührender Abstand zum tariflichen Mindestlohn der Berufstätigen gesetzlich geboten.
*
Solch radikale Maßnahmen propagieren die Herren
Staatsvertreter mit dem Argument, daß sie ihrem Volk
nicht länger zumuten können, von
Zwangseinrichtungen
drangsaliert zu werden. Diese
der Sache durchaus angemessene Kennzeichnung der
Sozialkassen fällt ihnen ein, weil der von Staats wegen
eingerichtete Sachzwang, demzufolge der Lohn der
Beschäftigten auch den Unterhalt der nichtbeschäftigten
Bestandteile des Arbeitsvolks herzugeben hat, heute
Ergebnisse zeitigt, die für ihren Staat
unzumutbar sind. Wenn dieser Sachzwang einerseits dazu
führt, daß die Lohn(neben)kosten der Unternehmer steigen,
und andererseits mit den staatlich vermehrt
eingesammelten Lohnprozenten gar nicht zu verhindern ist,
daß immer mehr verarmtes Volk auf die Sozialhilfe
verwiesen ist, dann bekommen die Verantwortlichen der
sozialstaatlichen Armutsverwaltung Zweifel am System. Es
steht dann für sie fest, daß die unbrauchbaren
Elemente ihres Volks einfach zuviel kosten.
Und diesen Befund verkünden sie volksnah, wie sie sind,
indem sie unter Berufung auf den eingerichteten Sachzwang
zum Skandal erklären, daß die brauchbaren Elemente ihres
Volks die Rechnung zu bezahlen haben. Mutig stellen sie
sich vor die zahlungskräftigen Gesunden
(Seehofer), denen die
Soziallasten schon bis zum Hals stehen
, und erklären
entschlossen, die wachsende Kritik der jüngeren
Generation am Sozialstaat und seinen Einrichtungen müsse
ernstgenommen werden
(Schäuble). Diese Volksverhetzung von
oben kommt gut an. Der Spiegel greift sie auf und titelt:
Die Alten plündern die Jungen aus
; die
Bild-Zeitung schärft den Gerechtigkeitssinn im Volk mit
einer Kampagne, in der sie skandalöse Mißverhältnisse
anprangert: Der eine zahlt Steuern, der andere
lacht.
Und dann kommen die Intellektuellen und
monieren mit der Wahl der Rentnerschwemme
zum
Unwort des Jahres
, daß beim Namen genannt wird,
wie zynisch der Staat seine Alten behandelt.
*
Daß der Abstand zwischen Lohn und Sozialalmosen durch die Senkung der letzteren und nicht durch Erhöhung des Lohns zu wahren ist, hat die gewerkschaftliche Tarifpolitik schon lange eingesehen. Sie will deshalb ihren jüngsten Vorschlag für eine Neuverteilung der Arbeit im Wege einer 32-Stundenwoche nicht mehr mit kostentreibenden Forderungen wie der nach einem vollen Lohnausgleich belasten. Wenn es auch bislang zwar immer einen vollen Leistungs-, nie aber einen „vollen Lohnausgleich“ für Verkürzungen der Regelarbeitszeit gegeben hat – die Kapitalisten haben sich die stets mit viel „Lohnzurückhaltung“ und neuen Freiheiten in Sachen Arbeitsorganisation bezahlen lassen –, so ziehen die Gewerkschaften jetzt auch die Illusion aus dem Verkehr, man könne zur Behebung der Arbeitslosigkeit die vorhandene Arbeit zu bestehenden Konditionen einfach umverteilen. Sie haben sich endlich auch offiziell die Klagen der Unternehmer einleuchten lassen, daß die Neueinstellung von „Mitarbeitern“ vor allem mit Kosten verbunden ist, weshalb sie dafür gleich vorab die Mitglieder ihres Vereins mit Lohnabschlägen in Haftung nehmen. Die Bedenken des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, die dergestalt gekürzten Einkommen würden dann bei vielen nicht mehr für den Lebensunterhalt reichen und die Betroffenen in Zweitjobs oder Schwarzarbeit „abdrängen“, was ja auch nicht Sinn der Sache sein könne, teilt die Interessensorganisation der Werktätigen offenbar nicht. Sie sieht da noch einigen Spielraum, den man „arbeitsmarktpolitisch“ nutzen könne, und findet den ablehnenden Gegenvorschlag der Unternehmer, statt einer neuen Regelarbeitszeit von 32 Stunden einen „Arbeitszeitkorridor“ von 30 bis 40 Stunden einzurichten, in dem die Belegschaft auf ihre allfällige Verwendung – natürlich ohne Mehrarbeitszuschläge – warten könnte, jedenfalls „interessant“.
*
Auf diese Weise kommt alles, was die für die Pflege des Standorts Verantwortlichen für unabweisbar halten, recht gut voran. Wo die Bundesregierung an Subventionen sparen will, tut sie es und legt Teile des deutschen Steinkohlebergbaus still – und mit ihm zusammen einen Großteil vom Rest eines ehemals angesehenen Berufsstands; wenn führende deutsche Stahlkapitalisten es zum Wohle ihres Geschäftserfolgs für nötig erachten, ihre Betriebe zusammenzulegen, so tun sie es – daß das Ganze ihrer neuen Belegschaften erheblich kleiner ausfällt als die aktuelle Summe ihrer Teile, gehört selbstredend mit dazu. Insbesondere Bauunternehmen wollen sich grundsätzlich kaum mehr um die Rechtsverbindlichkeit ihrer Verträge kümmern – die „Branche ist in der Krise“, und wo zum Ausweg aus derselben gehobelt werden muß, haben die Späne nichts zu lachen. Das alles und noch etliches mehr an Maßnahmen einer „Sanierung“ des Standorts, bei der die benötigte Arbeit immer weniger und immer billiger wird, wickeln die Verantwortlichen ab, und zwar reibungslos. Denn auf Seiten der Betroffenen besteht einfach kein Bedarf danach, irgendwie den banalen Grund ins Auge zu fassen, weswegen die „Wachstumskrisen“ bei Stahl, Kohle und im Baugewerbe – um nur diese Beispiele zu nennen – so zwangsläufig den Ruin ihrer Existenz nach sich ziehen; also gibt es auch keinen, der sich gegen Kapital und Staat zur Verteidigung des Interesses überhaupt nur aufbauen wollte, das ihm praktisch beschnitten wird. Die Gewerkschaften sind inzwischen auch dafür zu haben, „daß geltende Tarifverträge nicht mehr angewandt werden“.
Was es stattdessen als Reaktion auf die kapitalistische Standortpolitik und ihre praktischen Folgen gibt, ist eine Fundamentalkritik anderer Natur: Die Vertreter von Staat und Kapital werden beide zu ungefähr gleichen Teilen wegen des Vergehens kritisiert, verlangte Dienste am Gesamterfolg der Nation schuldig zu bleiben. Alle, die bloß passiv Betroffenen wie auch die Aktivisten der Standortsanierung selbst, haben vom Zustand der Nation die Auffassung, daß der erstens untragbar ist und dies zweitens deswegen, weil irgendwie alle ihre fälligen Beiträge zum nationalen Kollektiv schuldig bleiben: Bauarbeiter protestieren durchaus, im Verein mit ihrer Gewerkschaft, die sie in einen tarifrechtsfreien Raum entlassen hat – gegen Ausländer nämlich, die auf deutschen Baustellen werkeln, also Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen, die ihnen gebühren. Dieselbe patriotisch-faschistische Gesinnung, die vom eigenen Schaden auf Pflichtversäumnisse an höherer Stelle schließt, legen deutsche Bergleute an den Tag, wenn sie aus der Tradition ihrer Staublungen wie aus der ihrer erbrachten Dienste für die Industrie des Vaterlandes ihr Recht ableiten, ihm weiterhin unter Tage dienen zu dürfen. Leute, die ihr Leben lang Stahl gekocht haben, demnächst aber nicht mehr dürfen, ernten jede Menge Respekt seitens politisch verantwortlicher Kreise – wenn sie ihr Los mit dem einer deutschen „Zukunftsbranche“ identifizieren und diese den Machenschaften raffgieriger Geldsäcke überantwortet sehen. Und wie alle noch in Arbeit Befindlichen ohnehin, regen sich auch die Empfänger sozialer Dienstleistungen überhaupt nicht über die auf, die ihnen ihr Schicksal verordnen. Sie wären wirklich die Letzten, die sich die Verteidigung ihres „Besitzstandes“ nachsagen ließen – dafür kennen auch sie jede Menge aus ihren eigenen Reihen, die mit „Mißbrauch“ von Rechten und überzogener Anspruchshaltung das Gemeinwesen schädigen.
Wenn dieser in allen betroffenen Volksgruppen und arbeitenden Ständen, aber auch in den Reihen des Führungspersonals des Standorts verbreitete Geist, alles und jedes in eine Pflichtverletzung beim Dienst am allgemeinen Wohl zu übersetzen, die politische Führung aufs Korn nimmt und eine wirklich entschlossene Führung vermißt, findet das faschistische Ressentiment gegen die demokratische Routine bei der Abwicklung der entscheidenden Fragen im Standort zu seinem polemischen Höhepunkt: Da wird eine Steuerreform angekündigt, die für die erfolgreiche Zukunft von Wachstum und Beschäftigung die entscheidenden Weichen stellen soll – und dann kriegen die Verantwortlichen sie einfach nicht hin! Daß die verhandelnden politischen Parteien jeweils für sich den Standpunkt des Allgemeinwohls reklamieren, gegen den zu verstoßen sie dem Kontrahenten ankreiden – „Wir vertreten hier das Volk!“ (Lafontaine); „Die SPD schädigt das Gemeinwohl!“ (Waigel) –, und dem politischen Gegner die Schuld am Scheitern der eigenen gemeinnützigen Bestrebungen wegen seiner niederem, d.h. parteitaktischen Motive zuschieben, gehört noch zu den üblichen Umgangsformen, die dem aufgeklärten Bürger und erst recht dem professionellen Kommentator geläufig sind: „Schuld sind immer die anderen“ (SZ). Daß aber das – noch dazu von allen als vorläufig gewußte – Nichtzustandekommen der Einigung zum Thema Steuerreform als Skandal genommen und zu einem Indiz für ein umfassendes Versagen der Politik vor einem akuten Notstand der Nation verallgemeinert wird, ist schon nicht mehr so normal. Wenn Zeitungen, vom Standpunkt einer ideellen Gesamtbetroffenheit durch schlechte Staatskunst aus, mit der Schlagzeile aufwarten: „Steuergespräche gescheitert! Politiker lassen uns im Stich!“, dann gehen sie offenkundig davon aus, daß ihre Leserschaft keinesfalls unter den zu erwartenden höheren Steuern, wohl aber unter einem Mangel an politischer Führung zu leiden hätte – und das ist dann der Skandal.
Spätestens dann, wenn auch noch das überparteiliche Staatsoberhaupt demonstrativ nicht mehr an sich halten mag, in einer veritablen „Strafrede“ das staatsbürgerliche Unwohlsein der guten Deutschen zusammenfaßt und vom Standpunkt des Staats der Parteipolitik samt dem Volk quer durch alle Klassen „die Leviten liest“, wird deutlich, daß dies außerhalb des gewöhnlichen politischen Geschäftsgangs fallen soll. Das übliche demokratische Procedere, in dem man mit Druck und Erpressung, Verlockung, Täuschung und Spaltungsversuchen im gegnerischen Lager mit diesem zu einem schönen Kompromiß zu kommen sucht, erscheint inzwischen hierzulande allenfalls für „konjunkturelle Schönwetterzeiten“ als tragbar – keinesfalls aber „in Zeiten existentieller Herausforderung durch die Globalisierung“, und schon gleich nicht bei „dem drängenden Gewicht der Beschäftigungsprobleme“. Klassen kannte man ja ohnehin nie, aber in solchen Zeiten kennt man auch keine Parteien mehr – was allein zählt im Umgang aller Deutschen miteinander, ist nur mehr „das Bewußtsein, in gemeinsamen Interessen verbunden zu sein“. An dem Bild hat der fundamentalkritische Geist der Republik sein Maß.
Wenn amtierende, repräsentierende oder nur öffentlich-rechtlich räsonierende Demokraten ihren Standort und seine politischen Regenten obendrein in Grund und Boden kritisieren, steht selbstverständlich keine Revolution ins Haus. Aus allem, was so daherkommt wie die Propaganda eines wohl unbedingt fälligen, radikalen Umsturzes dieser in jeder erdenklichen Hinsicht untragbaren Verhältnisse, spricht genau das umgekehrte Bedürfnis. Es sind entschlossene Fanatiker des kapitalistischen Geschäftserfolgs, die in ihrer Nation, die sie für ihn eingerichtet haben, unerträgliche Fesseln entdecken. Die daher den Titel der „Reform“, die unbedingt zu erledigen ist, für den Zweck gepachtet haben, diese Fesseln loszuwerden, und denen alles, was sie dabei unternehmen, nie weit genug geht. In sein Recht gesetzt sieht sich dieser Radikalismus allemal: Die nicht zufriedenstellenden Zahlen des nationalen Wachstums und der Arbeitslosigkeit im Land, die ihm schon wieder nur fehlendes Wachstum signalisieren, sind ihm untrügliches Indiz, daß alle seine bisherigen Schritte ihrer „Bekämpfung“ „noch nicht gegriffen“ haben – also noch viel konsequenter weiterzutreiben sind: Alle vorhandenen Hebel zur weiteren Verarmung derer, die Arbeit haben, und auch derer, die keine haben, gehören nur umso entschlossener angepackt. Gegenüber den betroffenen Arbeitenden und Arbeitslosen, denen dieser reformerische Elan seine Werke widmet, setzt er sich natürlich auch ins Recht. Einmal als das Hindernis des Standorterfolgs entdeckt, bleibt ihr Lebensstandard das auch; jedes Niveau, auf das er schon abgesenkt wurde, begründet den Antrag an die Verantwortlichen, ihr Reformwesen zügig voranzutreiben: Weil „die Menschen in Deutschland heute reform-, innovations-, aber auch opferbereiter sind, als ihre Vertreter glauben“, begehen letztere ein einziges Verbrechen, wenn sie ihr Volk nicht in den Genuß einer Politik kommen lassen, bei der „Innovationen und Opfer“ einfach nicht voneinander zu scheiden sind.
*
Die Zahlen zu „Wachstum und Beschäftigung“ sollen andernorts vergleichsweise viel besser ausfallen, dort nämlich, wo die Konkurrenz, mit mehr Tatkraft und Rücksichtslosigkeit als in Deutschland gesegnet, nicht lange gefackelt, sondern gleich ordentlich hingelangt und gerade dadurch ganze Jobwunder bewirkt haben soll.
In den „Reformländern“ Großbritannien, USA und Holland wurden und werden „rigoros Sozialstandards abgebaut, Löhne gesenkt, Gewerkschaften entmachtet, Mindestlöhne aufgehoben, Arbeitsverträge einzeln ausgehandelt, … zu Zehntausenden gutbezahlte Angestellte durch Zeitarbeiter ersetzt, die jederzeit gefeuert werden können“; Arbeitszeiten werden verlängert, Renten und Sozialhilfe gekürzt, und durch Billigarbeit trotz „Rekordgewinnen und beginnender Arbeitskräfteknappheit“ „die Schicht der sogenannten working poor“ in großem Maßstab wiederbelebt. Dies alles durch „fast schon erbarmungsloses Einprügeln“ (Spiegel) auf die Gewerkschaften, wie in England; oder durch tätige Mithilfe der „demütigsten Gewerkschaften der Welt“ (niederländischer Arbeitgeberpräsident Blankert), wie in Holland.
Trotz aller in Deutschland an den statistischen Methoden der Arbeitslosenzählung in den gelobten Ländern gepflegten Zweifel – „die Amerikaner zählen jeden Minijob, auch wenn er nur eine Stunde pro Woche dauert …, in Holland ist nicht die Beschäftigung, sondern die Zahl der Beschäftigten (durch Teilzeit) gestiegen …, die Briten lassen einfach Arbeitslose aus der Statistik verschwinden“ (Spiegel) – bleiben sie, offenkundig weniger wegen ihrer Resultate als wegen ihrer Methoden, Vorbilder und Maßstab der Kritik am eigenen Laden.
Dabei bezieht sich dieses internationale Vergleichswesen bei Arbeitslöhnen und Beschäftigungslagen überhaupt nicht darauf, daß es sich in den genannten „Reformländern“ eben auch um Varianten nationaler (Miß-)Erfolgswege in der und durch die Krise des Kapitals handelt. Es ignoriert auch, daß es eine lohnende Beschäftigung billig gemachter Arbeit natürlich auch in Deutschland gibt, die mit genau denselben Methoden durchgesetzt wird wie anderswo; mit welchen auch sonst. Vielmehr will man sich von den USA und anderen Vorbildern nahebringen lassen, was der hiesige Standort in seinem Vergleich zu anderen Konkurrenten womöglich noch zu erledigen hätte. Da erscheint dann der in den USA schon immer bestehende „Markt“ für Tiefstpreis-„Dienstleistungen“ als eine Errungenschaft, die es auch hier unbedingt braucht. In der Herstellung einer dazu nötigen, soliden Tradition des Massenelends, die es in den USA auch schon immer gibt, hat die Zerschlagung des hergebrachten Systems sozial- und arbeitsrechtlicher Berechtigungen dann ihren wirtschaftlich vorwärtsweisenden Sinn. Vielleicht kriegt man auch hierzulande eine Lage hin, in der Zeitarbeitsfirmen massenhaft „Jobs schaffen“ und, wie die Firma Manpower in den USA, zu den größten „Arbeitgebern“ werden. Das wäre insbesondere deswegen so praktisch, weil sich im hiesigen Standort die Firmen zum Zweck der Steigerung ihres Umsatzes und Ertrags überwiegend auf die radikale Tour der kostensenkenden Massenentlassung konzentrieren. Angesichts des bekannten „Problems Nummer eins“, das darüber nur größer wird, mag sich der über die Ländergrenzen schweifende Blick auch gar nicht mehr an den Erfolgen der führenden deutschen Weltmarkt-Mitbeherrscher und ihrer nach wie vor überragenden Stellung in vielen Abteilungen der Konkurrenz freuen: Er beklagt die hohen Arbeitslosenzahlen und hinsichtlich des nationalen Wachstums insgesamt dessen verringerten Zuwachs auf hohem Niveau, um in dem Umgang mit „Beschäftigung“, wie er in anderen Standorten gepflegt wird, einen Konkurrenzvorteil gegenüber dem hiesigen zu erspähen. Dort macht man „es“ besser, wobei dieses „es“ das Desiderat meint, aus den nichtbeschäftigten, kapitalistisch ungenutzten, aber potentiell Reichtum schaffenden und kapitalistisch nutzbaren Volksteilen Quellen nationalen Wachstums zu verfertigen. Der Ergebnisstand beim staatlichen Umgang mit Arbeitenden und Arbeitslosen gerät da vergleichenden Standortpatrioten zum fiktiven Indiz, wie es um den Vergleich der nationalen Kollektive insgesamt bestellt sei, die ums Wachstum konkurrieren. Und selbstverständlich münden auswärtige Erfolge und heimische Niederlagen bei der Lösung des „Beschäftigungsproblems“ in die schon bekannten praktischen Konsequenzen ein. Weil die Nation bei der nutzbringenden Erschließung ihres ja bereitliegenden „Humankapitals“ im Hintertreffen ist, wegen ihrer im Vergleich zu anderen Standorten zuvielen Arbeitslosen, hat die Politik dafür Sorge zu tragen, daß die Nation nicht noch weiter ins Hintertreffen gerät. Daher gebietet im Namen des nationalen Konkurrenzerfolgs ein „Jobwunder“ anderswo erst recht und schon wieder die rigide Anwendung des ganzen Katalogs von Maßnahmen, mit denen hier die billige nationale Arbeitsarmee formiert wird. In die darf sich einreihen, wer gebraucht wird. Für die wachsende Zahl der übrigen Volksgenossen, die durch die fälligen Rationalisierungen überflüssig gemacht werden, wird aber auch etwas getan. Spätestens jetzt nämlich wissen sie auch noch die ausländischen Adressen, gegen die der Kampf ums Wachstum geht, bei dem sie auf ihre Weise auch dabei sind.
*
Nach diesem Muster geht es weiter im deutschen Standort. Unter Berufung auf die Notwendigkeit, Arbeit herbeizuschaffen für die vielen Arbeitslosen, wird Politik betrieben – und Zweck wie Inhalt der Politik ist alles andere als die Herbeischaffung von Arbeit. Jede Menge wird da zu dem vorgeblichen Zweck auf den Weg gebracht, diejenigen, die Arbeit zu geben haben, zur praktischen Ausübung ihres Berufs zu ermuntern. Da die aber nach ihren eigenen kalkulatorischen Gesichtspunkten entscheiden, ob sie arbeiten lassen oder nicht, und der Ausgang ihrer Kalkulation darüber entscheidet, wie es um den Stand der Beschäftigung bestellt ist, paßt der große Zweck, dem die politischen Werke gewidmet sind, nie auf das praktische Ergebnis, das sie herbeiregieren. Diesem betrüblichen Resultat ihres Wirkens tragen seine Urheber Rechnung. Erstens dadurch, daß sie unverdrossen daran festhalten, daß weiterhin so gut wie alles, was sie tun, wegen der Arbeitslosen zu tun ist; und zweitens dadurch, daß sie weit von sich weisen, daß etwas anderes oder mehr für die getan werden kann, die arbeitslos sind. Also senken sie auf jeden Fall schon einmal die einschlägigen Steuern und entlauben ihren Sozialstaat, damit Kapitalisten hinlänglich Anreize „für Beschäftigung“ finden – und sagen gleich dazu, daß an einen „Durchbruch auf dem Arbeitsmarkt“ in absehbarer Zukunft überhaupt nicht zu denken sei. Am Ergebnis lassen sie ihren Kampf gegen Arbeitslosigkeit nicht messen.
Eingefleischte Vertreter der Rechte des nationalen Arbeiterstandes, die in jedem Kapitalexport Vaterlandsverrat wittern und angesichts der Arbeitslosen „bei uns“ den „Export von Arbeitsplätzen“ an den Pranger stellen, erweisen gleichfalls dem Prinzip ihre Reverenz, daß einem Standort, der im Erfolg seines Kapitals auch seinen Erfolgsweg hat und weiß, letztlich die Hände gebunden sind, für die vielen Arbeitslosen etwas zu tun. Glatt ein Plädoyer für Globalismus läßt sich dann gewerkschaftlichen Nationalisten entlocken, die zur Einsicht vorgedrungen sind, daß eben der Konkurrenzerfolg des Kapitals die absolute Lebensbedingung des nationalen Standorts ist. Mit dem Bemerken, „daß die deutsche Industrie zwangsläufig in vielen anderen Ländern der Welt investieren muß, wenn sie auf Dauer ihre Rolle auf dem Weltmarkt behaupten will“ (Zwickel), nehmen sie die Unternehmer vor dem Vorwurf undeutscher Umtriebe in Schutz, der ihnen selbst auf der Zunge liegt.
Freilich – neben dem vielen, was sie wegen ihrer Abhängigkeit vom Erfolg des kapitalistischen Geschäfts an beschäftigungsfördernden Maßnahmen für die außer Dienst gestellten Produzenten des Wachstums leider schuldig bleiben müssen, tun Politiker schon auch noch positiv etwas für die vielen Betroffenen. Unter Berufung auf gewisse leidvolle Erfahrungen, denen zufolge brave, arbeitslose Bürger für un- und antidemokratische Umtriebe anfällig werden, nehmen die herrschenden Demokraten dem Volk das einzige Stichwort, das es noch zu stammeln vermag, aus dem Mund: „Arbeitsplätze!“ – diesen Antrag erklären sie zum Inbegriff ihrer demokratischen Pflicht. Wer den stellt, sich also bedingungslos zur Abhängigkeit vom Kapital als seinem Lebensmittel bekennt, kriegt von ihnen lauthals Recht. Als Anhänger ihrer selbstbewußten Knechte, haben sie viel Verständnis dafür, daß die mehr Arbeit brauchen, rentable nämlich, und mit dieser Vorgabe landen sie ein ums andere Mal zielsicher bei der Diagnose, daß der Lohn in allen Formen das Hindernis für mehr Beschäftigung ist. Aus ihren mittelmäßigen Erfolgen bei den Kämpfen an der Beschäftigungsfront ziehen sie stets denselben Schluß, nämlich noch immer zu wenig für die Befreiung des Kapitals von den Zwängen und Lasten getan zu haben, die sie vornehmlich in den Kosten bilanzieren, die die Arbeit für das kapitalistische Rechnungswesen und gleichermaßen für die Kassen des Staates verursacht. Dieser Schluß gebietet dann von selbst, immer noch nachhaltiger, immer noch rücksichtsloser gegen „alte Besitzstände“ vorzugehen und endlich „richtig“, „ohne Tabus“ und „falsche Rücksichten“ und möglichst mit „einem Ruck durch die ganze Gesellschaft“ das Ensemble von Innovation und Opfer voranzutreiben. Und wo demokratische Politiker ihren willigen, aber nicht gebrauchten Knechten so vorrechnen, daß sie und ihre Klassenbrüder letztlich selbst schuld sind, wenn so viele keine Arbeit haben, können sie auch noch stolz darauf sein, daß sich ihr Zynismus nicht mit dem von Hitler deckt.
Da sich einiges herbeiregieren läßt, die gewünschte Korrektur von Wachstums- und Arbeitslosenstatistiken aber nicht, bedarf es ihrer laufenden Klarstellung, auf dem genau richtigen „Kurs“ unterwegs zu sein. Nie und nimmer ist die periodische Bekanntgabe erneut ernüchternder Wachstums- und Beschäftigungszahlen als Eingeständnis der Schwindels der offiziell in Kraft gesetzten Zwecksetzung aller Politik gemeint; als Einwand gegen die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges ist sie schon gleich nicht zugelassen. Vielmehr ist sie ein einziger Auftrag, diesen Weg auch in Zukunft ohne Zögerlichkeiten zu verfolgen. Was sich nach herrschender Meinung allenfalls laufend blamiert, ist der „naive“ Glaube an „Patentrezepte und Wundermittel“, die zu leichten und schnellen Erfolgen verhelfen könnten. Weil es die nicht gibt, gilt umgekehrt nur das Versprechen schwerer und dauerhafter Opfer als „seriös“, und nur der Politiker ist ein wahrer „Hoffnungsträger“, der in Aussicht stellt, sie mit „Ausdauer, Tatkraft und Mut“ der Nation aufzuerlegen. Auf diese Weise nehmen die amtierenden Machthaber immer schon vorab zusammen mit ihren Maßnahmen die Kritik an deren Unwirksamkeit vorweg. Sie bezweifeln schon einmal höchstpersönlich, ob die Lohnhöhe wirklich der „entscheidende Punkt“ sei, an dem der Standort kranke, und dementieren selbst die Wirksamkeit von Steuer- und Sozialreformen, wenn da nicht auch das sonstige „Umfeld“ bei Forschung und Entwicklung, die Reform der öffentlichen Verwaltung, ihre Deregulierung, der Subventionsabbau und die positive Einstellung der Bevölkerung stimmt … Das tun sie natürlich nicht, um ihre Rezepte für „Beschäftigung“ aus dem Verkehr zu ziehen, sondern um zu bedeuten, daß jede einzelne ihrer unwirksamen Maßnahmen jedenfalls und ganz unbedingt „sein muß“.
*
So begleitet die monotone Wiederholung der immergleichen Leitidee, nur eine immer noch freiere Freisetzung des Kapitals, nur die weitere Verringerung seiner Kosten, nur die noch konsequentere Unterwerfung des verbliebenen Arbeitsvolks unter seine Bedürfnisse könne das kränkelnde Land gesunden lassen, das hartnäckige Ausbleiben durchschlagender politikverwertbarer Erfolge. Und weil Widerstand gegen die politischen Machenschaften nicht vorhanden ist, treibt die demokratische Streitkultur neue Blüten hervor.
Das einzige Hindernis, auf das die Regierung bei der Realisierung ihrer Variante von Standortsanierung stößt, ist der Wille der Opposition, auf ihrer Variante zu bestehen. Diesem Willen verleiht sie mit ihren institutionellen Erpressungsmitteln in der von ihr beherrschten Länderkammer Nachdruck, womöglich deshalb, weil sie ihre Variante für die bessere „Problemlösung“ hält, ganz sicher aber deswegen, weil sie sie für unverzichtbar zur Demonstration von Kompetenz, Eigenständigkeit, Durchsetzungswillen, kurz: von „Regierungsfähigkeit“ hält. Konsequent wirft die Regierung der Opposition, in Anerkennung der Gemeinsamkeit der Zwecke, im Falle des Streits um die Steuerreform daher „Obstruktion“ vor. Der Opposition, die sich allenfalls als der noch konsequentere Steuereintreiber zu profilieren gedenkt, bleibt hinsichtlich dieser Absichten an der Regierungspolitik nichts mehr „bloßzustellen“ oder zu „entlarven“ – also sucht sie mit dem Vorwurf zu punkten, die von der Regierung vorgesehenen Maßnahmen liefen doch absehbar auf eine Verfehlung des gemeinsamen Zweckes hinaus. Der sachliche Blödsinn der im Hin und Her der Lager ausgetauschten „Argumente“ – ob nun eine Steuerreform mit oder ohne „Nettoentlastung“ und deren „Gegenfinanzierung“ durch Steuern auf Benzin, Überstunden, Renten oder alles zusammen „mehr Arbeitsplätze schafft“ – ist bei ihrem Streit unverzichtbar. Die Arbeitslosen brauchen nämlich nichts dringender als einen „Machtwechsel in Bonn“, so daß jeder, der an die Macht will, dies unter Berufung auf sie als seinen wahren Auftraggeber betreibt: Wegen ihnen muß er an die Macht. Für sie regiert er dann das Elend auf dieselbe Weise wie die, die jetzt an der Macht sind.
An „die Arbeitslosen“ muß eigentlich ohne Unterlaß gedacht werden. Deswegen ist es unter den Parteien eingerissen, sich wechselweise unter Bezugnahme auf die für die Arbeitslosen fälligen Taten aufzufordern, von „Parteitaktik und Prestigespielchen“ Abstand zu nehmen. Wenn dann eine von ihnen mit der anderen nur reden will, wenn dem eigenen Chef der leibhaftige Kanzler gegenübersitzt; wenn die andere mit ihr nur dann redet, wenn sie ihr die 50 Meter zum gewünschten eigenen Verhandlungsort entgegenkommt; und wenn dann in diesem erbitterten Streit um die Sache die eine oder die andere Seite nachgibt, legt sie größten Wert auf die Feststellung, daß sie dies nur um der Arbeitslosen willen tue; sie jedenfalls sei nicht, wie die andere, dazu bereit, deren Wohl parteilichen Berechnungen zu opfern.
Weil die Parteien in der Sache grundsätzlich einig sind, und weil Widerstand gegen ihre Vorhaben ohnehin nicht existiert; weil Einsprüche gegen allzu große „Rücksichtslosigkeiten“ bei der Neudefinition der Lebenslagen ihrer Bürger, wenn überhaupt, dann ausgerechnet von so Typen wie Geißler und Süßmuth kommen, für die die Nestwärme des Sozialstaats auf jeden Fall erhalten bleibt, wenn nur die „Einschnitte“ in ihn nicht so schnell vollzogen werden; weil solche Einsprüche nur die Logik der eigenen Werbung erst recht scharf machen, daß man sich durch irgendwelche soziale Empfindlichkeiten auf gar keinen Fall „handlungsunfähig“ zeigen darf; weil die demokratischen Parteien durch einen vielstimmigen Chor von der Bildzeitung bis zum Bundespräsidenten ohnehin nur dazu aufgefordert werden, „Führung“ zu üben und „endlich zu handeln“ – : Deswegen spitzt sich bei den schon seit längerer Zeit verantwortlich Handelnden und bei denen, die sie gerne ablösen würden, alles auf die Frage zu, wer sich bei den nächsten Wahlen beim Volk das Mandat als führender Handlungsbevollmächtigter der Republik abholen wird.
Diese Frage wird derzeit im Vorfeld des Wahlkampfes mit allen bekannten Zutaten des demokratischen Führerkults angegangen: Kohl schafft sich einen Vorsprung, weil er erneut so entschlossen zur Führung entschlossen ist, daß er zur Ankündigung seiner Kandidatur nicht einmal das Ende seines Entfettungsurlaubs abwarten kann, sondern sich aus den Ferien und ohne das Plazet seiner Partei anmeldet. Das beschert der Konkurrenz ein Problem, weil die noch mehrere Interessenten hat, die zur „Übernahme von Verantwortung“ bereit wären und die sich jetzt erst einmal gegenseitig ausstechen müssen. Dabei gelingt Schröder derzeit die Kombination von geheuchelter Disziplin und demonstrativ berstender Führungswut so gut, daß er seit Monaten der Quotenkönig der Demoskopen ist. Soweit zum immerwährenden faschistischen Potential der laufenden deutschen Demokratie.
Ein großer Redner, dem man einfach glauben muß
Skandal beim „Aufbruch ins 21. Jahrhundert“: Keiner will ihn, keiner wagt ihn, und überhaupt weiß nur einer, wie er geht
Einer wie der Präsident Herzog kommt nicht nur viel herum in der Welt. Der zählt zu den ganz wenigen, bei denen die Erfahrungen, die er bei seinen Reisen macht, immer haarscharf dem Bild entsprechen, das er von der betreffenden Landesregion hat, in der er gerade weilt. So war er kurz vor seiner „Großen Berliner Rede“ in Regionen, in denen diese wuseligen gelben Völker nie rasten und ruhen wollen. Und obwohl ihm bei seinen Visiten naturgemäß wenig Zeit bleibt für genaues Beobachten – Herzog hat sie sofort erkannt, die Tiger in den Staaten dort:
„Ich komme gerade aus Asien zurück. In vielen Ländern dort herrscht eine unglaubliche Dynamik. Staaten, die noch vor kurzem als Entwicklungsländer galten, werden sich innerhalb einer einzigen Generation in den Kreis der führenden Industriestaaten des 21. Jahrhunderts katapultieren. Kühne Zukunftsvisionen werden dort entworfen, und sie beflügeln die Menschen zu immer neuen Leistungen.“
So einen erwischt es dann freilich nur umso härter, wenn er wieder in seine heimatlichen Gefilde zurückgekehrt ist. Kaum zuhause, ereignet sich schon wieder diese Koinzidenz von Sinn und Sinnlichkeit, nur eben diesmal in einem eher niederschmetternden Befund vereint:
„Was sehe ich dagegen in Deutschland? Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft.“
Nun ist Herzog robust genug, sich von einem Kulturschock dieses Ausmaßes nicht umhauen zu lassen. Ganz so alleine steht er ja auch nicht da mit seinen Depressionen, wie sehr sich sein trübes Land in Depressionen ergeht. Irgendwo weiß er schon auch, daß er keine Überzeugungsarbeit nötig hat, weil alle anderen seiner Landsleute sowieso schon so denken wie er. Und deren Präsident ist er ja immerhin auch; also dazu befugt, jedermann mitzuteilen, wie sehr ihm mißfällt, was er in Deutschland „sieht“. Er kann erwarten, daß seine Sicht der Lage der Nation bei all denen den nötigen Eindruck hinterläßt, die für ihre Geschicke verantwortlich sind. Daher läßt er die versammelte Riege der deutschen Verantwortungsträger live – das Fußvolk der Nation zeitversetzt – an der Aufarbeitung seines Urlaubserlebnisses teilhaben, damit dessen „Impulse auf ganz Deutschland ausgehen“.
Der Ernst der Lage
Der Präsident weiß, daß in jedem Menschen ein guter Kern steckt, er im Grunde also sein Publikum nur eindringlich mit dem Ernst der Lage vertraut machen muß, damit sie sich zum Besseren wende. Vielleicht weiß man hierzulande ja auch nur nicht so genau, wo die wahren Probleme sitzen. Also hebt er an:
„Ich will heute abend kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern die Probleme beim Namen nennen. Was ist los mit unserem Land? Im Klartext: Der Verlust wirtschaftlicher Dynamik, die Erstarrung der Gesellschaft, eine unglaubliche mentale Depression – das sind die Stichworte der Krise.“
Ganz genau bei ihrem Namen benannt und im Klartext ausgesprochen, entpuppen sich die Probleme des Landes allerdings gleich wieder als dieselben, die er schon zu Beginn „gesehen“ hatte – ein Volltreffer, der nur zeigt, wie richtig der Redner mit seiner Diagnose liegen muß. Neu hinzu kommt nur die Sache mit der „wirtschaftlichen Dynamik“. Diese gibt es, wie auch schon bekannt ist, im Osten – „ich komme gerade aus Asien zurück…“ Aber auch im Westen, in „Amerika und seinem leergefegten Arbeitsmarkt“, wie der Präsident dank ausgiebiger Feldforschung weiß. Nur hier ist sie nicht. Vielmehr fehlt sie hier sogar, weil sie nämlich verloren wurde. Nun sucht ein Staatsmann, der bei seiner Wirtschaft die „Dynamik“ vermißt, freilich nicht in seiner „Wirtschaft“ nach dem Grund, weswegen ihr Wachstum, auf das er scharf ist, nicht zustandekommt. Für den hängt die „Dynamik“ der Wirtschaft ganz eng mit einem Dynamo zusammen, der sich dreht, und wenn er das nicht tut, ist seine „Erstarrung“ der Grund, dessentwegen das Wachstum ausbleibt:
„Und der Verlust der wirtschaftlichen Dynamik geht Hand in Hand mit der Erstarrung unserer Gesellschaft.“
Auch ein so guter Redner wie Herzog erwischt nicht immer das passende Bild, denn selbstverständlich sind das keine zwei Sachen, die da Hand in Hand gehen. Wenn „die gewohnten Zuwächse ausbleiben“, „Arbeitslosigkeit“, „Existenzangst“ und manches mehr an Krisenerscheinungen um sich greifen, mag das schon so sein. Um eine Krise der Wirtschaft aber kann es sich dabei keinesfalls handeln:
„Aber soviel ist doch richtig: wer heute in unsere Medien schaut, der gewinnt den Eindruck, daß Pessimismus das allgemeine Lebensgefühl geworden ist.“
Die vom Präsidenten höchstselbst entdeckte „Erstarrung“ ist also das Hauptübel, dem sich alle bekannten Nebenübel verdanken. Und damit das ein jeder versteht, kann der Präsident seine Entdeckung gar nicht oft genug wiederholen: Vorwärts, indem er die Lähmungserscheinungen ausmalt, die eine „von Ängsten erfüllte Gesellschaft“ aufweist – „unfähig zu Reformen“, „gelähmter Erfindungsgeist“, fehlender „Mut zur Selbständigkeit“ usw. Rückwärts, indem er aus den Erscheinungen der Lähmung die schlimmen Folgen ableitet, die der gesamtgesellschaftliche Angstzustand nach sich zieht – kein „Schwung zur Erneuerung“, keine „Bereitschaft, Risiken einzugehen“, usw. Und dazwischen steht der Schluß, der die Botschaft nochmals griffig zusammenbringt:
„Unser eigentliches Problem ist also ein mentales.“
Die Schuldigen
Aber auch dieses „eigentliche Problem“ betreffend ist der Redner nicht ganz glücklich in seiner Wortwahl. Genau genommen will er nämlich nicht sagen, daß die Probleme, an denen er sein Land laborieren sieht, „mentale“ sind – „wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“. Er drückt sich nur so irreführend aus, weil er umgekehrt sagen möchte, daß ein Problem der praktischen „Umsetzung“ für ihn „eigentlich“ kein praktisches, sondern eben ein „mentales“ ist. Darauf kommt er, weil er bei „Problem“ an das denkt, was gemacht werden muß, und bei „Umsetzung“ daran, daß einfach gemacht werden muß, was zu machen ist. Zusammen mit allen Verantwortlichen weiß er genau, „daß wir Wirtschaft und Gesellschaft dringend modernisieren müssen“; er weiß auch, was gleichfalls allen bekannt ist, wo da was zu „modernisieren“ ist – „Steuern, Renten, Gesundheit, Bildung, … der Euro“. Auf der anderen Seite aber kann er nicht umhin zu konstatieren, daß von den vielen, so fraglos notwendigen guten Werken einfach viel zu wenig auf den Weg gebracht wird, es kein modernes Deutschland und stattdessen einen „Modernisierungsstau in Deutschland“ gibt: Während „wir wirtschaftlich und gesellschaftlich vor den größten Herausforderungen seit 50 Jahren“ stehen, packen die, die dazu da sind, das politisch Nötige anzupacken, einfach nichts an. Entscheidungsträger tragen keine Entscheidungen, Führungskräfte führen nicht. Und weil diesen schwierigen Gedanken nicht jeder der angesprochenen Führungskräfte aufs erste Mal versteht, die in repräsentativer Auswahl vor ihm sitzen und zuhören, sieht der Präsident sich ein weiteres Mal dazu veranlaßt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und beim Namen zu nennen, was die Spatzen von den Dächern pfeifen, „wenn Sie mich das so einmal sagen lassen, meine Damen und Herren.“
Einmal die Sache nämlich total nüchtern betrachtet, wie es unser unverkrampfter Präsident tut, muß einem ja schon davon schlecht werden, daß keiner so recht sagt und noch weniger überhaupt weiß, was eigentlich zu tun ansteht:
„Das ist ein Armutszeugnis für alle Beteiligten: die Politiker, die sich allzuleicht an Detailfragen festhaken und die großen Linien nicht aufzeigen, die Medien, denen billige Schlagzeilen oft wichtiger sind als saubere Information, die Fachleute, die sich oft zu gut dafür sind, in klaren Sätzen zu sagen, ‚was Sache ist‘.“
Gut, dafür ist ja nun er in die Bütt gestiegen. Aber vermutlich deshalb, weil mit „Modernisierung“ schon sehr viel an sauberer Information mitgeteilt ist, läßt auch er im Fortgang die großen Linien im Dunkeln. Dafür konzentriert er sich umso heftiger auf die Frage, woher diese üble Vermeidung von klaren Sätzen kommt:
„Kaum eine neue Entdeckung, bei der nicht zuerst nach den Risiken und Gefahren, keineswegs aber nach den Chancen gefragt wird. Kaum eine Anstrengung zur Reform, die nicht sofort als „Anschlag auf den Sozialstaat“ unter Verdacht gerät. … Wir leiden darunter, daß die Diskussionen bei uns bis zur Unkenntlichkeit verzerrt werden – teils ideologisiert, teils einfach ‚idiotisiert‘. Solche Debatten führen nicht mehr zu Entscheidungen.“
Richtig klare Sätze und ideologiefreie Diskussionen sind für den Präsidenten also solche, bei denen es ungefähr so zugeht, wie wenn er eine Rede hält. Bei denen also in jeder Hinsicht kenntlich bleibt, daß es bei der fälligen „Umsetzung“ des Umzusetzenden absolut nichts zu diskutieren gibt. Die daher zielstrebig in „Entscheidungen“ einmünden, und genau deswegen stattfinden, damit sie das tun. Das klingt ein bißchen schroff, ein bißchen totalitär. Aber natürlich ist bei allem die Demokratie schon etwas Feines, „Interessenvertretung ist sicher legitim“. Doch ob dieser Zirkus mit den Interessen gerade wegen der feinen Demokratie nicht doch besser einmal gescheit abgewürgt gehört? Geht denn da überhaupt noch eine Demokratie zu machen, wenn einzelne mit der „Verteidigung ihrer Sonderinteressen längst überfällige Entscheidungen blockieren“? Eben! Und weil der Redner nichts mehr haßt als Reden, die nicht zum Handeln führen, muß der Präsident das von ihm als notwendig Erkannte schon auch der leitenden Geschäftsführung des demokratischen Ladens als einzig senkrechte Maxime ihres zukünftigen Tuns ans Herz legen. Gerade weil er dieses Herumgetue beim Wegmodernisieren längst überlebten sozialen Krimskrams, dieses kleinliche Genörgele und Geheule, wenn „irgendeiner Interessensgruppe Opfer“ abverlangt werden, so gründlich satt hat, muß er einmal richtig grundsätzlich kritisch werden:
„Ich vermisse bei unseren Eliten in Politik, Wirtschaft, Medien und gesellschaftlichen Gruppen die Fähigkeit und den Willen, das als richtig Erkannte auch durchzustehen. Es kann ja sein, daß einem einmal der Wind der öffentlichen Meinung ins Gesicht bläst. Unser Land befindet sich aber in einer Lage, in der wir es uns nicht mehr leisten können, immer nur den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Ich glaube sogar: In Zeiten der existentiellen Herausforderung wird nur der gewinnen, der wirklich zu führen bereit ist, dem es um Überzeugung geht und nicht um politische, wirtschaftliche oder mediale Macht, ihren Erhalt oder auch ihren Gewinn.“
Das ist in Sachen „deutliche Worte“ wohl nicht zu übertreffen. Allerdings wird unmittelbar deutlich – das ist eben hohe Schule der Rhetorik –, daß genau dort, wo sich die größten Abgründe auftun, das Rettende ganz nahe liegt: Es sind ja die „Führungseliten“, die er nur an ihren Beruf erinnern muß – dann haben wir sie doch, die „Führung“! Man muß doch nur das, was alle wollen, richtig wollen, „umsetzen“ also – dann geht’s doch! Zumal auch die von den Eliten Geführten gar nicht die sind, die mit ihren „Sonderinteressen“ deren freies Schalten und Walten irgendwie behindern wollten. Die warten doch nur darauf, von oben gesagt zu bekommen, was demnächst auf sie zukommen möchte:
„Wir sollten die Vernunft- und Einsichtsfähigkeit der Bürger nicht unterschätzen. Wenn es um die großen Fragen geht, honorieren sie einen klaren Kurs.“
Richtig, das war schon bei allen guten Führern so der Fall; klare Kurse honoriert ein vernünftiges Volk immer dadurch, daß es ihnen folgt. Und damit es in dieser seiner Einsichtsfähigkeit richtig unterstützt wird, hat auch ein jeder guter Führer immer ein Mittel parat, mit dem ein gutes Volk sich so mobilisieren läßt, wie er es mobil haben will:
„Die Vision“
Es ist ein wenig schade, daß Herzog bloß der Bundespräsident ist und kein richtig gescheiter Führer sein darf; das Zeug zu letzterem hätte er ohne Zweifel. Aber es ist eben seine Tragik, daß er sein hervorragendes Talent ganz darauf verwenden muß, andere zum ordentlichen Führen anzuhalten. So nimmt sich die Vision, von der er kündet, bei aller Bemühung doch einigermaßen gebrochen aus. Da steht auf der einen Seite er, der Mensch Herzog, der den deutschen Staat nach allen Seiten gründlich durchleuchtet hat und so ziemlich als einziger in ihm weiß, woran es allenthalben fehlt – „Tatkraft“, „Entschlossenheit“, „Vitalität“, „Entscheidungswillen“, „Kraft“, „Bereitschaft“. Er kennt sogar alle persönlich, die es am fälligen Gebrauch dieser Führungstugenden fehlen lassen. Aber wie die Lage so ist, bleibt ihm nur der – einem Visionär mit Führungsqualitäten gar nicht ziemende – Ausweg, ganz allgemein und eher unverbindlich an die Betreffenden den Appell zu richten, sie möchten doch endlich ihres Amtes walten. Das sind die Stellen in der Rede, bei denen der Redner sich auf das Stilmittel des Aufrufs an die Allgemeinheit zurückgeworfen sieht: „Ich rufe auf zu mehr Entschlossenheit!“ „Ich rufe auf zur inneren Erneuerung!“ „Ich mahne zu mehr Zurückhaltung!“ „Ich mahne zu mehr Verantwortung!“ So bleibt ausgerechnet dort, wo die „große Perspektive“ steht wie eine Eins und nur noch „in klaren Sätzen“ zu benennen wäre, wer sie alles versaut, leider doch nur die Pose eines einsamen Weltverbesserers. Aber auch nach der anderen Seite hin, dort, wo er mit seiner Vision der „Erstarrung der Gesellschaft“ praktisch den Kampf erklärt – „Visionen sind nichts anderes als Strategien des Handelns“ –, will es dem Redner nicht so recht gelingen, das ausgesprochen Visionäre seiner Vision deutlich zu machen. Wo immer er aus dem wirklichen Staatsleben „Beispiele“ heranzieht, die die „Umsetzung“ seiner Vision dringlich erscheinen lassen sollen, stellt sich regelmäßig heraus, daß seine Vision mit der „Umsetzung“ des zitierten Beispiels zusammenfällt. „Beispiel Lohnnebenkosten“ heißt so ein vielversprechender Einstieg, bei dem ja jeder aufgeklärte Zeitgenosse weiß, daß sie viel zu hoch sind, und gespannt auf die Vision wartet. Und dann das: „Daß die Lohnnebenkosten zu hoch sind, weiß mittlerweile wirklich jeder. Wann endlich werden die Kosten der Arbeit von versicherungsfremden Leistungen befreit?“ Dieses „Wann endlich?“ ist schon die ganze Vision des Präsidenten, was er dadurch erhärtet, daß er dieselbe Frage an jedem Thema aufwirft: „Wann finden Arbeitgeber und Arbeitnehmer endlich die Kraft…“, „wo bleibt ein modernes Haushaltsrecht“, „warum ist es so schwierig, das Lohnabstandsgebot für die durchzusetzen, die wirklich arbeiten könnten“, „warum finanzieren die Krankenkassen noch immer Erholungskuren“, usw. usw. Und auf diese letztlich doch recht enttäuschende Weise läppert sich, was einen so großen Auftakt nahm, seinem Ende entgegen. Nach dem letzten Kraftakt des Rufers in der Wüste – „Ich rufe auf zu mehr Selbstverantwortung!“ – kommen die abschließenden, eher hilflosen Versuche, der „mentalen Depression“ im Land Einhalt zu gebieten: „Glauben wir wieder an uns selber. Die besten Jahre liegen noch vor uns.“ Hätte er doch wenigstens zu mehr Wachstum aufgerufen! Aber erstaunlich:
Die Resonanz auf diese große Rede
fiel eindeutig positiv aus: Sie war wirklich groß. Alle Angesprochenen fühlten sich sofort angesprochen. Manche von ihnen fühlen sich immer noch so. Andere fragen, ob sich alle Angesprochenen auch wirklich angesprochen fühlen. Manche gehen weiter und fragen, ob sie sich nicht nur angesprochen fühlen, sondern auch die entsprechende Wirkung zeigen, so angesprochen worden zu sein. Ob also „die Rede gewirkt hat“, und ob demnächst hier „gehandelt“ wird, daß es kracht. Nach den ersten Meinungsumfragen scheint sich diesbezüglich herauszuschälen, daß alle vorhandenen Eliten sich ordentlich ins Zeug legen. Sie tun tatsächlich das, was ihr Beruf von ihnen verlangt. Wie und wo sie wen oder was führen müssen, wußten sie ja schon vor der Rede des Präsidenten. Jetzt wissen sie, daß sie nur führen müssen. Alles wird also gut.
„Beutekunst“
Von der Tradition der deutschen
Kulturnation und ihren aktuellen Rechten
Entgegen manchen Gerüchten hat auch das faschistische Deutschland schwer auf den Glanz einer Kultur geachtet, die der Nation Ehre macht – auch im Dritten Reich kam die Kultur voll zu ihrem Recht, mit der geballten Wucht ihrer Werte Symbol der Größe und Erhabenheit des Staates zu sein, der sie in Besitz und entsprechenden Ehren hält. Wie man weiß, wurde da freilich nicht alles der Aufnahme in den diesbezüglichen Bestand für wert befunden und seiner staatlichen Pflege überantwortet. Wo der faschistische Kunstsinn sein Interesse an der Kunst nicht bedient sah und statt der Verherrlichung des deutschen Menschentums, an der ihm lag, nur Dokumente einer bindungslosen Individualität vorfand, hat er sich an die Vernichtung der ihm so erscheinenden „entarteten Kunst“ gemacht. Zufriedengestellt sah er sich dagegen überall dort, wo sein positiver Deutungswille am künstlerisch gestalteten Material die Botschaft von der Größe des Menschen, die in seiner „Ehre“, seiner „Hingabe“ und seiner „Pflicht“ besteht, hinlänglich versinnlicht sah. Und da die Kulturgeschichte der Menschheit eben voll ist von in Stein, Bronze und Öl verewigten Armutszeugnissen dieser Art, brachte er die staatliche Sammelleidenschaft von Kunstgegenständen auf seine Weise voran. In gelungener Fortführung bekannter herrschaftlicher Traditionen, die schon ägyptische Preziosen in das französische, den „Schatz des Priamos“ in das deutsche Kulturerbe einfließen ließen und denen das British Museum seinen Ruhm verdankt, erstreckte sich der faschistische Eroberungskrieg auch auf den Kulturbesitz seiner Feindstaaten und brachte das Recht des Siegers über die ihm unterlegenen Staaten zur Anschauung, indem er sich nach der Erledigung ihrer Machtmittel auch noch die Symbole ihrer kulturvollen Repräsentation als Trophäe aneignete und für sich sprechen ließ. So fiel in den Fällen jedenfalls, in denen der arische Kampfauftrag einen abendländisch-zivilisierten imperialistischen Konkurrenten im Visier hatte, dem Reich auch jede Menge Kunst als selbstverständliche Kriegsbeute zu – wo derselbe Auftrag unmittelbar auf die völkische Vernichtung des Gegners zielte, fand entsprechend wenig von dessen „kulturellem Erbe“ den Weg nach Deutschland, weil für die „Unterlegenheit der slawischen Rasse“ eben die Zerstörung auch ihrer Kulturgüter ein schönes Symbol war.
Zusammen mit dem Reich, das ihn betrieb, haben die Launen des Kriegsglücks auch diesem Dienst an der deutschen Kulturnation ein Ende gesetzt, und nicht nur das. Ziemlich genau vom selben kulturpolitischen Eifer beflügelt, den die Faschisten bei ihrer Wertschätzung fremder Kulturgüter an den Tag legten, sind auch die endgültigen Sieger des Krieges vorgegangen und haben sich nach der Zerschlagung ihres Feindes ihre Trophäen abtransportiert. Auch ein Stalin verstand sich gut auf die Grundfragen der Ehre seines Staates, und die Inbesitznahme dieses bedeutungsvollen Sperrmülls, der seiner Rote Armee in den von ihr besetzten Gebieten zufiel, war auch für ihn sinnfällige Geste seines Triumphes über den so gründlich besiegten Gegner, dem die ansehnlichen russischen Opfer im „Großen vaterländischen Krieg“ zu verdanken waren. Das war auch ihm etliches an knappen Transportkapazitäten wert. Zusammen mit dem siegreichen Sowjetvolk wurden so die Opfer postum für das Mitwirken an einer nationalen Ruhmestat symbolisch geehrt, indem man den geschlagenen Feind auch noch entehrte und ihm die kulturellen Insignien der Zurschaustellung seiner Erhabenheit einfach wegnahm – als „Preis des Blutes“, den die staatliche Arithmetik der Ehre errechnet hat.
Wo Staaten damit befaßt sind, ihre Rechte gegeneinander mit Krieg auszufechten, ist die Frage, ob ihre Maßnahmen zur abschließenden symbolischen Krönung ihres Sieges auch Rechtens sind, ziemlich daneben. Vollends absurd wird sie, wenn – wie im Fall Deutschlands – ein Kriegsergebnis gleich so gründlich ausfällt, daß die staatliche Souveränität mit ihrer Niederlage im Krieg untergeht. Dann diktiert nämlich das herrschaftliche Interesse der Sieger in dem Land, das sie besetzt halten, das Recht, das gilt. Nicht daneben und gar nicht absurd ist es allerdings, wenn 50 Jahre nach dem Untergang des Dritten Reiches dessen Rechtsnachfolger an die ungebrochen fortlebende Kontinuität einer deutschen Kulturnation anknüpft und sich gleich so an die Pflege des angetretenen Erbes macht, daß er von einem der maßgeblichen Sieger im verlorenen Krieg die Herausgabe „widerrechtlich angeeigneter Kulturgüter“ verlangt. Deutschland sieht sich durch seine zwischenzeitlichen Erfolge bei der praktischen Revision des Kriegsergebnisses offenbar dazu inspiriert, auch noch aus der symbolischen Welt der staatlichen Ehrenhaftigkeit die letzten Reminiszenzen zu tilgen, jemals besiegt worden zu sein. Kulturliebhaberei liegt nämlich nicht vor, wenn die deutsche Politik ihren außenpolitischen Umgang mit Rußland allen Ernstes auf die Frage konzentriert, wie es sich denn mit der „Beutekunst“ verhielte, die der aktuelle Erbe der Siegermacht UdSSR noch immer in Besitz habe, und der Antwort auf diese Frage ungefähr dasselbe Gewicht einräumt wie den „Problemen“, die im Rahmen der Expansion der NATO mit Rußland zur Abwicklung anstehen. Vielmehr wird da ein neuer deutscher Rechtstitel gegenüber Rußland in Anschlag gebracht und gleich mit der Klarstellung versehen, daß an seiner unbedingten Geltung wie an der deutschen Entschlossenheit, ihn durchzusetzen, alle Zweifel fehl am Platz sind: Deutschland ignoriert einfach, wie und warum diese vielen „spektakulären Schätze“ erst in deutsche Hand und dann in Lagerhallen auf russischem Boden gelangt sind, indem es die heute geltende Rechtsordnung für sein Anliegen auf Wiederherstellung seiner nationalen Ehre sprechen läßt und die Herausgabe von „Diebesgut“ verlangt. Es konzediert durchaus bereitwillig seinen moralischen Malus, einen Krieg angefangen zu haben, um im nächsten Zug alle Rechte zu bestreiten, die sich die Siegermacht gegenüber dem Kriegsverlierer damals herausnahm: „Wegen der nationalsozialistischen Kunstraubzüge sei die Sowjetunion berechtigt gewesen, sich durch Konfiskationen im Land des Aggressors zu entschädigen,“ – so wird empört deren Rechtsauffassung zitiert und fortgefahren: – „als ob die Frage des Erstangriffs über Recht und Unrecht des Kunstraubs entscheide“. Darüber ist nämlich hierzulande schon so endgültig und eindeutig entschieden worden, daß es auch überhaupt nichts ausmacht, wenn bei der Präzisierung des herauszugebenden deutschen Eigentums zur Sprache kommt, woraus es zu beträchtlichen Teilen besteht. Der bestechende Erfolg von „nationalsozialistischen Kunstraubzügen“ fundiert nämlich genau besehen den deutschen Rechtsanspruch, denn der steht ja nur stellvertretend für die vielen anderen, die sich gleich aus ganz Europa gegen Rußland akkumulieren:
„Rußland drohen auch Auseinandersetzungen mit anderen europäischen Staaten. Viele Kunstgegenstände wurden nämlich erst von den deutschen Besatzern gestohlen, bevor die Rote Armee sie in die damalige Sowjetrepublik brachte.“
Nichts weniger als der gesamteuropäische Kulturverbund steht also hinter der deutschen Absicht, das faschistische Intermezzo der Nation als unerlaubten Eingriff in die unveräußerlichen Eigentumsrechte ihres Kulturbestands zu interpretieren.
Im angesprochenen Rußland scheint neben dem vielen, was nicht mehr läuft, der Standpunkt noch halbwegs intakt zu sein, daß ein Staat, der etwas auf sich halten will, sich um seiner Ehre willen nicht jede Zumutung bieten lassen darf. Jedenfalls findet sich in den dortigen politischen Kreisen eine Mehrheit zusammen, die das deutsche Ansinnen ganz gut versteht: eher nicht als überbordende Kulturbeflissenheit des Volkes der Dichter & Denker, sondern als den Antrag, freiwillig den Status jener ruhmreichen Sieger- und Weltmacht Sowjetunion zu revidieren, den die heutigen russischen Machthaber neben allem anderen von der schon auch geerbt haben wollen. Seinen praktischen Niederschlag findet der Behauptungswille dieses Restpostens einer Tradition des russisch-nationalen Selbst- und Machtbewußtseins dann aber doch nicht so eindeutig. Gegen das vom russischen Parlament und Föderationsrat beschlossene Gesetz, das die während des Krieges nach Rußland verbrachten Kulturgüter zu russischem Eigentum erklärt, legt der Präsident sein Veto ein – keineswegs als der „Vaterlandsverräter“, als der er seitdem zuhause kritisiert wird. Vielmehr deshalb, weil er die politische Tragweite der offenen Zurückweisung eines deutschen Rechtsstandpunkts befürchtet und sein Rußland vor außenpolitischen „Komplikationen zu schützen“ sucht, die andernfalls im Umgang mit dem Partner Deutschland „bei jeglichen Verhandlungen“ (Schwedkoj, stellv. Kulturminister) zu erwarten seien.
Darin zumindest täuschen sich die regierenden Russen nicht. Streng nach der Logik, daß gegenüber einem von Deutschland angemeldeten Recht jeder politische Widerstand nur das Unrecht beweisen kann, das ihm vorgeworfen wird, entnimmt man hierzulande der russischen Unnachgiebigkeit ein einziges Dokument der absoluten Rechtfertigung des eigenen Anliegens. Professoren für Völkerrecht schärfen das öffentliche Rechtsbewußtsein mit Expertisen zum Thema: „Warum Rußland die Beutekunst an Deutschland zurückgeben muß“, Leitartikler fassen die Summe dann griffig so zusammen: „Diebstahl, Duma und Dummheit… Für die Links- und Rechtsnationalisten der Duma gilt: Reichtum, gerade gestohlener, macht nicht glücklich.“ Daß der russische Präsident bei seinem Besuch in Deutschland ein wenig der heißen Ware als Geschenk mitbringt, bestärkt nur die deutsche Intransigenz, die „Beutekunst“ als diplomatischen Streitgegenstand zu konservieren, bei dem sich die Bundesregierung ebenso wie bei der NATO-Osterweiterung „beharrlich um eine einvernehmliche, die Interessen beider Seiten berücksichtigende Lösung auf der Grundlage des Völkerrechts“ bemühe. Und wenn der Spiegel einen halbwegs vernünftigen „offenen Brief“ des russischen Föderationsrats an den deutschen Kanzler abdruckt: „Sehr geehrter Herr Kanzler, es vergeht kaum ein Treffen mit dem Präsidenten Rußlands, B.N. Jelzin, bei dem Sie nicht an den Anspruch der BRD auf Rückgabe jener Kulturgüter erinnern … Der Außenminister, Herr Kinkel, und der Botschafter der BRD in Rußland, Herr Studnitz, verstiegen sich am Vorabend der parlamentarischen Debatte des Gesetzentwurfs über die verlagerten Kulturgüter zu dem Versuch, direkten Druck auf Abgeordnete von Duma und Föderationsrat auszuüben … Man muß freilich annehmen, daß nicht die bloßen Kulturgüter Motiv der Aktivitäten deutscher Politiker sind, sondern ihr Wunsch, in diesem Bereich eine Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs zu erreichen“ –, dann weiß der Leser schon vorab, wie er das einzuordnen hat: „Kohl-Beschimpfung aus Moskau“ heißt die Richtlinie zur Interpretation der russischen Beschwerde über die aktuellen Fortschritte deutscher Vergangenheitsbewältigung.
„Dolly“
Ein tierischer und ganz viele
moralische Zuchterfolge
Nach etlichen Fehlversuchen hat ein Schaf das Licht der Welt erblickt, das Technologie und viel Fingerspitzengefühl aus den Rohstoffen des Erbguts einer Euterzelle und einer entkernten Eizelle verfertigten. Wie man hörte, lag die Besonderheit des Zellhaufens „Dolly“ darin, daß er sich auch ohne die Zuhilfenahme einer frisch befruchteten Eizelle zum fertigen Schaf zu organisieren vermochte.
Dieser Erfolg der Biologie hat der Menschheit sehr zu denken gegeben. Die darf sich schon seit geraumer Zeit damit abfinden, mit genetischen Züchtungserfolgen dieses anwendungsbeflissenen Wissenschaftszweigs im Wege großangelegter Feldversuche Bekanntschaft zu schließen. Bedenken, die möglichen Risiken des Zeugs betreffend, das diese Forschung in die Welt setzt, sind ziemlich populär. Kein Wunder, schließlich ist bei recht vielen ihrer Ergebnisse noch ziemlich unbekannt, was alles an „unbeabsichtigten Nebenwirkungen“ mit ihnen einhergeht. Solche Bedenken zählen nur nichts, weil die beabsichtigte Hauptwirkung dieser „Zukunftstechnologie“ der Profit ist, den deutsche Unternehmer mit ihr machen sollen und nicht die ausländische Konkurrenz. Der nationale Imperativ lautet daher: Auf diesem Feld „nicht ins Hintertreffen“ geraten, sondern „technologische Vorsprünge“ erzielen und sichern! Das läßt sich der Staat einiges an Entwicklungsförderung kosten und begründet seine Zurückhaltung bei den Auflagen, die der permanenten Kritik unterliegen, den Fortschritt zu behindern. Daß der Stand der Forschung stets dem Vertrieb ihrer Produkte hinterherhinkt, gehört also zum Geschäft.
Wenn dann in Großbritannien eine Manipulation von Zellen gelingt, durch die ein Schaf ohne Vater zustandekommt, das mit seiner Mutter, die es auch nicht hat, „vollkommen identisch“ ist, ist die Aufregung groß. Die Perspektive, aus „beliebigem Zellmaterial eines Säugetiers“ dessen „identische Kopie“ machen zu können, kündet von einem neuen Stand der Technik und fällt aus dem bekannten Vorstellungsrahmen von unverrottbarem Frischgemüse, Riesenkartoffeln und resistenten Weizenkulturen, mit dem man sich hierzulande sein privates Bild von dieser Wissenschaft und zugleich seinen Frieden mit ihr gemacht hat. Da muß man sich dann schon sorgen – darüber nämlich, wie es genau mit den Vor- und Nachteilen bestellt ist, die diesmal von dem Fortschritt der Wissenschaft zu erwarten seien. Und freilich auch darüber, wieweit es der Mensch in seinem hybriden Drang, es seinem Schöpfer gleich zu tun, möglicherweise demnächst wohl noch bringen werde.
Gleich nach Bekanntwerden des glücklichen Ausgangs des Zuchtversuchs war daher von dessen Endprodukt, dem Schaf, nicht mehr die Rede, und von den experimentellen Bedingungen seines Zustandekommens gleichfalls nicht. „Freund Klon klopft leise an“, hieß es stattdessen, und mit der Kundgabe des Prinzips einer „beliebigen Vervielfältigung“, welches in Wahrheit mit „Dolly“ auf die Welt gekommen sei, stand gleichfalls fest, daß der Treffer der schottischen Schafszüchter der Universalschlüssel zum Universalschloß ist: „Jetzt wird alles machbar.“ Ein Teil der dann folgenden Einfälle, diese Idee des machbaren Machbaren in den Status des zumindest Vorstellbaren zu erheben, orientierte sich noch ein wenig am Metier des Forschungsbereichs, in dem diese „wissenschaftliche Revolution“ stattfand. Unter flotter Abstraktion von allem, was da der Forschung bei einem Schaf gelungen war, hatte man aber sofort den unglaublichen Nutzen zum Thema, den die Anwendung des Prinzips, „erbgleiche Kopien von Individuen in beliebiger Zahl herzustellen“, einfach über die Menschheit bringen muß. Vorwiegend gediegene Wissenschaftler kamen in dieser Abteilung zu Wort, und nur zu gerne gaben sie die verlangten Kostproben einer Weltfremdheit ab, die den auf die Manipulation von Genen bornierten Forschertrieb stets im Auftrag beschäftigt weiß, „dem Wohle der Menschheit zu dienen“: „Gewünschte Lebewesen werden sich künftig so herstellen lassen wie Fließbandware“; „genmanipulierte Tiere, die als lebende Ersatzteillager für organkranke Patienten dienen“; „kaum ein Gebrechen – ob Krebs, AIDS oder BSE –, das sich nicht durch Scharen genetisch völlig identischer Versuchstiere … letztlich besiegen ließe“; „aus den Eutern von Dollys Nachfolgern lassen sich – zu niedrigen Preisen – lebensnotwendige Medikamente melken,“ usw. usw.
So war der Segen gesichert, den der Fortschritt von Technik und Wissenschaft „der Menschheit“ bringt, und alles für die Abhandlung des Fluchs aufbereitet, ohne den der Segen bekanntlich nicht zu haben ist. Da gab es dann im Hinblick auf das „Machbare“, das demnächst gemacht werden wird, endlich kein Halten mehr: Es ist ja auch einfach nicht auszudenken, was geschieht, wenn der Mensch beim Klonen Hand und Pipette an sich selbst legt! Aber immerhin Bilder davon ließen sich schon vorstellen, und derselbe bürgerliche Geist, der sich eben noch in seiner Idealisierung der Macht des Wissens nicht einkriegen wollte, erging sich in finsteren Szenarien der Ohnmacht, die über den Menschen im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit hereinbricht. Diese Bilder zitierte er zwar auch nur aus Dichterstuben und Filmstudios herbei. Aber ein Intellektueller, der in ihnen messerscharf das Verhängnis erkannt haben will, das mit „Dolly“ unter die Menschen gekommen ist, gebraucht den Indikativ Präsens: „In die Reichweite des Machbaren rücken … all jene düsteren Zukunftsvisionen von der Züchtbarkeit des Menschen, wie sie etwa der britische Autor Aldous Huxley schon in den dreißiger Jahren beschworen hat“; „auch die uralten Träume von Unsterblichkeit und Wiederauferstehung, beschworen in zahllosen Werken von der Bibel bis zu dem Science-fiction Film ‚Jurassic Park‘ gewinnen plötzlich Realitätsgehalt“; „ein Hollywood-Opus …, in welchem der Nazi-Arzt Josef Mengele Frauen auf der ganzen Welt aus Körperzellen des toten Hitler geklonte Embryonen austragen läßt, erhält schaurige Aktualität“, usw. usw. Erwähnenswert sind noch die brennend heißen Fragen, ob sich – neben dem Bösen, das steht ja fest – auch das Gute, das Schöne und das Wahre klonen läßt. Thomas Mann, Claudia Schiffer und Albert Einstein waren da zum Beispiel genannte Favoriten; oder Y. Menuhin, als vervielfachte Aura vom Gesamtkunstwerk Mensch gewissermaßen; wieviel „Bildung und Charakter“ da im Erbgut stecken möchte – „vielleicht mehr, als man bislang dachte“; oder ob der Mensch „Geist und Genialität“ nicht vielleicht doch mehr von der „Umwelt“ vererbt bekommt; sicher wurde man sich nicht so ganz: „Ein geklonter Einstein würde vielleicht sein Leben am Strand vertrödeln, und die Technik wird es nicht verhindern können.“ Ja, vielleicht.
Spätestens damit war die entscheidende Fragestellung auf dem Tisch, die sich einem aufmerksamen Zeitgenossen bei „Dolly“ ja dann doch irgendwann aufdrängen mußte. Die Kirchen konnten einer rapiden Erosion ihrer Urheberrechte auf Auferstehung natürlich unmöglich das Wort reden, also lehnten sie – stellvertretend für alle, wie immer – selbstredend „das Klonen von Mann und Frau“ ab. Als „Verstoß gegen die Schöpfung“, auch logisch. Andere dachten nämlich bei dem schottischen Schafstall auf ihre Weise an Bethlehem und mußten feststellen: „Irgendwie spielen die Gott“. Mit ihrer weiterführenden Frage: „Was darf der Mensch?“, blieben sie dann aber doch allein, wenn ihnen nicht schon die Kirche weitergeholfen hatte – bis dann ex kathedra die notwendige Orientierung kam: „Wissenschaftler stellen im Auftrag der Bundesregierung fest, daß die Herstellung von Menschen-Kopien mit der Wertordnung des Grundgesetzes unvereinbar ist.“ Begründet wurde dieses Verdikt von dem konzentrierten ethisch-politischen Sachverstand, der sich an „Dolly“ und seinen Folgen zu schaffen gemacht hat, aber schon auch – mit einer Gedankenführung, die vom „Menschen“ zielstrebig auf das Subjekt führt, das für dieses Wesen allein zuständig ist: „Entscheidendes Kriterium sei nicht die Entstehung eines Menschen mit gleichem Genom. Problematisch ist …, daß ein Mensch als Mittel zu einem Zweck hergestellt wird, der nicht er selber ist, und daß ihm zu diesem Zweck die genetische Gleichheit mit einem anderen Menschen auferlegt wird.“ Durch diese Instrumentalisierung sei die Würde des Menschen berührt. Das Klonen von Menschen sei ein Verstoß gegen diese Würde und mit der Wert- und Rechtsordnung des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren. „Das als Zwilling hergestellte Kind stünde unter der Erwartung, den Menschen wiederholen zu müssen, dessen Genom es trägt. Es hätte ein vorgelebtes Leben.“ Daß sich der Mensch durch Manipulationen am Erbgut um seine Freiheit bringen ließe – diese Vorstellung bereitet den offiziellen Sachverständigen des Staats allen Ernstes Sorge. In ihrem staatsmoralischen Gutachten gehen die Anbeter bürgerlicher Freiheit realistischerweise davon aus, daß es den mit ihr ausgestatteten Privatsubjekten den ganzen Tag sowieso um nichts anderes geht, als ihresgleichen zum Instrument ihrer Zwecke zu degradieren; die ziemlich konsequenten Phantasien dieses Menschenschlags, mittels Genforschung endlich total verfügbare Kreaturen hervorbringen zu können, sind für sie so vertraut, daß sie auch gleich noch den sachlichen Unsinn nachvollziehen, den diese Phantasien unterstellen: Weil aus einem Genom ein Mensch wird, steckt alles, was er als Mensch dann ist, will und tut, im Genom. Und so legen sie der Genforschung glatt die Bedeutung bei, sie könnte auf dem Sprung sein, diese bürgerlichen Tagträume demnächst technisch zu realisieren. Dagegen wollen sie schon mal vorab auf jeden Fall rechtliche Vorkehrungen getroffen sehen.
Denn nur ein bißchen staatsethisch durchgedacht und hinsichtlich der politisch brisanten Folge durchleuchtet, daß dann ja jeder Private jedem anderen seinen eigenen Zweck als Lebensprogramm diktieren könnte, beunruhigen solche für ziemlich möglich gehaltenen Fortschritte der Gen- und Zellforschung schon – den in Sachen freier Gestaltung von Lebensschicksalen regierenden Monopolisten jedenfalls, der mit seiner Wert- und Rechtsordnung des Grundgesetzes ganz prinzipiell und abschließend definiert hat, daß er dem Menschen seine Würde verleiht und auch dekretiert, was die im einzelnen beinhaltet. Der sah sich daher zur Klarstellung veranlaßt, daß bis zum Klonen von sich selbst die Willkür der Privaten nicht gehen darf. Er ließ aber auch durchblicken, daß er, wenn er einmal einen Replikanten trifft, nicht ansteht, ihn zum Staatsbürger zu küren. Aus drei Sätzen, in denen ca. neunmal „der Mensch“, siebenmal „der Zweck“ und viermal „der Selbstzweck“ vorkamen, extrahierte der Vorsitzende der Deutschen Forschungsgesellschaft die goldenen Worte, daß auch geklonte Menschen „volle menschliche Geschöpfe seien“ – womit das Geistesprodukt des sich frei austobenden bürgerlichen Wahnsinns offiziell und abschließend in seinen Staat repatriiert wäre.
Die Wehrmacht-Ausstellung
Neues von der Pflege der nationalen
Ehre
Der Streit um die Wehrmacht-Ausstellung zeigt, so war von
prominenter Seite zu hören, daß in Deutschland noch
immer Widerstand gegen die Wahrheit geleistet wird
–
in dem Land, dem es im übrigen, so der Prominente weiter,
am besten gelungen ist, eine wahrheitsgemäße, relativ
nicht-nationalistische und bemerkenswert selbstkritische
Nationalgeschichte zu schreiben
, und dem nicht
zuletzt deswegen die Entwicklung zu einem relativ
nicht-nationalistischen, international verantwortungsvoll
agierenden Nationalstaat
gelungen sei, dessen
politisches System
sich anderen Ländern
als
Modell
zur Nachahmung empfehle. Die Einlassungen
stammen von jenem amerikanischen Historiker, der in
besagtem Musterland neulich übel beschimpft worden ist,
mit seinem Buch über Hitlers willige Vollstrecker
die Deutschen in den Schmutz zu ziehen.[1] Deswegen, bevor wir auf die
Wehrmacht-Ausstellung zu sprechen kommen, ein kurzer
Nachtrag zu unserem Artikel „Die Goldhagen-Debatte“ in
GegenStandpunkt 4-96, S.29.
Goldhagen, der sich selbst als Nationalismus-Kritiker versteht, stellt da unter Beweis, wie es um seine diesbezüglichen Fähigkeiten bestellt ist. Wo er am Umgang der Deutschen mit ihrer Vergangenheit Nationalismus ausmacht – im Bedürfnis, Fakten zu leugnen –, hält er ihn für nicht repräsentativ für die von ihm geschätzte Nation. Ansonsten kann er daran, wie diese Nation ihre Vergangenheit bewältigt, im großen und ganzen keinen Nationalismus entdecken. Die nationale Dauerveranstaltung stellt sich ihm dar als ziemlich aufrichtiges Ringen um die historische Wahrheit, zu dem sich seine und seinesgleichen Aufklärungsbemühungen wie konstruktive, kritische Anmerkungen verhalten.
Offenkundig wissen Leute seines Schlages gar nicht, in
was sie sich einmischen, wenn sie in wohlmeinender
Absicht ihre Korrekturen am offiziellen Geschichtsbild
anbringen. Dabei könnten sie spätestens an den
Reaktionen, die sie damit auslösen, merken, daß es sich
dabei ganz und gar nur um eine Frage der nationalen
Ehre handelt. Wenn wahrlich nicht sonderlich
umwerfende Erkenntnisse wie die, daß im Dritten Reich
größere Gegensätze zwischen der NS-Führung und ihrem Volk
nicht bestanden haben, von der halben Nation mit dem
Vorwurf der Ehrabschneiderei quittiert werden,
ist nicht davon auszugehen, daß in dieser Nation wegen
mangelnder Kenntnis der Quellenlage so entschieden darauf
bestanden wird, daß niemand die Deutschen unter Hitler
mit den Untaten der Staatsführung auch nur in
Zusammenhang bringt. Statt des Versuchs, durch die
Darbietung umfangreichen Faktenmaterials für ein besseres
Verständnis der damaligen Zeit zu sorgen, wäre da schon
einmal die Klärung der Frage fällig, in was Vertreter des
heutigen Deutschland da ihre ganze Ehre legen
und warum diejenigen, die sich in der Verurteilung der
verbrecherischen
Nazi-Führung so einig sind, kein
kritisches Wort über deren Anhänger, Mitläufer und
Ausführungsorgane zulassen. Die Entschiedenheit, mit der
sie darauf pochen, daß selbst das, was Hitlers Staat mit
seinen Volksgenossen anstellen konnte, keinen Vorbehalt
gegen deren Gehorsam rechtfertigt, verrät nämlich einiges
über ihren Anspruch auf blinde Gefolgschaft.
So eine Klärung ist nur leider nicht zu erwarten von einem, der wie Goldhagen mit seiner historischen Untersuchung erklärtermaßen niemandem zu nahe treten will, schon gleich nicht den heutigen Deutschen – also einfach nicht versteht, warum sich von denen gar nicht wenige durch die Ergebnisse seiner Forschung angegriffen sehen. Den empörten Nationalismus, der sich da zu Wort meldet, ordnet er als Relikt der Vergangenheit ein. Ihm stellt er die demokratisch geläuterten, heute maßgeblichen Deutschen entgegen, mit denen er sich einig weiß in der Verurteilung des NS-Regimes. Dabei beschäftigt ihn keinen Moment lang die Frage, von welchem nationalen Rechtsstandpunkt aus das demokratische Deutschland eigentlich was verurteilt, wenn es von „Hitlers Verbrechen“ spricht. Daß die „Lehre“, die das heutige Deutschland „aus der Geschichte“ gezogen haben will, ihr überzeugendstes Argument allemal in der Niederlage hat, in die Hitler seine Nation geführt hat, also ziemlich unverblümt den Standpunkt eines fortexistierenden nationalen Erfolgsrechts ausposaunt; daß das geläuterte Deutschland mit dem feierlichen Vorsatz, nie wieder Juden zu vernichten, darauf pocht, daß nun jedermann seine moralische Güte vorbehaltlos anzuerkennen hat – sowas kann Goldhagen nicht davon abschrecken, die deutsche Vergangenheitsbewältigung als Ausdruck einer beachtenswert selbstkritischen Haltung dieser Nation zu nehmen.
Dieses Mißverständnis ist verantwortlich für seine flotte Karriere vom Ehrabschneider der Deutschen zur in Deutschland geehrten Persönlichkeit. Es sind die beiden Seiten desselben Nationalismus, die einem entgegentreten, der das Argument, mit dem sich Deutschland ins Recht setzt – es bekennt sich zur selbstkritischen Auseinandersetzung mit seinen begangenen Schnitzern –, umstandslos für die Wahrheit über diese Nation nimmt: Wo so einer mit seinen kritischen Anmerkungen zu Hitlers willfährigem Volk nur auf die Konsequenzen des rechtfertigenden Arguments dringt, von dem er diese Nation beseelt glaubt, stellt die ihm gegenüber klar, wie ihr Bekenntnis zur Selbstkritik gemeint ist: Mit diesem Bekenntnis verwahrt sie sich dann entschieden dagegen, daß ihr einer mit dem dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit kommt und Bedenken gegen Hitlers Volk äußert, dessen Patriotismus sie in Ehren halten will. Wenn der Gemaßregelte sich angesichts solcher Klarstellungen dann als unverbesserlicher Idealist deutscher Rechtfertigungskünste erweist und sich allein vom selbstkritischen Gestus, den diese Nation vor sich herträgt – ohne ein Urteil darüber, was sie tatsächlich treibt, auch nur in Erwägung zu ziehen –, davon überzeugen läßt, daß es am heutigen Deutschland wirklich nichts mehr zu kritisieren gibt, dann verleiht ihm derselbe deutsche Nationalismus dafür den Demokratiepreis 1997.
*
Doch nun zur Hauptsache. Für Furore im nationalen Überbau
sorgt derzeit eine Ausstellung mit dem Titel
Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis
1944
, die sich das Ziel setzt,
„zu beweisen, daß die deutsche Wehrmacht in diesen Jahren nicht einen ‚normalen Krieg‘ geführt hat, sondern daß sie an Verbrechen gegen Juden, Kriegsgefangene und Zivilisten ‚als Gesamtorganisation beteiligt‘ war.“ Der von den Initiatoren bekundeten Absicht zufolge „räumen die gezeigten Dokumente und Photos mit der Auffassung auf, die Wehrmacht habe Distanz zum NS-Regime gehalten“ und „nur ihre soldatische Pflicht getan.“ (Der Ausstellungsmitinitiator Heer, zitiert in der Süddeutschen Zeitung vom 27.1. und vom 25.2.1997)
Wie kommen sie denn darauf? Wenn der faschistische Staat der halben Welt den Krieg erklärt und in diesem Krieg sein völkisches Säuberungsprogramm verfolgt, dann wird darin wohl der Auftrag bestanden haben, den seine Ausführungsorgane, Wehrmacht und Sonderkommandos, erledigt haben. Und worin eigentlich sonst als eben in der Erledigung ihres staatlichen Auftrags soll die soldatische Pflicht einer Armee bestehen? Wie kommen die Aussteller auf die Absurdität, den staatlichen Auftrag für etwas anderes als den Inhalt der soldatischen Pflicht zu halten und seine Ausführung als Pflichtverletzung zu betrachten? Was soll ihr Nachweis, daß die Wehrmacht an der Durchführung des Vernichtungskrieges „als Gesamtorganisation beteiligt“ war? Seit wann fällt es in die Entscheidung des staatlichen Ausführungsorgans, woran es sich beteiligt? Wo gibt es denn das, daß eine funktionierende Armee nicht als Gesamtorganisation handelt, sondern ihre Truppenteile und Soldaten machen, was sie wollen und vor sich verantworten können? Die Aussteller sind den Touren der offiziellen Vergangenheitsbewältigung da ziemlich auf den Leim gegangen.
Mit dieser Veranstaltung insistiert Deutschland seit seinem demokratischen Neubeginn darauf, daß die Wehrmacht ihrem Staat gedient hat, nicht aber dessen rassistischer Politik – als hätte im faschistischen Deutschland nicht das eine das andere eingeschlossen. Weil Deutschland sich heute von der von seinem Rechtsvorgänger in und außerhalb der Nation durchgeführten Vernichtungspolitik gegenüber Juden und anderen „Feinden des deutschen Volks“ distanziert, gleichzeitig aber selbst viel von einem Militär hält, das seinem Staat bedingungslos ergeben ist, wird geleugnet, daß der Krieg der Wehrmacht der des faschistischen Staates war, und besteht darauf, daß er ein ganz „normaler Krieg“ war, in dem die Wehrmacht im großen ganzen nur ihre „ehrenvolle Pflicht“ getan hat. In einzelnen Fällen, in denen einfach nicht zu leugnen ist, daß die Wehrmacht ihrem Staat auch für dessen völkische Verfolgungsbedürfnisse zur Verfügung gestanden hat, wird nach Kräften bestritten, daß es sich da um Beispiele soldatischer Pflichterfüllung handelt. Es wird dann zugegeben, daß Angehörige der Wehrmacht – nicht die Wehrmacht – „in Einzelfällen“ beteiligt waren; und zwar eben nicht an einer staatlichen Auftragsarbeit, sondern an „Verstößen gegen den militärischen Auftrag“. Und die sind ja in einigen exemplarischen Fällen sogar rechtsförmlich als Kriegsverbrechen verfolgt worden. Auf diese Weise ist für die rechtsverbindlichen Richtlinien gesorgt, die bei der Aufarbeitung der Wehrmacht-Vergangenheit gelten: Unter kriegsrechtlichen Gesichtspunkten betrachtet, wie es der offizielle Standpunkt verlangt, handelt es sich bei dem, was die Wehrmacht im faschistischen Staatsauftrag erledigt hat, um die „Auswüchse“ eines im übrigen sauberen Krieges, für die Privatpersonen verantwortlich zu machen sind, welche ihre „soldatische Pflicht verletzt“ haben.
Die Aussteller merken die Unangemessenheit dieser staatsoffiziellen „Aufarbeitung“ der Wehrmacht-Vergangenheit und wollen es nicht durchgehen lassen, daß ein „Vernichtungskrieg“ mit dem Verweis auf ein paar bedauerliche Ausrutscher abgetan wird. Sie wollen die Besonderheit dieses Krieges herausstellen, tun das allerdings auf eine unbrauchbare Weise: Wo sich das offizielle Deutschland nach dem Muster des unnötigen Fouls in einzelnen, nicht zu bestreitenden Fällen dazu bequemt anzuerkennen, daß es im Rahmen dieses Krieges zu einigen Unregelmäßigkeiten gekommen ist, insistieren sie darauf, daß die Unregelmäßigkeiten in diesem Krieg die Regel waren. Ihnen fällt gar nicht auf, daß sie die Besonderheit dieses Krieges, die sie festhalten wollen, leugnen, wenn sie ihn an den gängigen Maßstäben eines „normalen Krieges“ messen. Soll wirklich das die völkischen Säuberungen in ganz Europa ausgemacht haben, daß in Kreisen des Militärs nicht sauber zwischen der gegnerischen Streitmacht und der Zivilbevölkerung unterschieden oder bereits außer Gefecht gesetzten, gefangengenommenen und kapitulierenden Angehörigen der feindlichen Armee der Respekt verweigert worden ist, auf den sie nach den menschenfreundlichen Richtlinien des Kriegsrechts Anspruch haben? Sie kriegen nicht mit, daß der Maßstab das Unangemessene ist, an dem sie – wie das offizielle Deutschland, nur viel gründlicher – Verstöße gegen die staatsmoralischen Kriterien einer sauberen Kriegsführung ausmachen und an dem sie – im Unterschied zur geltenden Sicht – den Krieg der Wehrmacht insgesamt für entartet erklären. Natürlich ist es ein Unterschied, ob das faschistische Deutschland einen Krieg mit der Zielsetzung führt, einer „jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung“ gegen Deutschland den Garaus zu machen, oder ob die freie Welt mit der Abschreckungsdrohung seiner Atomwaffen ihre imperialistische Weltordnung verteidigt. Dieser Unterschied betrifft aber den Kriegszweck und nicht die Moral der Kriegsführung. Statt sich dem politischen Auftrag zuzuwenden, mit dem der Krieg der Wehrmacht geführt wurde, und aus dem die Besonderheiten der Kriegsführung zu erklären, die sie ja als die damals herrschende Normalität des Krieges dokumentieren, dementieren die Aussteller, daß dieser Krieg normal war, weil er nicht den guten Sitten des Krieges entsprochen hat.
Es wird wohl so sein, daß sie mit diesem Befund die offizielle Vergangenheitsbewältigung mit ihren Legendenbildungen über die Wehrmacht korrigieren wollen. Sie verlassen jedoch gar nicht das durch diese Veranstaltung vorgegebene Feld der staatsmoralischen Begutachtung. Die staatsoffizielle „Aufarbeitung“ des Wehrmachtkrieges, bei der Deutschland nachträglich ein paar moralische Vorzeichen vor dem, was damals zum Auftrag des Militärs gehörte, nach neuen nationalen Gesichtspunkten ein bißchen umgekehrt oder anders verteilt hat, nehmen sie glatt als Vorlage für ihre Bemühungen um die historische Wahrheit. Sie legen sich keine Rechenschaft darüber ab, worauf sie sich da einlassen. Es schreckt sie nicht, daß sie an einer Veranstaltung Maß nehmen, die der Rechtfertigung Deutschlands gilt: Das hat sich mit ihr, kaum war seine Niederlage besiegelt, schon wieder als ein Staat empfohlen, der sich wie jedes andere anerkannte Mitglied der Völkerfamilie moralisch nur vor den Rechten verantwortet, die einer Militärmacht gebühren; das hat noch zu Besatzungszeiten erbittert darum gerungen, von den Siegermächten anerkannt zu bekommen, daß ihm allein die Rolle des Richters über den gelaufenen Waffengang zukommt; und das hat in dieser Position von Anfang an und bis heute klargestellt, daß der Krieg der Wehrmacht nichts ist, was Vorbehalte gegen dieses Deutschland rechtfertigen könnte. Diese Veranstaltung wollen die Aussteller mit ihrer Dokumentation blamieren als eine, die nie richtig durchgeführt worden ist; sie führen vor, wovon man sich alles staatsoffiziell noch zu distanzieren hätte, wenn es nach den dem Kriegsrecht entnommenen Maßstäben ginge. Und das rächt sich. Für ein Urteil über den Wehrmachtkrieg ist in der durch die staatlichen Rechtfertigungsmaßstäbe definierten Betrachtungsweise einfach kein Platz mehr. In der ist alles, was als soldatischer Dienst so für normal gilt und nach den Regeln sauberer Kriegsführung international anerkannt ist, von vornherein abgehakt, weil eben diese zwischen politischer Befehlsgewalt und Befehlsempfängern sowie unter den Staaten anerkannte Normalität des Krieges der rechtfertigende Maßstab ist, an dem zwischen ehrenwerten Taten des Militärs und verurteilenswerten „Auswüchsen“ unterschieden wird. Wo da genau die Trennungslinien verlaufen, darüber rechten die Aussteller mit dem offiziellen Deutschland. Und das ist eine ziemlich dürftige Antwort auf die verlogene Übung, mit der sich jeder anständige deutsche Nationalist von „schlimmen Exzessen“ empört distanziert, sie als Verletzung der Normalität des Krieges betrachtet, ihr damit entgegenstellt und so bestreitet, daß die Gründe besagter „Exzesse“ allemal in der nationalistischen Großveranstaltung liegen, die noch jeder „normale Krieg“ ist.[2]
Die Aussteller wollen eben auch nicht mehr als mehr öffentlich und offiziell gepflegte moralische Distanz zur Wehrmacht-Vergangenheit. Als das passende Mittel, diese Distanz zu fördern, haben sie sich eine Dokumentation ausgedacht, und die leistet, was eine Dokumentation leistet: Sie bebildert die Schrecken des Krieges im Allgemeinen. Was sich die Aussteller von ihr versprechen, daß sich durch die Betrachtung der Bilder ihr Urteil über den deutschen Krieges verallgemeinern möge, kann eine Dokumentation gar nicht leisten. Bilder liefern nun mal keine Gründe zur Korrektur der Stellung zu diesem Krieg, sondern nur Anlässe zur Bestätigung von Vorurteilen. Mit denen gehen die Leute dann rein – und wieder raus. Je nach dem, welche sie mitgebracht haben.
*
Der Befund der Aussteller, die Wehrmacht habe nicht „nur ihre soldatische Pflicht“ erfüllt, stößt auf den entschiedenen Widerspruch von Leuten, die sich durch ihn in ihrer Soldatenehre verletzt sehen. Personen melden sich zu Wort – „Ich war Frontsoldat (Ostfeldzug)“ –, die ihren ganzen Eigenwert in die Pflicht legen, in der sie zu ihrer Obrigkeit gestanden haben, und sich nicht nachsagen lassen, diese Pflicht nicht vorbildhaft erledigt zu haben. Empört bestehen sie in einer Flut von Leserbriefen darauf, im Krieg „nur ihre soldatische Pflicht“ getan zu haben. Daß ihnen das in Gestalt einer Ausstellung bestritten wird, die die Drecksarbeit dokumentiert, die sie für ihr Vaterland erledigt haben, halten sie für äußerst ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit weisen sie in Stellungnahmen zurück, die einigen Aufschluß darüber bieten, was es mit der Soldatenpflicht so auf sich hat:
„Nach über 50 Jahren werden jetzt im eigenen Land Soldaten der Wehrmacht, die unter größten Entsagungen in Rußland kämpften und dabei zu einem Großteil den Tod fanden, als Verbrecher abgestempelt.“
Statt sich lange mit der Frage aufzuhalten, was sie dort zu suchen hatten, kommen die sensiblen Persönlichkeiten lieber gleich auf den Punkt. Sie verweisen auf die Leichen in den eigenen Reihen, in der Sicherheit, damit den Inbegriff dessen angegeben zu haben, was es an der soldatischen Pflicht zu ehren gibt. Die erbrachten Opfer sind schließlich tatsächlich unbestreitbare Zeugnisse dafür, daß die Pflichterfüllung bis zum äußersten gegangen ist. Und für die fordern sie den gerechten Lohn vorbehaltloser Anerkennung. Sie empfinden es als empörend, daß ihnen dieser Lohn versagt wird und sie stattdessen mit irgendwelchen „Greueltaten“ konfrontiert werden. Daß die den Wert ihrer Leistung irgendwie schmälern könnten, ist für sie nämlich keineswegs einsichtig. „Als schlichte Wehrmachtangehörige“ insistieren sie darauf, daß sie für deren Anordnung gar nicht zuständig waren, ihr Part nur im Ausführen bestanden hat – und daß sie es dabei an Einsatz haben fehlen lassen, können sie guten Gewissens von sich weisen. Da äußern sich nicht etwa Vertreter einer antiquierten Pflichtauffassung, sondern ziemlich perfekte Charaktermasken der Soldatenpflicht, die nur ausplaudern, was jeder Staat seiner kämpfenden Mannschaft abverlangt. Die hat seine Befehle auszuführen, sie hat sie umstandslos zu akzeptieren – und das geht überhaupt nur so, daß die Ausführenden einerseits die Verantwortung für ihr Tun vollständig an die Befehlsgewalt abtreten und sich für unzuständig erklären in der Frage, ob der Inhalt der Anordnungen, die sie befolgen, in Ordnung geht. Sie haben sich – als verantwortungslose Subjekte sozusagen – zum Erfüllungsgehilfen ihres Staats zu machen; und dafür müssen sie sich andererseits ebenso vollständig zuständig machen für die ihnen befohlene Sache, aber eben nur im Hinblick auf deren prompte Erledigung. Die haben sie als ihre Verantwortung und höchste Pflicht zu begreifen.
Es sind Leute, die diese Trennung hinter sich haben, die nachträglich zu Protokoll geben, es als Glück zu empfinden, daß ihnen – „Bei unserer Division war es strengstens verboten, sich an Zivilisten zu vergreifen.“ – die Befehlslage oder ihre späte Geburt Dinge erspart hat, die sie vor sich nicht hätten verantworten können, aber wohl ausgeführt hätten, wenn sie ihnen befohlen worden wären. Dieselben Leute empfinden es als „Tragödie einer Generation“, daß sie im Krieg Dinge angerichtet haben, die sie vor den sittlichen Maßstäben, die für sie im gewöhnlichen Leben gelten, nicht rechtfertigen können, die sie aber schließlich auch nicht zu verantworten hatten. Und ihr Soldatengewissen funktioniert dabei dermaßen gut, daß sie keineswegs defensiv, sondern im stolzen Bewußtsein der erfüllten Pflicht Dokumente zu „Fälschungen“ erklären, auf denen deutsche Soldaten bei Hinrichtungen und ähnlichem zu sehen sind. Sie brauchen sich als treue Diener ihres Staates sowas nicht zurechnen zu lassen, und so ist nach der Auschwitz- die Wehrmachtlüge fällig. Gar nicht anders, sondern nur umstandsloser von den praktisch ohnehin allemal maßgeblichen Bestimmungsgründen ihres Willens her erläutern diejenigen ihr Handeln, die mit dem schlichten Verweis auf die „Gesetze des Krieges“ einen ihnen unverständlichen Moralismus zurückweisen, der Kriegsgreuel für Pflichtwidrigkeiten hält. Mit Auskünften darüber, was im Krieg so alles zur Soldatenpflicht gehört, wird dieser Moralismus dann eines besseren belehrt:
„In dieser Ausstellung werden Bilder von der Hinrichtung von Männern und Frauen durch Erhängen oder Erschießen gezeigt. Gezeigt werden keine Bilder von den Gründen und Vorfällen, die zu dieser Bestrafung geführt haben. Wenn man diese Bilder sehen könnte, würde man die Leiber von deutschen Soldaten sehen, die durch von Partisanen gelegte Minen zerfetzt oder…“
Man mag gar nicht nachfragen, wie wohl die Aussteller dem Argument begegnen würden, daß das, was sie als Kriegsverbrechen anprangern, eine Strafaktion war, die ausweislich der Grundsätze des internationalen Kriegsrechts rechtmäßig war:
„Aber es verschwindet unter der scheinbar dokumentatorischen Suggestivkraft des Bildes, ob es sich um eine Hinrichtung von Partisanen handelt – bis heute gerechtfertigt vom Kriegsvölkerrecht, das das Recht zum Töten den „Kombattanten“ vorbehält, also den von ihrem Staat in die Pflicht des Tötens genommenen Soldaten.“ (Aus einem Kommentar von F. K. Fromme in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 25.2.1997)
Mehr als auf dieselben Grundsätze zu verweisen –
„Infolge des Grundsatzes der Gegenseitigkeit berechtigt die Anwendung verbotener Kampfmittel den Gegner zum Einsatz derselben Kampfmittel, jedoch nur in den Grenzen der Repressalie, d.h. unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.“ –
und mit ihren Gegnern darüber zu rechten, auf welcher Seite das Foul begangen worden ist und ob die Repressalien verhältnismäßig waren, bleibt ihnen ja gar nicht. Der vielfach vorgetragene Wunsch nach „einer reichhaltigen Ausstellung zum Thema ‚Kriegsverbrechen an den Deutschen‘“, als Ersatz oder zur Abrundung des in der Wehrmacht-Ausstellung behandelten Themas, liegt schließlich ganz in der Logik ihrer Ausstellung und ist mindestens ebenso hochanständig wie die billige Aufrechnerei, der sie sich anschließen, wenn sie in Anlehnung an die im Kriegsrecht gemachten Güterabwägungen zwischen einem normalen Krieg und Kriegsverbrechen unterscheiden.
*
Die politischen Verantwortungsträger im Deutschland von 1997 mit seinen mündigen Bürgern und seiner demokratischen Kultur können diesen Standpunkt der verletzten Soldatenehre gut nachempfinden. Politiker vom Schlage Gauweilers, die sich das Nationale als ihren obersten Wert auf die Fahne geschrieben haben, also gar nicht wenige, begreifen es geradezu als ihre Pflicht, die Ausstellung als „beleidigend“ zurückzuweisen.[3] Was die Ausstellung zeigt, sind – wenn es sich nicht um „Fälschungen“ handelt – „schlimme Exzesse einzelner Soldaten, aber das gibt keinem das Recht, die Wehrmacht als solche zu diffamieren.“[4] Eine Ehrenrettung der Wehrmacht ist also fällig.
Warum eigentlich? Warum lassen sie die Vergangenheit nicht auf sich beruhen? – Heute, wo dem demokratischen Deutschland niemand mehr einen Vorwurf aus seiner Nazi-Vergangenheit macht; wo sie selbst zu Sprachregelungen finden, die nicht gerade schmeichelhaft für die Wehrmacht ausfallen:
„Die Wehrmacht sei ein Instrument der nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik gewesen und in ihrer Spitze sowie mit Truppenteilen in Verbrechen des Nationalsozialismus verstrickt gewesen. Es sei aber nicht zulässig, ein Pauschalurteil über alle 18 Millionen deutsche Soldaten zu fällen und sie als verbrecherisch abzustempeln.“ (Aus der Erklärung der großen Koalition in Bremen, wo die Ausstellung demnächst im Rathaus gezeigt werden soll. Süddeutsche Zeitung 4.3.1997)
Warum wehren sie sich dennoch bzw. gerade mit solchen verdrechselten Sätzen erbittert gegen das Gesamturteil der Aussteller, die Wehrmacht sei eine „verbrecherische Organisation“ gewesen? Warum stellen sie immer wieder die Verbindung zwischen Hitlers Deutschland und dem heutigen Deutschland her, indem sie sich demonstrativ vor die Wehrmacht stellen?
Die Herren Staatsvertreter lassen sich eben auch nicht lumpen. Auf Untertanen, die sich für den Staat aufgeopfert haben, lassen sie nichts kommen. Zur Kranzniederlegung begeben sie sich zum Mahnmal des Unbekannten Soldaten, um dort
„all der deutschen Soldaten zu gedenken, die im Zweiten Weltkrieg als Opfer eines Unrechtsregimes ihr Leben lassen mußten und nun in einer beispiellosen Hetze von der Landeshauptstadt München generaliter als Verbrecher diffamiert werden.“ (Aufruf der Jungen Union, zitiert nach der Süddeutschen Zeitung vom 15./16.2.1997)
Gedacht wird da nicht irgendwelcher „Opfer eines (?) Unrechtsregimes“. Als Gegenstand der Verehrung fallen Leute, die im Dritten Reich einfach unter die Räder gekommen sind, von vornherein durch. Sie mag man als bedauerliche Nebenwirkung ansehen, sie haben aber überhaupt nichts Verehrungswürdiges an sich. Es sei denn die Leichen sind im Einsatz für die richtige Sache angefallen.[5] Das ist bei Soldaten, die Deutschland bis zur Selbstaufgabe gedient haben, eindeutig der Fall. Ihre bedingungslos praktizierte Pflichtergebenheit gegenüber Deutschland verdient die Anerkennung der zur Stelle geeilten Volksvertreter. Auch dann, wenn diese Leistung einem Verbrecherregime erbracht worden ist – schließlich stellen sie es auch nicht in die Entscheidung ihrer kämpfenden Truppe, wofür sie sich einsetzt. Ein nobler Standpunkt, der hier wohlgemerkt nicht von Untertanen eingenommen wird, die für ihre treuen Dienste in Ehren gehalten werden wollen, sondern von Repräsentanten der demokratischen Obrigkeit, die ihren Untertanen diese Pflichtergebenheit als vorbildlichen Bürgersinn nahebringen.
Nur für eine richtige Heldenverehrung reicht es bei den Frontkämpfern von damals nicht. Die haben zwar haargenau die richtige Dienstauffassung gegenüber ihrem Staat gezeigt, aber mit dieser Dienstauffassung der falschen Führung gedient. Als Vorbilder für das heutige Deutschland taugen sie deswegen leider nur bedingt: Für die Opfer, die sie dem damaligen Deutschland erbracht haben, können die Vertreter des heutigen Deutschland sie nicht vorbehaltlos verehren. Sie halten sie als „Opfer eines Unrechtsregimes“ in Ehren, was sie im Glanz von Ruhm und Ehre dann doch nicht erstrahlen läßt. Dafür müßten schon andere „deutsche Soldaten“ her. Solche, die nicht dem falschen, sondern dem heutigen Deutschland mit der Ergebenheit von damals bis zum Letzten die Treue halten. Nur hat das heutige Deutschland solche strahlenden Vorbilder noch nicht vorzuweisen. Das liegt am wenigsten an der fehlenden Bereitschaft seiner Untertanen. Der Staat hat solche vorzeigbaren Einsätze seiner Untertanen noch nicht zustandegebracht.[6] Und solange das so ist, greifen seine Politiker immer wieder zu dem Ersatzobjekt der nationalen Verehrung – und stören sich dann doch daran, daß das nicht vollwertig ist.
*
Und was sagt dazu die Opposition im Lande? Das war keine Werbung für die CSU! Die SPD erinnert an „CSU-Politiker der ersten Stunde“, die „sich im Grabe umdrehen würden, wenn sie das hören könnten“; die Grünen zeigen sich „entsetzt über den dramatischen Absturz der CSU ins ultrarechte Spektrum“; eine Riesengelegenheit, die gemeinsame Verantwortung für das demokratische Parteienspektrum ins Spiel zu bringen, um der Konkurrenzpartei mit der „Befürchtung“ über sie zu kommen, die aus ihr bereits herausschallt: Gauweiler drohe, so die CSU-interne Kritik,
„die Partei mit seinen Äußerungen über die Wehrmacht-Ausstellung endgültig aufs Abstellgleis zu führen.“ (Süddeutsche Zeitung vom 20.2.1997 und vom 24.2.1997)
Bleibt nachzutragen, was die Kritiker an den Gedenkfeierlichkeiten zu Ehren der Wehrmacht auszusetzen haben: „eine Verhöhnung der Opfer des Dritten Reiches“.[7] In Stellungnahmen wie dieser – alle folgenden sind von der Art – melden Politiker und ihre journalistischen Sprachrohre das Bedürfnis an, sich von der inszenierten Ehrenrettung der Wehrmacht zu distanzieren, ohne auch nur ein einziges Wort darüber zu verlieren, wovon sie sich distanzieren. Stattdessen schreiten sie zu einer alternativen Ehrenrettung all der Güter, die sie durch die Ehrenrettung der Wehrmacht in Mitleidenschaft gezogen sehen. Die Würdigung der Opfer ist den kritischen Stimmen also zu kurz gekommen. Die gehören erwähnt, damit die Distanz der heutigen Demokratie zum Rechtsvorgänger deutlich bleibt. Und das ist damit nachgeholt. Sonst noch was? Die Veranstaltung war eine
„organisierte Kampagne von Traditionsvereinen, die nicht nur die damals Widerstand leistenden Soldaten und Offiziere, sondern auch die heutige Bundeswehr durch ihre suspekte ‚Ehrenrettung‘ diskriminieren.“ (Kommentar in der Süddeutschen Zeitung vom 25.2.1997)
Suspekt ist die Ehrenrettung nicht deswegen, weil sie die Pflichtergebenheit von Soldaten als auch in der Demokratie beherzigenswerte Tugend hochhält und die Sehnsucht demokratischer Politiker nach vorzeigbaren militärischen Glanztaten erkennen läßt, sondern deswegen, weil sich diese Sehnsucht in einer allzu unbefangenen Pflege der Wehrmacht-Tradition Ausdruck verleiht. Dies paßt nicht recht zusammen, mit gewissen anderen ehrenwerten Traditionen, auf die sich das demokratische Deutschland und seine Bundeswehr auch noch beruft: Der Widerstand gegen Hitler, der nicht zuletzt in der Wehrmacht eine machtvolle Bastion hatte – zumindest ganz zuletzt –, wie steht der da, wenn die Wehrmacht staatsoffiziell für ihre Pflichterfüllung geehrt wird? Und wo bleibt der demokratische Unterschied, der die Bundeswehr so unverwechselbar mit der Wehrmacht macht, wenn die von führenden Demokraten als Vorbild soldatischer Pflichterfüllung in Ehren gehalten wird? Schließlich ist es dieser Unterschied, der das Recht der Bundeswehr auf treu dienende Soldaten begründet.[8] Am besten man sagt ihn einfach hin:
„Die Bundeswehr, die genau wisse, was sie von der Wehrmacht unterscheide, solle von der CSU in eine Kampagne einbezogen werden.“ (Der Münchner SPD-Oberbürgermeister Ude, zitiert nach der Süddeutschen Zeitung vom 25.2.1997)
Sie darf es bloß nicht sagen:
„In der Bundeswehr ärgern sich höchste Führungskräfte darüber, daß sie nicht öffentlich erklären dürfen, was die Armee eines demokratischen Staates von der des NS-Staates unterscheidet.“ [9]
Und das ist schade für eine demokratische Armee, deren ganzer Stolz es ist, in Albanien gerade zu einem Einsatz gekommen zu sein, bei dem sie 1. schießen durfte; und das 2., ohne sich dafür beim Parlament extra eine Erlaubnis abholen zu müssen.
*
Und was hört man sonst von der Truppe? „Bundeswehr-Soldaten verprügeln drei Ausländer“. Leider „in der Innenstadt von Detmold“ und nicht im Rahmen des SFOR-Dienstes, den sie demnächst in Bosnien hätten antreten sollen, um dort für Ordnung zwischen den bosnischen Volksgruppen zu sorgen. Ihren Auftrag, Nationalitäten auseinanderzuhalten, müssen sie irgendwie falsch verstanden haben. So kommen sie nun nicht zum Einsatz, und ihr Dienstherr muß erklären, wie es dazu kommen konnte:
„Das gesamtgesellschaftliche Problem Rechtsextremismus wirke auch in die Bundeswehr hinein, die Teil dieser Gesellschaft und besonders als Wehrpflichtarmee Spiegelbild der Gesellschaft ist.“ (Süddeutsche Zeitung 19.3.1997)
Wer sagt es denn: Jede Nation hat eben ihr Militär, und in der Bundeswehr sind junge Deutsche in bester Gesellschaft.
[1] Goldhagen in seiner Rede bei der Verleihung des Demokratiepreises 1997 der „Blätter für deutsche und internationale Politik“. Abgedruckt in der Süddeutschen Zeitung vom 15./16.3.1997
[2] Diese Distanzierungsleistung gegenüber verschiedenen Abteilungen „überflüssiger“ Gewalt, die der auf saubere Kriegsführung bedachte Moralismus (nachträglich) zustandebringt, ist wirklich nicht mehr wert als die Unterscheidungsbedürfnisse, auf die es den kriegführenden Befehlsgewalten selbst ankommt: Zum einen gegenüber der eigenen, ausführenden Mannschaft, die als Vollstrecker staatlicher Befehle funktionieren muß, deswegen den Unterschied zwischen staatlich angeordneter und individueller Gewalt zu respektieren hat und es bei eigenmächtigem Gewaltgebrauch mit den Kriegsgerichten zu tun bekommt. Zum anderen untereinander: Weniger in Kriegszeiten, dafür umso mehr in deren Gefolge, wenn es ihnen darum geht, das Benutzungsverhältnis zwischeneinander wieder herzustellen, und ihnen auffällt, daß sie dessen Willensgrundlagen durch ihre Aktivitäten im Krieg ziemlich zerrüttet haben, lebt in ihnen das Bedürfnis nach einem internationalen Kriegsrecht auf, das (künftige) Waffengänge so regelt, daß sie den Frieden danach nicht dauerhaft verunmöglichen. In den einschlägigen Konventionen verpflichten sie sich feierlich auf den Imperativ, daß sich die staatlich angeordnete Gewalt aus dem gegen den anderen Staat gerichteten Kriegszweck zu rechtfertigen hat, und verbieten sich Kriegshandlungen, die sich gezielt gegen die Bevölkerung des Kriegsgegners richten; zumindest dann, wenn der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht beachtet wird… Dieses zwischen den Staaten anerkannte Recht gilt zwar nicht in dem Sinn, es betrifft ja gerade die Fälle, in denen sich Staaten in der grundsätzlichsten Weise die Anerkennung und den Respekt vor ihren Rechten aufkündigen. Es kommt jedoch regelmäßig nach gelaufenen Kriegen zur Geltung und zwar im Rahmen und als Instrument der dann fälligen moralischen Abrechnung mit der unterlegenen Partei. Mit der exemplarischen Aburteilung von deren politischem und militärischem Führungspersonal stellen Sieger- und Aufsichtsmächte, aber auch die neueingesetzte Hoheit dann klar, daß Volk und Armee der falschen Führung hinterhergelaufen sind; und indem sie die ausgetragene Staatsfeindschaft kriegsrechtlich behandeln, als wäre sie die Privatveranstaltung einiger Personen gewesen, die zufällig führende Positionen im Staat innehatten, leisten sie gleichzeitig ihren Beitrag zur Beilegung der Feindschaft und zum Übergang zur Geschäftsordnung.
[3] Darunter z.B. das einstmalige Aushängeschild der Friedensbewegung Mechtersheimer, der sich heute als Mitgründer einer „Anti-Diffamierungs-Aktion München“ hervortut, um gegen die „pauschale Diffamierung der Soldaten“ zu protestieren. Dem Herrn wird wohl das Argument eingeleuchtet haben, daß die Bundeswehr die größte Friedensbewegung ist.
[4] Stoiber in der Süddeutschen Zeitung vom 25.2.1997
[5] Volksnahe Politiker wie Peter Gauweiler sind da nie um einen passenden Vergleich verlegen. Dem „Herrn Reemtsma“ empfiehlt er, lieber eine Ausstellung zu organisieren „über die Toten und Verletzten, die der Tabak angerichtet hat, den er verkauft hat.“ (Süddeutsche Zeitung 21.2.1997) Der regt sich über Leichen auf, wo er selber welche im Keller hat! Der Verkauf von Tabak disqualifiziert für Kritik am deutschen Krieg; soweit so klar. Nur hat sich der Münchner Politiker ein bißchen gehen lassen und mit seiner gelungenen Polemik herausposaunt, daß die Geschädigten des Tabakgenusses seiner Auffassung nach viel mehr Aufhebens wert sind als die Opfer der Wehrmacht. Das wurde als Mißgriff bemerkt und sofort korrigiert. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (9.4.1997), die einen noch passenderen Vergleich bei der Hand hatte und mit dem den „Herrn Reemtsma“ ein ganzes Interview lang traktierte: „Können wir jetzt noch einmal auf die Frage nach Ihrem Vater und seinen Aktivitäten im Dritten Reich zurückkommen?“
[6] Ein bißchen was davon, wonach da führende Nationalisten Bedarf anmelden, hatte der Hubschraubereinsatz der Bundeswehr in Albanien an sich: Die Bild am Sonntag hat das gemerkt und sich gar nicht mehr eingekriegt. Die Überschriften vom Tage (16.2.1997) lauteten: „So holten wir unter Beschuß 103 Menschen raus“ – „Die Deutschen feuerten 250 mal“ – „Oberst Glawatz: Ich schoß als erster“ – „Die deutschen Helden von Albanien“ – „Jetzt weiß ich, warum wir die Bundeswehr haben.“
[7] Der CSU-Politiker Thanheiser in der Süddeutschen Zeitung vom 20.2.1997
[8] In diesem Zusammenhang ist eine Episode aus dem Bundestag zu erwähnen. Der hat sich nun endlich zur Rehabilitierung und Entschädigung (DM 7000,-) von Wehrmachtdeserteuren entschlossen – und dabei das dringende Bedürfnis nach einer Erläuterung verspürt. In der stellt er ausdrücklich klar, daß die „Achtung“, die er den Deserteuren der Wehrmacht ausspricht, keineswegs ihr Verhalten als solches rechtfertigt; in seinen Worten: daß „die der Verurteilung zugrunde liegende Handlung auch heute Unrecht wäre“. „Negative Auswirkungen“ seines Entschlusses auf die Bundeswehr sind also auszuschließen, weil das Desertieren in der Bundeswehr selbstverständlich auch verboten ist. Was wiederum heute in Ordnung geht, weil „Bundeswehr und Wehrmacht nicht vergleichbar seien, schließlich sei es den Soldaten der Bundeswehr verboten, verbrecherische Befehle zu befolgen.“ (Süddeutsche Zeitung 24.4.1997)
[9] Süddeutsche Zeitung vom 27.1.1997. Riehl-Heyse bezieht sich in seinem Kommentar da auf einen Beschluß der Bundeswehr, die es ihren Offizieren untersagt, an Diskussionen über die Ausstellung teilzunehmen. Dieser Beschluß ist gefaßt worden, nachdem die Ausstellung politisch zum Streitfall geworden ist. Davor ist die Bundeswehr mit der Ausstellung ganz gut zurechtgekommen. In ihrer offiziellen Zeitschrift bemerkt sie, daß an deren Quellen „wohl kaum zu zweifeln“ sei; der Besuch der Ausstellung wurde ausdrücklich empfohlen. Man kann die Ausstellung eben auch als eine einzige Bekräftigung des demokratischen Unterschieds zwischen Bundeswehr und Wehrmacht sehen. Die Bundeswehr wird sich freilich hüten, sich in einem politischen Streit einzumischen! Den hat schließlich nicht sie zu entscheiden!