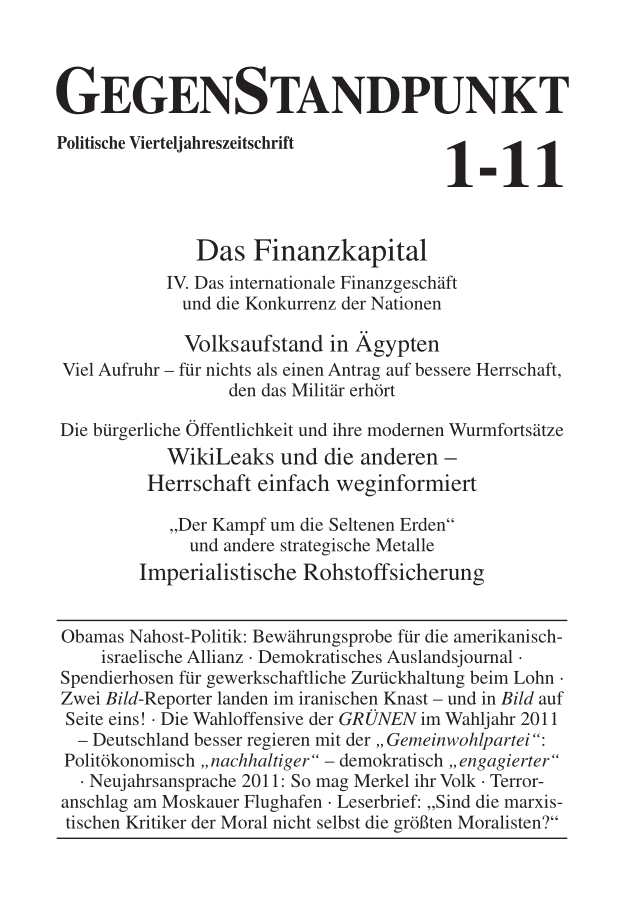Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Demokratisches Auslandsjournal
Die Demokratie gilt als der wertvollste Exportartikel des westlichen Abendlandes. Meinungsfreiheit, Wahlen, Rechtsstaat und was alles so dazugehört: Das sind Insignien einer Herrschaft, die den Nationen der Welt keineswegs nur zur Übernahme anempfohlen werden. Das sind auch die Maßstäbe ihrer kritischen Überprüfung, ob sie auch den Respekt verdienen, den sie als Mitglieder der modern zivilisierten Völkerfamilie für sich in Anspruch nehmen. Schließlich haben die Menschen ein Recht darauf, den Gang ihrer Gemeinschaft in die eigene Hand zu nehmen und – wie der Name sagt – als Volk die Herrschaft selbst zu bestimmen. Die politisch Verantwortlichen in den Heimatländern der Demokratie pflegen je nach ihren Mitteln zur Beförderung dieses Menschenrechts ein wenig Nachhilfe zu leisten – und eine kritische Öffentlichkeit bilanziert ihrerseits täglich den Stand der Fortschritte der Demokratisierung auf dem Globus.
Wie immer zufällig und willkürlich ausgewählt: zwei Monate demokratischer Auslandsjournalismus, und was man dabei lernt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Demokratisches Auslandsjournal
Die Demokratie gilt als der wertvollste Exportartikel des westlichen Abendlandes. Meinungsfreiheit, Wahlen, Rechtsstaat und was alles so dazugehört: Das sind Insignien einer Herrschaft, die den Nationen der Welt keineswegs nur zur Übernahme anempfohlen werden. Das sind auch die Maßstäbe ihrer kritischen Überprüfung, ob sie auch den Respekt verdienen, den sie als Mitglieder der modern zivilisierten Völkerfamilie für sich in Anspruch nehmen. Schließlich haben die Menschen ein Recht darauf, den Gang ihrer Gemeinschaft in die eigene Hand zu nehmen und – wie der Name sagt – als Volk die Herrschaft selbst zu bestimmen. Die politisch Verantwortlichen in den Heimatländern der Demokratie pflegen je nach ihren Mitteln zur Beförderung dieses Menschenrechts ein wenig Nachhilfe zu leisten – und eine kritische Öffentlichkeit bilanziert ihrerseits täglich den Stand der Fortschritte der Demokratisierung auf dem Globus.
Wie immer zufällig und willkürlich ausgewählt: zwei Monate demokratischer Auslandsjournalismus, und was man dabei lernt.
14. - 20. Dezember 2010, Weißrussland
Beim weißrussischen Präsidenten Lukaschenko handelt es sich – aus der Sicht seiner westeuropäischen Nachbarn – nicht um einen Herrscher im Dienste des Volkes, dem der Ehrentitel eines Demokraten
gebührt, sondern um den letzten Diktator Europas
(FAZ). Seit Jahren will dieser Herrscher am Ostrand Europas
nämlich dem natürlichen Drang des von ihm verwalteten Volkswillens nach mehr Westorientierung nicht nachgeben und sich nicht aus der Umklammerung Putins lösen
. (SZ, 16.12.)
Obwohl die Europäische Union mit Lockangeboten und Strafaktionen daran arbeitet, den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko auf den Pfad der demokratischen Tugenden zu bringen
(SZ, 20.12), kommt die Entmachtung des dortigen Herrschers resp. die Umorientierung seines Herrschaftsbereiches auf mehr Demokratie, sprich: die Subsumtion seines Landes unter Europas Vorherrschaft, nicht so recht voran. Und dann das
(SZ): Ein triumphaler Sieg des Diktators mit 79,67 % Wahlstimmen bei den heimischen Präsidentschaftswahlen!
Dass der Mann damit auf den Pfad der demokratischen Tugenden zurückgekehrt wäre, den die EU gerne von ihm hätte – den Respekt vor seinem eindrucksvollen Wahlsieg kann der weißrussische Präsident Lukaschenko seitens der hiesigen Öffentlichkeit nicht erwarten. Da man sich hierzulande den Abgang seiner Herrschaft wünscht, entdeckt man im Wahlsieg des Potentaten weniger den Ausweis demokratischer Legitimität als den Beweis für die Renitenz und den Machtinstinkt
(SZ) eines Diktators, der sich den Ansprüchen europäischer Ordnungsbelange an der Ostgrenze Europas versagt, und damit der natürlichen Orientierung des von ihm verwalteten Volkswillens auf Demokratie und Westorientierung durch den unbedingten Willen zum Machterhalt
(SZ) im Weg steht. Für die Aufrechterhaltung seiner Definition der nationalen Ausrichtung Weißrusslands beugt und knechtet er Volkes Willen, wie es ihm gerade passt.
Allein die Höhe des Wahltriumphs Lukaschenkos – fast 80 % Zustimmung
(FAZ) – zeigt eindeutig, wie umfassend das System aus Repression und Gewalt in Weißrussland funktioniert. Dass über die Wahlen in Weißrussland der Abgang Lukaschenkos und die gewünschte Neuausrichtung der ortsansässigen Herrschaft nach Westen nicht zu erwarten war, deutet eindeutig auf ein System von Repression, das die Artikulation des wahren Volkswillens unmöglich macht.
„Dass der ‚letzte Diktator Europas‘ die Präsidentenwahl diesmal verlieren würde, hat niemand ernsthaft erwartet. Dafür funktioniert das System seiner persönlichen Herrschaft, das die Meinungsfreiheit unterdrückt und die politische Opposition mit Drohungen und Verfolgungen einschüchtert, einfach zu gut“. (FAZ)
Und dann zeugen 80 % Zustimmung der Wähler eben eindrucksvoll von einem System aus 100 % Repression, in dem der Wählerwille in Weißrussland solange unter Kuratel gestellt wird, bis keine Stimme gegen Lukaschenko mehr übrig bleibt! Über den wahren Charakter von Lukaschenkos Herrschaft macht man sich doch im Westen nichts vor, und da der Wahlausgang den Abgang der Herrschaft Lukaschenkos nicht befördert, sind die Belege für Wahlbetrug auch eindeutig: In Weißrussland werden etwa 40 % der Stimmen bereits vor der Wahl abgegeben, was die nötige Transparenz beim Wahlprozess unmöglich macht.
(Der Standard, 14.12.) – Diktatoren wissen natürlich, wie man eine Briefwahl dafür nutzt, die Wahlzettel für die entsprechenden Ergebnisse zu fälschen. Und wenn die entsprechenden Beweise fehlen – sogar die OSZE will von einem Wahlbetrug nicht sprechen
(Standard,16.12.) –, reicht die Logik des Verdachts: Die alten Herrschaftscliquen des Regimes sind viel zu gut organisiert, um sich bei eindeutigen Aktionen von Wahlbetrug in flagranti erwischen zu lassen.
(SZ, 20.12.)
Man sehe sich nur die infamen Tricks der Wahlmanipulation an, erlaubt der Diktator doch glatt mehrere Wahlalternativen: Neun Kandidaten hatten den weißrussischen Dauerherrscher in dessen Amt herausfordern dürfen. So viele wie nie zuvor in der 16-jährigen Epoche von Alexander Lukaschenko – die sichtbarste Geste, dass das Land zu mehr Pluralismus bereit ist
. Das Land
schon, dessen demokratischen Aufbruchswillen weg von Lukaschenko man durch die Vielzahl von Gegenkandidaten belegen will, und auch wenn die als lupenreine Demokraten in unserem Sinn nicht recht funktionieren mögen – Wie hoffnungslos die Lage der Opposition auch heute noch ist, zeigt allein schon der Umstand, dass sie noch vor wenigen Monaten Moskau als ihren Hoffnungsträger betrachtete.
(NZZ) –, so wird doch die Hoffnung auf demokratische Gegenopposition mit der Zulassung der Gegenkandidaten durch Lukaschenko auch schon wieder erledigt:
„Gönnerhaft ließ Lukaschenko das Großaufgebot an Gegnern zu – eigentlich ein kluger Zug. Machiavellis Ratschlag an den Fürsten Medici, ‚divide et impera‘, teile und herrsche, konnte nirgends besser fruchten als in einem zerfransten Bewerberfeld.“ (SZ)
Der alte und neue Machthaber hat mit den Gegenkandidaten, gegen die er antritt, eben nicht gleich selbst die erfolgversprechende Opposition installiert, die sich zu seiner Abwahl verbündet und ihn von der Macht vertreibt: ein eindeutiger Beweis für die taktische Finesse Lukaschenkos, sich den Machterhalt zu sichern. Hätte Lukaschenko allerdings nur einen von denen zugelassen – hätte ihm die SZ aber erst sowas von Unterdrückung der Opposition erzählt!
Und als ob schon manchem Wahlbeobachter das Material von Wahlbetrug, taktischen Manövern und Repression bei der Wahl durch Lukaschenko auszugehen scheint, mit dem die undemokratischen Machenschaften dieses Mannes zu belegen ist, beweist sich nach Ende der Wahl doch noch, dass der einzige Inhalt seiner Herrschaft die blanke Repression ist:
„Gerade weil Lukaschenko verhältnismäßig sicher im Sattel sitzt – und die politische Opposition mit neun aufgebotenen Gegenkandidaten aussichtslos zersplittert ist – , hätte er nicht viel riskiert, diesmal demokratische Spielregeln gelten zu lassen. Eine Zeitlang sah es auch so aus. Jedenfalls konnten die Präsidentschaftskandidaten ohne größere Behinderung Wahlkampf führen, und sie durften sogar im Fernsehen auftreten.“ (FAZ)
Rechtzeitig nach Ende der Wahl veranstalten einige Oppositionelle dann doch noch die Randale, mit denen das Regime Lukaschenkos durch Demonstrationsverbote und diverse Verhaftungen uns wieder sein wahres Gesicht zeigt
. (FAZ)
Denn auch wenn im demokratischen Heimatland der FAZ der Wahlkampf am Wahlabend für beendet erklärt und das gegenseitige Aufhetzen des Wahlvolks heruntergefahren wird, vom Wahlverlierer verlangt ist, das Ergebnis zu akzeptieren und sich an seinen vorgesehenen Platz auf die harte Bank der Opposition zu begeben: In Weissrussland verlangt die Demokratie eben auch die Berücksichtigung der Wahlverlierer auf Machtanspruch – mindestens bis sich das System Lukaschenko von der Macht verabschiedet.
Das kann sich ziehen. Denn wenn schon von einer Opposition nichts zu sehen ist, die sich demokratisch-westtauglich gegen die Machenschaften Lukaschenkos vereint und eine Randale endlich zum notwendigen Volksaufstand für die echten Werte unserer Demokratie organisiert, dann noch weniger von einem Volk, das sich immer noch für dumm verkaufen lässt und einen Führer wählt, der ihm so einigermaßen sein Auskommen sichert:
„Noch immer gelingt es Lukaschenko, der Bevölkerung einen für den postsowjetischen Raum ansehnlichen Lebensstandard zu bieten. Sollte dieser Grundpfeiler seiner Popularität ins Wanken geraten, könnte auch die Macht Lukaschenkos erodieren.“ (NZZ)
Ungeheuerlicherweise verzichtet der Diktator auf die im übrigen postsowjetischen Raum beim Aufbau der freien Marktwirtschaft so übliche Verarmung und besticht sein Volk mit einem Lebensstandard, der auch in der Schweiz Eindruck macht. Den Auftrag der Volksfreunde aus Zürich, diesem Treiben des Diktators ein Ende zu machen, hat das Volk in Belarus jedoch vorerst vergeigt. Es lässt sich, gerade erst aus dem Völkergefängnis entlassen,von dem bisschen Borschtsch und Kalduny betören und von seinem ureigenen Freiheitsdrang abhalten – wo doch der edle Charakter eines freien Volkes gerade darin gipfelt, dass es seinen Lebensstandard nur dann hinnimmt, wenn es sich über den auch beschweren darf.
22. Dezember, Ukraine
In der Ukraine – so berichtet die SZ – wird die frühere Premierministerin Timoschenko wegen angeblichen Amtsmissbrauchs
angeklagt, weil sie in ihrer Zeit als Regierungschefin 217 Mio Euro, die nach dem Gesetz für den Umweltschutz ausgegeben werden mussten, an die staatliche Rentenkasse überwiesen hat
, und so könnte man ja, wenn man will, abwarten, wie der Rechtsstreit seinen Gang nimmt. Soll man aber nicht. Im Kommentar deckt der Berichterstatter aus der Ukraine nämlich ganz andere Rechtsverstöße auf:
„Schon auf den ersten Blick wirkt die Anklage gegen die ukrainische Oppositionsführerin, der bei einer Verurteilung eine hohe Haftstrafe droht, reichlich konstruiert.“ (SZ)
Dass die Anklage am in der Ukraine geltenden Recht vorbei inszeniert ist, braucht durch Studium der Anklageschrift schon mal nicht nachgewiesen zu werden. Wenn allein die Drohung, Timoschenko könnte aus dem Verkehr gezogen werden, auf den Münchner Redakteur so unmittelbar wirkt
, dann muss ja auch was dran sein. Warum schon die Anklageerhebung gegen eine ordnungsgemäße Arbeit der Staatsanwaltschaft spricht, zeigt der Vergleich mit der normalen Demokratie, die selbstverständlich da herrscht, wo die SZ zu Hause ist: Dort sind für Amtsmissbrauch ja ganz andere Richter zuständig!
„In einer normalen Demokratie wäre dafür keinesfalls ein Strafrichter zuständig. Doch in der Ukraine ist die Demokratisierung vorerst gescheitert. Die Führung der letzten Jahre, hervorgegangen aus der Orangenen Revolution vor sechs Jahren, hat ihre Chancen dafür nicht genutzt. Daran ist auch Julia Timoschenko, die zweimalige Ministerpräsidentin schuld.“
Dabei wäre es doch so einfach gewesen: Hätte die zweimalige Ministerpräsidentin in ihrer Amtszeit den Rechtsstaat entsprechend angepasst und politische Prozesse gegen sich auch nach ihrer Amtszeit verunmöglicht, dann könnte der ideelle Richter aus München der Ukraine jetzt eine prima Demokratie attestieren, so aber:
„Doch kann all dies nicht rechtfertigen, wie der neue Präsident Viktor Janukowitsch, der Mann der ostukrainischen Industrie-Oligarchen, mit der jetzigen Opposition um Timoschenko umgeht. Ganz offensichtlich will er mit Hilfe des Generalstaatsanwalts, eines alten Gefolgsmannes, kleingeistig Rache an den Helden der Orangenen Revolution nehmen, weil diese ihn an der Spitze von Millionen Demonstranten vor sechs Jahren vorübergehend von der Macht verdrängt hatte.“
Es bleibt bei parteilichen Attributen in denunziatorischer Absicht, obgleich gut und böse hier mal ganz anders als sonst üblich verteilt ist. Dass in der Ukraine Revolutionäre groß raus- und gut vernetzte, kapitalkräftige Unternehmer äußerst schlecht wegkommen, sortiert die Grauzonen zwischen Recht, Rechtsprechung und (Un-)Gerechtigkeit jedenfalls sehr offensichtlich
: Timoschenko mag zwar abgewählt sein, ist aber eine farbige Heldin mit millionenfacher demokratischer Legitimation, und Janukowitsch – wenn auch ins Amt gewählt – steht ohne da, weil er ja bloß Lobbyist von einigen wenigen Geld- und Drecksäcken ist.
Wenn in der Ukraine diejenigen, die uns nicht passen, vom Recht Gebrauch machen und uns genehme Politiker damit fertigmachen können: dann ist das Recht schlecht und die Justiz nicht unabhängig.
24. Dezember, Argentinien
Anderen Orts kann die politische Instrumentalisierung der Justiz dagegen richtig Freude bereiten.
Das Aufheben der Amnestie und die Neuaufnahme der Verfahren gegen Juntamitglieder der argentinischen Militärherrschaft mit der klaren politischen Vorgabe einer Verurteilung zur Höchststrafe widerspricht hier keinesfalls dem Grundsatz der Unabhängigkeit der Gerichte. Die von der amtierenden Staatsführung bestellte und erfolgreich durchgezogene Abrechnung mit den Amtsvorgängern wird einhellig begrüßt: Politiker wie Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner mögen manches falsch machen, bei diesem Thema liegen sie richtig.
(SZ)
Dieser Schauprozess begeistert: Die leichenträchtige Amtsausübung als persönliche Verfehlung der damaligen Staatschefs strafrechtlich zu ahnden, lenkt zielgerichtet vom politischen Gehalt der Schlächterei ab und nimmt umstandslos Partei für deren Opfer – vollkommen ohne Erwähnung dessen, was die eigentlich wollten und wessen Feindschaft sie sich warum zugezogen haben.
So bleibt es ausgerechnet den Angeklagten überlassen, zu ihrer eigenen Ehrenrettung auf dem Zusammenhang zwischen Nation, politischer Opposition und Schlächterei zu bestehen, von dem heute keiner mehr etwas wissen will. Sie erinnern an die damalige Auftragslage des Westens und ihren nationalen Beitrag zur Abwehr des Kommunismus. Ihre Verteidigung, die Nation habe sich im Staatsnotstand gegen marxistische Subversive
befunden, in einem inneren Krieg, angefangen von terroristischen Organisationen
, weswegen jeder aufrechte Demokrat auch heute die Notwendigkeit ihres staatlichen Gegenterrors einsehen müsste, gilt allerdings nichts mehr. Von diesen verflossenen Sünden weiß die argentinische Justiz den Westen zu befreien. Als antikommunistischer Wahn
auf einen psychischen Defekt heruntergebracht, wird er den Putschisten als nachträgliche Verhöhnung der Opfer, als Beweis ihrer unbelehrbaren Amoralität zur Last gelegt. Mit ihren Bluthunden wollen Demokraten, nach getaner Arbeit, nichts mehr gemein haben. Es geht um Gerechtigkeit und um einen Staatsterror, der sich nicht nur gegen Guerilleros richtete, sondern auch gegen friedliche Andersdenkende.
Solange die Andersdenkenden friedlich sind und nicht zur Tat schreiten, gehört sich Staatsterror definitiv nicht.
27. Dezember, China
Einen wohlwollenden Ratschlag in Sachen Demokratie und Wahlen erteilt die SZ der VR China:
„Doch weil immer deutlicher wird, dass nicht alle im Land gleichermaßen davon (vom kapitalistischen Aufbruch Chinas) profitieren, bröckelt der Rückhalt der Menschen. Die meisten fühlen sich benachteiligt, viele gänzlich chancenlos und einige sogar betrogen. Und weil es kein Ventil für die wachsende Wut der Bürger gibt, wie die Demokratie sie unter anderem in der Institution der freien Wahlen gewährt, muss die Partei dringend Lösungen und neue Perspektiven für alle bieten.“ (SZ)
Der freiheitsliebende Journalist scheint nicht zu befürchten, dass es den Leser verstören könnte, welch zynische Botschaft er da über die Demokratie mitteilt. Unseren Kenner der Marktwirtschaft überrascht nicht, dass beim Aufbruch in den Markt die meisten Menschen materiell zu kurz kommen. Anlass zur Sorge gibt diesem Volksfreund die materielle Lage der Massen, wenn „die Menschen“ ihre Armut als nicht angemessen empfinden, und diese gefühlte
Ungerechtigkeit durch bröckelnde
Gefolgschaft das Programm der Regierenden gefährdet. Denn dagegen hat sich die Demokratie etwas Vorbildliches ausgedacht, um im Unterschied zur chinesischen Einparteien-Undemokratie mit derartiger Unzufriedenheit fertigzuwerden: Empörte Bürger dürfen ihre Unzufriedenheit – gleich welchen Anlass und Grund sie hat – in der institutionalisierten freien Wahl in ein hoffnungsfrohes Wahlkreuz für eine konstruktive Regierungsalternative übersetzen – das ist das Ventil
, das eine wachsende Wut
braucht. Da die chinesische Herrschaft diesen Hauptsatz der politischen Hydraulik nicht beherzigt und ihr Staatspersonal einfach nicht vom Volk auswählen lassen will, steht sie nun in dem Dilemma, ihren unzufriedenen Bürgern glatt etwas bieten
zu müssen. In Sachen Effektivierung der Herrschaft können die chinesischen Kommunisten also noch gewaltig von uns lernen.
28. Dezember, Venezuela
„Erst vor wenigen Wochen hat das venezolanische Parlament den Präsidenten Hugo Chávez in einer umstrittenen Entscheidung mit einer Fülle zusätzlicher Kompetenzen ausgestattet. Bis 2012 darf Chávez faktisch per Dekret regieren. Nun macht er erstmalig Gebrauch davon ... unterzeichnet der linksgerichtete Präsident einen Erlass, der die Gründung eines Fonds vorsieht, aus dem der Wiederaufbau der bei einer Flutkatastrophe zerstörten Häuser finanziert werden soll. 130 000 Menschen soll mit 2,3 Milliarden Dollar geholfen werden.“ (SZ)
Solche Meldungen kann ein verantwortlicher Zeitungsredakteur unmöglich unkommentiert stehen lassen. Dem unvoreingenommenen Leser fehlt nämlich noch völlig die Richtung für die zu bildende Meinung. Sicher ist sich der Berichterstatter freilich, nach welchem Kriterium der Leser sein Urteil zu fällen gedenkt, schließlich kennt er selber auch kein anderes und schreibt seitenweise seine Zeitung damit voll: Herrscht hier einer, um dem Volk zu dienen, oder dient hier einer dem Volk, um zu herrschen? Die Antwort auf diese Alternative gibt die Sachlage allerdings niemals her. Ob in Venezuela der gute Zweck ein umstrittenes
Mittel heiligt oder die böse Absicht die gute Tat relativiert, dieses moralische Urteil entspringt allein dem eigenen Standpunkt.
Gute Dienste leistet auch hier die unlängst an der Ukraine geschulte Methode, die Sachlage auf sich wirken zu lassen:
„Es wirkt wohl kalkuliert, dass Chávez seine neue Macht als Erstes auf ein Projekt humanitärer Hilfe anwendet. Er baut dadurch seine Popularität bei den Armen aus, die seine wichtigsten Wähler sind und ihm 2012 zur neuerlichen Wiederwahl helfen sollen. Der Opposition nimmt er fürs erste die Argumente.“
Der sich einstellende Ärger bewirkt dann wie von selbst, welche parteilichen Vokabeln dem Autor aus der Feder fließen. Für die Fluthilfe passt populistische Kalkulation
, der Opposition werden gute Argumente
gestohlen; je mehr Gutes der Präsident tut, desto schwerer kann sie ihn schlechtmachen.
Apropos venezolanische Präsidenten: Carlos Pérez, dem Amtsvorgänger und ehemaligen Widersacher
von Hugo Chávez, widmet die SZ anlässlich seines Ablebens einen kritischen Nachruf. Pérez soll eine widersprüchliche Politik
betrieben haben, indem er die Verstaatlichung der Ölindustrie in Gang gebracht hat. Das würdigt der Kommentar rückblickend als ein Stück Umverteilungspolitik
, die durchaus den Maßnahmen ähnelt, die Chávez heute unternimmt
; der kleine Unterschied, dass der verblichene Pérez die Erträge des nationalisierten Öls von ca. 200 Milliarden Dollar direkt in die eigenen und die Taschen seiner Mitstreiter umverteilt
haben soll, tut bei diesem Vergleich gar nicht viel zur Sache. Kritisch sieht der Kommentar, dass Pérez bei Unruhen der verarmten Bevölkerung in die Menge schießen ließ, weil das letztendlich in der Machtübernahme des Populisten endete. In der Tat hatte die widersprüchliche Politik des Carlos Andrés Pérez viel zum Aufstieg des Offiziers Chávez beigetragen.
Mit seiner Steilvorlage für Chávez hat sich der Verstorbene, bei allem Respekt, dann doch ein paar Widersprüche
zu viel geleistet.
31. Dezember, Russland
Hat der Leser noch vor einer Woche in der Ukraine Industrie-Oligarchen
zu verabscheuen gelernt, heißt es jetzt: Relativieren! Denn beim Blick nach Russland gilt es eine solche Figur positiv zu besetzen. Dort wird zwar einer der Wirtschaftskapitäne, die ihr märchenhaftes, zusammengerafftes, manchmal geraubtes Vermögen in politischen Einfluss umsetzen wollten
, einer der letzten Oligarchen aus den Neunzigern, als der Staat so schwach war, dass die Tycoons allen Ernstes glaubten, nur sie, die frisch gebackenen Kapitalisten, könnten Russland retten
(SZ), zum zweiten Mal zu 14 Jahren Haft verurteilt. Chodorkowskij soll man allerdings als Opfer sehen.
Die SZ knüpft dafür bereits an die Urteilsverkündung einen Verdacht: Es hat etwas von einem Angsturteil.... Die Begründung vier Tage lang dahingemurmelt, das Strafmaß am Tag vor Silvester verkündet, als viele Zeitungen nicht mehr erscheinen, als das ganze Land sich auf Neujahr vorbereitet, das wichtigste Fest des Jahres. Hätte der Richter Danilkin seine Entscheidung in seinem Wohnzimmer verkündet, es hätte nicht diskreter ablaufen können. Was immer auch Chodorkowskij und Lebedjew sich zuschulden kommen ließen – dieser Prozess, der selbst nach Ansicht von Kreml-Beratern rechtsstaatliche Kriterien verletzt, hat es nicht ans Licht gebracht.
Der SZ können die Russen es nie recht machen: Ziehen sie einen Schauprozess auf, heißt es STALIN!, endet ein jahrelanger Schauprozess ohne Show, auf der man herumhacken könnte, ist es ein „Angsturteil“. Der Richter erzählt vier Tage lang, warum es gefällt wird: Der Korrespondent braucht keine Sekunde lang hinzuhören, um absolut im Bilde zu sein – der Mann murmelt, also hat er was zu verbergen, also ist es zum Himmel schreiendes Unrecht, was er spricht!
Noch mehr Licht in die Sache bringt das Messen des Gerichtsurteils an vorgefassten politischen Erwartungen, die man hierzulande in die russische Führung setzt, um sich ein ums andere Mal abgrundtief enttäuscht zu geben:
„Vor allem aber verrät dieses Urteil viel über die russische Führung. Präsident Medwedjew hat die Erwartungen, die in ihn - vielleicht zu Unrecht – gesetzt wurden, nicht erfüllt. Er, der Jurist, galt als Grund dafür, dass das Verfahren fairer ablief als das erste, dass das Urteil bis zum Schluss als offen galt. Ob er ein milderes Maß nicht durchsetzen konnte oder wollte, ändert nichts daran, dass er wie der Komplize eines fremden Racheaktes wirkt.“
Hätte der Präsident dagegen das Recht im Sinne unserer Erwartung frisiert, ordentlich Einfluss auf die Justiz genommen und per Ukas ein mildes Urteil bestellt, dann hätte der Richterspruch auf die Prozessbeobachter aus Süddeutschland aber so was von fair gewirkt
. Und die Unabhängigkeit der russischen Justiz stünde außer Zweifel. So aber muss die SZ ihrem Feindbild freien Lauf lassen: Da ist ein Pappkamerad an der Spitze des russischen Staates, dessen Premier Privatfehden ficht. Auch das gelingt mittels der unerschöpflichen Leichtigkeit der – uns schon bekannten – Wirkung, die das Urteil bei unserem Beobachter hinterlässt.
„Denn vor allem wirkt die Gerichtsentscheidung, die niemand in Russland für unabhängig hält, wie die Abrechnung von Premier Putin mit einem Intimfeind. Dabei bemühen sich Putin und Medwedjew derzeit so angestrengt um den Westen wie seit Jahren nicht, beschwören gemeinsame Werte, Interessen, Ziele, werben um Know-how, Kapital, Dialog. Dieses Urteil aber zeigt, wie viel sie noch vom Westen trennt.“
Diese Leute haben sich einfach in ihrem Feindbild eingemauert. Sie geben selbst zu Protokoll, wie wenig das Russland von heute zum Bild des anti-westlichen Riesen passt, das sie von ihm zeichnen, bemerken selbst noch, wie sehr und auf wie vielen Ebenen dieses Land substantiell mit dem Westen kooperiert – und kaprizieren sich im nächsten Satz auf einen Urteilsspruch eines Moskauer Richters, um ihre Lieblingsidee von Russland als bedrohlicher Gegenmacht des Westens aufzuwärmen!
12. Januar 2011, Deutschland
„China hat wieder einen Rekord hingelegt: der größte Importpartner Deutschlands. Klingt belanglos – ist es aber nicht! Denn das fleißige Milliardenvolk hetzt von Superlativ zu Superlativ: der Präsident mittlerweile laut ‚Forbes‘ mächtigster Mann der Welt, das Land Exportweltmeister. Und der Titel ‚Größte Wirtschaftsmacht der Welt‘ nur noch eine Frage der Zeit. Lauter und schriller kann ein Weckruf nicht sein! ... Noch können wir gegenhalten! Mit Erfindergeist, Tüchtigkeit und Einsicht: vor allem in die Tatsache, dass wir uns jahrelange Diskussionen über Reformen oder auch nur einen neuen Großflughafen nicht mehr leisten können. Nie mehr!“ (Bild)
Ja, so gehen die Weltmeisterschaften in der Disziplin Demokratie und Wirtschaft und ziehen die Wochen ins Land: Ende Dezember haben die Chinesen von uns zu lernen. dass sie gefälligst mehr demokratische Umstände machen sollen, 14 Tage später wir von ihnen, dass diese Umstände für rein gar nichts taugen.
26. Januar - 12. Februar, Demokratie für Ägypten
Von der Revolution lernen
Wenn in fernen Ländern Menschen gegen ihre Herrschaft aufstehen, ist die Presse herausgefordert. Sie hat ihre Leser immerzu mit Einschätzungen und Kommentaren über Marokko, Algerien, Tunesien und Ägypten versorgt. Und jetzt schmeißen die Leute Zustände über den Haufen, die von deutschen Journalisten als nordafrikanische Normalität und typisch Dritte Welt abgehakt waren. Was auf den Straßen von Tunis und Kairo geschieht, lässt sich nicht damit vereinbaren, was bislang über die arabischen Völker in der Zeitung zu lesen stand. Also sind Journalisten ein paar Wochen lang damit beschäftigt, selbstkritisch ihre Sicht der Dinge zu korrigieren. Sie haben nie und nimmer mit diesem Verlauf der Ereignisse gerechnet und erklären ihren Lesern nun, warum man sie so hat überraschen können.
1. Das Volk hat seine Lethargie überwunden.
Alle haben geklagt, keiner hat etwas getan
(SZ, 12.2.11), etwa so sprach man bisher vom politischen Bewusstsein der Nordafrikaner. Das war meist der Auftakt dazu, einen Vergleich anzustellen und zu fragen, warum die Menschen dort so anders sind als die Bürger der europäischen Länder, die sich bekanntlich nie und nimmer einem Diktator fügen würden. Die Bürger des bevölkerungsreichsten arabischen Landes gelten als lethargisch, wenn es um Widerstand geht.
(SZ, Avenarius, 27.1.) Doch jetzt halten sich die Araber nicht mehr an ihre Volksnatur: Was wir in Tunis und Kairo sehen, das ist die früher für anhaltende politische Trägheit ... bekannte arabische Bürgergesellschaft
. (17.1., Avenarius)
Der selbstsichere demokratische Rassismus der Presse unterstellt den Nordafrikanern ein eigentliches Streben nach dem Menschheitsanliegen Demokratie und bescheinigt ihnen, darin träge und lethargisch zu sein. Als ob das bisher deren Sorge gewesen – und als ob Demokratie, wie sie hier gilt, jetzt deren Ziel wäre. Dafür – für ihr Streben nach unserer Demokratie – bezeugen die Presseleute den Arabern dann allen Respekt: Tatsächlich, diese Menschen, die doch ganz gut zu den Diktatoren gepasst haben, denen sie gehorchten, zeigen ganz unvorhersehbare Eigenschaften: Sie sind reifer für die Demokratie
, als wir dachten. Eine Nation entdeckt sich selbst, hat ihre Angst, ihre Apathie, ihre Vorurteile überwunden.
(SZ, 27.1.)
Die Fachleute von FAZ und SZ begrüßen die „arabische Revolution“, ohne sich weiter mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu befassen, gegen die die Menschen dort anrennen. Sie loben begeistert das Streben nach Demokratie, um sich sogleich zu dessen Gutachtern aufzuschwingen. Die Aufständischen, die gerade ihre Folgsamkeit kündigen, werden von europäischen Demokraten umarmt und daraufhin überprüft, ob sie unsere Demokratie auch richtig praktizieren.
Zwischen Pöbel und Traum
Vorsicht mit allzu großzügig verteilten Pluspunkten! Einen Tag lang steht auf der Kippe, ob die Revolution nicht doch in eine ganz falsche Richtung läuft:
„Jetzt, nach dem Verfall von Recht und Ordnung, prägt der Mob das Bild von Ägypten. Die Ärmsten der Armen kommen aus den Elendsvierteln. Sie stehlen, was sie jahrelang in den Glitzerschaufenstern nur sehen konnten, sich nie hätten leisten können. Sie zerschlagen die 5000 Jahre alten Statuen im Ägyptischen Museum. Sie schießen. Aus der Facebook-Revolte droht der Raubzug der Barfüßigen zu werden, der Pöbel raubt Hotels, Supermärkte und Wohnungen aus.“ (SZ, 31.1., Avenarius)
Deutsche Journalisten mögen Revolutionen, aber nur, wenn sie das Eigentum respektieren und auch sonst nichts durcheinander bringen. Mit stehlendem Pöbel und randalierenden Barfüßigen ist keine Demokratie zu machen. Die bilden den Mob, der die Befreiung vom Diktator für eine Verbesserung seiner materiellen Lage missbrauchen will. So etwas muss der demokratische Umsturz unterdrücken. Nach einem Tag ist dieser Spuk vorbei und wirft auch keinen bleibenden Schatten auf die Revolution von Kairo. Die Presse entscheidet sich, die schlechten Subjekte dem abgehalfterten Mubarak anzulasten: Er hat Verbrecher aus den Gefängnissen entlassen, um die Gemeinde vom Tahrir-Platz zu diskreditieren.
Schon bald gibt es wieder positive Bilder: Die erzählen von Anstand und Rechtsgefühl der Demonstranten, die ganz ohne Polizei für Ordnung auf dem Tahrir-Platz sorgen, Hotels und Supermärkte vor Plünderung schützen, und die Würde einer demokratischen Erweckungsbewegung an den Tag legen: Forderungen beschränken die Aufständischen vernünftig auf den Rücktritt des Diktators. Und das kommt den Berichterstattern so authentisch vor, dass dieser Aufruhr einen Platz ganz vorne in ihrem Revolutions-Ranking belegt.
„Die ägyptische Revolution hat Heimwerker-Charakter...Glamour hat sie nicht. Gegen die glanzvollen Beispiele der Regimewechsel in Osteuropa sehen die nahöstlichen Aufstände ärmlich aus... Die Rosenrevolution in Georgien 2003, die orangefarbene Revolution in der Ukraine 2004 folgten regelrechten Drehbüchern für den perfekten Umsturz, einem branding, zum Teil finanziert durch Gelder aus Amerika, klug geleitet durch spin-doctors, die Faxmaschinen brachten, T-Shirts drucken ließen und revolutionären Nachwuchs trainierten. Washington wollte Moskaus postsowjetische Verbündete in Kiew und Tiflis entsorgen – durch telegene happenings. Wandel war sexy. Die ägyptische Revolution hat bis heute nicht mal einen Namen.“ (SZ, 2.2.)
Dieser Journalist hat keine Scheu, sein umfassendes Faktenwissen über Revolutionen auszuplaudern: Ihm war immer klar, dass der ukrainische Umsturz in den USA erfunden und vor Ort mit CIA und Konrad-Adenauer-Stiftung durchgeführt wurde. Damals hätte er nie öffentlich in Zweifel gezogen, dass das ukrainische Volk höchstselbst den Diktator vom Sockel gestoßen hat; aber das ist ja lange her. Der Aufstand von Kairo ist kein derartiges „Fake“: Da besteht ein Volk ohne Sex-Appeal und Faxmaschinen wahrhaft die Prüfung und qualifiziert sich für die Demokratie: So echt, wie das Schauspiel vom Tahrir-Platz ist dem Journalisten schon lange keine Revolution mehr vorgekommen.
„Manche sprechen bereits von der freien Republik Tahrir...vielleicht ist das einfach das echte Ägypten. Die offene Sprache, die Plakate, die Wandzeitungen. Alles ohne Zensur. Die Zeltstadt, die Musik, das Getanze. Die Armen und die Reichen, die vorübergehend klassenlose Gesellschaft... Es gibt etwas für alle. Dieser Aufstand begann wie ein Film, eher zufällig. Er schweißt Menschen zusammen, die vorher nichts miteinander gemein hatten“. (SZ, Avenarius, 12.2.)
Herr Avenarius weiß, dass diese Leute nicht nur „vorher nichts miteinander gemein hatten“, sondern auch nachher nichts gemein haben: Die klassenlose Gesellschaft der Armen und Reichen existiert nur „vorübergehend“ auf dem Tahrir-Platz, sie ist ein Irrtum und Selbstbetrug der engagierten Arbeitslosen und Kleinunternehmer, der etablierten Akademiker und perspektivlosen Studenten, der Hausfrauen und Müllarbeiter – aber eben ein lobenswerter, volks-bildender Selbstbetrug. Dem Berichterstatter wird ganz warm ums Herz, wo Menschen, die keine gemeinsamen, sondern sogar gegensätzliche Interessen haben, sich entschließen, diese Interessen zurückzustellen und sich zum Volk zusammenzuschließen. Mitten in ihrer Revolution beweisen sie dem deutschen Beobachter, dass sie nichts Revolutionäres wollen, sondern nur einen anderen Regierungschef. Dieser Reife kann er seine Anerkennung nicht versagen. Das Volk hat sich große Verdienste erworben, mutige und sehr freiheitsliebende Menschen wollen ihr Opfer honoriert sehen. Sie haben einen neuen Staat verdient.
(SZ, 11.2., Kornelius)
Generös! Die Ägypter haben die demokratische Führerscheinprüfung bestanden: Ein Journalist aus München spricht ihnen zu, worauf Umstürzler, wenn sie Recht kriegen, ein Recht haben: einen (neuen) Staat.
Wo bleibt der neue Führer?
Dem Geschenk des neuen Staates müssen sich die Leute vom Tahrir-Platz allerdings auch würdig erweisen; und da versagen sie an der wichtigsten Stelle:
„Das Problem ist, dass sich die Regimegegner nur darin einig sind: Mubarak muss weg. Aber sie haben keine Vorstellung, wer und was danach kommen könnte...Seit Beginn des Aufstandes fehlt der Opposition eine Führungsfigur, ein Gesicht, eine Stimme. Eine Person, die die Massen führt.“ (Avenarius, SZ, 5.2., Planspiele für das Vakuum)
Das geht natürlich nicht, dass Volksmassen der Regierung den Gehorsam kündigen und noch gar nicht wissen, wem sie statt ihrer hinterherlaufen wollen. Denn die Kür neuer Führer ist doch der Sinn von Revolutionen, oder? Einem demokratischen Aufstand jedenfalls fehlt das Entscheidende, solange er von unten kommt. Ein Führer muss auftreten, der die Massen dafür gewinnt, sich führen zu lassen. Oder umgekehrt: Untertanen, die ihren Chefs nicht mehr folgen wollen, haben gleich neue mitzubringen, denen sie lieber gehorchen. Alles andere ist Chaos und Anarchie; Demokratie ist, wenn sich das Volk als Basis und Manövriermasse einer Führung betätigt.
Wo ein neuer Führer fehlt, schlägt die Stunde der Verführer:
„Und niemand weiß, wie groß der Einfluss der islamistischen Muslimbrüder ist... Denen misstrauen das Regime und die internationale Staatengemeinschaft. Doch die Brüder legen sich nicht fest... Die Fundamentalisten haben in den vergangenen Tagen mehr erreicht, als sie sich je erträumen konnten während der Jahrzehnte der Unterdrückung, Haft und Folter... Doch ihre eigenen politischen Ziele geben die Islamisten nicht preis.“ (SZ, 5.2., Avenarius)
Ein schöner Verdacht ist fast so gut wie ein Beweis: Man weiß nicht, wie groß der Einfluss der islamischen Partei ist, deren Bereitschaft zum Führen so gar nicht recht ist: Also muss er gefährlich groß sein. Man bescheinigt den Moslembrüdern ihre Unauffälligkeit auf dem Tahrir-Platz; sie versuchen nicht, die Bewegung anzuführen, fügen sich ein und schwingen keine islamistischen Tiraden. Auch das lässt sich so auslegen, dass es gar nicht für sie spricht: Durch ihre Zurückhaltung verheimlichen sie ihre üblen Ziele, die „wir“ natürlich kennen, und täuschen die demokratischen Demonstranten. Dass sie keinen Stoff für die Hetze gegen sie liefern, ist vorerst ihre größte Gemeinheit; die zweitgrößte, dass sie aus „Unterdrückung, Haft und Folter“ nun politisches Kapital schlagen können.
2. Was man über Diktatoren wissen sollte
In den Tagen der Revolution erteilen Journalisten ihrer Leserschaft wichtige Lehren: Nie mehr dürfen wir auf Diktatoren hereinfallen! Obwohl es ja vieles gibt, was Ben Ali und Mubarak wirklich gut gemacht haben: Positiv ist, dass Mubarak Ägypten einen jahrzehntelangen Frieden in einer unfriedlichen Region garantiert hat.
(SZ, 12.2.)
Dafür, dass die Zunft – bei aller routinemäßigen Kritik an Demokratiedefiziten in Tunesien und Ägypten – jahrelang den Regierungen in Berlin und Paris gefolgt ist, hatte sie gute Gründe: Mubarak sorgte für Stabilität im Nahen Osten und akzeptierte alle Kriege und Massaker Israels als Beiträge zum schwierigen „Friedensprozess“. Er leistete, was wir von „good government“ so erwarten. Was aber hat der Diktator dann falsch gemacht?
„Im Geiste Offizier auf Lebenszeit, reagierte Mubarak auch ohne Uniform autoritär, mit Hilfe von Ausnahmezustand, Anti-Terrorgesetz und unverkennbar manipulierten Wahlen.“ (SZ, 12.2., Avenarius.)
Richtig, der beruflich verbildete Militär hat die schöne Stabilität sehr ruppig gegen Widerstand im eigenen Land durchgesetzt, unliebsame Parteien unterdrückt, Gegner ins Gefängnis geworfen und gefoltert. Damit konnten europäische Demokraten in Regierungsämtern und Redaktion leben; man wusste ja, wofür die nicht salonfähigen Methoden gut waren. Heute wissen wir, sie waren nicht gut genug: Er sollte Stabilität garantieren und hat stattdessen mit seinem autoritären Gehabe den Aufstand provoziert!
„Mubarak hat mit seinem Starrsinn die Saat für Gewalt ausgebracht, vielleicht sogar für einen Bürgerkrieg.“ (SZ, 11.2., Kornelius)
Wenn befreundete Diktatoren sich nicht mehr halten können, verlieren demokratische Journalisten jedes Verständnis für deren blutige Herrschaftsmethoden. Wenn deren Regimes zusammenbrechen, sehen sie plötzlich ganz deutlich, dass auch vorher schon alles Blendwerk und Friedhofsruhe statt Stabilität gewesen ist.
„Wie ein orientalischer Gottkönig war Mubarak allgegenwärtig... Ein Heer von Polizisten, Ziviloffizieren und Spitzeln kontrollierte sein Volk, mindestens 1,4 Millionen Mann stark sollen die Sicherheitskräfte sein, die die knapp 80 Millionen Ägypter überwachen.“ (SZ, 12.2.)
So viele Spitzel hätte er doch gar nicht gebraucht! Da wird das demokratische Gebot der Verhältnismäßigkeit der Mittel eindeutig verletzt: So viel Gewalt ist kontraproduktiv. Weil Mubaraks Unterdrückung versagt, wird ihr Übermaß als Ursache des Aufstands entdeckt. Hätte der alte Komisskopf doch Maß gehalten! Aber das ist eben das Problem mit alternden Diktatoren: Sie überschätzen sich.
Blind für die Realität klebte er weiter an der Macht.
(11.2., Kornelius) Realisten müssen Diktatoren schon sein. Wenn sie an Realitätsverlust leiden, gehören sie wirklich weg: Mit Mubarak (ist) kein Staat mehr zu machen. Der Mann ist unhaltbar.
(ebd.) Das hatte der SZ-Mann schon an Ben Ali bemerkt: Die bizarre Analyse zeigt das zentrale Charakteristikum: Die Herrscher der Region halten sich für unangreifbar durch ihr Volk. Der Sturz des Tunesiers ist daher ein Meilenstein... Er zeigt, dass der Volkszorn selbst die Betonregime ins Wanken bringen kann ... ein Mann musste das Weite suchen, dessen Zugriff auf die Macht als garantiert galt..
(SZ, 17.1.)
Vom Volke lernen, heißt Recht behalten: Was wir selber bis vor kurzem für unmöglich gehalten haben, dass das „lethargische“ arabische Volk seine Herrscher verjagen könnte, haben auch die Diktatoren geglaubt. Das ist ihnen nun zum Verhängnis geworden. Hätten sie vorher auf das gehört, was wir jetzt wissen, wäre das nicht passiert – so die „bizarre Analyse“ aus München.
3. Die unverzeihlichen Fehler des Westens
Journalisten üben harsche Kritik an den Regierungen von USA und EU, die so lange zu den Diktatoren gehalten haben.
„Amerika hat Abschied genommen von Mubarak...Abschied nehmen muss die Regierung Obama aber auch von der Vorstellung, dass sich Stabilität und Einfluss über Potentaten kaufen und auf Dauer halten lassen. Die Vorstellung, mit 1,5 Mrd. $ im Jahr und politischen Streicheleinheiten Einfluss zu gewinnen, ist gescheitert...am Ende ist der Volkswille stärker, kein Ventil hält dem Druck im Kessel stand... Keine noch so nachvollziehbare Interessenpolitik kann funktionieren, wenn sie die archaischen Kräfte eines unterdrückten Volkes missachtet.“ (SZ, 31.1., Kornelius)
Schlecht ist es also nicht, von außen ein Land samt Insassen auf eine dem Westen genehme Stabilität zu verpflichten und dafür Einfluss auf die lokalen Machthaber zu nehmen, sondern zu glauben, dass dergleichen funktioniert. Nach mehr als 30 Jahren Scheinerfolg erweist sich die Politik der Westmächte als folgenschwerer Irrtum! Weder an ihren „nachvollziehbaren Interessen“ ist etwas verwerflich noch an dem Motiv, Stabilität mit Zahlungen an Diktatoren zu erkaufen. Die Demokratien haben in bester Absicht gehandelt, sie müssen nichts zurücknehmen – außer dem Glauben, das Volk ließe sich in alle Ewigkeit unterdrücken.
„Der Aufstand in Ägypten richtet sich nicht gegen den Einfluss ausländischer Mächte. Die spielen nur eine Nebenrolle. Die Menschen in Kairo haben den Herrscher im Visier. Die Patronatsnationen des Mubarak-Systems aber sind verhaftet mit dem alten System und zahlen nun einen Preis, selbst wenn die USA Mubarak im Stillen in den vergangenen Monaten gedrängt haben, das System zu öffnen und Freiheiten zu gewähren.“
Das ist tröstlich: Der Aufstand richtet sich eigentlich gar nicht gegen den Westen und seinen imperialistischen Einfluss. Was den Patronen zum Verhängnis wird und was sie nie mehr tun dürfen, ist, sich an Subjekte zu heften, die den Volkszorn auf sich ziehen. So kommt man ins Visier von Demonstranten, die dem Westen gar nicht böse sind. Hätte man früher schon und nicht nur im Stillen, sondern offen von Ben Ali und Mubarak verlangt, was die Demonstranten jetzt fordern, wäre der Stabilität ein besserer Dienst erwiesen worden. Doch leider, die Westmächte waren in ihrem Handeln nicht mehr frei, sie haben sich vom Bündnis mit den Diktatoren fesseln lassen:
„Die USA konnten Mubarak nicht zu Reformen bewegen, aber sie konnten ihn auch nicht vom Geldtropf abhängen....Der faustische Pakt funktionierte, die tiefe Furcht vor Fundamentalisten und Nationalisten erzeugte eine Abhängigkeit, die den Potentaten am Ende sogar stärkte. Mubarak nutzte die Zuwendungen, um sein Regime zu festigen und den Sicherheitsapparat zu bezahlen. Was einer islamistischen Gefahr vorbeugen sollte, half auch bei der Unterdrückung der Modernisierer und Demokraten.“
Die ungeschickte Weltmacht wird zum Opfer ihrer eigenen Marionette: Da haben die USA Mubarak mit Geld und Waffen versorgt, damit er den politischen Islam nieder macht. Und was macht dieser Diktator? Er unterdrückt damit nicht nur die Feinde des Westens, sondern auch noch seine eigenen. Der Westen hätte erkennen müssen, dass er die Fäden gar nicht in der Hand hält, dass er instrumentalisiert wird, anstatt zu instrumentalisieren. Aber der Teufelspakt hat ihn eben blind gemacht.
„Am Ende machte die Furcht vor den Muslimbrüdern Mubaraks Helfer im Ausland blind für die Gefahren, die von dem Regime ausgingen. Nun besteht die Gefahr, dass Anarchie und Fanatismus unkontrolliert eskalieren, dass diese gewaltige Nation implodiert.“ (s.o.) „Die westliche Politik wurde von dieser Revolution blank erwischt. Sie war, man muss es so sagen, nicht vorbereitet. Genauso wenig waren es die Fachleute in den Medien...Wie klug wäre es gewesen, hätte man das Land zu einer Öffnung und Liberalisierung bewegen können, ohne die stabilisierende Funktion aufs Spiel zu setzen...“ (SZ, Kornelius, 4.2.)
Was uns klugen Fachleuten dummerweise nicht rechtzeitig eingefallen ist, genau das soll jetzt der Aufstand der Ägypter erledigen: Das Land von Mubarak befreien, ohne aufs Spiel zu setzen, wofür der Mann gestanden hat – viel Ordnung und noch mehr Stabilität.
4. Was sich niemals ändert: Unsere Interessen
Da können die Demonstranten die herrschenden Verhältnisse in Nordafrika und Nahost noch so sehr zum Zittern bringen, die Sicherheit der Journalisten, dass die Region auch morgen noch in unseren Diensten stehen muss, können sie nicht erschüttern.
„Versinkt der demokratische Aufbruch in einem gewalttätigen Chaos, dann ist das Risiko groß, dass der EU die südliche Nachbarschaft politisch und mit unkalkulierbaren Folgen für die Sicherheit und die Wirtschaft im Mittelmeerraum weg bricht.“ Zu warnen ist „vor einer zunehmenden Macht islamistischer und fundamentalistischer Kräfte, die an einem Ausgleich mit Europa oder mit Israel nicht oder nur gering interessiert sind... Die Versorgung des alten Kontinents mit Öl und Gas oder auch die Pläne für große Solarstromanlagen hängen von Nordafrika ab. Ohne Kooperation der gesamten Region wird Europa kaum des Zustroms von Wirtschaftsflüchtlingen aus Afrika Herr werden können. Und ohne ein Ägypten, das fest zu dem Friedensvertrag mit Israel steht, geriete die europäische Nahostpolitik aus den Fugen... Deshalb ist es wichtig, wer die neuen Leute in Tunis und Kairo sind ... und wie man sie übers Mittelmeer hinweg an Europa binden kann.“ (SZ, 4.2., Winter, Angst vor der Kettenreaktion)
Für dieselben Interessen, für deren Sicherung wir gestern die Diktatoren brauchten, hat jetzt die demokratische Revolution geradezustehen. Kaum ist die alte Art der Bindung geplatzt, muss das ägyptische Volk sich schon wieder binden. Aber was heißt schon das Volk? Auf die „neuen Leute in Tunis und Kairo“ kommt es an; an die neuen Machthaber muss man sich halten, mit ihnen ins Geschäft kommen und sie auf unsere Interessen verpflichten – das mit dem Volk regeln die dann schon. Anderswo herrscht die edle Demokratie eben nur, wenn die Interessen der großen Demokratien bedient werden.
5. Freie Wahlen, aber richtig!
Am Selbstlauf der „Revolution“ in Nordafrika hat die Presse gelernt, dass keinem Volk die Demokratie verweigert werden darf. Also führt an Wahlen in Ägypten und Tunesien kein Weg vorbei. Was aber, wenn man vorher nicht weiß, ob sie die richtigen „neuen Leute“ an die Macht bringen? Die Ungewissheit stellt die Zunft vor eine demokratische Gewissensfrage: Darf man, wenn Wahlen daneben gehen, die Goldene Regel der Demokratie aussetzen, dass das Verfahren das Ergebnis legitimiert? Ex-Präsident George Bush hatte damit ja kein Problem, als die Hamas in Gaza die Mehrheit der Stimmen gewann: „Die Anerkennung des Verfahrens verpflichtet mich keineswegs zur Anerkennung des Ergebnisses.“ Ein schönes Dilemma: Einerseits legitimiert das Verfahren jeden Machthaber, wenn er denn gewählt ist, andrerseits legitimiert nur das demokratisch genehme Resultat das Verfahren.
Herr Chimelli meint, dass demokratische Prinzipienfestigkeit in dieser Sache nicht länger zu vermeiden ist:
„Wer Demokratie predigt, muss sich mit den Verhältnissen arrangieren, die aus freien Wahlen hervorgehen... Der Westen würde sich noch unglaubhafter machen, wollte er an anderer Stelle weiterhin zwei Ziele verfolgen, die sich gegenseitig ausschließen: Demokratie und gefügige Regime.“ (SZ, 12.2.)
Andere halten im Interesse der Demokratie dagegen:
„Das allerorten bejubelte ‚Fest der Freiheit‘ darf nicht in einem anderen, möglicherweise noch schlimmeren autoritären Regime enden. Radikale Kräfte, die sich einen solchen Ausgang wünschen, gibt es am Nil genug.“ (FAZ, 7.2., Kohler)
So absolut ist das Dilemma aber auch wieder nicht, und der Westen ist ja nicht zum passiven Abwarten und Zusehen verdammt. Wenn korrekte Wahlen stattgefunden haben, müssen die Ergebnisse nolens volens akzeptiert werden; vorher aber lässt sich manches befördern und behindern: Man kann die Ägypter jetzt nicht von einem Tag auf den anderen irgendwelche Leute wählen lassen. Wahlen wollen vorbereitet sein, dem Volkswillen müssen Kanäle gegraben werden, aus denen er nicht auslaufen kann.
„In einem Land wie Ägypten, das noch nie demokratische Verhältnisse erlebte, reicht es nicht, Wahlen abzuhalten, damit alles gut wird. Die politische Willensbildung muss organisiert und kanalisiert werden.“ (ebd.)
Und dafür weiß man schon die Adresse, an die man sich halten kann, und die man in ihrem schwierigen Auftrag, das Volk in freie Wahlen zu führen, unterstützen muss:
„Dem Militär ist an Ordnung und Stabilität gelegen. Es will den Übergang ohne Demonstrationen, ohne Streiks.“ Es organisiert einen „wie auch immer lange befristeten Übergang, in dem die Verfassung geändert und die Parteienlandschaft konsolidiert wird. Vielleicht kann das ägyptische Volk am Ende dieser Phase einen Präsidenten wählen... Ein Zeitgewinn könnte sich durchaus als Vorteil erweisen. Der geordnete Übergang braucht Zeit.“ (SZ, 11.2., Kornelius)
Nur keine Ungeduld! Man kann es mit der Freiheit auch übertreiben. Vorerst garantiert uns die Militärherrschaft für Demokratie.