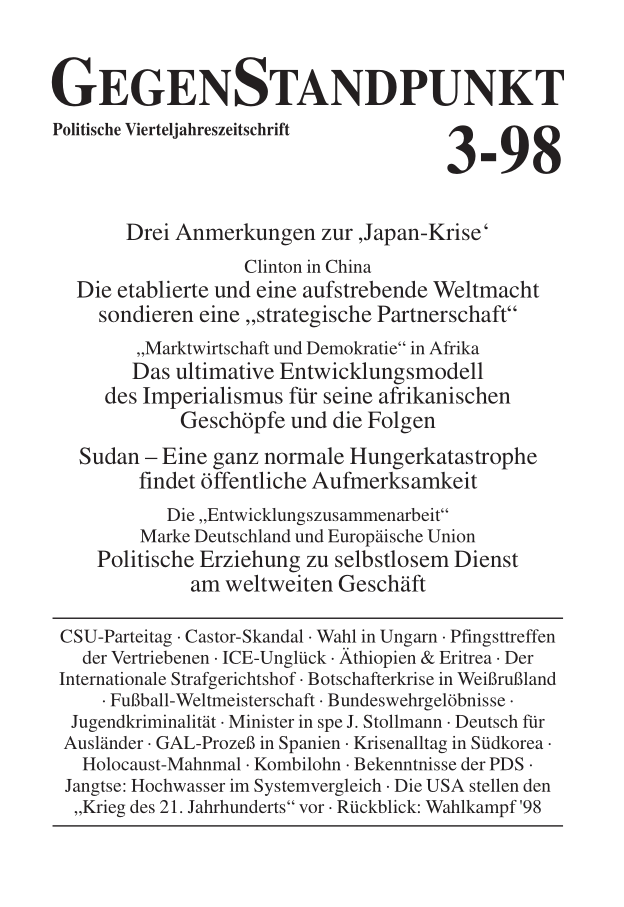Clinton in China
Die etablierte und eine aufstrebende Weltmacht sondieren eine „strategische Partnerschaft“
China hat es geschafft, mit seiner „Öffnung“ gegenüber dem siegreichen Kapitalismus nicht zum gigantischsten „emerging market“ aller Zeiten, sondern selber zu einer veritablen kapitalistischen Wirtschaftsmacht zu werden. Mit den „guten Beziehungen“, die Clinton mit seinem Besuch im Reich der Mitte pflegen will, will die USA auf dem Weg weiter kommen, amerikanisches Kapital an Chinas Nationalökonomie mit verdienen zu lassen, und damit auf die mittlerweile auch ernst zu nehmende weltpolitische Betätigung der Großmacht China auf dem asiatischen Kontinent immer mehr Einfluss zu gewinnen. Die „guten Beziehungen“ hängen also davon ab, wie die Interessen der Weltmacht Nr. 1 in dieser neuen „strategischen Partnerschaft“ mit China vor zu kommen haben, und wie man das im Reich der Mitte aufnimmt: Atomwaffen, strategische Interessen, Taiwan, wirtschaftliche Beziehungen, Finanzkrise in Asien und Menschenrechte.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Clinton in China
Die etablierte und eine aufstrebende
Weltmacht sondieren eine „strategische
Partnerschaft“
Der amerikanische Präsident bricht zu einer neuntägigen
Reise nach China auf. Sein Besuch im Reich der Mitte gilt
als äußerst schwierig
, in seiner eigenen Nation
ist er gar umstritten
, hierzulande ist man sehr
gespannt darauf, wie er die heikle Frage der
Menschenrechte
anpacken wird. Am Ende der Reise
erfährt man, daß sie ein großer Erfolg für
Clinton
, aber auch ein Achtungserfolg
für
China war und zwischen beiden Seiten durchaus gute
Beziehungen
herrschen. Mag ja sein. Da man aber nicht
erfährt, worin der Sache nach der Erfolg eigentlich
besteht, dessen beide Seiten sich rühmen; da der
politische Stoff und Inhalt der Beziehungen gleichfalls
nicht vorkommt, wenn sie mit ihrem Güteprädikat versehen
werden; deswegen im Folgenden ein paar sachdienliche
Hinweise zur besseren Einordnung einer nicht ganz
unwichtigen Etappe imperialistischer Weltpolitik.
Grund und Zweck der Reise
China ist groß: ein beträchtlicher Fleck auf der
Weltkarte, mit viermal mehr Einwohnern als die Weltmacht
Nr. 1. Und China ist eine Macht, die – anders
als die Staaten des sowjetischen Blocks – den
Zusammenbruch des kommunistischen Systems nicht nur
politisch unbeschädigt überlebt hat. Sie hat es bislang
geschafft, ihre Öffnung
gegenüber dem siegreichen
Kapitalismus nicht zu einem Ruin ihrer materiellen
Grundlagen geraten zu lassen, den neu definierten
nationalen Reichtum vielmehr sogar zu mehren. Aus der
ehemaligen geschlossenen Kommandowirtschaft
ist
eine kapitalistische Wirtschaftsmacht geworden, die an
Waren viel im- und noch mehr exportiert, die für das nach
profitabler Anlage suchende Kapital der Welt offensteht,
und die – anders als die sogenannten „Transformations-“
und „Entwicklungsländer“ sonst – bislang einigermaßen
erfolgreich dafür Sorge trägt, daß die „Integration in
den Weltmarkt“ nicht zur bedingungslosen Auslieferung an
die Interessen derer ausartet, die den Weltmarkt als ihr
Betätigungsfeld geschaffen haben. China hat nämlich nicht
bloß „Ressourcen“ zu bieten, sondern auch eigene
Interessen, die sich auch gar nicht auf das eigene
Land und dessen zahllose Insassen beschränken. Und es
besitzt weitreichende Mittel: Mit seinen
Atomwaffen verfügt es über eine strategische, mit seinem
Vetorecht im UNO-Sicherheitsrat über eine diplomatische
Bedeutung, an der keine Macht vorbeikommt – schon gar
nicht die USA, die auf der ganzen Welt soviel zu bewegen
und unter Kontrolle zu halten haben. China ist, mit einem
Wort, eine Großmacht.
Und außerdem ist es eine Volksrepublik
; mit einer
Staatspartei, die sich – aus Gründen, die jedenfalls mehr
mit Traditionspflege und Ahnenkult als mit Marx und der
revolutionären Arbeiterbewegung zu tun haben –
kommunistisch
nennt. Mit dieser irreführenden
Selbstbezichtigung bietet die herrschende Partei einen
ideologischen Titel, unter dem Macher und Parteigänger
westlich-demokratischer Weltpolitik sich und der Welt
ihre Unzufriedenheit mit der chinesischen Großmacht
erklären können. Unzufrieden sind sie nämlich, bei aller
„Öffnung“ und „Transformation“, mit dem bisherigen
Zwischenergebnis, daß da ein Land, das eigentlich das
Zeug zum gigantischsten „emerging market“ der neueren
Weltmarktgeschichte hätte, so stur und sogar relativ
erfolgreich seine eigene kapitalistische
Akkumulation betreibt und auch keinerlei Anstalten macht,
seine politische Macht in Kleinteile von handlicher Größe
zu zerlegen. Marktwirtschaftlich und demokratisch ist das
tatsächlich nicht, weil im Programm der maßgeblichen
marktwirtschaftlichen Demokratien so überhaupt nicht
vorgesehen – und wenn sie es schon selber sagen, dann
wird bei den Chinesen wohl einer der letzten Fälle von
kommunistischer Diktatur vorliegen.
Eine wichtige Fraktion US-amerikanischer Weltpolitiker
zieht aus diesem Ärgernis den keineswegs bloß
ideologischen Schluß, mit China habe sich eine neue
Feindmacht an die Stelle der untergegangenen Sowjetunion
gesetzt; diese sei daher mit denselben politischen
Mitteln zu bekämpfen, die sich nach ihrer Auffassung beim
Sieg über das sowjetische „Reich des Bösen“ so gut
bewährt hätten: weltpolitische Isolierung sowie
militärische, wirtschaftliche und ideologische
Kriegführung. Demgegenüber besteht die offizielle Politik
der USA mit China darauf, sich nicht von einer
nostalgischen Idee
wie der eines bedingungslosen
Antikommunismus leiten zu lassen. Es gelte vielmehr, ganz
den Geboten zu folgen, die von einer realistischen Sicht
Chinas diktiert werden. Einer, der sich diesbezüglich
auskennt:
„Die Vereinigten Staaten und China sind zwei Großmächte, die danach streben, potentielle Differenzen auszuräumen und den Bereich der gemeinsamen Absichten zu stärken. Der Prüfstein für den Besuch ist die Fähigkeit, die Interessen beider Mächte zu harmonisieren und den Meinungsverschiedenheiten ihren Stachel zu nehmen.“ (H. Kissinger, in WamS, 28.6.98).
Jenseits aller diplomatisch-ideologischen
Sprachregelungen – von wegen „potentielle
Differenzen“ und „Harmonie“ – ist das Programm doch klar:
Man will dieses Land nicht als Macht bekämpfen, weil man
in der Art und den Methoden seiner Selbstbehauptung und
Weiterentwicklung schon seit längerem genügend
Gelegenheiten und Handhaben entdeckt und genutzt hat, um
frühere „Differenzen“ zu überwinden; man setzt
darauf, auf diesem Weg weiterzukommen, also an Chinas
Nationalökonomie zu verdienen, genauer: Kapital aus den
Staaten am chinesischen Wachstum mitverdienen zu lassen,
und auf die Betätigung der politischen Macht immer mehr
Einfluß zu gewinnen. Das verlangen
jedenfalls,
immer noch lt. Kissinger, unsere nationalen
Interessen
: gute Beziehungen
zu diesem neu
verfaßten Mitglied des Weltmarkts und der Weltpolitik.
Deren Pflege ist der politische Zweck der weiten Reise, die Clinton unternimmt. Es geht darum zu demonstrieren, also vor allem gegenüber China, aber auch fürs eigene Land klarzustellen, wie sehr die US-Regierung hinter den angesponnenen Beziehungen steht – wobei natürlich auch eine Verdeutlichung mit abfällt, welche Beziehungen die Weltmacht wichtig findet, wie sehr und inwiefern. Natürlich zielt die Unternehmung auch auf ein chinesisches Echo, das die amerikanischen Anliegen bestätigt, so daß auch für die USA feststeht, wie kräftig die Führungsfiguren der „Volksrepublik“ an der Weiterentwicklung der von der Weltmacht gewünschten Beziehungen interessiert ist. Solche wechselseitigen Klarstellungen und Bestätigungen sind in der bizarren Welt der Diplomatie notwendig, weil sie all dem, was substanziell zwischen den beteiligten Nationen läuft und nicht läuft, in durchaus praktischer Absicht die explizite Willensbekundung von höchster Stelle hinzufügen, wie das alles gemeint ist und weitergehen soll.
Die politische Agenda
des Treffens umfaßt dementsprechend viel. Ganz oben steht
darauf der Stachel
selbst, der politische
Meinungsverschiedenheiten
zwischen Großmächten
heutzutage zu einer immer so prekären Angelegenheit
macht:
1. Die Atomwaffen
Von diesen Geräten besitzen bekanntlich beide Mächte
einige. Die Weltmacht USA sogar in einem Ausmaß, daß sie
nach dem Urteil aller Sachverständigen in militärischer
Hinsicht ihren exklusiven Status mit Sicherheit bis weit
ins nächste Jahrhundert hinein konservieren wird. Doch
ist China eben auch eine Atommacht und verfügt zwar nicht
im entferntesten über eine „glaubwürdige
Gegenabschreckung“ wie einst die Sowjetunion, die damit
den Amerikanern das unselige „atomare Patt“ sowie eine
Diplomatie der fortwährenden „Rüstungskontrolle“
aufnötigten; immerhin besitzt die Nation aber die
entscheidenden Mittel, um sich inmitten der mit
überlegener Waffengewalt abgesicherten amerikanisch
definierten Weltordnung eine gwisse Unangreifbarkeit zu
sichern. Der politische Kontrolle dieser Mittel gilt das
Bestreben der Weltmacht schon seit längerem: Sie sucht
eine Vergewisserung über die Bereitschaft der kleineren
Atommacht, ihr Arsenal nicht in einer Weise politisch,
geschweige denn militärisch zu gebrauchen, die in
Widerspruch stünde zu den amerikanischen Vorstellungen
über die angemessenen strategischen
Kräfteverhältnisse sowie über einen
verantwortlichen
Umgang mit diesem militärisch wie
weltpolitisch so brisanten Gerät. Mit Chinas Zustimmung
zum Atomwaffensperrvertrag ist da bereits ein Fortschritt
erzielt worden. Das Land hat sich damit nämlich in aller
Form auf das Interesse der Weltordnungsmacht
verpflichtet, militärische Gewalt in Form von
Nuklearwaffen – über die sie bedauerlicherweise nicht
mehr als Monopolist gebietet – einer generellen
Überwachung und weltweiten Kontrolle zu unterwerfen,
damit solche Vernichtungsmittel nicht in falsche
Hände geraten. Welche das sind, entscheidet die
Weltmacht selbst danach, wo eine Störung
amerikanischer Interessen droht. Diesem
imperialistischen Kontrollbedürfnis, verallgemeinert zu
einem supranationalen „Regime“, hat auch China seinen
Respekt nicht verweigert, und das ist für die Weltmacht
ein Erfolg, auf dem sich zum Zweck einer weiteren
politischen Zivilisierung
der Atommacht China
aufbauen läßt.
Umgekehrt versucht auch China schon seit längerem, die überlegene Abschreckungsdrohung, die von den Nuklearwaffen der Weltmacht ausgeht, für sich ein wenig berechenbar machen. Bislang erfolglos allerdings, so daß man den Besuch Clintons erneut als Gelegenheit wahrnimmt, in dieser Sache voranzukommen: Im erneuten Vorschlag eines beiderseitigen Verzichts auf die „Option“ eines atomaren Erstschlags trägt die chinesische Regierung vor, wie sie selbst sich einen „zivilisierten“ Umgang der Atommacht USA mit ihren strategischen Waffen oder jedenfalls einen ersten Schritt dahin vorstellt.
Die Weltmacht lehnt den Antrag auf freiwillige Selbstbeschneidung ihrer Handlungsfreiheit in Sachen atomarer Abschreckung selbstverständlich ab. Den Nutzen ihrer „Erstschlags-Option“ sieht sie zu Recht darin, daß nur so ihr abschreckendes Arsenal seine politische Wirkung zu entfalten vermag: Unberechenbarkeit ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit der in jeder Hinsicht totalen Drohung, auf die die USA ihr wirkliches Kontrollregime über die Kräfteverhältnisse auf der Welt gründen. Damit, daß China seinerseits dann selbstverständlich auch nicht auf die „Option“ des atomaren Erstschlags verzichtet, kann die Weltmacht leben: Anders als seinerzeit die sowjetische ist diese Gegendrohung einstweilen ziemlich fiktiv.
Ein Einvernehmen bezüglich des Gebrauchs der Waffen, die man hat, läßt sich zwischen beiden Seiten dann aber doch noch erzielen. Die Weltmacht weist das Ansinnen Chinas, die wechselseitige Bedrohung, die vom atomaren Potential beider Mächte ausgeht, gewissermaßen einzuklammern und so die absichtsgemäß höchst einseitige Abschreckungswirkung zu relativieren, nicht einfach so zurück. Sie macht vielmehr das interessante Angebot, ersatzweise auf einem anderen Gebiet beiderseitigen Verzicht zu üben: Man könne doch die Raketen, mit denen man sich unmittelbar bedroht, fortan auch woandershin fliegen lassen und eine entsprechende Umprogrammierung der Zielkoordinaten in die Wege leiten. Quasi als Kompensation für die Klarstellung, daß sie sich natürlich nie und nimmer mit China strategisch auf eine Stufe stellen, bieten die USA den Schein einer gewissen Gleichrangigkeit an – und China ist einverstanden. So schaffen es die zwei recht ungleichgewichtigen Atommächte, einander von gleich zu gleich und auch noch einvernehmlich zu begegnen: Sie kommen überein, sich wechselseitig nicht mehr als unmittelbare Bedrohung zu betrachten. Das sind und bleiben sie zwar, verfolgen auch nach wie vor ihre diesbezüglichen atomaren Strategien; aber sie entlasten ihre Beziehungen durch die wechselseitige Versicherung, daß kein akut feindlicher Wille dahintersteht: Streitfragen, die eine Erpressung mit den „letzten“ Waffen nötig machen könnten, sehen sie aktuell nicht. Das dokumentieren sie mit einem Symbol beiderseitigen Vertrauens: dem Entschluß zur Umprogrammierung ihrer Raketen.
2. Die strategischen Interessen
Zum Status einer Großmacht hat es die chinesische Nation
nicht zuletzt darüber gebracht, daß sie erfolgreich
Außenpolitik betrieben hat. Sie hat es mit dem Einsatz
ihrer Mittel verstanden, andere Staaten in ihrem Umkreis
politisch, militärisch und wirtschaftlich an sich zu
binden. Auch wenn sie nicht über soviele eigene
Partner
und befreundete Staaten
verfügt wie
ihr großer Konkurrent, so reicht ihr politischer Einfluß
im gesamten asiatischen Kontinent doch so weit, daß die
Selbstwahrnehmung Chinas als neue asiatische
Vormacht
(NZZ) keinesfalls bloße Angeberei ist.
Das ist der Weltmacht selbstverständlich nicht egal. Ihre
Kontroll- und Aufsichtsbefugnisse erstrecken sich
schließlich auch auf den asiatischen Kontinent. Also
verlangt sie von der Macht, die dabei ist, das dort
herrschende Kräfteverhältnis gründlich zu verschieben,
eine offizielle Festlegung, in welchem Sinne und wie weit
sie dabei gehen will, und hat ihrerseits in dieser
Hinsicht Forderungen anzumelden. Um Spannungen
zu
vermeiden, wie sie sich bei der Konkurrenz um
strategische Einflußzonen allemal ergeben, bestehen die
USA auf Respekt Chinas vor ihrer Richtlinienkompetenz und
den geltenden Richtlinien:
„Die Beziehungen zwischen Amerika und China sind nicht zuletzt deshalb besonderen Spannungen ausgesetzt, weil sich die derzeit einzige Supermacht einem Land gegenübersieht, das möglicherweise über das Potential verfügt, selbst eine Führungsrolle zu übernehmen. Diese drohende Umverteilung des internationalen … Kräfteverhältnisses bestimmt in hohem Masse die Handlungen der beteiligten Regierungen, die bestrebt sind, die zukünftigen Rahmenbedingungen zum eigenen Vorteil zu gestalten.“ (NZZ 23.7.98)
Auch wenn der Kommentator aus Zürich in der Stilisierung
der chinesischen Macht und dessen, was von dieser alles
auszugehen droht
, vorwiegend seine
parteilich-sorgenvolle Betrachtung des etablierten
Kräfteverhältnisses zum Ausdruck bringt – in der Sache
liegt er keineswegs daneben. Was die Chinesen mit ihrer
Macht demnächst anstellen wollen; in welchen Staaten sie
ihre Freunde, in welchen ihre Feinde sitzen sehen; was
sie im jeweiligen Fall zur Pflege der Beziehungen
praktisch in Erwägung ziehen oder schon vorhaben; wie sie
mit Nationen kalkulieren, mit denen die Vereinigten
Staaten freundschaftlichen Verkehr pflegen, wie mit
denen, die zu den ausgemachten Feinden der Weltmacht
gehören: Das alles ist der politische Stoff, um den sich
der Meinungsaustausch über die zukünftigen
Rahmenbedingungen
der Weltpolitik beider Seiten
dreht. So entdecken beide Mächte ihre potentiellen
Differenzen
, aber auch Absichten
, die sie
gemeinsam
haben; und vor allem hinsichtlich
letzterer kommt die Weltmacht ihrem Konkurrenten schon
wieder mit einem interessanten Angebot. Sie stellt
ihre Definition der Problemgebiete Asiens
(Clinton) vor, bringt also die Fälle zur Sprache, die
ihrem Weltordnungsinteresse zuwiderlaufen und
die sie daher für sich als sicherheitspolitische
Herausforderung
(Clinton) identifiziert hat.
Pakistan, das dank chinesischer Hilfe nunmehr
auch Atomwaffen besitzt, die Atommacht Indien,
der Iran als Vormacht in der Ölregion am Golf –
das sind die vom Präsidenten der Weltmacht genannten
Kandidaten, auf die sich Aufsicht und Kontrolle
vordringlich zu erstrecken haben. Und bei der praktischen
Wahrnehmung dieser Pflicht will Amerika keineswegs allein
bleiben. Im Gegenteil, China soll in diesen
Fällen Mitverantwortung tragen, also für die
sachgemäße Erledigung von Fragen der Weltaufsicht
mitzuständig sein. Und es gibt Erfolg zu
vermelden:
„Wir verfolgen jetzt eine gemeinsame Strategie, Indien und Pakistan von weiteren Tests abzuhalten und zu einem Dialog über die Beilegung ihrer Differenzen zu veranlassen.“ (Clinton)
Man macht also den Chinesen ihr eigenes strategisches
Interesse in Asien nicht streitig, sondern bindet es in
die eigene politische Strategie ein, lädt die Chinesen
dazu ein, bei der Definition ihrer Strategie an dem Maß
zu nehmen, was man selbst an strategischem Interesse
verfolgt. Atommächte und solche, die es werden wollen
oder könnten, begründen für Amerika generell Aufsichts-
und Ordnungsprobleme und stellen Anwendungsfälle des
Gebots der Non-Proliferation
dar; Mächte unterhalb
dieser Schwelle, die sich fragwürdiger Absichten schuldig
machen, werden mit Embargo-Maßnahmen auf den rechten Weg
gebracht resp. bestraft, bei denen das Prinzip des
dual-use
von Gütern wie Mikrochips, Düngemitteln,
Zentrifugen und Dollars zur Anwendung gebracht wird –
dabei muß China mitmachen, soll das
Kontrollregime flächendeckend wirksam werden. Es soll
sich also erstens der ordnungspolitischen Sicht
Washingtons anschließen, um dann zweitens als
strategischer Partner
der Weltmacht die nötige
politische Ordnung vollstrecken zu helfen. Die
Anerkennung, die Amerika der strategischen Rolle
Chinas zollt, fällt also mit deren Einordnung in
das weltumgreifende Aufsichtsregime zusammen, dessen
Subjekt die USA sind – und umgekehrt. Sofern sich also
die zum global partner
ernannte chinesische Macht
das Welt-Aufsichtsrecht zur eigenen Sache macht, das die
Supermacht auf der anderen Seite des Pazifik vertritt,
wird sie von der dazu ermächtigt, mit ihr gemeinsam
die gefährlichen Waffen der Welt zu kontrollieren
(Clinton).
Für China bedeutet diese Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten die offizielle Anerkennung als Großmacht, die über eigene weltpolitisch-strategische Ambitionen verfügt. Dafür nimmt man in Peking hin, daß – gegenwärtig wenigstens noch – an der amtierenden Weltmacht und ihrer Definition der weltpolitischen Verantwortlichkeit, welche aufstrebende Großmächte wahrzunehmen hätten, kein Weg vorbeiführt, will man sich nicht feindlich mit ihr anlegen. So findet man einen Konsens, den beide Seiten als Erfolg für sich verbuchen können.
Letzteres gelingt der Diplomatie manchmal auch dann, wenn ein Konsens über eine strittige Frage wegen allzu gegensätzlicher Interessenslagen ausbleiben muß:
3. Taiwan
Diese Insel wird von der VR China als abtrünnige Provinz
betrachtet, die sie sich wieder eingliedern will. Die
alten politischen Vertreter der Insel dagegen begreifen
sich selbst als Repräsentanten Chinas und möchten daher
das Festland an Taiwan angliedern; die neuere
Politikergeneration bemüht sich um die Anerkennung der
Insel als eigenes Staatswesen. Taiwan kann sich
hinsichtlich seiner Partnerschaft mit den USA einer weit
längeren Tradition rühmen als das postkommunistische
China; zu Zeiten, als es noch eine kommunistische Gefahr
einzudämmen galt, stellte sich die Weltmacht sogar hinter
die in Taiwan übliche Auslegung der
Ein-China-Politik
. Die von Peking vertretene
Lesart war dann freilich in der diplomatischen
Anerkennung der chinesischen Volksrepublik durch Amerika
– seinerzeit ein wichtiger weltpolitischer Schritt, der
einiges zur Zersetzung des einstigen „kommunistischen
Blocks“ beigetragen hat – mit eingeschlossen; jedenfalls
im Prinzip. Nicht eingeschlossen war die praktische
Konsequenz, daß die USA die letzte Inselbastion der
„Nationalchinesen“ den „Roten“ überlassen hätte. So
treiben die USA erstens seit geraumer Zeit mit einer
Insel, die sie als Staat nicht anerkennen, regen
Wirtschaftsverkehr und Waffenhandel, anerkennen zweitens
das Festland, mit dem sie dasselbe auch gerne treiben
wollen, als das einzige China weit und breit, und sorgen
drittens als militärische wie politische Schutzmacht
Taiwans dafür, daß die VR China sich nicht nimmt, worauf
sie ihr nationales Recht erstreckt – kaum drei Jahre ist
es her, daß die Weltmacht zum demonstrativen Schutz der
Insel vor der Bedrohung durch ein chinesisches Manöver
ihre Flugzeugträger in dieser Krisenregion
aufmarschieren ließ. Ein recht belangvoller Prüfstein
für den Besuch
liegt also da im Weg.
Doch wo ein politischer Wille zur Harmonisierung
von Interessengegensätzen vorhanden ist, da findet die
Diplomatie auch einen Weg. Zuallererst wirkt die
Weltmacht dem Verdacht entgegen, ihre ablehnende Haltung
gegenüber einer Veränderung der Lage an ihrer
strategischen Gegenküste wäre – wie früher –
chinafeindlich gemeint: Befriedigt darf der
chinesische Staatschef zur Kenntnis nehmen, daß er von
den USA als Repräsentant von ganz China anerkannt ist und
bleibt, Amerika keinesfalls Bestrebungen unterstützt, die
aus Taiwan einen eigenen Staat fabrizieren wollen. Im
Prinzip habe die Weltmacht auch nichts gegen eine
Wiedervereinigung Chinas mit Taiwan; nur müsse diese
schon friedlich
vonstatten gehen und vom Willen
beider Völker getragen
sein, unter einem
gemeinsamen Dach
zu leben. Diese kleine Prämisse hat
es freilich in sich. Sie bedeutet im Klartext, daß die
Weltmacht ihr Recht verletzt, daher auch für
sich einen eigenen Kriegsgrund vorliegen sieht,
wenn etwas geschieht, was sie unfriedlich
findet.
Ein vereinigtes Ganzchina kommt folglich nur zustande,
wenn die Weltmacht dies genehmigt: Sie behält
sich, und zwar auf Dauer, das Urteil
darüber vor, ob die VR China den nötigen Respekt vor dem
„Volk von Taiwan“ wahrt oder Sachen unternimmt, die als
Erpressung und Gewalt einzustufen sind. Völlig
ausgeschlossen ist damit, daß Taiwan je einer VR China
angegliedert werden könnte, deren
demokratisch-rechtsstaatlich-kapitalistisches Innenleben
nicht voll und ganz dem imperialistischen Standard
genügt, den Taiwan schon längst erfüllt – und keineswegs
eingeschlossen, daß eine lupenrein kapitalistische
Volksrepublik sich Taiwan greifen dürfte: Schließlich ist
China für den Geschmack des demokratischen Imperialismus
schon jetzt ein viel zu ausladendes „gemeinsames Dach“.
In diesem Sinne wacht die Weltmacht darüber, daß – bei
aller Anerkennung des Pekinger Standpunkts – dem
taiwanesischen Nationalismus nichts angetan wird.
Mit der Floskel von der friedlichen
Wiedervereinigung
drückt die amerikanische Diplomatie
somit höflich und auf Einvernehmen mit dem Partner
berechnet aus, daß sie die von diesem beabsichtigte
Ausdehnung und Aufwertung seiner strategischen Position
nicht zuläßt und es an der chinesischen Seite
liegt, das zu akzeptieren – von US-Seite aus bräuchte das
eindeutige Veto gegen Chinas Taiwan-Ambitionen keine
Feindseligkeit zu begründen. Genau so ist es beim
strategischen Partner
dann auch angekommen,
verstanden – und akzeptiert worden. Nun wissen beide, daß
ihre Interessen im Fall der Insel Taiwan miteinander
kollidieren, aber China sich – einstweilen – nichts
herausnimmt. Sie halten an ihrem Gegensatz fest, tragen
aber zu dessen Harmonisierung
bei, indem sie sich
auf eine Sprachregelung verständigen, in der der
Interessengegensatz enthalten – und der amerikanische
Vorbehalt als gültige Friedensbedingung anerkannt ist.
4. Die wirtschaftliche Beziehungen
sind dann gleich mehrfach zwischen den Partnern Thema,
obwohl
sie der hiesigen Berichterstattung zufolge
ursprünglich bei diesem rein politischen Besuch
gar nicht im Vordergrund
stehen sollten. Von wegen
obwohl
! Auch auf diesem Feld haben
strategische Partner viel zu bereden und
miteinander auszumachen, weil zwischen ihnen nämlich
erstens bereits ein reger wirtschaftlicher Verkehr
herrscht; weil sie zweitens – aus freilich
unterschiedlichen Interessen – noch sehr viel mehr von
diesem Verkehr und so auch voneinander wollen; und weil
drittens ihr ganzer wirtschaftlicher Verkehr ohnehin ein
einziges Politikum ist.
Jenseits der Frage, ob es den vielen Chinesen deswegen
besser geht: Die Volksrepublik China ist zweifellos eine
aufstrebende kapitalistische Wirtschaftsmacht. Sie hat
ihr menschliches und produktives Inventar den
Erfordernissen des kapitalistischen Systems unterstellt,
mit der Politik der zwei Systeme in einem Land
allerdings darauf geachtet, daß das Land mit seinen
Ressourcen nicht schlagartig der kapitalistischen
Produktionsweise ausgeliefert und darüber verheert wird.
Immer nur schrittweise sollte der Kapitalismus von für
ihn eigens reservierten Enklaven aus expandieren,
zweckmäßig und produktiv sollte er im gesamten restlichen
Reich allmählich durchsickern. Freilich erhält diese
politische Ökonomie einer kontrollierten kapitalistischen
Erschließung Chinas auch einige kapitalistische
Systemwidrigkeiten am Leben – im Vergleich zu den längst
fertigen großen kapitalistischen Wirtschaftsmächten, an
denen man in China ja Maß nimmt. Doch gerade mit und
wegen diesen hat es China zu seiner wirtschaftlichen
Potenz, zu seinem bemerkenswerten
Export von
Waren, zu reichlich Import von Kapital und dabei vor
allem mit der führenden Weltwirtschaftsmacht in beiden
Geschäftsabteilungen zu sehr vielen bilateralen
Transaktionen gebracht. Wenn Clinton seinem Gastgeber von
dem pulsierenden Wachstum
im riesigen Markt
China vorschwärmt, dann weiß er schon, daß da reichlich
Geschäftemacher aus seinem eigenen Land an den
erstaunlichen Wachstumsraten
teilhaben.
Beim erreichten Stand seines ökonomischen Erfolgsweges will China es nicht belassen. Es möchte vollständig in den Weltmarkt integriert sein. Schon länger will es als gleichrangiger Partner am Weltmarkt teilnehmen, den Zugang zu den internationalen Märkten als eigenes, international verbrieftes Recht und Verpflichtung seiner Handelspartner verankert haben. Es strebt daher die Aufnahme als vollwertiges Mitglied in der WTO an. Das maßgebliche Subjekt, an dem dieses Begehren schon seit längerem scheitert, ist die Macht, deren oberster Repräsentant gerade zugegen ist – also ist der die genau richtige Adresse für den Antrag, zur unbeschränkten Konkurrenz auf den Weltmärkten zugelassen zu werden.
Dieser Wunsch wird abschlägig beschieden. Bei allem
Respekt, den Chinas Wachstum verdient; bei allen
begrüßenswerten Öffnungsmaßnahmen
und
Liberalisierungsschritten
, die – vom Zollwesen
über den Schutz des geistigen Eigentums bis zur
Bekämpfung der Copyright-Piraterie – von China gefordert
wurden und inzwischen ernsthaft angegangen werden: Gegen
die Manier, in der in dieser Nation Kapitalismus gemacht
wird, sind nach der maßgeblichen Auffassung Amerikas nach
wie vor jede Menge Vorbehalte angebracht. Gemessen
nämlich an den Regeln, die die USA für das freie
Konkurrieren auf ihrem Weltmarkt erlassen haben, nimmt
sich eine kapitalistische Entwicklungsnation, die sich
nicht freiwillig zum bloßen Derivat auswärts
akkumulierten Reichtums erklärt und als eine einzige
Sonderzone für dessen lohnende Anlage anbietet, wie ein
einziger Fremdkörper und Regelverstoß aus. Chinas
unbeschränkter Zulassung zum Weltmarkt steht also seine
eigene innere Verfassung grundsätzlich im Wege, was man
dem Antragsteller gegenüber allerdings nicht so
grundsätzlich ausdrückt, wie man es meint. Man erläutert
ihm beispielsweise an den zum Himmel schreienden
Handelsdefiziten
, die die USA im Handel mit China
zu verzeichnen haben, en detail und konkret, daß China in
Sachen Öffnung
noch sehr viel zu tun hat. Nach der
bewährten Logik, derzufolge ein Minus im Handel, sofern
es in Amerikas Büchern steht, das Ergebnis unfairer
Handelspraktiken des diesbezüglichen Partners sein muß,
klagt man den Protektionismus
an, der in China
noch immer herrsche: Für den selbstlosen Verfechter des
weltweiten Freihandels sei es in keinem Fall hinnehmbar,
daß dortigen Staatsbetrieben der Export subventioniert
wird, während amerikanischen Autos, Telefonen und
Agrarkonzernen, aber auch Banken und Versicherungen der
Zugang zu Chinas Märkten verwehrt bleibe.
Die Zurückweisung des chinesischen Wunsches, von
der führenden Weltwirtschaftsmacht als Handelspartner mit
gleichen Rechten anerkannt zu werden, kleidet sich so in
den konstruktiven Antrag, erst einmal im
bilateralen Verkehr untereinander für die Voraussetzungen
eines fairen
, also für Amerika garantiert
einträglichen Wettbewerbs zu sorgen. Falls der
zufriedenstellend zustandekommt, wäre man im Gegenzug
auch bereit, die Frage, ob China im Handel mit den USA
speziell zu diskriminieren sei, nicht mehr einer
alljährlich neuen Beschlußfassung zu überantworten:
Auf immer
will Clinton China Meistbegünstigung
gewähren – sofern man in Washington die
chinesische Wirtschaftspolitik als das Zeichen des
guten Willens
zu interpretieren geneigt ist, den man
von China verlangt.
5. Die Finanzkrise in Asien
Während die mangelnde Konvertibilität der chinesischen
Landeswährung für die USA immer ein schlagender Einwand
gegen die Aufnahme Chinas in den Kreis der WTO-Partner
ist, ist der Präsident der Weltfinanzmacht für den
Umstand, daß der Wert dieser Währung im Unterschied zu
wirklichem Welt-Geld politisch dekretiert wird, aktuell
ausgesprochen dankbar. Derzeit macht China
nämlich genau dadurch alles richtig, daß es sich
nicht den internationalen Geldspekulanten
bedingungslos öffnet
. Das glorreiche globale
Finanzsystem
, dem die USA maßgeblich vorstehen, ist
deren eigenem Urteil zufolge in einer Verfassung, daß
selbst ein Staat, der darin noch gar nicht so richtig
integriert ist, mit ein paar Cent weniger für den Yüan
seinen Kollaps befördern kann. Die Wirkungen jedenfalls,
die die berufenen Kenner der Materie aus einer Abwertung
der chinesischen Landeswährung locker herleiten – sie
reichen vom endgültigen Zusammenbruch erst der Märkte in
Asien, dann Hongkongs, dann derer in Japan, dann der
Landeswährung dort und darüber dann auch des Geldes, das
zum Großteil den Kredit der ganzen kapitalistischen Welt
ausmacht –, machen auch dem Präsidenten Clinton Sorge,
der von alledem nichts versteht. Daß China der
Spekulation gegen seine Währung – bislang wenigstens noch
– eisern trotzt und mit schwerverdienten Dollars die
Fiktion einer grundsoliden und „stabilen“ Landeswährung
am Leben erhält, läßt für ihn und andere dieses Land
daher gleich als eine Insel der Stabilität
erscheinen. Und die Berechnungen der chinesischen
Finanzpolitiker, auf diese Weise vielleicht doch weniger
zu verlieren als auf die andere, avancieren zu Gesten der
Selbstlosigkeit im Namen der globalen Verantwortung:
„China hat seine Verantwortung gegenüber der Region und der Welt während dieser letzten Finanzkrise entschlossen übernommen – und zur Vermeidung eines weiteren Zyklus gefährlicher Abwertungen beigetragen. Wir müssen weiterhin zusammenarbeiten, um diese Bedrohung des globalen Finanzsystems sowie von Wachstum und Wohlstand … abzuwehren.“
Mögen sie nach amerikanischer Auffassung auch mit unlauteren Methoden zustandegekommen sein: Wenn China seine Handelsüberschüsse weiterhin für diesen guten Zweck ausgibt, verdient es uneingeschränkt Lob.
*
So bringen die beiden Staatschefs in ihren vielen
Gesprächen über alle Ebenen der Weltpolitik, die sie
treiben, diplomatisch auserlesene und politisch besonders
wertvolle Sprachregelungen und Sichtweisen darüber
zustande, welche Interessen beide Seiten demnächst zu
verfolgen gedenken. Sie wissen, bis wohin sie dabei gehen
können, ohne Unmut zu erregen, wissen auch, was sie sich
besser nicht erlauben sollten, wenn zwischen ihnen
weiterhin gute Beziehungen
herrschen sollen, und
tun einander und der Welt kund, daß sie nach dem Besuch
besser als vorher wüßten, wo ihre potentiellen
Differenzen
, aber auch die Bereiche gemeinsamer
Absichten
liegen. Doch auch wenn letztere nach dem
Bekunden der etablierten Weltmacht sogar eine
strategische Partnerschaft
hergeben: Daß dieser
neue Partner keineswegs den bereits etablierten, den
imperialistischen Mächten von gleicher Machart wie die
USA selber, gleichgestellt ist, wissen beide nach diesem
Besuch auch. Um China und der Welt genau dies
mitzuteilen, nimmt der amerikanische Präsident nämlich
seinen Besuch zum Anlaß für eine eigene kleine
Veranstaltungsreihe zum Thema:
6. Die Menschenrechte
Auch in China kennt man die Tour, in der die Weltmacht
auszudrücken pflegt, daß ihr ein anderer souveräner
Staatswille grundsätzlich nicht genehm ist. Mit
den Menschenrechten
und dem Vorwurf, sie zu
mißachten, werden Verfahrensweisen, Gewohnheiten oder
auch nur Einzelaktionen einer Herrschaft beim Umgang mit
ihren Landesbewohnern, zu denen diese sich allemal durch
ihre Verpflichtung auf Recht & Ordnung und ein durch sie
definiertes Gemeinwohl ermächtigt weiß, als
unerlaubte Übergriffe gegeißelt. Und zwar keineswegs
alles, was einem anständigen Menschen am Walten moderner
politischer Herrschaften und an den von denen
eingerichteten Lebensverhältnissen mißfallen kann,
sondern zielsicher eine Spezialabteilung: gewaltsame
Kontrollmaßnahmen, mit denen eher ungefestigte
Gewaltmonopolisten es in Sachen Stabilität den
marktwirtschaftlich erfolgreichen Demokratien gleichzutun
suchen. Und auch die werden keineswegs überall dort
geächtet, wo sie anzutreffen sind, sondern wo man der
regierenden Gewalt Stabilität nicht als oberstes
Anliegen, weil Grundvoraussetzung aller weiteren
politischen Wohltaten zugutehält; was immer und nur dann
der Fall ist, wenn die Herrschaft selbst
mißfällt. Und zwar den Instanzen, die aufgrund ihrer
Macht das Recht haben, die
„Menschenrechtswaffe“ zur Anwendung zu bringen:
Imperialistische Nationen klagen auf die Art
Staatsgewalten an, an denen sie mehr als das eine oder
andere unpassende Interesse auszusetzen haben. Die
Anrufung eines moralischen Grundprinzips, dem
das Herrschen generell verpflichtet wäre und von dem es
im vorliegenden Fall abweiche, dient dazu, dem
Subjekt der Herrschaft prinzipielle Mißbilligung
auszudrücken: Mit dem Deuten auf verletztes
Menschenrecht
wird dem Souverän und allen
Rechten, die er in seinem Umgang mit seinen Menschen
verfolgt, beschieden, grundsätzlich nicht
respektabel zu sein.
Dies freilich auch nur in einem höheren, moralischen, nicht im handfest politischen Sinn: Die diplomatische Anerkennung, diese Grundfigur und Grundlage allen friedlichen Verkehrs souveräner Staatsgewalten miteinander, wird mit der sittlichen Diskreditierung einer auswärtigen Herrschaft allein noch nicht widerrufen. Sie kann einen solchen Schritt ankündigen; wenn die politische Ächtung eines erklärten Feindstaates ansteht, geht das nie ohne Anrufung der Menschenrechte ab; und bewaffnete Interventionen kommen erst recht nicht ohne die Rechtfertigung aus, menschenrechtswidrige Regime verstünden nur „die Sprache der Gewalt“. Das diplomatische Instrument der moralischen Fundamentalkritik läßt sich eben wegen seiner Überbau-Qualitäten aber auch so dosiert einsetzen, daß eine flott laufende und weitergeführte „politische Zusammenarbeit“ dadurch bloß unter den Generalvorbehalt gestellt wird, im Partner, so wie er politisch verfaßt und orientiert ist, noch keineswegs den passenden Erfüllungsgehilfen vor sich zu haben, sondern einen noch sehr grundsätzlich besserungsbedürftigen politischen Willen.
In diesem letzteren Sinn gibt der US-Präsident seinem chinesischen Gastgeber zu verstehen, daß bei allem beabsichtigten und absichtsgemäß herbeigeführten Einvernehmen in vielen und höchst wichtigen Einzelfragen Chinas volksrepublikanisch-großmächtige Verfassung im Ganzen auf Ablehnung trifft und jedenfalls bislang noch viele und entscheidende Anpassungsleistungen schuldig geblieben ist: Clinton bringt Anklagen vor – die einstige blutige Aktion der Volksarmee gegen demokratie-idealistische Studenten auf dem ‚Platz des himmlischen Friedens‘ ist ideell ebenso allgegenwärtig wie das um seinen Quasi-Gott betrogene tibetische Volk –, die ernstgenommen ein Widerruf all dessen wären, wozu man es beim Ausbau der Beziehungen schon gebracht hat und weiter bringen will; eben deswegen bringt er sie gerade nicht als moralische Totalabsage an seinen Gastgeber vor – dann wäre er im übrigen auch gar nicht erst verreist –, sondern als moralisierenden Zusatz, wie eine wohlmeinende Anregung für Chinas Herrscher. Das will er damit aber schon klargestellt haben, wenn er von dem Segen kündet, den die Freiheit, die freie politische Meinungsäußerung im besonderen sowie das Prinzip, sich seine politischen Führer wählen zu dürfen, für die Menschen bringen: Ganz grundsätzlich, getrennt von allem, worüber er mit der chinesischen Regierung im einzelnen politisches Einvernehmen herstellt, sind die USA mit der Volksrepublik als weltpolitischem Subjekt nicht einverstanden. Zu dieser Verdeutlichung fühlt sich der oberste Amerikaner gedrängt, gerade weil sein Staatsbesuch die Demonstration bezweckt und eine einzige Demonstration des Inhalts ist, daß die Weltmacht auf China als gutwilligen Mitmacher im zeitgenössischen Weltordnungswesen und Weltgeschäft Wert legt und dafür sogar die politischen Eigeninteressen der Volksrepublik ein gutes Stück weit gelten läßt. Daß ein Recht auf Eigenmächtigkeit daraus nicht erwächst, die selbstgesetzten Ziele der Nation keineswegs als pauschal abgesegnet gelten dürfen: Das muß den Chinesen und dem Rest der Welt entsprechend unmißverständlich gesagt werden – und wird mit der Mahnung an nicht bereutes staatseigenes Unrecht klargestellt.
Die Gastgeber reagieren entsprechend. Der oberste
Repräsentant von Freiheit und Demokratie kommt in den
Genuß der Meinungsfreiheit, die er von zu Hause
gewohnt ist: Live im Fernsehen, mit Telefon, Fax und
Auftritten in Universitäten darf er unzensiert
Propaganda für die US-amerikanisch-demokratische
Wertordnung machen und sogar seine christliche Notdurft
verrichten. So, als überhaupt nicht unterdrückte
Privatmeinung, die er ruhig äußern darf, hört
der Chinese sich die netten Anregungen
durchaus
aufgeschlossen an, die der Präsident für China parat hat.
Den politischen Vorbehalt, der darin ausgedrückt
wird, nimmt die Staatsführung so auf der diplomatischen
Ebene zur Kenntnis, auf der er geltend gemacht wird: als
mißbilligenden Zusatz zu dem berechnend
gewährten Respekt vor Chinas Macht und
Wichtigkeit – und so nimmt man ihn im Interesse der
eigenen Interessen in Kauf.
Dieses Theater erleichtert dann auf seine Weise die
Urteilsfindung der hiesigen Öffentlichkeit
ungemein. In dieser nimmt man vorzugsweise ganz ohne
störenden Rekurs auf den politischen Stoff der
diplomatischen Verhandlungen darauf Bezug, wie sich die
Beziehungen zwischen dem mächtigen Gast und seinem
machthabenden Gastgeber während des Besuchs gestaltet
haben und nach dem Besuch so im allgemeinen darstellen.
Man stellt fest, daß Clinton etliches angesprochen hat,
was man als Kritik an Chinas „Machtelite“ auffassen
kann: Kein Zugeständnis
in den Grundsatzfragen
einer moralisch nicht zu beanstandenden Herrschaft habe
er gemacht, seinen Gastgebern gar eine Lektion in
demokratischer Gesinnung
erteilt. Andererseits stellt
man auch fest, daß der Präsident viele freundliche Worte
gefunden hat, die man durchaus als Anerkennung
Chinas auffassen kann. Immerhin hat er ja nach
eigenem Bekunden in den Dörfern die Demokratie
knospen
gesehen; und in der Hauptstadt hat er
dem Symbol des chinesischen Menschenunrechts,
dem ‚Platz des himmlischen Friedens‘, die Ehre seines
Besuchs erwiesen – auf eine Weise, daß die chinesische
Führung weder „ihr Gesicht verlieren“ mußte noch sich
freigesprochen fühlen durfte…
Derlei Stimmungsberichte reichen dann schon für den Eindruck, daß es sich bei China um ein Land handeln muß, das irgendwie in „unsere“ Weltordnung hineingehört, aber doch auch wieder – noch – nicht so recht. Mit solcher Unsachlichkeit liegt die Weltöffentlichkeit dann doch wunderbar genau auf der Linie der demokratischen Weltpolitik.