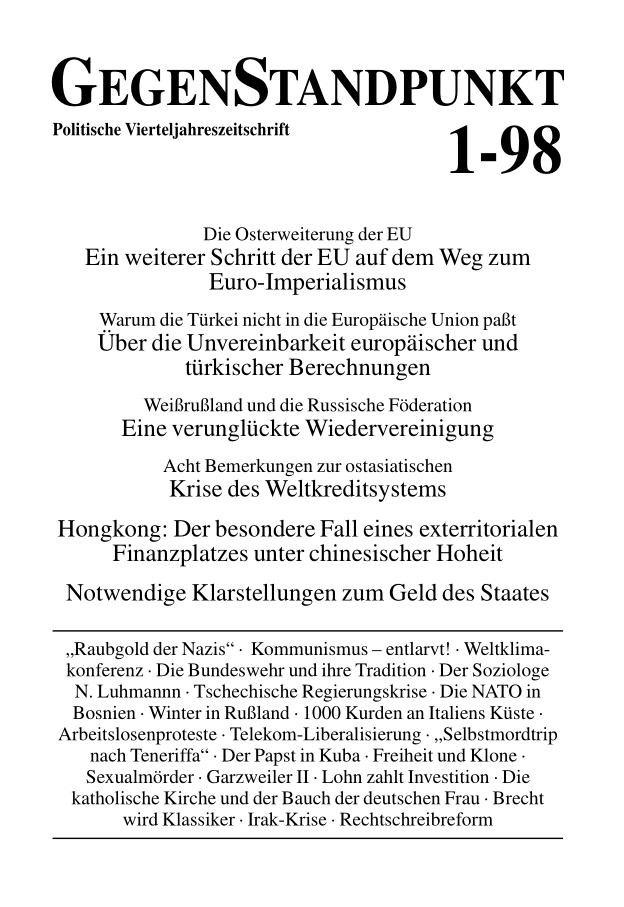Warum die Türkei nicht in die Europäische Union passt
Über die Unvereinbarkeit europäischer und türkischer Berechnungen
Warum die Türkei auf dem Recht auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union besteht: Über die Notwendigkeit und neue Freiheiten der Türkei, ihren Status als Regionalmacht auszubauen / Über die Ausrichtung der Nationalökonomie an Bedürfnissen und Konjunkturen der EU-Ökonomie ohne den erwarteten Nutzen / Über Anspruch und Leistungen der Türkei, um vom Objekt zum Mitsubjekt der EU aufzusteigen. Warum die Europäische Union der Türkei einen externen Sonderstatus verpassen will: Über die politökonomische Integration der Türkei bei Ausgrenzung ‚schädlicher Risiken‘ / Das subimperialistische Programm der Türkei – zu ‚eigenmächtig‘ für den EU-Imperialismus / Die Zuweisung eines externen Teilnehmerstatus erfordert eine europäische Beschwichtigungsdiplomatie.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Warum die Türkei nicht in die
Europäische Union paßt
Über die Unvereinbarkeit
europäischer und türkischer Berechnungen
Im Gegensatz zu den osteuropäischen Beitrittskandidaten der EU ist der türkische Staat seit langem fester Bestandteil des transatlantischen Militärbündnisses, in dem sich die westeuropäischen Nationen zur Sicherung ihrer herrschaftlichen Interessen versammelt haben. Die Türkei ist seit 1952 – also länger als der immer schon freiheitliche Teil Deutschlands – Mitglied der NATO. Unter der Führung der USA ist sie zum strategischen „Eckpfeiler an der europäischen Südostflanke“ für den Kampf gegen die Sowjetunion ausgebaut worden, wofür auch der bundesrepublikanische Frontstaat gerne Kriegsgerät anlieferte oder bezahlte. Die ökonomische Grundlage des türkischen Staatswesens erfuhr gleichzeitig eine immer engere Zuordnung zum europäischen Kapitalismus. Seit 1963, also seit 35 Jahren, hat das Land den Status eines assoziierten Partners der EG/EU.
Die in Aussicht gestellte Aufnahme als Mitglied fand nicht statt. Ende 1997 beschloß die EU den offiziellen Beginn ihres Erweiterungsprogramms nach Osten. Die Türkei kommt darin so vor, daß sie auch für die zweite Runde nicht vorgesehen ist. In der ersten Runde dabei ist aber Zypern, wobei dessen progriechischer Südteil sozusagen stellvertretend für den Gesamtinselstaat anerkannt wird, während der türkisch besetzte Norden auf die Mitzuständigkeit der Türkei für den Staat Zypern pocht. Das EU-Programm richtet sich somit aus der Sicht Ankaras in doppelter Weise gegen die Türkei: erstens durch diskriminierende Ausgrenzung und zweitens durch eine progriechische Einmischung in den offenen Hoheitskonflikt mit dem europäischen Nachbarn.
Kein Wunder, daß sich die Türkei herausgefordert fühlt. Sie will und kann sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden. Für sie steht nichts Geringeres als die Selbstbehauptung und Zukunft der Nation auf dem Spiel. Sie entnimmt der diplomatischen Hinhaltetaktik Brüssels zurecht eine inhaltliche Absage und fordert ein klares Entweder-Oder, d. h. eine konkrete Beitrittsperspektive für ihr Land. Sie ist schließlich nicht Estland und hat es nicht nötig, als bloßer Bittsteller anzutreten, immerzu ihren konstruktiven Teilnahmewillen zu beweisen und doch nur als abhängige Variable europäischer Einigungsbeschlüsse zu fungieren, auf die sie selbst keinen Einfluß nehmen kann. Das ist zumindest der Standpunkt ihrer Regierung.
Die Euro-Führer sehen das offenbar genau andersherum.
I. Warum die Türkei auf dem Recht auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union besteht
1.
Der unblutige Sieg des kapitalistischen Westens über die Sowjetunion und ihr realsozialistisches System hat die Türkei mit einer neuen Lage konfrontiert. Ihre NATO-Rolle als Bollwerk – heute gegen eine mögliche „Re-Imperialisierung“ Rußlands – blieb zwar erhalten, wurde aber ein Stück weit entwertet. Die Ein- und Unterordnung unter die von den USA organisierte globale Kriegsfront hatte dem Land einerseits Rechte und Gewicht gegeben, andererseits der Entfaltung nationaler Interessen enge Grenzen gesetzt. Der neuen Lage entnehmen die politisch Verantwortlichen in Ankara folglich nicht nur die Notwendigkeit, eine „neue Rolle“ – durch die ihre internationale Wertschätzung verbürgt wird – zu finden, sondern vor allem neue Freiheiten, darunter auch die, ihre Funktionen im Rahmen der „Neuen Weltordnung“ nach Kräften mitzudefinieren. Die aktive Beteiligung am Golfkrieg gegen den Irak war ein Auftakt und auch als Signal gemeint. Die Türkei drängt sich den kaukasischen und zentralasiatischen Nachfolgestaaten der UdSSR als säkulares Modell islamischer Orientierung und politökonomischer Türöffner in Richtung Goldener Westen auf; sie sieht sich zu einer grenzüberschreitenden Offensive gegen die Kurden berechtigt; sie bekräftigt ihre kriegsträchtigen Ansprüche in der Ägäis und mischt sich im Balkankrieg auf Seiten der bosnischen Muslime ein. Aus diesen Ambitionen, die sie tatkräftig verfolgt, fertigt sie gleichzeitig lauter Angebote an den sich formierenden europäischen Kollektivimperialismus. Als Machtfaktor kann sie eine Reihe nützlicher Dienste leisten, denn die Türkei liegt geographisch im Zentrum von lauter veritablen „Krisengebieten“ im südöstlichen Vorfeld des Kontinents. So fordert die Nation Unterstützung und Rückendeckung der EU für ihr Programm ein. Das hat seinen guten Grund: Mißerfolge bei ihren anspruchsvollen Unternehmungen machen sie nämlich laufend darauf aufmerksam, daß sie nicht nur auf den Widerstand störender Völkerschaften und regionaler Einflußkonkurrenten, sondern auch und gerade auf Bedingungen und Schranken stößt, die von den führenden Bündnispartnern in NATO und EU gesetzt werden. Der NATO-Staat Türkei arbeitet sich an den Widersprüchen eines autonomen Subimperialismus ab. Er erwartet sich von einer gleichberechtigten Mitgliedschaft in der EU den ihm gebührenden Zuwachs an Rechten und Mitteln der Nation.
Das zweifelsfreie Recht auf Mitgliedschaft in der Europäische Union gründet sich für die Türkei darauf, daß sie – im Unterschied zu erst einzugliedernden Staatenneulingen – über langjährige, funktionierende und strategisch wesentliche Beziehungen zur westlichen Welt bereits verfügt. Ihr Nutzen und ihre Schlagkraft sind nicht herzustellen, sie steht schon in einem politischen und militärischen Verhältnis zu Europa: Als „Brückenkopf“ der NATO hat sie sich bewährt und diese Funktion will sie auch unter den neuen weltpolitischen Umständen bewahren. Die Türkei verweist darauf, was sie ist: gleichberechtigter Mittäter in einem Militärbündnis, das Definitions- und Gewalthoheit in zwischenstaatlichen Aufsichtsfragen für inzwischen ganz Europa beansprucht. Als dessen Teil steht sie auf der ordnenden, nicht auf der zu ordnenden Seite der Staatenwelt. In der Funktion als amerikanischer „Pfeiler“ im Vorderen Orient ist sie darüberhinaus mit einer gesonderten Unterstützung der USA gesegnet. Die Türkei verweist darauf, was sie deshalb alles hat: Kriegshäfen und Fliegerbasen, US-Bomber und gebrauchte NVA-Panzer sowie das größte europäische Heer außerhalb Rußlands. In dieser Ausstattung bilanziert sich das Interesse des NATO-Pakts an ihr; daß sie den Status als dessen hochgerüstete südöstliche Flanke als „Argument“ für sich verwendet und respektiert wissen will, ist im Verkehr unter souveränen Staaten so üblich.
Wie jeder andere Staat handelt der türkische nicht als bloßer Auftragnehmer der NATO-Zentrale oder der USA – erst recht nicht, seit der alles bestimmende Auftrag gegen den früheren Hauptfeind Sowjetunion erledigt ist –, sondern er versucht, aus seinem soliden Fundament an Landmasse, territorialer Lage und Bewaffnung das Beste für die Nation zu machen. Dabei läßt er, wiederum nach guter imperialistischer Sitte, sich als „Mitte der Welt“ und die Umgebung als seine „Peripherie“ definierend, keine Himmelsrichtung aus. Gen Norden und Osten tritt die Türkei sehr selbständig als Schirmherr der neuerrungenen Freiheit ihrer kaukasischen und zentralasiatischen „Brudervölker“ auf, engagiert sich als Aufbauhelfer in Aserbeidschan gegen den armenischen „Erzfeind“ und operiert als Makler beträchtlicher Pipeline-Projekte, der nicht nur die geschäftsförderliche Überführung von Gas und Öl in die industriellen Metropolen des Westens vermittelt, sondern zugleich seine Dienste als Garantiemacht eines sicheren Transportwegs anbietet. Richtung Naher und Mittlerer Osten reiht sie sich ein in die historisch erste Frontstellung der „Neuen Weltordnung“ gegen den Irak und sucht nach nutzbringenden Wirtschaftsbeziehungen mit dem Nachbarn Iran, ungeachtet der schlechten Noten, die dieser aus den Hauptstädten des Imperialismus sonst erhält. Im Süden ihres Staatsgebietes führt die türkische Herrschaft einen langjährigen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, wird in dem Zuge immer wieder grenzüberschreitend im Nordirak aktiv, wo sie logistische Rückzugspositionen der PKK bekämpft und zudem mit ihrer Luftwaffe an der UN-Flugverbotsüberwachung („Northern Watch“) teilnimmt. Daß dabei nicht nur Saddams Flieger in einem Teil des eigenen Landes am Fliegen gehindert werden, sondern auch die eine oder andere Bombe auf ein „Kurdennest“ fällt, liegt in der – national gesehen – doppelten Stoßrichtung dieses militärischen Auswärtsspiels. Im Süden pflegt sie enge Waffenbrüderschaft mit Israel und fährt gemeinsame Seemanöver unter Patronage der USA, um sich als Kontrollmacht im östlichen Mittelmeer aufzustellen. Und über der Ägäis mißt sie sich mit Griechenland in der hohen Kunst militärischer Scheingefechte, die dazu dienen, die von Athen proklamierte Erweiterung der Hoheitsgebiete zu bestreiten. Als Antwort auf die mögliche Aufnahme Zyperns in die EU droht sie mit der endgültigen Eingemeindung des Nordteils der Insel. Und auf dem Balkan entdeckt sie, nachdem der Ostblock verschwunden ist, eine ganze Reihe turkstämmiger Minderheiten oder historische und muslimische Bande, in deren Namen türkische Autobahnbauer nach Tirana und türkische Soldaten nach Sarajevo reisen.
Bei der Durchführung ihres außenpolitischen Programms stößt die Türkei auf ein Mißverhältnis zwischen dem, was sie will, und dem, was sie kann; Programm und Anspruchsniveau auf der einen Seite, Ertrag und Wirkung auf der anderen gehen nicht zusammen. Darauf wird sie in unterschiedlicher Weise gestoßen: Mal vermag sie etwas nicht und trifft auf den hartnäckigen Widerstand ihrer unmittelbaren Feinde, oft sieht sie sich aber auch durch konkurrierende und ihr überlegene auswärtige Ordnungsinteressen beschränkt. An der inneren Hauptkampflinie, der Kurdenfrage, zahlt sich die massive Überlegenheit der Armee, für die der türkische Haushalt seit Jahren geradesteht, militärisch einerseits zwar aus; andererseits beurteilen die NATO-Partner die Dauerausflüge in den Irak mehr oder weniger kritisch, und das sich gegen „Migranten“ abschottende Europa bedrängt die Türken, „ihr Problem“ in den Griff zu kriegen und ihm die Flüchtlinge vom Hals zu schaffen. Bei allem Verständnis, auch waffenmäßiger Ausrüstung für diese Feldzüge, müssen sie sich von außen immer wieder zurechtweisen lassen. Ihre damalige Eingliederung in die Golfkriegsfront hat die Türkei zwar mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln betrieben, doch die erhoffte außenpolitische Aufwertung hat sich durch ihre Beteiligung an der Anti-Saddam-Koalition nicht nur nicht eingestellt; dadurch, daß die USA die erneute Zerstörung der irakischen Macht angesetzt haben, droht aus türkischer Sicht die Gefahr der Etablierung eines Kurdenstaates an ihrer Südgrenze, der den Separatismus des einheimischen Kurdenvolkes anstacheln und so die territoriale Integrität des eigenen Staates endgültig untergraben würde. Im seit Jahren akuten Fall der umstrittenen Pipelinerouten aus den früheren sowjetischen Öl- und Erdgasgebieten in die sicheren Häfen Europas bricht sich die türkische Ambition, erste Anlaufadresse und Wachhund der empfindlichen Energieleitungen zu sein, nicht nur daran, daß man auf positive Entscheidungen der Multis und der federführenden Großmächte angewiesen ist und dabei selbst als Risikofaktor gilt (eine mögliche Route führt durch umkämpftes Kurdengebiet), sondern auch an ebenfalls interessierten Nebenbuhlern wie Russen oder Griechen, die andere „Lösungen“ in ihrem Sinne bevorzugen. Auch im östlichen Mittelmeer sieht sich die reklamierte türkische Handlungsfreiheit elementar behindert. Zum ersten durch den ähnlich gestrickten Ehrgeiz Griechenlands, dem die Türkei die einseitige Ausdehnung von Hoheitszonen in der Luft und im Meer vorwirft – ausdrücklich in der Beschwerde über die Mißachtung nationaler Rechtstitel auf „1000 Inseln“ (Çiller) – sowie nicht hinnehmbares Hegemoniestreben gegenüber Zypern; zum zweiten dadurch, daß die Griechen hier die politische Rückendeckung Europas genießen und durch die anvisierte EU-Mitgliedschaft des griechischen Teils Zyperns weiter begünstigt werden.
An diesen Teil- und Mißerfolgen registriert die Türkei, daß an ihr als Militärstandort und regionaler Ordnungsmacht nur ein bedingtes auswärtiges Interesse besteht, wenn ihre diesbezüglichen Anstrengungen nicht gleich durch konkurrierende Unterfangen mißachtet oder durchkreuzt werden. Daß sie bei der Forschung nach dem Grund ihres unbefriedigten Nationalismus immer wieder auf die Europäische Union trifft, ist kein Wunder. Das liegt daran, daß fast überall dort, wo die Türkei sich als Machtfaktor präsentieren möchte, in irgendeiner Form auch Europa unterwegs ist. Am Kaukasus als OSZE, nördlich des 36. irakischen Breitengrades als englischer Chefüberwacher; man begegnet sich mit Truppen und Militärberatern in Bosnien; den Kurdenkrieg führt die Türkei zwar alleine, erntet aber wachsende Kritik wegen seiner flüchtenden Opfer; in der Ägäis prallen sich ausschließende Souveränitätsansprüche aufeinander. An all diesen Affären wird die Türkei darauf gestoßen, daß sie in dem Maße auf rivalisierende oder gar feindliche europäische Interessen trifft, wie diese Nationen ihrerseits – einzeln und/oder gemeinsam – die Freiheit der neuen Weltlage dazu nutzen, sich mittels und neben der NATO als eigenständige Ordnungsmacht für Europa aufzubauen. Aus demselben Grund, weshalb die Türkei in alle Himmelsrichtungen aktiv wird: wegen ihrer zu Höherem berufenen imperialistischen Staatsräson, kreuzt sich ihr Weg immer öfter mit der expandierenden Macht und Reichweite der EU. Gegen deren überlegene Mittel kann sie sich nicht behaupten.
Angesichts dieser Lage muß die Türkei widerwillig zur Kenntnis nehmen, daß sie Gefahr läuft, selbst ein kritischer Fall der Beaufsichtigung durch die gleichen Mächte zu werden, mit denen sie in einem Militärbündnis sitzt. Ihr eigenes Aufbruchsprogramm droht an der Expansion der EU zu scheitern. Aus dieser Erfahrung und aus dieser Perspektive zieht die Türkei einen Schluß. Wenn alles, was sie für sich unternimmt, als autonomer Sonderweg disqualifiziert wird, mit dem sie sich zusehends aus Europa ausgrenzt; wenn sich ihre NATO-Mitgliedschaft in dem Maße als unzuverlässiger und gar nicht ausreichender Hebel zur Mehrung türkischen Einflusses erweist, wie die EU eigene Ordnungsprojekte vorantreibt und ihr Bündnis gen Osten ausdehnt; wenn dieser europäische Staatenverbund also fähig ist, in den von ihr ins Auge gefaßten Gegenden und Aufsichtsfällen um einiges potenter und maßstabsetzender als sie selbst aufzutreten: Dann will und muß sie unbedingt dabei sein und sich zur regionalen Ordnungsmacht ermächtigen lassen, um nicht zum Objekt und Opfer europäischer Ordnungsstiftung zu werden. So haben ausgerechnet der offizielle Ablehnungsbeschluß der EU selbst und die damit verknüpfte Parteinahme des vereinigten Europa für das NATO-Mitglied Griechenland und gegen das NATO-Mitglied Türkei den Politikern in Ankara deutlich gemacht, daß der türkische Nationalismus nur in der Europäischen Union das Gewicht erlangen kann, das ihm aus seiner Warte zusteht.
2.
Im Interesse einer „Modernisierung“ ihrer wirtschaftlichen Grundlagen hat sich die Türkei darauf festgelegt, den Erwerb nationalen Reichtums durch die systematische Ausrichtung an der Europäischen Gemeinschaft und am EG-Binnenmarkt zu suchen. Dank jahrzehntelanger Kooperationsbeziehungen ist sie zu einem festen Bestandteil der supranational organisierten Kapitalakkumulation geworden und bezieht folglich den Großteil ihrer Mittel aus ihrer wirtschaftlichen Integration in „Europa“. Die EU-Orientierung hat zur Folge, daß die türkische Wirtschaft maßgeblich von den Bedürfnissen und Konjunkturen der Politischen Ökonomie der Gemeinschaft bestimmt wird. Das Land hat sich durchaus „entwickelt“: vor allem in seiner Eigenschaft als „64 Millionen-Markt“, als Kapitalstandort von Euro-Multis für die Erschließung asiatischer und nahöstlicher Absatzgebiete sowie als Exporteur von überschüssigen Billigarbeitskräften ins deutsche Wirtschaftswunderland. Die Hoffnung aber, darüber umgekehrt zu soliden und wachsenden Einkommensquellen für die eigene Nation zu gelangen, ist weniger aufgegangen. Statt dessen sind die Außenhandels- und Haushaltsdefizite gewachsen, der angegriffene Kredit untergräbt zusätzlich die innenpolitische Stabilität und die außenpolitischen Projekte des Landes. Entsprechend dringlich fiel der Appell an die EU aus, im wohlverstandenen Eigeninteresse an einem stabilen Partner einer vollen und förmlichen Integration der türkischen Volkswirtschaft zuzustimmen. Statt dessen wurde der ewige Kandidat zum 1.1.1996 ersatzweise mit einer Zollunion abgespeist. Der Vertrag und die Praxis dieser Union erscheinen den Machthabern in Ankara als symptomatischer Beweis für die erpresserische Übervorteilung und Demütigung, die sie sich – als treue Verbündete – gefallen lassen müssen. Das wollen sie nicht länger und fordern endlich Gegenleistungen, d.h. eine Revision des ergangenen Ablehnungsbescheids.
Aufschlußreich ist die Presse-Plauderei der seinerzeitigen türkischen Ministerpräsidentin, in welcher sie sich das Inkrafttreten der Zollunion mit der EU als unsterbliches Verdienst fürs Vaterland zurechnet:
„Hätten wir nicht rechtzeitig eingegriffen, hätte sich die Frage zum EU-Beitritt heute nicht gestellt. Im Dezember ist die Sache auf Eis gelegt worden. Ich übertreibe nicht, ich weiß, wovon ich spreche. Diese Entscheidung wurde in den USA getroffen. Amerika war sich mit Rußland einig. Die Turkrepubliken sollten Rußland als besonderes Einflußgebiet überlassen bleiben. Der Türkei wurde für die Nahostregion eine militärische Rolle zugewiesen. In diesem globalen Rahmen war Amerika nicht gewillt, daß die Türkei Europa angegliedert wird. Die Türkei sollte außerhalb Europas stehen. Denn Amerika sieht in Europa seinen Konkurrenten. Es paßt Amerika besser, wenn die Türkei nicht dazugehört. Amerika wollte, daß die Türkei mit ihm (Amerika) gute Kontakte pflegt, nicht mit Europa. Dies war die Wahl. Es war kein Zufall, daß die Zollunion im Herbst des letzten Jahres (gemeint ist 1994) abgelehnt wurde. Dies war der wahre Hintergrund. Es ist eine unglaubliche Tatsache. Das ganze Tohuwabohu um die Zollunion ist darauf zurückzuführen. Der Türkei war eine andere Rolle zugedacht. Sie sollte Sicherheitszone für die Nahostregion sein. Sie sollte militärisches Sprungbrett der Amerikaner in Nahost werden. Kurzum: Die Sache war geritzt. Ich habe durch meine persönlichen Beziehungen den Lauf der Dinge geändert. Damit konnte wieder ein richtiger Anfang gemacht werden. Wir unternahmen enorme Anstrengungen, um die Türkei auf diese Ebene zu bringen. Ich meine, wir haben die Entwicklung der Geschichte und die vorprogrammierte Ordnung der Welt geändert.“ (Tansu Çiller, Hürriyet 5.12.95)
Hier spricht die Repräsentantin eines Staates, der sich in einer prekären Lage sieht und einen Ausweg sucht. Sie nimmt zu ihrem großen Ärgernis wahr, daß die Türkei von den Weltordnungsmächten bloß als ein strategisch interessanter Faktor gehandelt wird, als ein Spielball in ihrer Aufsichts- und Einflußkonkurrenz, und hält das für einen Skandal. Sie nimmt zur Kenntnis, daß die USA sich die letzte Entscheidungsbefugnis darüber vorbehalten wollen, welcher Platz und welche Funktionen ihrem Land zuzuweisen sind und verfertigt daraus die Verschwörungstheorie, Washington habe die EU auf intrigante Tour von ihrer Absicht abgebracht, die Türkei in ihr großeuropäisches Projekt einzubauen. Läßt man einmal den Anflug von Größenwahn beiseite, demzufolge es ausgerechnet ihr, Çiller, als Vertreterin jener hin- und hergeschobenen drittklassigen Macht, gelungen sein soll, die amerikanische „Vorprogrammierung“ der europäischen Entscheidung umzuprogrammieren, so stellt sich doch die Frage, wieso aus der politischen Unzufriedenheit mit dem von den USA vorgesehenen Vasallenstatus der Türkei folgt, daß justament der Einstieg in den zollfreien Handelsverkehr mit der EU die ersehnte nationale Emanzipation des Landes aus fremder Vormundschaft und minderwertiger Auftragsarbeit verspricht. Immerhin verheißt die Zollunion ja zunächst „nur“, daß die türkische Wirtschaft sich künftig in einem Wirtschaftsblock zu bewähren hat, in welchem schlagkräftigste kapitalistische Weltkonzerne die Maßstäbe des profitlichen Erfolgs setzen. Für proeuropäische türkische Politiker wie Çiller aber steht der Sinn und Zweck dieser Maßnahme außer Frage. Für sie ist der Anschluß an den wachsenden Euro-Binnenmarkt erst einmal keine Sache kleinlicher ökonomischer Vor- und Nachteilsrechnungen, sondern eine politisch-strategische Richtungsentscheidung von zukunftsweisender Tragweite für die Nation. Die hat sich demzufolge mit der Zollunion ihren Platz in dem aufstrebenden Wirtschaftsbündnis Europa erkämpft, und damit unwiderruflich auch die Entwicklung ihrer kapitalistischen Reichtumsquellen auf die Tagesordnung gesetzt.
Die „mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Wirtschaft gegenüber den EG-Mitgliedstaaten“ (EG-Kommission in der Ablehnung des türkischen Beitrittsantrags 1987) ist der anerkannte Ausgangspunkt des türkischen Integrationswillens. Deshalb sind auch die absehbarerweise einseitigen Nutzen- und Schadensbilanzen im Zuge der Einführung eines zollfreien Handels mit Industriegütern nicht unbedingt ein Einwand für Regierung und Wirtschaftsverbände der Türkei. Sie erklären die Einbußen als notwendige Opfer, die das Land und seine Geschäftsleute nun mal bringen müssen – und auch bereit sind zu bringen, da ansonsten weit und breit keine Alternative in Sicht ist:
„Mit der Zollunion haben wir eine schwierige Zunkunft, ohne Zollunion hat die Türkei keine Zukunft.“ (Metallarbeitgeberverband, in: Gümrükçü, Türkei und Europäische Union im Lichte der vollendeten Zollunion, S.103)
Bei einem Ausschluß aus dem nach Osten ausgreifenden europäischen Binnenmarkt würden heimischen Geschäftemachern von vorneherein alle Chancen auf die Vergrößerung ihrer Erträge und den Aufbau einer konkurrenzfähigen Industrie verwehrt bleiben:
„Die Türkei kann den Aufstieg des Landes nicht dadurch beschleunigen, daß sie die Zusammenarbeit mit den noch unterentwickelten Ländern stärkt, sondern indem sie mit den entwickelten Ländern kooperiert; so kann sie ihrer Wirtschaft die nötige Wettbewerbsfähigkeit für das 21. Jahrhundert sichern.“
„Hinsichtlich des Außenhandels wickeln wir etwa die Hälfte unseres Exports/Imports mit der EU ab… Ich glaube, daß es für die Türkei von Vorteil ist, mit dem größten Verbrauchermarkt in dieser Art institutionalisierten Verhältnis zu stehen. Denn dieser Markt steht der Türkei offen. Für einen türkischen Investor ist es ein Trumpf, seine Investitionen mit Hinblick auf diesen Markt zu tätigen…“ (TÜSIAD, Türkischer Industriellen- und Unternehmerverband, Cumhuriyet hafta, 9.1.98)
Das ist das ehrgeizige Ziel der aktuellen türkischen Politik: die Schaffung einer voll wettbewerbsfähigen Wirtschaft, die den massenhaft vorhandenen Arbeitslosen und den vom Krieg entvölkerten Landstrichen Möglichkeiten nutzbringender Verwendung eröffnet und über wachsende Erträge auch den Staatshaushalt (Inflationsrate: 100%) in Ordnung bringt. An diesem Ziel gemessen erfolgt die ebenso selbstkritische wie zirkuläre Diagnose, derzufolge die Tatsache, daß die türkische Industrie sich bislang dem Druck der Konkurrenz entzogen hat, Grund für ihre fehlende Konkurrenzfähigkeit ist. Höchste Zeit demzufolge, daß die „maroden Staatsbetriebe“ „privatisiert“ und die Wirtschaftsordnung „liberalisiert“ werden! Daß nach Wegfall der Schutzzölle auf Investitionsgüter manche inländische Betriebe endgültig auf der Strecke bleiben, gilt als unvermeidliche „Strukturanpassung“, die der „Gesundschrumpfung“ dient. Mit solchen Sanierungs-Idealen wird aus der Not eine Tugend gemacht. Die Türkei spekuliert darauf, daß die unumgänglichen Opfer durch wachsende Erfolge der nationalen Wirtschaft auf dem europäischen Markt mehr als aufgewogen werden – und sieht sich in dieser Erwartung laufend enttäuscht. Das kann ihrer Auffassung nach nicht mit rechten Dingen zugehen. Die immer negativer ausfallenden Handelsbilanzen werden zum Anlaß für Beschwerden über die vielen Ungerechtigkeiten, welche die Praxis der Zollunion mit sich bringt.
Dabei ist den von der EU-Kommission diktierten „einseitigen“ Vertragsbedingungen und „restriktiven Handelspraktiken“ – Ausklammerung der Sektoren Landwirtschaft, Kohle und Stahl, in denen die Türkei einiges an Exportware anzubieten hätte, aus der Zollunion; Hindernisse für Textilausfuhr; Verschiebung der Öffnung der Arbeitsmärkte auf unbestimmte Zeit; Blockierung der vereinbarten jährlichen Ausgleichszahlungen von 375 Mio. ECU; etc.[1] – unschwer zu entnehmen, welchen Zweck die Zollunion tatsächlich hat und auch erfüllt. Sie erstreckt das wirtschaftspolitische Regime der EU, von der Zollautonomie über das Wettbewerbsrecht bis zum Markenschutz, auf die Türkei, unterwirft damit den gesamten türkischen Handel mit Drittstaaten seinen Regeln (d.h.: Freihandelsabkommen der Türkei mit ihren Nachbarn oder etwa den USA sind verboten!), und räumt so die verbliebenen Hindernisse eines freien Waren- und Kapitalexports für ihre Lieblingsbürger aus dem Wege. Für die türkische Regierung stellt sich die Sachlage anders dar. Sie schließt aus der ausbleibenden „Wechselseitigkeit“ des Nutzens der Zollunion nach bewährtem Muster, daß es die der Türkei vorenthaltenen Rechte sind, die den mangelnden nationalen Ertrag aus der wirtschaftlichen Kooperation begründen. Sie hat sich mit dem Zollunion einen handfesten Souveränitätsverlust eingehandelt und bleibt von einer Teilnahme an den EU-Entscheidungen über die Bedingungen des ökonomischen Verkehrs ausgeschlossen.[2] Das will sie nicht hinnehmen. Sie erneuert also umso dringlicher den Antrag, die Staaten der EU sollten endlich die erbrachten „Vorleistungen“ honorieren und das Land zu einem vollwertigen Mitglied des politökonomischen Euro-Blocks befördern. Damit stünde dann aus ihrer Sicht der Entwicklung der Türkei zu einem potenten Kapitalstandort – mit attraktiven Anlagesphären und einem harten Nationalkredit – endgültig nichts mehr im Wege, so daß die heimische Staatsgewalt ihre politischen Ansprüche künftig erfolgreich untermauern könnte. Und auf diesem Wege einer „gleichberechtigten“ Mitgliedschaft würde sie es gleichzeitig vermeiden – so lautet jedenfalls das türkische Rezept „Europa“ –, an Stelle eines US-Vasallen ein Satellit des Euroblocks zu werden.
3.
Die türkische Regierung dringt so ultimativ, wie sie es aus der Position des Antragstellers heraus vermag, auf Mitgliedschaft im Euro-Club. Vom Anschluß ihrer Nation an die expandierende Erfolgsgemeinschaft erwartet sie die Mehrung des nationalen Nutzens und das Recht auf Mitentscheidung über die Bedingungen dieses Nutzens, also den Aufstieg vom abhängigen Objekt zu einem Mitsubjekt der Europäischen Union. Diese Politik ist nicht unumstritten. Der unbefriedigende und unbefriedete Zustand der Nation hat vielmehr, jenseits des kurdischen Separatismus, eine Opposition hervorgebracht, welche die einseitige Verpflichtung auf die westliche Bündnisräson nicht länger als Sachzwang anerkennen will. Die von Erbakan geführte Islamische Wohlfahrtspartei hat einen alternativen Weg der Selbstbehauptung des Staates eingeschlagen, nachdem sie äußerst demokratisch an die Regierung gelangt war. Die stets putschbereite Armee hat sich daraufhin wieder einmal als Garant der prowestlichen Staatsräson bewährt; die Partei wurde aus den Staatsämtern vertrieben und dann verboten. So ist die „fundamentalistische Opposition“ einstweilen wieder zu einer drohenden Staatsalternative herabgesetzt, deren Existenz wiederum als besonderer und besonders dringlicher Grund für eine unwiderrufliche Aufnahme in die EU geltend gemacht wird. Ferner hat die türkische Regierung auf das strategische Interesse der USA an einer EU-Einbindung des Landes, also auf ein klärendes Machtwort aus Washington gesetzt. Eine Rechnung, die trotz amerikanischer Unterstützung ebensowenig aufgeht. Die guten Ratschläge, die Präsident Clinton ihr erteilte, verweisen sie darauf zurück, die Vorbehalte der Euro-Union selbst nach Kräften auszuräumen – sprich, sich weiterhin als guter Kandidat zu bewerben.
Ende 1995 erhielt die Islamische Wohlfahrtspartei die meisten Wählerstimmen, ihr Führer Necmettin Erbakan wurde Mitte 1996 – unterstützt von der Koalitionspartei der ehemaligen Regierungschefin Tansu Çiller – Ministerpräsident. Das war eine ungewohnte Herausforderung für die bis dahin herrschende politische Elite, vor allem für die Generalität, welche die Interessen der Nation mit der auf Kemal Atatürk zurückgehenden „modernen Staatsordnung des Laizismus“ identifiziert. Deren feste Grundlage war und ist die Orientierung am kapitalistischen Westen. Erbakan verstieß denn auch gleich gegen einige geschriebene und ungeschriebene Gesetze der traditionellen Staatsräson.
Seine erste Auslandsreise, abgesehen von der für jeden Nationalisten obligatorischen Stippvisite im türkisch besetzten Teil Zyperns, ging ausgerechnet nach Teheran – also zum amerikanischen Hauptfeind Nr.2 in der Region. Dort unterschrieb er ein 20 Mrd. Dollar schweres Ölgasprojekt, womit er das d’Amato-Sanktionsgesetz der USA ignorierte. Gleichzeitig schickte er seinen Innenminister zu Verhandlungen mit Saddam Hussein, also zum Hauptfeind Nr.1, um angesichts der Lockerung des Öl-Embargos eine Normalisierung der Handelsbeziehungen anzubieten. Er brachte ein Abkommen der vier Nachbarn (Türkei, Iran, Irak, Syrien) ins Spiel, in welchem ein Ende der feindlichen Rivalität, die den imperialistischen Aufsichtsmächten nur Ansatzpunkt für ihre Einmischung geben würde, und der Unterstützung kurdischer „Subversion“ vereinbart werden sollte. Er brachte eine einvernehmliche Lösung des Streits um die Versorgung Syriens und des Iraks mit Euphrat- und Tigris-Wasser in die Diskussion. Er bereiste weitere islamische Länder und propagierte öffentlich die Vision eines islamischen Bündnisses bis Pakistan und Indonesien unter der Bezeichnung „D8“, das er als Gegengewicht gegen die G7 und ihre Internationale der Christen verstand. Er verkündete die Hochrechnung, daß die Türkei durch ihre Solidarität im Krieg gegen den Irak 20 Mrd. Dollar verloren hat, und verlangte Schadensersatz. Kurz: Die Regierung Erbakan lieferte eine Reihe von Anhaltspunkten dafür, daß sie es mit der islamistischen Kritik an der „Verwestlichung“, d.h. am so definierten moralischen und materiellen Ausverkauf der Nation ernst meinte und die gültige imperialistische Freund-Feind-Ordnung im Nahen und Mittleren Osten mißachtete.
Die Unzufriedenheit mit dem nationalen Ertrag der Partnerschaft mit NATO und EU, die dem politischen Vorwurf eines Verrats „islamischer Werte“ zugrundeliegt, wendete sich naturgemäß auch gegen die heimischen politischen Parteien und Kräfte, welche die stolze Nation in die Irre geleitet und so auch im Inneren gespalten haben. Für Erbakan war die Zustimmung zur Zollunion mit der EU eine „Dienerschaft im Dienst der Giauren (= Ungläubigen)“, zu verantworten von Seiten der türkischen Politiker, „die religionsfeindlich sind“ (Hürriyet 7.12.95) Außerdem stellte er die Möglichkeit einer rein militärischen Lösung des „Kurdenproblems“ zunächst in Frage und gab der Armee eine Mitschuld bei der Zerstörung der südöstlichen Regionen des Vaterlandes. Wiewohl der „Fundamentalist“ Erbakan die überkommenen „Bündnisverpflichtungen der Türkei“ nicht kündigen wollte, wie die Kohabitation mit der „laizistischen“ Westpolitikerin Çiller demonstrierte, sondern eher vorsichtig neue Optionen staatlicher Selbstbehauptung und Einflußgewinnung sondierte, handelte er sich die entschiedene Konfrontation mit der Hüterin der türkischen Verfassung, der Armeeführung, ein. Er beugte sich letztlich dem Druck des Militärs und ersparte diesem somit einen blutigen Putsch; zum Dank wurde seine Partei vor kurzem auch noch ganz rechtsstaatlich verboten.
Auf diese Weise hat das türkische Militär, ob mit oder ohne offiziellen US-Auftrag, einstweilen die Ordnung im Lande wiederhergestellt. Die Generäle sowie die Nachfolgeregierung unter Ministerpräsident Mesut Yilmaz wissen natürlich, daß die so empfundene „Diskriminierung“ des Landes durch die abweisende Politik der EU Wasser auf die Mühlen der islamistischen Opposition leitet. Sie fordern an Stelle der unsolidarischen Dauerkritik aus den Zentralen der EU den verdienten Lohn für ihre fraglose Bündnis-Loyalität – so präsentieren sie ihren Kampf gegen den „politischen Islam“ –, nämlich Unterstützung ihrer Anliegen. Ansonsten müßten sie den Argumenten der Opposition, daß die Türkei ein Opfer fremder imperialistischer Kalkulationen sei, gewissermaßen recht geben. Das will Yilmaz natürlich nicht. Aber in der einen Hinsicht ist er sich mit allen patriotischen Politikern, Erbakan und seine damalige Außenministerin eingeschlossen, einig: Die Türkei hat es nicht nötig, als ohnmächtiger Bittsteller anzutreten und die zum nationalen Nachteil gereichenden Entscheidungen der EU taten- und folgenlos hinzunehmen:
„Einen ‚Sonderstatus‘ für die Türkei in der EU hatte Çiller zurückgewiesen. Falls die Türkei damit abgespeist werden sollte, könnte sie ‚ihr Veto gegen bestimmte Großprojekte der NATO wie die Erweiterung in Osteuropa einlegen…Wir sind nicht in der Ausgangsposition, die uns verpflichtet, eine Sonderlösung für die Türkei hinzunehmen‘.“ (Handelsblatt, 30.1.97)
Die Türkei fordert das Recht auf die Anerkennung eigener Ansprüche. Sie verlangt deshalb eine Teilhabe an den Entscheidungen darüber, welche politischen und ökonomischen Rechte ihrem Land zustehen. „Vorleistungen“ (wie die Zollunion oder die Rolle als Stützpunkt im Krieg gegen den Irak) ja, aber nicht ohne Gegenleistungen. Von der vollen Mitgliedschaft in der EU verspricht sie sich Stimme und Gewicht, also die Macht, die ihr als ausgesperrter Partnerstaat abgeht. Die starke „Ausgangsposition“, auf die Çiller und Co zählen, ist hauptsächlich die Tatsache der NATO-Mitgliedschaft, die das Land zweifelsfrei besitzt. Der Haken ist nur, daß der Erpressungsversuch mit dem angedrohten Veto zur Osterweiterung der Allianz nichts wert ist, wenn die realen Kräfteverhältnisse im Bündnis der eigenen Rechtsposition nicht zur Durchsetzung verhelfen. So mußte sich die Regierung von der Führungsmacht der NATO unmißverständlich darüber aufklären lassen, wer hier auf wen angewiesen ist – bei einem Nein aus Ankara ist höchstens die Türkei draußen:
„Für ein Veto ist bei der Erweiterung der NATO kein Platz.“ (Außenministerin Albright) „Die einzige und intakte Anbindung der Türkei an den Westen ist die NATO. Wenn die Türkei der NATO schadet, bedeutet das, daß sie dieses Band durchtrennt. Die Türkei muß ihrer Unterschrift treu bleiben (also immer zustimmen!). Andernfalls geht die Erweiterung der NATO mit oder ohne die Türkei weiter.“ (Sprecher des US-Außenministeriums, Sabah 10.2.97)
Die Türkei ist also nur solange ein wertvoller Bündnispartner, wie sie Ja zu den Aufträgen sagt, die ihr zukommen. Das gilt für die NATO genau wie für die EU. Sonst avanciert sie zum Problemfall. Versuche, die USA gegen ihre europäischen NATO-Partner in der EU auszuspielen, gehen folglich nur soweit auf, wie sie sich mit den ureigensten amerikanischen Kalkulationen decken. Die Türkei hat in der Regierung Clinton einen mächtigen Fürsprecher, was die Perspektive eines EU-Beitritts des Landes betrifft. Aber den, so wurde dem türkischen Ministerpräsidenten Yilmaz bei seinem Washington-Besuch freundlich mitgeteilt, muß sie sich schon hauptsächlich selber verdienen. Durch das erwünschte Wohlverhalten in Sachen Demokratie, Menschenrechte und Ägäis-Konflikt – mithin durch den praktischen Beweis, daß der türkische Staat den berufenen Führungsmächten der EU garantiert nicht in die Quere kommt, wenn er dabei ist. Allerdings: Ginge es der Türkei um die Übernahme der so in Aussicht gestellten subalternen Rolle, könnte sie sich gleich mit dem Assoziiertenstatus bescheiden. Ein Anhängsel aber will sie nach wie vor nicht sein. Da die türkische Regierung bei all ihren Ambitionen laut Yilmaz durchaus „pragmatisch“ zu Werke geht, ist sie zwar um Schadensbegrenzung im Verhältnis zu Bonn und Brüssel bemüht; dennoch verlangt sie weiterhin Teilhabe am europäischen Imperialimus, der sich neu formiert.
II. Warum die Europäische Union der Türkei statt der Mitgliedschaft einen externen Sonderstatus verpassen will
1.
Die EU entnimmt dem Antrag der Türkei, die wirtschaftliche Kooperation auf eine stabile und dauerhafte Grundlage zu stellen, den Willen, sich auch weiterhin für die Expansionsbedürfnisse ihrer Geschäftswelt nützlich zu machen, und nimmt das Angebot dankend entgegen. Auch die steigenden Verschuldungs- und Inflationsraten, die Handelsbilanz- und die politischen Stabilitätsdefizite registriert sie aufmerksam und durchaus mit Sorgen um den Fortgang einträglicher Benutzungsverhältnisse. Die erfolgreiche Ausdehnung ihres Wirtschaftsblocks bis nach Anatolien und die definitive Unterwerfung des Landes unter ihre Geschäftsbedingungen sind und bleiben ihr natürlich ein Anliegen. Als Grund für eine Aufnahme in die EU läßt sie die Nöte und Schwierigkeiten der Türkei jedoch nicht gelten. Im Gegenteil. Sie erklärt sie zum Hindernis. Eine – in ihren Augen unnötige – Belastungsprobe durch die „strukturellen Defizite“ dieser großen Nationalökonomie wollen sich die EU-Manager, die in Kürze einen unschlagbar stabilen Euro ins Rennen schicken wollen, unbedingt ersparen. Folglich wird die Türkei zur Beseitigung ihrer „selbstverschuldeten Probleme“ ermahnt, ihre „Hausaufgaben“ zu machen, in ihrem eigenen Interesse, versteht sich. Integration des Nutzens und Ausgrenzung „schädlicher Risiken“, für die man sich unzuständig erklärt, so lautet das EU-„Sonderprogramm“ des politökonomischen Umgangs mit der Türkei.
Seit in den achtziger Jahren das kapitalistische Wachstum in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft durch die Produktion einer steigenden Zahl von – gemessen an den Bedürfnissen des Profits – überflüssigen Arbeitskräften vonstatten ging, stand die politische Debatte über einen möglichen EG-Beitritt der Türkei vor allem im Zeichen der Gefahr einer „Überschwemmung durch türkische Gastarbeiter“, die es abzuwehren gelte. Vor allem in der Bundesrepublik Deutschland, die seinerzeit für die Verfügbarkeit von Millionen zusätzlichen Arbeitskräften gesorgt hatte, wurde es für die zuständigen Außen-, Wirtschafts- und Innenpolitiker immer klarer, daß das „Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit“ in Gestalt weiterer arbeitssuchender Türken einfach „nicht verkraftbar“ ist. Und zwar aus wirtschaftlichen Gründen („nehmen uns die Arbeitsplätze weg“), aus sozial-kulturellen Erwägungen („wollen sich nicht integrieren“) und aus politischer Verantwortung („rufen wachsende Ausländerfeindlichkeit hervor“). Mehr noch: In den stets wiederkehrenden Debatten um eine – nicht akzeptable – doppelte Staatsbürgerschaft kommt zum Ausdruck, daß die deutsche Regierung an einer Ausdünnung der bereits ansässigen türkischen „Arbeit-(Weg)Nehmer“ durchaus gelegen ist. Es gab ja auch schon mal „freiwillige Rückkehrhilfen“, wohingegen die Anerkennung eines Minderheitenstatus für die Millionen „türkischen Mitbürger“ mit entsprechenden Rechten wohlweislich immer kategorisch abgelehnt wurde. Minderheitenschutz fordert man schließlich auswärts zur Genüge – für „deutschstämmige Bürger“, versteht sich.
Um die angestrebte EU-Aufnahme an diesem „Hindernis“ nicht scheitern zu lassen, betonten die türkischen Politiker immer wieder ihre Kompromißbereitschaft und boten im letzten Sommer sogar eine „EU-Mitgliedschaft minus Freizügigkeit“ an. Damit ist das Problem für die europäischen Experten in Sachen „Wirtschaftsflüchtlinge“ (vornehm: „Ursachen des Migrationsdrucks“) jedoch nicht vom Tisch, sie wittern eher eine Falle:
„In der Türkei wurde vorgeschlagen, bei einer Mitgliedschaft in der Union die Freizügigkeit eine Weile auszusetzen. Aber das ist künstlich. Normalerweise (!) muß jeder Türke seine wirtschaftliche Zukunft in seinem eignen Land suchen können. Das ist das entscheidende Kriterium. (Wie bei uns, die wir auch die Arbeitslosen bis 2000 halbieren!) Die Freizügigkeit auszusetzen heißt, die illegale Abwanderung zu fördern.“ (Vergau, Deutscher Botschafter in der Türkei, Cumhuriyet hafta, 26.9.97)
Bekanntlich leidet vor allem der deutsche Innenminister sehr unter der Tatsache, daß die bloße Existenz von zwei bis drei Millionen Türken und Kurden auf deutschem Boden ausreicht, um den durch Krieg und Elend ausgelösten Wanderungsbewegungen eine „natürliche“ Adresse zu liefern. Welche Familie hätte nicht zumindest einen Bekannten hier! Die Grenzen zur Türkei müssen also dicht bleiben, genauer gesagt erst so richtig dicht gemacht werden, wie die jüngste Kampagne gegen die „illegalen Kurdenflüchtlinge“ schön demonstriert hat. Denn die Alternative, daß sich Deutschland und die EU darum kümmern, die Lebensverhältnisse der Massen in der Türkei so zu verbessern, daß sie daheim ein Auskommen finden, ist definitiv ausgeschlossen. Einen irgendwie gearteten Sachzwang zur Förderung der türkischen Nationalökonomie oder Subventionierung des dortigen Staatshaushalts will man sich nicht ins europäische Haus holen. Freilich ist es nicht so, daß die beklagten „Mißstände“ – also die „strukturellen Ungleichgewichte“, das „Übergewicht der Landwirtschaft“, die „mangelhafte Infrastruktur“, die „überhöhte Staatsverschuldung“ samt Inflation etc. etc. – ein Privileg des türkischen Beitrittsaspiranten im Unterschied etwa zu den Ungarn oder Esten wäre. Aber in diesem Falle markiert schon die Dimension einen Unterschied, der gegen das Land spricht:
„Insbesondere muß vom ökonomischen Standpunkt aus die in weiten Gebieten herrschende Unterentwicklung überwunden werden, vor allem müssen Fortschritte bei der Sicherung der finanziellen Stabilität im Hinblick auf Inflation, innere Verschuldung und Reform des Steuerwesens erzielt werden. Damit sind die Einwände noch nicht zu Ende. In Anbetracht der Größe der Türkei und der Bevölkerungszahl ist es keine reelle Herangehensweise, die Bedeutung dieser Probleme mit den Problemen der kleinen Staaten zu vergleichen, die auf eine Aufnahme in die Europäische Union warten.“ (ders., Hürriyet, 24.12.96)
Die türkischen „Probleme“ sind also für den Staatskredit des europäischen Kapitalismus, der eine harte Konkurrenzwährung gegen den Dollar begründen soll, nicht zu bewältigen – für die „unterentwickelte“ Türkei aber wird ihre Lösung zum Imperativ gemacht: Sie soll sich selber helfen, ihre „selbstverschuldeten“ Hindernisse für eine eventuelle Integration in Europa aus dem Weg räumen!
Zum Beispiel ein „wirtschaftliches Aufbauprogramm“ für den durch Krieg und verbrannte Erde verwüsteten Südosten des Landes auflegen, das den Kurden wieder eine Heimstatt bieten würde statt Gründe zur Flucht übers Mittelmeer. Auch wenn dieses Projekt den berühmten „Analysten“ zufolge mindestens soviel kostet wie bis dato der Krieg gegen die Kurden, der 150 Milliarden DM „verzehrte“. Und dabei – nicht vergessen! – die unproduktiven Staatsausgaben zurückfahren, um die 100%ige Inflationsrate zu drücken…
Im Gegensatz zu den Staaten Mittelosteuropas kommt für die Türkei eine politische Öffnungsklausel nicht in Betracht: Während jene trotz Nichterfüllung des wirtschaftlichen Kriterienkatalogs im Interesse einer unwiderruflichen politisch-strategischen Eingemeindung des bisher feindlichen östlichen Vorfelds für den erwünschten Beitritt präpariert werden, gelten für die Türken zwar im Prinzip dieselben Forderungen der Europatauglichkeit, deren Umsetzung ist aber – selbst im Falle des Erfolges – mit keinerlei Aufnahmegarantie verbunden. Die Konsolidierungsimperative an die Türkei dienen folglich der Erhaltung und, wenn möglich, dem Ausbau der geschäftlichen Benutzbarkeit des Landes, die bereits hergestellt ist. Seiner Funktion als „Riesenmarkt“, auf dem sich derzeit angeblich „644 deutsche Firmen“ tummeln und die europäischen Großkonzerne „mit Jahresumsätzen von z.T. mehr als 1 Mrd. DM vor Ort“ präsent sind, soll es gerecht werden; mit der Zollunion mehr als bisher. Das erste Jahr nach deren Inkrafttreten vergrößerte sich das türkische Handelsbilanzdefizit um 10 Mrd. DM, trug also umgekehrt entsprechend zur positiven Bilanzentwicklung des EU-Kapitalstandortes bei. Der Standort Türkei soll ferner, wenn möglich ebenfalls mehr als bisher, als „Sprungbrett“ für die Erschließung asiatischer und nahöstlicher Märkte dienen, wofür sich „türkische Tochterfirmen“ und „niedrige Lohnkosten (ein Sechstel bis ein Siebentel des Niveaus von Westeuropa)“ sehr gut eignen.(SZ 26.8.97) Die Sonderstrategie der Union für die Türkei geht davon aus, daß dieser Nation wegen der bereits hergestellten Abhängigkeit von eurokapitalistischer Bewirtschaftung nichts anderes übrig bleibt, als die designierten Funktionen als ihre Chancen zu begreifen – auch ohne daß man ihr „dafür“ Mitgliederrechte zubilligen müßte.
Dieses Kalkül schließt natürlich nicht aus, daß in der Hauptstadt der Union hier und da mal eine Finanzspritze locker gemacht oder ein Fonds geöffnet wird. Vor allem dann, wenn man es für nötig hält, auf diese Weise das eigene politische Interesse am „europäischen Kurs“ der Türkei zu demonstrieren. Zumindest würde man mehrheitlich gerne wie versprochen den vereinbarten „finanziellen Ausgleich“ für die türkischen Einbußen infolge der Zollunion leisten, wenn die Griechen ihn nicht leider blockieren würden. Immerhin hat man Ankara die per Saldo so einträgliche Zollunion „trotz großer Bedenken“ doch noch „gewährt“, und zwar genau eine Woche vor den türkischen Parlamentswahlen 1995, von denen die falsche – islamische – Partei zu profitieren drohte. Die gewann dann die Mehrheit – ob trotzdem oder deswegen, weiß nur Allah.
2.
Die EU begrüßt die Bereitschaft der Türkei, ihr wertvolle Dienste bei der Erschließung neuer politischer Einflußfelder zu leisten. Dementsprechend betonen die Verantwortlichen immer wieder, daß die nationale Perspektive des abservierten Kandidaten nur „Europa“ sein kann. Sie verfolgen mit ihrer systematischen Ausweitungsoffensive ja tatsächlich den vordringlichen Zweck, die politische Hegemonie über den gesamten Kontinent zu erlangen und zu institutionalisieren, um das imperialistische Gewicht ihrer Nationen in der internationalen Machtkonkurrenz maßgeblich zu steigern. Dabei ist das „Land zwischen Orient und Okzident“ wegen seiner herausragenden geostrategischen Lage – und ungeachtet seines unchristlichen Glaubensbekenntnisses – fest eingeplant: als „Brückenfunktion“, d.h. Einfallstor und sichere Geschäftsverbindung zu den nationalisierten Zerfallsprodukten der Sowjetunion im Kaukasus und rund um das ölreiche Gebiet des Kaspischen Meeres sowie zum Nahen und Mittleren Osten, wie auch als militärisch-politischer „Brückenkopf“ inmitten alter und neuer Krisengebiete. Eine Beförderung dieses wertvollen Partners zum Mitglied der Union ist gleichwohl abgelehnt worden. Die EU will ihre Ordnung erstens nicht mit einem instabilen Staatswesen belasten, dessen Herrschaft sich unfähig zeigt, mit seinen nationalistisch und religiös motivierten Gegnern fertig zu werden. Sie stört sich zweitens an der Intransigenz, mit der die Türkei auf ihrer Art der Kurden- und Oppositionsbekämpfung besteht. Und drittens sieht sie in der grenzüberschreitenden „Machtpolitik“ der Türkei Zielsetzungen am Werk, die den Maßstäben und Kalkulationen ihrer großangelegten Ordnungspolitik zuwiderlaufen und deshalb disfunktionale Konflikte – im Fall von Griechenland und Zypern sogar in die EU hinein – heraufbeschwören. Der durchaus potente Nationalismus dieses Staates ist nicht nur im Inneren zu ungefestigt, sondern auch zu autonom, zu mächtig, eben zu eigenmächtig, als daß er von der Politischen Union, wie sie nun mal verfaßt ist, zu beherrschen wäre. Auch in strategisch-politischer Hinsicht spricht also derselbe Grund, aus dem heraus die Türkei kategorisch das Recht auf Mitentscheidung einklagt – ihr subimperialistisches Programm nämlich –, in den Augen des EU-Rats dafür, sie zur Hälfte draußen zu lassen.
Auf der nach unten offenen Skala der politischen Argumente, mit denen Politiker einen EU-Beitritt der Türkei abzulehnen pflegen, rangiert der Vorwurf von „Verstößen gegen Demokratie und Menschenrechte“ an oberster Stelle. In der Mitte letzten Jahres herausgegebenen offiziellen „Agenda 2000“ der EU ist diese Kritik so dokumentiert:
„Obwohl die Notwendigkeit von Verbesserungen anerkannt wird und in letzter Zeit bestimmte Rechtsvorschriften geändert wurden, bleibt die Türkei doch bislang bei der Wahrung der Persönlichkeitsrechte und des Rechts auf freie Meinungsäußerung deutlich hinter dem Standard der EU zurück. Bei der Bekämpfung des Terrorismus im Südosten des Landes muß die Türkei größere Zurückhaltung üben, sich stärker bemühen, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu achten und eine politische anstelle einer militärischen Lösung zu finden. Obgleich die Regierung wiederholt offiziell zugesagt hat, derartigen Praktiken ein Ende zu setzen, gibt es nach wie vor Fälle von Folter, spurlosem Verschwinden und außergerichtlichen Hinrichtungen, die Zweifel daran aufkommen lassen, inwieweit die Regierung in der Lage ist, diese Aktivitäten der Sicherheitskräfte zu überwachen und zu kontrollieren. Die jüngsten Entwicklungen in Verwaltung und Bildungswesen sollten zwar die säkularistische Ausrichtung des Staates stärken, machen aber dennoch die besondere Rolle des Militärs in der türkischen Gesellschaft deutlich. Der Nationale Sicherheitsrat spielt nach der Verfassung … eine besondere Rolle, und der Ministerrat hat seinen Beschlüssen Vorrang einzuräumen. Die türkische Verfassung weist Widersprüche im Zusammenhang mit der politischen Kontrolle des Militärs durch Zivilbehörden auf.“ (Kommissionsbericht zur Erweiterung der EU Agenda 2000, S.80f)
Diese Art der Be- bzw. Verurteilung des türkischen Staates besticht zunächst durch ihre durchgängige Doppelbödigkeit. Auf der einen Seite soll die Türkei den „Terrorismus“ des kurdischen Separatismus natürlich bekämpfen (dürfen). Auf der anderen Seite soll sie keine Gewalt anwenden, sondern menschenrechtlich-zurückhaltend nach politischen Lösungen suchen. Und dasselbe noch einmal: Auf der einen Seite soll die Regierung selbstredend die „säkularistische“, sprich anti-islamische Staatsausrichtung gegen die Opposition durchsetzen (dürfen). Auf der anderen Seite soll das Militär, welches ganz in diesem Sinne gegen die an die Regierung gelangte Wohlfahrts-Partei und sonstige Dissidenten Front macht, daran gehindert werden, das letzte Wort zu behalten – also auf Erbakans parlamentarisch-zivile Mehrheit hören?
Diese „Widersprüche“ weisen auf einen zugegebenermaßen etwas komplizierten Standpunkt der Begutachterkommission hin. Die EU kann und will dem Ziel der gewaltsamen Behauptung des prowestlichen Gewaltmonopols bis an die südöstlichen Landesgrenzen ihre Anerkennung nicht versagen. So bleibt der Partnerstaat schließlich bündnisfähig. Gleichzeitig wird sie kritisch in bezug auf die Methoden der staatlichen Selbstbehauptung. Diese Kritik kommt im Gewande überlegener Moral daher, suggeriert Unvereinbarkeit wegen Abweichung von den hohen Normen der Menschlichkeit, wie „wir“ sie pflegen. Die Heuchelei solcher Selbstgefälligkeit bedarf keiner großen Entlarvung. Jeder weiß, daß dieselben Türken in unserer „Wertegemeinschaft“ namens NATO durchaus willkommen sind. Bemerkenswerter ist schon die Unverfrorenheit, mit der nahegelegt wird, die – erwünschte! – Ausschaltung des Terrorismus und islamischen Fundamentalismus sei ohne Gewalt zu erledigen, und zwar auch noch mit größerem Erfolg. Dennoch löst sich die Anprangerung undemokratischer Methoden nicht einfach darin auf, daß die EU sich an der mangelnden Geltung des staatlichen Gewaltmonopols stört. Klar: Die „Instabilität“ der inneren Ordnung ist eine Schranke für die Übernahme strategischer Funktionen durch die Türkei – wie den sicheren Transfer von Öl und Gas in die Euro-Metropolen – und ein ernstgemeinter Einwand gegen die Integration dieses „Unsicherheitsfaktors“ in die Union. Darüber hinaus aber wirft die Unbeirrtheit, mit der die NATO- und europaorientierten Politiker und Generäle an der kompromißlosen Durchsetzung ihrer Staatsräson festhalten, bei den EU-Verantwortlichen Zweifel an der Linientreue dieses Partners auf.
Das ist nur auf den ersten Blick paradox. Eines zeigt sich an der „Unbelehrbarkeit“ der „türkischen Machthaber“ nämlich schon: daß diese sich nicht als Erfüllungsgehilfen auswärtiger Anweisungen verstehen. Umgekehrt läßt der beharrliche Vorwurf an die Adresse der Türkei, sie weiche von unserer rechtsstaatlichen Verfassungsordnung und unseren demokratischen Standards ab, sei also (noch) ein bißchen diktatorisch, erkennen, daß es genau das ist, was die EU von ihren neuen Mitgliedern erwartet: die Bereitschaft, die Diktate und Interessen der europäischen Führungsnationen zum Inhalt ihrer nationalen Politik zu machen. Es ist also die Eigenständigkeit des türkischen Nationalismus, der seine Machtansprüche behauptet und seine Mittel auf eigene Rechnung einsetzt, die in der Kritik an zuviel türkischem Gewaltgebrauch attackiert wird.
Die Türkei, die sich als historische Erbin des Osmanischen Reiches versteht, ist nicht nur ein großes und bevölkerungsreiches Land, sondern auch ein – durch die NATO und außerdem durch Sonderbeziehungen zu den USA potent gemachter – Machtfaktor in einer strategisch bedeutsamen Region. Das macht sie einerseits interessant und brauchbar, andererseits dank der Fähigkeit zu selbständiger Interessenpolitik auch zu einem „schwierigen Partner“. Der offensive, auf seine Souveränität und neue Machtquellen setzende türkische Nationalismus ist nicht einfach ein Angebot an den sich konstituierenden EU-Imperialismus, sondern er kommt dessen Bedürfnissen und Ordnungsvorstellungen auch in die Quere. Das zeigt sich ein wenig bei der neuen Ostpolitik, welche unter dem Titel eines wiedererwachten Pantürkismus vonstatten geht und nicht nur Rußland mit seinen „natürlichen“ Vormachtambitionen über die ehemaligen Sowjetrepubliken provoziert, sondern auch parteilich hineinstößt in Kriegs- und Krisenfronten – wie im Falle Aserbeidschan contra Armenien, einen türkischen Erbfeind.[3] Das galt von vornherein in der latenten Gefahr eines unautorisierten türkischen Engagements im bosnischen Krieg zugunsten der muslimischen Glaubensfreunde. Das zeigt sich noch mehr an den grenzüberschreitenden Aufmärschen im Nordirak, wo sich für die EU die Frage stellt, ob die türkische Armee vielleicht dort bleiben will und so auf Dauer ein zusätzlicher Unruheherd entsteht, der neue Kräfteverhältnisse und Koalitionen in der nah- und mittelöstlichen Weltgegend heraufbeschwört und neue „Flüchtlingswellen“ gegen die Schengener Festungsgrenzen spült. Und das wird vor allem deutlich in den jederzeit für einen Krieg guten Souveränitätskonflikten mit dem NATO-Partner und EU-Mitglied Griechenland. Die EU nimmt wahr, daß die Türkei die Bündnissolidarität keineswegs als obersten Wert und hinreichenden Einigungsgrund betrachtet – was analog auch für Griechenland gilt und für die Führungsnationen erst recht! –, sondern sich als die legitime Ordnungsmacht im östlichen Mittelmeer in Szene setzen will, nicht zuletzt durch einen militärischen Pakt mit Israel. Und sie sieht sich außerstande, die Türkei zur Unterordnung unter eine von ihr dekretierte Aufteilung der Rechte und Zuständigkeiten zu zwingen. Schon eher sieht sie sich imstande, dem so definierten „Expansionismus“ der Türkei durch die Stärkung der griechischen Position Grenzen zu setzen – was mit der beabsichtigten Aufnahme Zyperns passiert. Ob diese Strategie wirklich, wie die EU-Diplomatie hofft, als erpresserischer „Anreiz“ für die Türkei funktioniert, der anvisierten „politischen Regelung“ unvereinbarer nationaler Rechtsansprüche auf diese und andere Inseln konstruktiver gegenüberzutreten, sei dahingestellt; sie unterstreicht jedoch, daß die EU die Nation am Bosporus für zu eigen-mächtig hält, als daß man sie durch die Verleihung gleicher Mitgliedsrechte in die Rolle eines politischen Auftragnehmers zwingen, also disziplinieren könnte. Ein Befund, den der deutsche Außenminister so ausdrückt:
„Die EU kann es sich nicht leisten, Länder aufzunehmen, die ungelöste territoriale und sonstige politische Probleme in die EU hineintragen würden.“ (Handelsblatt, 30.1.97)
Die – befürchtete – Aufwertung der Türkei durch Aufnahme in den Kreis der Mächte, die über die politischen Zielsetzungen „Europas“ mitentscheiden, scheidet deshalb aus. Eine Ermächtigung zur regionalen Ordnungsmacht mit autonomen Kompetenzen ist ebensowenig vorgesehen. Statt dessen steht ihre Einbindung, d.h. Ein- und Unterordnung als nützlicher Machtfaktor auf dem Programm. Denn eines ist den Zukunftsplanern in Berlin und Paris, die mittels der EU mehr „politische Verantwortung“ in der Welt zu übernehmen gedenken, schon klar: Die Perspektive, sich als eine echte Weltordnungsmacht aufzustellen, so abstrakt sie auch gemessen an der aktuellen Verfassung und den derzeitigen Mitteln der Union sein mag, schließt auf jeden Fall ein, sich der Loyalität und Dienstbarkeit eines so potenten Staates an einer für Europa entscheidenden geopolitischen „Nahtstelle“ zu versichern. Nach folgendem Motto:
„Für die künftige europäische Staatengemeinschaft ist es jedoch zwingend erforderlich, schon jetzt Konzeptionen für größere Gebiete zu entwickeln als nur für die ihr unmittelbar benachbarten. Dabei wird es auch darauf ankommen, eine neue Lasten- und Aufgabenverteilung innerhalb der NATO anzustreben. Die vielfältigen Handelsverbindungen, Energieversorgungsstränge und Verkehrswege zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil des Mittelmeerraumes sind unteilbar und liegen damit in ihrer Gänze innerhalb der europäischen Interessenssphäre. Die Türkei ist ein unverzichtbarer Eckpfeiler für ein notwendiges europäisches Engagement im ostwärtigen Mittelmeer.“ (Türkeiexperte Tappe, Europäische Sicherheit, 9/97, S.49)
Dementsprechend wurde die Türkei 1995 zum assoziierten Mitglied der Westeuropäischen Union (WEU) befördert, die einmal der „militärische Arm“ der europäischen „Verteidigungs- und Sicherheitsunion“ werden soll. Das Land mit seiner riesigen und kriegserprobten Armee gehört zwar nicht in die EU, soll aber nichtsdestotrotz den „Europäischen Pfeiler“ in der NATO stärken. Mit einer derartigen Statuszuweisung an die Türkei ist der Einstieg in die Vormachtskonkurrenz mit der NATO-Führungsnation auch an diesem Punkt eröffnet. Im Interesse der Sicherung des wichtigen „Brückenkopfes“, den die Eurostrategen nicht der Disposition des großen Bruders überlassen wollen, wurde sogar vorgeschlagen, die Türkei (sowie Norwegen und Island) – gleichberechtigt mit den Vollmitgliedern – an allen WEU-Entscheidungen (d.h. auch an der vorgeschriebenen Konsensbildung für einen Einsatz) zu beteiligen. Der Plan scheiterte wieder einmal am griechischen Widerstand, demonstriert aber die europäische Generallinie, der Türkei die EU-Mitgliedschaft zu verweigern, damit sie für die Dienste geradesteht, die man von ihr erwartet.
3.
Die Regierungschefs der EU sind sich sicher, daß ein Mitgliedstaat Türkei ihre herrschaftlichen und politökonomischen Bedürfnisse nicht wie gewünscht bedienen, sondern zwangsläufig mit-, also umdefinieren würde. Sie sind sich – bislang zumindest – darin einig geworden, daß sie eine derartige Veränderung der Union – d.h. auch: der aktuellen Hierarchie und Besitzstände ihrer Mitgliedstaaten – nicht akzeptieren wollen, treten der türkischen Bewerbung also als fertiger Block gegenüber. Genausowenig, wie die europäischen Führungsnationen sich ihre Richtlinienkompetenz durch die Integration osteuropäischer Staaten relativieren lassen – sie organisieren so deren Dienstbarkeit –, genausowenig geben sie dem Mitbestimmungsanspruch der Türkei recht. Diese Nation ist schließlich bereits ein brauchbarer Partner, und man verläßt sich darauf, daß sie es auch bleibt. In diesem Sinne brechen sie mit einer Konvention und schaffen einen neuen Modellfall für ihr „europäisches Haus“: Sie klopfen die Rolle eines assoziierten Partners als gültigen Dauerstatus fest. Ob die Strategie der Unterordnung durch Ausgrenzung aufgeht, ist eine andere Frage. Die EU baut dabei – außer auf politökonomische „Sachzwänge“ – auf die disziplinierende Funktion der NATO im allgemeinen und die Kontrollmacht der Amerikaner im besonderen, wohl wissend, daß das von den USA gepflegte Sonderverhältnis die Türken umgekehrt zu eigenmächtigen Initiativen ermuntern oder gar ermächtigen kann. Sie setzt darauf, daß es sich die Türkei nicht leisten kann und will, vom Mitsubjekt der militärischen Weltaufsichtsallianz zum potentiellen Objekt ihrer Ordnungsstiftung zu werden. Die in Brüssel, Berlin und Paris ansässigen Gegner der Militärdiktatur erwarten folglich, daß auch künftig die türkische Armee – über alle demokratisch-parlamentarischen Konstellationen und politischen Konjunkturen hinweg – die prowestliche Staatsräson des Landes verbürgt. Dabei sind es nicht zuletzt die Ergebnisse der EU-Politik, welche in der Türkei den Nährboden für nationalistische Unzufriedenheit abgeben. Die brüske Abweisung der türkischen Beschwerden über die europäischen Ausgrenzungsargumente, die angeblich in Ankara erfunden wurden, gehört dazu. An der gleichzeitig in Gang gesetzten Beschwichtigungsdiplomatie der EU-Außenminister wird jedoch deutlich, daß sich die Herren bewußt sind, daß die Türkei sich ihrer designierten Rolle sehr wohl widersetzen kann.
In den letzten Jahren ist das volkstümliche Argument immer mehr zu offiziellen Ehren gekommen, demzufolge ein EU-Beitritt der türkischen Gesellschaft einfach unmöglich ist, weil diese es mit Allah, dem Koran und dunklen Schleiern statt mit dem dreifaltigen Gott, der Bibel und den Blue Jeans hält. Der Parteikongreß der christlichen Internationale samt ihrem deutschen Bundeskanzler haben so votiert, und Kronprinz Schäuble betonte gern die Nicht-Zugehörigkeit der Türkei zu unserem christlich-abendländischen Kulturkreis. So wenig es stimmt, daß ein türkischer Staatsbürger einfach kein „guter“ deutscher oder europäischer Untertan werden kann – diese Vorstellung wurde hierzulande tausendfach praktisch widerlegt (was beileibe kein Kompliment sein soll!) –, so bezeichnend ist der kategorische Hinweis auf den „nicht zu leugnenden Unterschied“ in Religion und Sitten. Er faßt nämlich alle politischen und ökonomischen Vorbehalte gegen eine EU-Mitgliedschaft der Türkei in dem Verdikt der „Andersartigkeit“ zusammen und fügt ihnen einen weiteren, und zwar absoluten Vorbehalt hinzu. Die Konstruktion einer „Europa“ definierenden, nationenübergreifenden staatsmoralischen Identität, zu welcher die türkische Nation infolge ihrer rückständigen völkisch-sittlichen Natur einfach nicht paßt, ratifiziert die Unvereinbarkeit der europäischen und türkischen Staatsinteressen in einer Weise, die endgültig nicht mehr zu widerlegen ist.
Es ist zweifellos wahr, daß sich die Türkei aus diplomatischer Berechnung besonders gerne auf diese geistig-moralische Ausgrenzung bezieht, um den willkürlichen und diskriminierenden Charakter der EU-Beschlußlage an den Pranger zu stellen. Umgekehrt besticht die Reaktion des Kanzlers auf die Beschwerden aus Ankara durch die Dreistigkeit, mit der schlicht dementiert wird, solche Argumente jemals in den Mund genommen zu haben. Yilmaz’ Vorwurf vom „Christen-Club“ sei „abwegig“, „falsch und macht keinen Sinn“, was er schon daran sehen könne, daß „die uneingeschränkte Religionsfreiheit für die muslimischen Gemeinden in Deutschland das Gegenteil zeige“ (FAZ 20.12.97).
Mehr noch. Mit zur Schau gestellter Empörung über die „bösartige Unterstellung“ wird konstatiert, die Türken wollten offenbar von ihren selbstverschuldeten Problemen als den „einzig wahren Gründen ablenken“ (Lamers/CDU, ebd.). Was nur als Beleg für fehlende Einsicht zu werten sei – womit der Urteilsspruch über die Unreife des Landes für einen Beitritt in die europäische Solidargemeinschaft unfreiwillig bestätigt wäre! Daß die Regierung Yilmaz sich der für die Nation vorgesehenen Perspektive widersetzt und unter Androhung von Konsequenzen auf Revision des Ablehnungsbescheids dringt, beweist den EU-Verantwortlichen nur, wie sehr ein Mitglied Türkei die etablierte Rangordnung und damit die von ihnen beanspruchten Entscheidungskompetenzen innerhalb der Union durcheinanderbringen würde. Die Zuweisung eines externen Teilnehmerstatus ist nötig, um den Zweck der anstehenden „Erweiterungsrunden“ – die strategische Unterordnung weiterer Länder unter ihre exklusive Macht und Zuständigkeit – nicht zu gefährden. Die herabsetzenden und schulmeisterlichen Töne eines Kinkel im Anschluß an die türkische Ankündigung, den Aufnahmeantrag nunmehr zurückzuziehen –
„Diese emotionale Reaktion haben wir nicht erwartet.“ „Die türkische Regierung sollte sich die Sache nochmal in Ruhe überlegen. Ich bin sicher, das darf und wird nicht die letzte Antwort sein.“ (SZ 16. und 22.12.97 und TV)
– unterstreichen eindrucksvoll den Standpunkt, dem sich der Umgang mit der Türkei verdankt: Die Regierung soll sich gefälligst klarmachen, wer die Maßstäbe der Kooperation setzt und wer sich ihnen anzubequemen hat. Die Europa-Macher setzen offenbar darauf, daß diesem Staat letztlich gar keine andere Alternative bleibt, als auf die Linie ihres „Angebots“ einzuschwenken, mit dem die dauerhafte Assoziation, also der Anschluß des Landes an den sich formierenden Euroimperialismus institutionalisiert werden soll. Dabei unterstellen sie, daß die NATO weiterhin als die Klammer wirkt, die die Türkei von islamistischen oder sonstigen Abenteuern abhält. Und sie zählen geradezu auf die Kontinuität der „politischen Rolle“ des türkischen Militärs, das als Garant der prowestlichen Staatsräson allen Unkenrufen zum Trotz seine demokratische Qualifikation doch wohl (immer schon) eindruckvoll bewiesen hat, oder?
„Der nationale Sicherheitsrat der Türkei konnte den Islamisierungsbestrebungen der vorherigen Regierung (Erbakan) Einhalt gebieten. Dies (!) zeigt die Einbindung des türkischen Islamismus in das parlamentarische System, was ihn (!) von gleichartigen Bewegungen in anderen Ländern unterscheidet. Das türkische Militär, für das Vorgehen gegen die Kurden im Südosten des Landes von westlichen Medien kritisiert, erweist sich (!) hierbei als ein demokratischer Faktor, der den offenen oder schleichenden Versuchen, die laizistische Verfassung zu unterminieren, entschlossen gegenübertritt. Eine abrupte Kehrtwendung ist nicht zu erwarten, wenn auch das bislang unangefochtene Konzept der Westorientierung in der Türkei stärker hinterfragt wird.“ (Tappe, Europäische Sicherheit 9/97, S.49f)
Schön gesagt. Dennoch hat das Assoziationsmodell der EU, welches das NATO-Mitglied Türkei zu einem EU-Vasallen machen will, einen Haken. Die definitive Zurücksetzung des Dauerkandidaten schafft nämlich erst recht den Nährboden jener Unzufriedenheit, die zur „Hinterfragung“ der Westorientierung führt. Wer dem türkischen Nationalismus keine zufriedenstellende Erfolgsperspektive bietet, der stellt damit auch die Zuverlässigkeit des NATO-Partners in Frage. Diese Gewißheit ist es wiederum, welche die Führungsmacht des Atlantischen Militärbündnisses auf den Plan ruft: Sie warnt vor diskriminierender Ausgrenzung eines strategisch wichtigen Verbündeten. Die USA sehen in der EU nämlich umgekehrt einen polit-ökonomischen Unterbau für das Funktionieren der NATO, in der sie das Kommando führen. Folglich müssen sich die Europäer wehren gegen eine unerwünschte Einmischung des großen Bruders in ihre „inneren Angelegenheiten“. Der fordert nicht nur warnend die feste Verankerung des türkischen Eckpfeilers im europäischen Haus.[4]
Die USA sind auch praktisch engagiert – u.a. als Krisenmanager mit UNO-Vollmacht im Zypern-Konflikt.[5] Während die EU in der amerikanischen „Vermittlung“ ein Instrument sieht, die Türkei zur friedlichen Hinnahme des beabsichtigten Inselanschlusses zu bewegen, wollen die Amerikaner ihre unverzichtbare Rolle zur Verhinderung eines heißen Kriegs zwischen zwei NATO-Partnern dazu nutzen, um der EU eins ihrer entscheidenden Argumente gegen die Mitgliedschaft der Türkei aus der Hand zu schlagen:
„Holbrooke sagte, daß es ein Fehler der EU wäre, die Initiativen, die die USA und die UN hinsichtlich Zyperns begonnen haben, zu unterschätzen… ‚Als USA unterstützen wir die Bemühungen der UN… Wir sind keine Zuschauer des Geschehens. Wir sind entschlossen, den NATO-Mitgliedern Türkei und Griechenland zu helfen.
Die EU denkt darüber anders, aber wir als USA glauben, daß die Türkei als europäisches Land angesehen werden muß. Die Mitgliedschaft Zyperns wird unserer Meinung nach bei der Lösung des Problems eine große Rolle spielen. Diese beiden Sachverhalte hängen eng miteinander zusammen. Die EU muß sich bewußt sein, daß die USA und die UN Initiativen gestartet haben, um die Zypernfrage zu lösen. Andernfalls macht sie einen großen Fehler.‘“ (Hürriyet 16.7.97)
So gesehen ist die Mahnung von Herrn Kinkel, „die USA sollen nicht für die Türkei Druck machen“ (Hürriyet, 30.6.97), ein frommer Wunsch. Am Fall der Türkei zeigt sich vielmehr ein kleiner Widerspruch, den die EU bei ihrem Projekt einer eigenständigen Ordnungsmacht nicht los wird. Sie begibt sich damit in Konkurrenz zur Weltmacht Nr.1 und ist gleichwohl – wie ihr Doppelcharakter als NATO-Subunternehmer offenbart – beim Aufbau und Ausbau ihrer Positionen als Zentralmacht über ganz Europa, samt „unserem“ Mittelmeer und angrenzenden Regionen, auf Rückendeckung und Aufbauhilfe der USA angewiesen. Die aktuellen Angebote zur Beschwichtigung Ankaras (z.B. die Einladung zu einer „Europäischen Konferenz“), welche die Türkei mit ihrer Einsortierung als drittklassiger Teilnehmer im Europäischen Block versöhnen wollen, richten sich deshalb genauso an die Adresse der Amerikaner.
[1] Die herrschende
Praxis der Assoziationsbeziehungen benachteiligt die
Partnerländer in zweifacher Weise: Restriktive
Handelspraktiken der EU schränken ihren Marktzugang bei
Industriewaren und landwirtschaftlichen Produkten ein
und versagen ihnen sol mögliche hohe Exporterlöse. Der
fehlende Zugang zu den EU-Strukturfonds sowie die
relativ geringen Finanzhilfen im Rahmen der Assoziation
belassen die Hauptlast des sich aus Freihandel und
Zollunion ergebenden wirtschaftlichen und sozialen
Strukturwandels auf den Schultern der Assoziierten.
(H. Kramer, Die
Assoziierungsabkommen der EU; Die Türkei und
Mittelosteuropa in einem Boot?, Eurokolleg
32/1995)
[2] Manch deutscher
Türkei-Experte findet die türkischen Beschwerden
verständlich, weil auch er die Politik mit einer Art
gerechtem Tausch verwechseln möchte: Die Türkei hat
sich erstens einseitig an den bestehenden an den
bestehenden Zolltarif der EU anzupassen und bleibt
zweitens als Nichtmitglied von einer effektiven
Beteiligung ausgeschlossen. Sie muß letztlich in jedem
Fall die in Brüssel beschlossenen Veränderungen – auch
jene vorübergehender Natur wie Anti-Dumpingmaßnahmen
usw. – übernehmen. Damit leistet (!) die Türkei einen
teilweisen Souveränitätsverlust, dem eigentlich keine
erkennbare politische Kompensation seitens der EU
gegenübersteht.
(ders.,
ebd.)
[3] Der europäische
Standpunkt sieht so aus: Die Mittel der Türkei
reichen in keinem Fall aus, das ehemals sowjetische
Zentralasien auch nur partiell zu organisieren…
Zentralasien ist kein Raum für türkische Expansion und
imperiale Spätbauten, wohl aber für eine konzertierte
europäische Aktion mit einer türkischen
Beteiligung.
(Der deutsche
Strategieexperte L. Rühl, Europa-Archiv 11/92,
S.294f)
[4] Der stellvertretende
US-Außenminister Talbott agitiert in diesem Sinne gegen
falsche Vorurteile: „Die Türkei muß ihren Platz in
Europa einnehmen. Die Länder der EU dürfen das nicht
behindern, sondern müssen das unterstützen…
Die Türkei war während des Kalten Krieges ein
Frontstaat gegen die Sowjetunion. Die Türkei hat heute
wegen ihrer Grenzen mit Irak, Iran und Syrien die
gleiche Wichtigkeit behalten. Deswegen ist eine starke,
erfolgreiche, laizistische, demokratische und in den
Westen vollständig integrierte Türkei für uns alle von
Vorteil. Die Türkei ist seit dem 16. Jahrhundert ein
Teil des europäischen Systems. Es ist richtig, daß ein
großer Teil der Türkei durch ein Stück Wasser von
Europa getrennt ist. Aber mit diesem Maßstab wäre auch
England völlig von Europa getrennt.“ (Hürriyet 8.5.97) Gekonnt ist auch die
Anspielung auf die dunkle Vergangenheit „gegenwärtiger
EU-Mitglieder“, die heute auf den fehlenden
Menschenrechten in der Türkei herumreiten: Die
Türkei macht gegenwärtig Wehen des Übergangs zur
Modernität durch, und das betrifft auch die Bereiche
Demokratie und Menschenrechte. Diese Bereiche bieten
zusammen mit den türkisch-griechischen Beziehungen
gerechtfertigte Gründe zur Besorgnis der EU. Diese
Schwierigkeiten bedeuten jedoch nicht, daß die Türkei
deshalb weniger europäisch ist. Genau genommen haben
viele gegenwärtige EU-Mitglieder in diesem Jahrhundert
noch viel schlimmere Traumata überwunden, um es milde
auszudrücken.
(ders. auf einer
Konferenz zwischen den USA und der EU am
28.5.97)
[5] Nachdem die Amerikaner 1996 bei einem türkisch-griechischen Streit um eine Ägäis-Insel in letzter Minute einen Übergang zum Krieg verhinderten, begann im vorigen Jahr der Clinton-Sonderbeauftrage Holbrooke mit einer diplomatischen Mission zur „Beilegung des Zypern-Konflikts“, wofür sich die USA gleich noch einen UNO-Auftrag erteilen ließen. Die erste Verhandlungsrunde brachte „keine Annäherung der gegensätzlichen Standpunkte“ zwischen den Vertretern des griechischen und des türkischen Teils der Insel. In diesem Frühjahr soll der politische Druck auf beide Parteien und ihre „Hintermänner“ in Athen und Ankara erhöht werden.