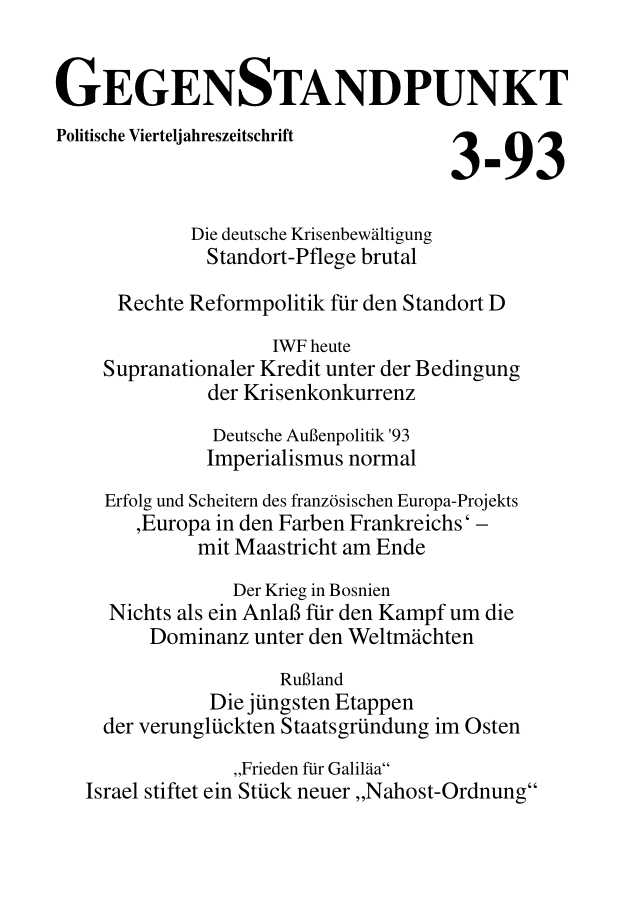Die Bergarbeiter aus Bischofferode
Hungern für einen Standort in Deutschland
Die BASF verschafft sich ein Monopol auf Kali, indem es mit Zustimmung und finanzieller Unterstützung des Staates das Werk in Bischofferode aufkauft und dichtmacht. Mit einer Absage ihrer Forderung an die Regierung konfrontiert, die Verträge für unwirksam zu erklären, wähnen sich die entlassenen Bergarbeiter als Opfer westdeutschen (Monopol-)Kapitals und einer verkehrten Standortpolitik und demonstrieren als Deutsche 2. Klasse mittels Betriebsbesetzung und Hungerstreik für das Recht auf ostdeutsche Gleichbehandlung im Standort Gesamtdeutschland. Der Staat erteilt ihnen und potenziellen Nachahmern eine ebenso demonstrative Absage wie die zuständige Gewerkschaft, die ihre westdeutsche Basis für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gegen die der ostdeutschen Kumpel aufmarschieren lässt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Der Fall: Kapitalistische Standortpflege führt zur Absage an einen Standort
- Die Fehldeutung des Falls: Eine alternative Auffassung von deutscher Standortpolitik
- Der Protest: Eine Demonstration ostdeutschen Rechtsbewußtseins
- Die Reaktion: Eine westliche Klarstellung übers „Zusammenwachsen“ im Standort Deutschland
- Die Folgen
Die Bergarbeiter aus
Bischofferode
Hungern für einen Standort in
Deutschland
Der Fall: Kapitalistische Standortpflege führt zur Absage an einen Standort
Die Kali und Salz AG, Tochterunternehmen der BASF, und ein bislang von der Treuhand verwaltetes ostdeutsches Kaliunternehmen haben von zwei Seiten das gleiche Kalivorkommen angegraben. Beide Konkurrenten haben damit erfolgreich Geschäft gemacht, auch international. Beim Verkauf des ostdeutschen Unternehmens erteilt der deutsche Staat in Gestalt seiner Treuhand der Kali und Salz AG gegen einen konkurrierenden Interessenten den Zuschlag. Die AG übernimmt das ostdeutsche Unternehmen mitsamt Grube, Arbeitern und Absatzbeziehungen, erhält von der Treuhand eine ansehnliche Barausstattung zusätzlich und die Zusage einer Verlustübernahme bis 1997 obendrein. Der Konzern BASF schätzt die Marktlage auf dem Kalisektor, die er nunmehr auch europaweit beherrscht, so ein, daß es sich für ihn mehr lohnt, das ostdeutsche Werk zu schließen und die Nachfrage im wesentlichen vom westdeutschen Standort aus zu bedienen. Das betrifft 700 Bergarbeiter in Bischofferode, die im Zuge der schon gelaufenen Rationalisierung des Werks von den mehreren tausend des ehemaligen Kombinats „Thomas Müntzer“ noch übriggeblieben sind.
An diesem ganzen Fall deutscher Standortpflege fällt bei nüchterner Betrachtung auf, daß alle an ihm Beteiligten ausschließlich dem Auftrag gerecht geworden sind, den Standort Deutschland für seine effektive kapitalistische Nutzung herzurichten:
Die Staatsbehörde Treuhand kommt ihrem Auftrag zur Privatisierung nach und verkauft das ostdeutsche Werk, und zwar an dasjenige kapitalistische Unternehmen, das das gewichtigste Interesse an diesem Werk geltend machen kann. „Sanieren“ oder auch „Erhalten“ sind nicht die Gesichtspunkte, denen sie sich dabei verpflichtet weiß, und sie verkauft auch nicht meistbietend, sondern ausdrücklich mit der Zwecksetzung, dem Käufer auf diesem Wege ein Monopol bei der Kaliproduktion in ganz Europa und darüber den Standort Deutschland zu sichern. Dafür stellt sie beträchtliche Mittel bereit, finanziert die zu erwartenden Verluste und sichert die geplante Erledigung der außer der geschluckten ostdeutschen AG noch verbleibenden Wettbewerber per Fusionsvertrag rechtlich ab.
Die Rechnung des kapitalistischen Unternehmens aus Westdeutschland gilt ab dem Moment, in dem ihm das Bergwerk gehört. Also kommt es seinem Auftrag zur produktiven und gewinnträchtigen Nutzung seiner Monopolstellung nach – und schließt das ostdeutsche Werk. Es läßt sich dabei ausschließlich von geschäftlichen Überlegungen leiten, legt die Gruben also nicht böswillig still, sondern ausdrücklich mit der Zwecksetzung, so mit dem Monopol auf Kali, das es nunmehr besitzt, zu verdienen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Mittelständler, der bloß sein Werk betreibt und mit dessen Erträgen steht und fällt, und einem Konzern, der Betriebe aufkauft, um den Markt zu beherrschen, also unter Umständen mit einem geringeren Angebot mehr Profit zu erzielen, weil kein Konkurrent ihm die Marktanteile streitig macht. Weshalb BASF seine Pflege des Kalimarkts an Bischofferode statt an Wernigerrode durchzieht, ist Privatsache des Konzerns, geht sonst niemanden etwas an, ist für den guten kapitalistischen Grund dieses Vorgehens egal. Für diesen ehrenwerten Zweck jedenfalls macht es von seinem Eigentumsrecht Gebrauch, schließt andere von der Benutzung der ostdeutschen Grube aus und entläßt die Arbeiter mangels weiterer lohnender Verwendbarkeit zum Jahresende.
Die deutschen Politiker sind mit der Fusion ihrem Auftrag bereits nachgekommen. Was ihnen noch bleibt, ist, den Erfolg bei der Standortsicherung zu begrüßen, den sie herbeigeführt haben. Nicht zynisch, sondern offen und ehrlich geben sie zu Protokoll, daß es die Wettbewerbslage der Nation insgesamt einfach nur verbessern kann, wenn ein deutscher „Chemiegigant“ vom Führer zum Beherrscher des europäischen Kalimarktes wird und auf dem nur noch einen (französischen) Konkurrenten vorfindet. Dafür haben sie von ihrer politischen Macht Gebrauch gemacht, den Standort im Westen auf Kosten desjenigen im Osten saniert und für die Freisetzung von Arbeitern gesorgt, deren weitere Verwendung sich genau wegen dieser Sanierung einfach nicht mehr lohnt.
Von einer Partei war im Zusammenhang mit diesem schönen Geschäft nicht die Rede, obwohl für sie dessen Folgen auch ziemlich gewichtig sind. Über die Arbeiter des ostdeutschen Kaliunternehmens wurde aber bei den Vereinbarungen, wem demnächst ihre Arbeitsplätze gehören sollen, von den drei beteiligten Parteien gleich mitentschieden, so daß es vollkommen in Ordnung geht, daß sie mit ihrem Interesse bei der ganzen Transaktion gar keine Rolle spielten. Das bezeugt nämlich überhaupt nicht ein mangelndes Interesse an ihnen, sondern – im Gegenteil – genau das Interesse, das kapitalistische Eigentümer von Arbeitsplätzen an ihnen haben: Sie werden gebraucht, entsprechend eingekauft und entlohnt, wenn sie mit ihrer Arbeit die Bilanz des Kapitals mit Profit vermehren; andernfalls also nicht.
Ein anderes, darüber hinausreichendes Interesse nimmt auch der Staat an ihnen nicht. Wenn ihnen aufgrund der Kalkulationen des Kapitals mit ihren Arbeitsplätzen auch ihre zukünftige Lebensgrundlage entzogen wird, sieht er sich jedenfalls nicht weiter zu kompensatorischen Rücksichten herausgefordert.
Die Fehldeutung des Falls: Eine alternative Auffassung von deutscher Standortpolitik
Nun haben sich allerdings die ostdeutschen Bergarbeiter nach Bekanntwerden des Umstands, daß sie für das Kaligeschäft des neuen Eigentümers überflüssig sind, als Partei zu Wort gemeldet. Sie, die sich die Massenentlassungen der letzten Jahre wohl mit dem Verweis auf unabdingbare Bemühungen um Rentabilität haben einleuchten und auch gefallen lassen, wollen sich jetzt, wo der Standort als ganzer aufgegeben werden soll, den Verlust ihrer Existenzgrundlage nicht bieten lassen und erheben dagegen Protest. Wie sie diesen jedoch sich und anderen begründen, macht deutlich, daß sie überhaupt nicht so recht wissen wollen, was in diesem Fall deutscher Standortpflege Sache ist. Stattdessen scheint anläßlich der Erfahrung, daß ihr frischer Einstieg in die Marktwirtschaft gleich mit einem gründlichen Ausstieg aus ihr beginnt, in ihren Köpfen eine schlechte Meinung über den Kapitalismus wiederbelebt worden zu sein, die sie in den alten SED-Zeiten ziemlich oft gehört hatten:
„Der staatsmonopolistische Kapitalismus ist unter Ausnutzung der wissenschaftlich-technischen Revolution und gestützt auf einen starken, hochorganisierten Produktionsmechanismus bestrebt, mit Hilfe des Staates alle Hilfsquellen im gesamtnationalen Maßstab zu mobilisieren, das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung zu beschleunigen (…), die Werktätigen dem Einfluß der monopolistischen Bourgeoisie zu unterwerfen (…). Wesentliche Merkmale des staatsmonopolistischen Kapitalismus sind die Verschmelzung der Macht der Monopole mit der Macht des imperialistischen Staates zu einem Gesamtmechanismus im Interesse des Profits, der Machterhaltung und -ausweitung sowie der äußeren Expansion des Monopolkapitals.“ (Kleines politisches Wörterbuch, Berlin (DDR) 1973, S.828 f.)
Geglaubt haben sie diesem moralischen Bild vom feindlichen System früher ja nie, demzufolge der bürgerliche Staat zwar effektiv, aber überhaupt nicht gut und fortschrittlich herrscht, das Kapital zwar effektiv, aber gar nicht zum öffentlichen Wohl wirkt und die Arbeiter zwar immer die angeschissenen, aber doch die einzig Guten sind. Aber jetzt, wo sie von dem System, zu dem sie übergelaufen sind und das ihnen auch so schöne Versprechungen gemacht hat, nicht mehr gebraucht werden, da fällt ihnen auch nichts Besseres ein als der Moralismus von der unverdienten Schlechtbehandlung der Werktätigen durchs Monopol – und in dem werden sie furchtbar radikal.
Ihnen ist überhaupt nicht entgangen, daß es die ökonomische Kalkulation des neuen Eigentümers der ostdeutschen Grube ist, die über deren nicht weiter lohnenden Weiterbetrieb befunden hat. Daß aber nichts weiter als diese Kalkulation eines für das Kapital rentablen Einsatzes von Arbeitskraft darüber entscheidet, ob nach ihrer Arbeitskraft nachgefragt wird oder nicht, wollen sie einfach nicht wahrhaben: Sie begründen ihre Forderung nach einem Weiterbetrieb der Kaligrube mit einer Kritik an der Geschäftsrechnung des neuen Grubeninhabers, indem sie dem „Mißmanagement und Fehlkalkulation“ vorwerfen. Ihrer Auffassung nach kann es unmöglich sein, daß marktwirtschaftliche Rechnungsweisen ganze Regionen wie ihr Kalirevier einfach abschreiben, also muß, da es abgeschrieben wird, höheren Ortes falsch gerechnet worden sein. Deswegen rechnen sie selbst dann laut vor, daß – von ihrem Verständnis von Marktwirtschaft aus gesehen – alles nur für den Weiterbetrieb ihrer Grube spricht: Ihre Löhne sind niedriger als die ihrer Kollegen im Westen, ihre Arbeitsleistung mindestens gleich hoch, ihre Grube arbeite sehr profitabel, und im übrigen könne auf die Qualität des Gebrauchswerts Kali, den sie lieferten, gar nicht verzichtet werden. In diesem Sinne bestehen sie auf Benutzung durch einen anständigen Kapitalisten. Aber „Gruben“ sind eben im Kapitalismus überhaupt nicht rentabel; auch nicht deshalb, weil es – obendrein noch „gutes“ – „Kali“ ist, was sich aus ihnen herausbuddeln läßt; auch „Arbeit“ – selbst zu den billigsten Preisen – ist nicht rentabel, sondern die einzige Rentabilität, die es gibt ist die des Kapitals selbst: Wenn sein Wachstum, der Saldo zwischen Kosten und Überschuß, stimmt, – und darüber, wann der stimmt, entscheidet niemand anderer als der Eigentümer – dann hat sich der Einkauf von Gruben und Arbeitskraft und der Verkauf von Kali gelohnt und war rentabel. Und die Folgen dieser Rentabilität könnten die ostdeutschen Bergarbeiter auch mit einem Blick nach Westen bequem mitbekommen: Die Massen, die da gerade aus laufenden Produktionen entlassen werden, sind die augenscheinlichen Zeugnisse davon, daß die Herstellung rentabler Arbeitsplätze über die Vernichtung von solchen geht, die sich nicht mehr rentieren. Aber die neuen Deutschen halten lieber stur an dem unverwüstlich guten Bild von der Marktwirtschaft fest, das man ihnen vorgelogen hat: Die Produktionsstätten des Kapitals halten sie für Gelegenheiten zur Produktion nützlicher Gebrauchswerte. Vom Profit des Kapitals haben sie die Anschauung, er sei gewissermaßen eine Begleiterscheinung, die dabei abfällt, wenn diese Gebrauchswerte effektiv produziert werden. Und den niedrigen Preis der Arbeit verwechseln sie ganz ernsthaft mit einer Eigentumsgarantie der Arbeitsplätze, auf denen sie so profitabel und effektiv werkeln – weil doch ohne Arbeit nichts Nützliches produziert werden kann. Mit letzterem mögen sie zwar recht haben, aber das beflügelt sie nur in dem falschen Bewußtsein, das sie über alles andere besitzen.
Den ostdeutschen Grubenarbeitern ist auch die Rolle nicht entgangen, die der Staat und die Treuhand beim Zustandekommen des Geschäfts gespielt haben, das sie ihre Arbeitsplätze kostet. Sie wissen schon, daß es das Interesse des Staates ist, das das Zurechtmachen des Standorts Deutschland so und nicht anders gebietet – aber wahrhaben wollen sie auch das nicht. Vom selben Staat, der an ihnen gerade exemplarisch statuiert, daß die „Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft Deutschlands“ (Rexrodt) keine Rücksichten auf die Existenzgrundlage derer kennt, die von Lohnarbeit leben, fordern sie Rücksichtnahme. Er soll Respekt haben davor, daß sie von Lohnarbeit leben müssen, er soll sich für die Rückgängigmachung des Vertrages verwenden und ihnen so ihre Lebensgrundlage erhalten. Offenbar halten sie den deutschen Staat für eine Instanz, die ihre Macht dafür gebrauchen soll, arbeitsamen Bürgern ein Auskommen zu sichern; die zur Verwirklichung eines von denen in Anspruch genommenen Rechts auf Arbeit natürlich auch und erst recht dann verpflichtet sei, wenn am Gebrauch der Arbeitskraft durch die Geschäftswelt kein Bedarf besteht. Also soll die westdeutsche Staatsgewalt sich darauf verwenden, ihnen gegen die Kalkulation dieser Geschäftswelt zu ihrem Recht zu verhelfen, mit einem bißchen Stamokap, bloß eben andersherum, gegen die bösen Monopole und für sie, die guten Arbeiter.
Obwohl überhaupt nichts für sie und ihre idealistische Interpretation der Lage spricht, rücken die ostdeutschen Bergleute von der nicht ab. Wo sie gerade brutal erwischt werden von den Sachzwängen, die in dieser Nation unter dem programmatischen Titel „Den Standort Deutschland sichern!“ von Staats wegen in Kraft gesetzt werden; wo keines der beteiligten Interessen irgendeinen Zweifel daran läßt, daß seine Durchsetzung auf ihre Kosten geht: Da werden sie überhaupt nicht zu Gegnern der politischen Ökonomie des Kapitalismus, die sie in ihrer ganzen Widerwärtigkeit erfahren. Sie wollen nicht glauben, daß sie die Arschlöcher dieses deutschen Standorts sind – und lassen von ihrer Vorstellung einfach nicht ab, dieses Deutschland könne doch unmöglich auf sie und ihr Kali verzichten. Die Schließung „ihrer“ Grube lassen sie deswegen nicht zu.
Der Protest: Eine Demonstration ostdeutschen Rechtsbewußtseins
Die verweigerte Einsicht in die banalen, aber eben wirklichen Zwecke der deutschen Standortpolitik im Fall Bischofferode und das sture Festhalten an der Vorstellung, diese Politik müsse gerade als Pflege eines deutschen Standorts alles für den Erhalt „ihrer“ Grube tun, hat sich im Bewußtsein der Bergleute zu einer harten moralischen Verurteilung der „Machenschaften“ höheren Orts verfestigt, denen sie zum Opfer fallen würden. Der einzige Grund nämlich, der ihnen dafür überhaupt noch einleuchten mag, daß in den Reihen von Wirtschaft und Staat keiner so recht ihren Vorstellungen von einer emsigen Kaligrube in Bischofferode folgt, ist der mangelnde Wille derer, die für deutsche Standortfragen zuständig sind: Sie wähnen sich als Opfer nicht des Projekts „Standort Deutschland“, sondern einer verkehrten Standortpolitik; sie machen nicht die nationale Rechnung selbst dafür haftbar, daß ihre Arbeitsplätze in Zukunft nicht mehr vorgesehen sind, sondern mutmaßen, daß da von Leuten falsch gerechnet worden ist; und zwar – das zeigt deren Unbelehrbarkeit ja nur – mit voller Absicht, denn in Wahrheit wollen sie nur den Westen der Republik auf Kosten des Ostens sanieren. Und mit diesem Ressentiment des ostdeutschen Bergmanns gegen eine westdeutsche Bilanzführung zum Nutzen des Kapitals machen sie den Fall Bischofferode ganz anders zu einer nationalen Frage: Sie kommen sich vor als die um ihre guten Rechte betrogenen deutschen Bürger zweiter Klasse und bauen sich in ihrem Protest stellvertretend für die schlechte Behandlung der ganzen östlichen Hälfte dieser Nation auf.
Dem Staat, der ihnen ihr hartnäckiges Festhalten an „ihrer“ Grube mit dem Zugeständnis abkaufen wollte, sie könnten sich – zeitlich befristet – auf „Ersatzarbeitsplätzen“ anderswo nützlich machen, erteilen sie eine Abfuhr – mit dem an sich gar nicht so verkehrten Argument, daß dann eben 700 andere Ostbürger anderswo ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Im übrigen aber entnehmen sie diesem staatlichen Angebot auch nur wieder, daß sie mit ihrem moralischen Urteil über den Wessi-Staat, der den Ostbürgern die Lebensgrundlagen nur immer entzieht, natürlich genau richtig liegen.
Über das westdeutsche Kapital, das sich in ihrer
Anschauung nur deshalb so bequem auf ihre Kosten saniert,
weil die ostdeutsche Arbeitskraft ihm
nichts gilt, macht dann ausgerechnet in ihren Reihen das
ideologische Fossil die Runde, mit dem die alte
SED-Staatspartei die BRD dereinst in höchstes moralisches
Unrecht zu setzen pflegte: Wie in den eingestampften
Lehrbüchern des Marxismus-Leninismus verhindert ein böser
Wille namens Monopolkapital
die freie Entfaltung
aller guten produktiven Kräfte – nur daß sich das eben im
neuen Deutschland nicht einmal mehr der Intention nach
als Kritik des Systems der kapitalistischen Ausbeutung
begreift. Vielmehr steht das „Monopol“, das ein
Verhandlungsführer der Bergleute bei Politikern in Bonn
getroffen haben will – „Nicht die Politik, sondern
Monopole regieren in Bonn“ –, allein noch für die
Vorstellung, daß die Würdigung eines rechtschaffenen
ostdeutschen Arbeitswillens im neuen Deutschland von
üblen Kräften hintertrieben wird. Dafür taugt die
Erinnerung an eine böse „Verschmelzung“ von
Staat und Wirtschaft und den unheilvoll wirkenden
„Gesamtmechanismus“ ganz gut, wie man beides
ziemlich lange über die BRD zu hören bekam.
Wie ernst sie es mit ihrem moralischen Verdikt über ihren neuen Staat und mit ihrer Auffassung meinen, von dem um ihre Rechte nur betrogen zu werden, demonstriert dann ein Teil von ihnen mit einem Hungerstreik. Nun ist dies kein Mittel, schon gleich keine Waffe, zugunsten des eigenen Interesses etwas erzwingen zu können, sondern im Gegenteil ein Dokument des eigenen Bewußtseins, daß man selbst über solche Mittel nicht verfügt und insoweit ohnmächtig ist. Im Recht mit dem eigenen Anliegen will man sich gleichwohl wissen, und zwar in einem Maße, daß man dieses Recht zur Frage der eigenen Existenz überhaupt macht und das Anliegen zum Anlaß degradiert, dessentwegen dem eigenen Rechtsgefühl Gehör geschenkt werden müsse: In der Androhung des freiwilligen Selbstverhungerns als Alternative zum Entzug der Lebensgrundlage „Arbeitsplatz“ wird die ganze Trostlosigkeit eines privat angemaßten Rechtsstandpunkts deutlich, der von der höheren Rechtsinstanz Staat bloß noch respektiert werden will – denn wenn ihm dieser Respekt versagt wird, will er gar nichts mehr.
Freilich knüpfen sich auch an diesen Fanatismus des Privatrechts noch Erwartungen. So berechnungslos der Standpunkt der absoluten Rechthaberei in Bezug auf das eigene Anliegen auch ist, berechnet ist er schon darauf, daß ihm Recht gegeben wird: In der ganzen Hoffnungslosigkeit ihres Entschlusses haben die hungerstreikenden Bergarbeiter schon irgendwo noch die Hoffnung, der Staat möge doch anders sein, als sie selbst es für sich wahrzumachen drohen; er möge sich doch nicht wirklich als die – „unmenschliche“ – Gewalt erweisen, die ihre Bürger lieber verhungern läßt, als ihnen Arbeit zu geben. Aber je länger ihre Verhungern dann dauert, weil sich der Staat, den sie mit ihrer Drohung beeindrucken wollen, überhaupt nicht beeindruckt zeigt, desto mehr verflüchtigt sich diese Hoffnung. Sie wird zur Gewißheit, daß es doch so ist, wie das verletzte Rechtsgefühl des ostdeutschen Bergmanns es schon immer gewußt haben will, und mit dieser Überzeugung, den Staat öffentlich in das Unrecht gesetzt zu haben, das er darstellt, mag er sich dann trösten. Wie wichtig er diesen Trost nimmt und als letzten Triumph des Rechts, für das er steht, gegen das Unrecht, das ihm seine Lebensgrundlage entzieht, auskostet, entscheidet dann darüber, wie weit er den Widerspruch seines Protestes treibt und wirklich lieber selbst verhungert, als sich vom Staat verhungern zu lassen.
Einstweilen wird noch von einigen weitergehungert, und daneben nach Bündnispartnern gesucht. Die sollen das moralische Recht der eigenen Sache bezeugen und von einem Gewicht sein, das – im Unterschied eben zu ihnen – den deutschen Staat zu beeindrucken verspricht: Der Papst z.B., aber auch ein Spruch der EG-Monopolkommission möchten da vielleicht das Wunder bewirken, dem ohnmächtigen Guten zu seinem Recht gegen die Macht des Bösen zu verhelfen.
So oder so, ob sie nun jetzt aufgeben oder später: Symbol eines ostdeutschen Selbstbewußtseins, das sich um all seine hohen Erwartungen an den neuen deutschen Staat betrogen wähnt; das sich weigert, dies einfach so hinzunehmen und das die Absage an den eigenen Glauben von der Güte des westdeutschen Staates zu einer existenziellen Frage macht, weil dieser Staat praktisch das Existieren fraglich macht – das sind die hungernden Bergarbeiter für die Bürger im Osten in jedem Fall. Und als dieses Symbol verstehen sie sich auch selbst, wenn sie gar nicht mehr allein für „ihre“ Kali-Grube, sondern gegen die „Unmenschlichkeit“ ihres neuen deutschen Staates und für alle entrechteten Bürger im Osten hungern.
Die Reaktion: Eine westliche Klarstellung übers „Zusammenwachsen“ im Standort Deutschland
Das hat man natürlich auch im Westen mitbekommen und entsprechend auf die Betriebsbesetzung und den Hungerstreik der Bergleute in Bischofferode reagiert – und natürlich nicht so, daß man Partei für die Protestierenden genommen hätte. Sicher gab es anfangs noch die Heucheleien, daß man die Empörung der „Kalikumpel“, der guten, schon nachempfinden könne, ihr Anliegen irgendwo schon auch verständlich sei. Aber auch da folgte schon der heute ausschließlich vorherrschende Tonfall hintendrein, daß Betriebsbesetzung und Hungerstreik doch in dem Fall, wo schon alles entschieden sei, ziemlich sinnlose Unterfangen wären. Ohne sich groß miteinander abzusprechen wußten nämlich alle an der deutschen Standortpflege maßgeblich beteiligten Instanzen im Westen sofort, daß ein Nachgeben in Bischofferode überhaupt nicht in Frage kommt: Den Protest mit Erfolg zu belohnen – das könnte ja glatt Schule machen, und zwar nicht nur bei den Bürgern im Osten, die sich ja allesamt ungefähr so entrechtet vorkommen wie die Bergleute in Bischofferode. Sondern auch die Kollegen im Westen könnten sich womöglich ein falsches Vorbild wählen, ein bißchen aufsässig werden und die massenhaften Entlassungen per Verweis auf Bischofferode damit kontern, daß sie doch gar nicht so unumgänglich seien, wie man es ihnen sagt. Inzwischen wird den Protestierenden von den Vertretern der demokratischen Öffentlichkeit im Westen auf deren Tour nur noch zu verstehen gegeben, daß sie endlich aufhören sollen, bevor wirklich der erste stirbt und die Sache ernsthaft peinlich wird: Man gibt bekannt, wieviele in Bischofferode noch weiterhungern.
An allem, was ihnen dann von westlicher Seite zu verstehen gegeben worden ist, haben die Bergarbeiter im Osten dann nochmals die Bestätigung des wirklichen Prinzips erfahren können, nach dem ihnen so übel mitgespielt wird.
Die Vertreter des Staates haben ihnen gegenüber ihren feststehenden Willen deutlich gemacht, die annektierte Ostzone als das zu behandeln, was sie ist: ein Teil des deutschen Standorts. Damit der sich als das bewährt, gehört er sich den Sachgesetzen ausgeliefert, die in diesem Standort gelten. Und wenn ihn die überlegene westliche Konkurrenz gleich flächenweise ruiniert, dann geht er eben an dieser westlichen Konkurrenz und daran zugrunde, daß der Staat ihr den Osten als Feld ihrer freien Betätigung überantwortet hat: So sortiert sich die Nation in einen schlechten Osten und einen besseren Westen. Diese Wahrheit gesagt haben die westlichen Politiker freilich nicht. Ausgerechnet sie, die mit ihrer Standort-Pflege die Verarmung ganzer Regionen betreiben, beaufsichtigen und die Folgen verwalten; und ausgerechnet da, wo allein ihr politischer Wille zum schlagkräftigen Standort Deutschland den Kalibergbau in Bischofferode erledigt: Da verstecken sie sich hinter einem großen Sachzwang namens „Marktwirtschaft“ und beteuern wie immer, als Politiker nur in besten Absichten unterwegs zu sein: „Unser gemeinsames und immer wieder betontes Ziel ist es, daß der Aufbau Ost rasch vorankommen muß, daß die Menschen vor Ort eine Lebensperspektive haben müssen“, und wenn wir letztere beim Kaputtsanieren etlichen nehmen müssen, dann läßt uns das überhaupt nicht kalt, sondern wir bedauern. Aber was sein muß, muß sein und wir machen es guten Gewissens, denn jeder von uns wegsanierte Arbeitsplatz ist ein einziger Dienst an allen anderen, die noch bleiben – was den übereinstimmenden Befund von Treuhand und Wirtschaftsministerium erklärt, gerade die Schließung der Kaligrube in Bischofferode sei ein „maßgeblicher Beitrag zur Sicherung der Kali-Arbeitsplätze in Ostdeutschland.“
Man muß den Bergleuten in Bischofferode das wenigstens zugutehalten, daß sie – anders als das gut erzogene westdeutsche Proletariat in vergleichbaren Fällen – auf diese Verlogenheit ihrer Politiker nicht hereingefallen sind. Statt dessen haben sie in ihrer Verbohrtheit an ihrem Verdacht, hier walte kein Sachzwang, sondern Absicht, weiter festgehalten – und sich erfrecht, zur öffentlichen Bestätigung ihres Verdachts „Einsicht in den Fusionsvertrag“ zu fordern. Schon war die nächste Klarstellung fällig: Der Frau Süßmuth, die noch vorgelassen wurde, bevor sich die Bergleute ihre eigene Verarschung vor Ort als „politisches Trittbrettfahrertum“ verbaten, ist allein schon wegen ihrer Andeutung einer leichten Möglichkeit, ihnen diese Einsicht zu gewähren, von ihrem Kanzler übers Maul gefahren worden. Und dies gar nicht einmal nur wegen der sicherlich nicht uninteressanten Offenlegung von Betriebsgeheimnissen aus der staatlichen Schmiedewerkstatt industrieller Monopole. Sondern weil es galt, den Einspruch der Bergleute umstandslos niederzubügeln und deshalb „jeden Eindruck zu vermeiden, als gäbe es zur Schließung der Kaligrube eine vorstellbare Alternative.“ (Der Kanzleramtsminister) Für genau diese wird vor Ort zwar gerade von einigen das Verhungern riskiert. Aber wo kämen wir da hin, wenn ein Beschluß des Staates bei seinen widerspenstigen Opfern noch in irgendeiner Weise für Einsicht werben müßte: „Man kann mit der Fusion nicht warten, bis jeder Kalikumpel den Vertrag gelesen hat.“ (Ein Mann der Wirtschaft) Ja, die Kalikumpel. Wer weiß, ob sie überhaupt lesen können.
Auch von den Vertretern der deutschen Bergarbeiterschaft, der mächtigen Gewerkschaft IGBE, ist den Protestierenden zu verstehen gegeben worden, daß die Nation gegenwärtig andere Sorgen hat als den Lebensunterhalt von 700 Bergleuten: Diese Gewerkschaft hat ja selbst die Erledigung des Standorts Bischofferode mitgetragen und als „Zukunftsinitiative zur Rettung der letzten 7500 Arbeitsplätze der deutschen Kali-Industrie“ hochleben lassen. Von ihr selbst kommen deshalb auch die veröffentlichten Aufrufe zum Abbruch der Proteste und des Hungerstreiks wg. Sinnlosigkeit, und sie hat auch die Demonstration der westdeutschen Bergleute initiiert, die dieselbe Grußbotschaft mit dem Verweis auf die hier gefährdeten Arbeitsplätze untermauerte. Als vorläufig letzte Konsequenz des schönen gewerkschaftlichen „Kampfes um Arbeitsplätze“ haben sich 2500 Arbeiter (West) mal kurz als Planer des Gesamtstandorts Deutschland aufgeführt und 700 Arbeitern (Ost) aus derselben Branche zu verstehen gegeben, daß ihr Arbeitsplatz natürlich nur auf Kosten derer „sicher“ ist und bleiben kann, die ihn gerade verloren haben, die also endlich die Schnauze halten und sich fügen sollen. Das gibt zwar nur die Rechnungsweise des Unternehmens wieder, dem hier zufällig die Arbeitsplätze in Ost- und Westdeutschland gehören. Aber das ist eben das Selbstbewußtsein der Arschlöcher des Standorts Deutschland, Abteilung West, im Unterschied zu denen von drüben: Auch diese großartigen Wessi-Kumpel sind mit ihren Arbeitsplätzen natürlich bloßes Anhängsel der Kalkulation des Betriebes, der sie beschäftigt, solange sich das für ihn lohnt. Aber sie werden eben noch beschäftigt, und das – so gut sind sie von ihrer Gewerkschaft erzogen worden – fassen sie als Vorrecht auf und verteidigen es gegenüber allen anderen, denen das knappe Gut „Arbeitsplatz“ versagt wird. Daher machen sie sich, wenn sie sich als Arbeiter zu Wort melden, gegen ihre arbeitslosen Kollegen zum Anwalt ihres Betriebes – und danken ihm so dafür, daß er sie noch beschäftigt.
Solches soll einer Gewerkschaft und ihrem „Kampf um sichere Arbeitsplätze“ auch im Osten Profil verleihen, und das tut es sicherlich. Nur eben anders als beabsichtigt. Mögen die Gründe, derentwegen die frustrierten Ostbürger der IGBE in Bischofferode Hausverbot erteilen, noch so verkehrt und national-psychologisch verseucht sein: Der Vorwurf, daß man in diesem Verein für Abwicklung der Standortfragen in Arbeitsdingen doch bloß dieselbe westliche Interessenspartei vor sich hat, die man schon in Politik und Wirtschaft zum eigenen Schaden genossen hat, ist überhaupt nicht abwegig.
Die Folgen
Der Protest der ostdeutschen Bergleute ist die einzige Form von Kritik und Widerstand, die die politischen Macher des Standorts Deutschland sich bislang von denen haben bieten lassen müssen, die von Honecker weg zu ihnen übergelaufen sind. Und diese Kritik ist auch insoweit grundsätzlich, als den Politikern das freie Verfügen über die Lebenslagen ihrer Untertanen bestritten und allen ihren verlogenen Bemühungen um Vertrauen eine Absage erteilt wird.
Das grundlegend Verkehrte dieser Kritik ist jedoch, daß sie die Politik des deutschen Staates gar nicht in dem Prinzip trifft, dem die gehorcht, sondern von ihr ein anderes Prinzip als Leitinstanz ihres Handelns verlangt: Beansprucht wird das Recht auf ostdeutsche Gleichbehandlung im Standort Gesamtdeutschland. Ein enttäuschter deutscher Nationalismus sucht sich gegen den amtierenden das Gehör zu verschaffen, das ihm vermeintlich gebührt, und will mit dem Verweis auf die von Staats wegen ruinierten Lebensperspektiven von so vielen im Osten der Republik bedeuten, daß überhaupt nicht zusammenwächst, was doch zusammengehört.
Insofern diesem enttäuschten Nationalismus die praktischen Anlässe auch außerhalb von Bischofferode demnächst so schnell nicht ausgehen werden, an denen er sein verkehrtes Ressentiment gegen die Wessi-Deutschen bestätigt finden kann, steht jetzt schon fest, daß sich die Spaltung der deutschen Volksgemeinschaft in die zwei Himmelsrichtungen um einiges verfestigen wird. Das bereitet westdeutschen Politikern, denen die Ruinierung der Lebensgrundlagen ihres völkischen Zuwachses im Osten herzlich gleichgültig ist, dann schon wieder Sorgen. Die nämlich, ob denn nicht alternative Nationalisten ihnen im Osten die Wahlstimmen wegnehmen, die ihnen gehören. Von dem Sternmarsch von rechts wollten die Bergmänner ihren Protest zwar jüngst nicht mißbrauchen lassen; aber immerhin haben sie statt dessen einen Gysi als den glaubwürdigen Vertreter ihrer ostdeutschen Rechte mit der Wahrnehmung derselben beauftragt. Und der steht mit seiner PDS für das gute Recht der Ostdeutschen auf Arbeit und gute Behandlung durch den Staat – in der Optik der hiesigen Regenten also genauso wie die Nationalisten von rechts für die Gefahr, daß ihr politisches Vertretungsmonopol für die Zone demnächst angekratzt werden könnte. Die Sorgen sind nicht unbegründet, denn der Protest, der sich da regt, ist gefundenes Fressen für jeden Nationalisten, der alternativ zu den Regierenden einen Dienst des Staates am Recht verspricht, das sich jetzt gerade verraten vorkommt.
Aus demselben Grund kommt auch keine Freude darüber auf, wenn den schwarz-rot-goldenen Gewerkschaften im Osten die Mitglieder davonlaufen. Ziemlich sicher laufen die nämlich nur wieder denen nach, die sich besser, als ein DGB dies tut, auf die Vertretung der Ehre der ostdeutschen Arbeitskraft verstehen. Und das hat schon wieder ganz viel mit dem Standort Deutschland, in praktischer Hinsicht also auch wieder mit dem Gegenteil von Wohlstand zu tun.