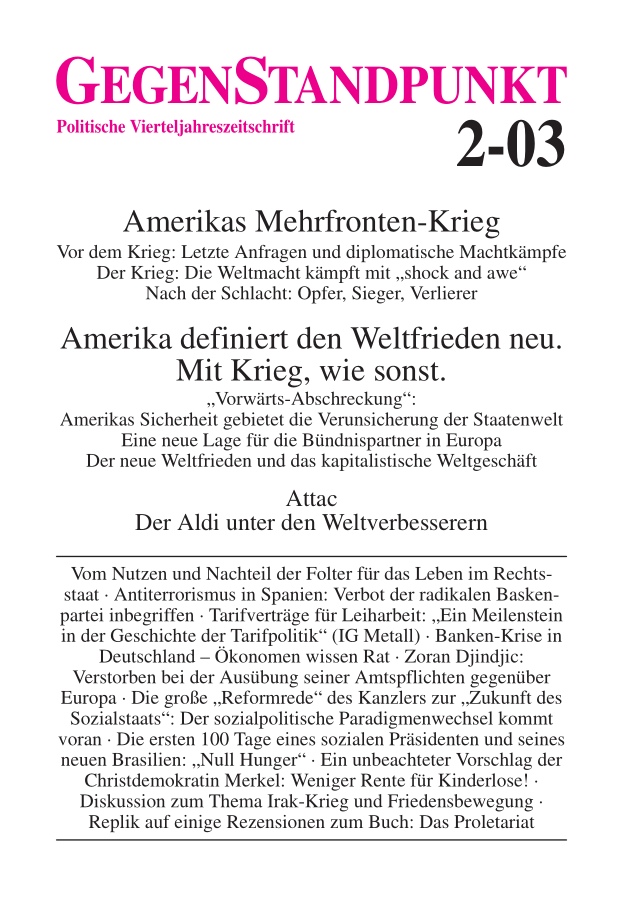Amerikas Mehrfronten-Krieg
Vor dem Irak-Krieg: Letzte Anfragen und diplomatische Machtkämpfe. Der Krieg: Die Weltmacht kämpft und argumentiert mit „shock and awe“. Nach der Schlacht: Opfer, Sieger, Verlierer und ein neu eröffneter Streit zwischen den einen und den anderen Aufbauhelfern.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- A. Vor dem Krieg: Letzte Anfragen und diplomatische Machtkämpfe
- Sorgen und letzte Fragen einer demokratischen Öffentlichkeit, bevor der Krieg – endlich – losgeht
- Absurd, aber logisch: Die Diplomatie hat ihre Vorkriegs-Konjunktur
- Form und Schein eines „Gewaltmonopols der UNO“
- Die „Staatenfamilie“ und ihr Völkerrecht: Nutzen und Ärgernis für die Weltmacht
- Eine Absage an die konventionelle UNO-Diplomatie: Amerikas neues sicherheitspolitisches Anspruchsniveau
- US-Diplomatie bis zum bitteren Ende: Ein ultimativer Tauglichkeitstest für die UNO
- Die Front der Kriegsdienstverweigerer: Ein diplomatisches Nein zu Amerikas Krieg ohne undiplomatisches Nein zu Amerika
- Der Kampf um Gefolgschaft und die Spaltung der Staatenwelt
- „Ende der Diplomatie“? Schön wär’s.
- B. Der Krieg: Die Weltmacht kämpft und argumentiert mit „shock and awe“[8]
- C. Nach der Schlacht: Opfer, Sieger, Verlierer und ein neu eröffneter Streit zwischen den einen und den anderen Aufbauhelfern
Amerikas Mehrfronten-Krieg
A. Vor dem Krieg: Letzte Anfragen und diplomatische Machtkämpfe
Die ebenso verlogene wie blöde Frage, „ob der Krieg nun kommt oder vielleicht noch zu verhindern ist“, hat Hochkonjunktur. Sie bildet den öffentlichen Abgesang auf die diplomatische Kampagne, mit der gewichtige Staaten ihre Rolle als Partner und Konkurrenten der USA, als Mitglieder von NATO und UNO geltend machen, um die Vereinigten Staaten von ihrem Kriegsprogramm abzubringen. Den zuständigen Regierungen ist im Verlauf dieser Kampagne in der Meinung aufgeregter Bürger der Ruf zugewachsen, „für Frieden und gegen Krieg“ zu sein – was sie nicht verdient haben. Immerhin ist ihnen kein Einwand gegen die lautstark propagierte „Notwendigkeit“ gekommen, den Gewaltapparat der irakischen Nation den Sicherheitsbedürfnissen auswärtiger Mächte entsprechend abzurüsten. Für diese Gewaltaktion hat ihnen allerdings ein anderer Veranstalter vorgeschwebt als „die einzige verbliebene Supermacht“, die das Thema überhaupt aufgebracht hat, die vollständige Vernichtung des inkriminierten Apparats einschließlich seiner Befehlshaber vorbereitet und ultimativ Zustimmung und Unterstützung einfordert. Die Amerika-kritischen Mächte pochen auf eine kollektive Rechtfertigung des Vorgehens gegen den Irak, bezweifeln bis zuletzt Notwendigkeit und Nutzen der geplanten und in die Wege geleiteten militärischen Großaktion – und erheben auf die Art Einspruch gegen den Kurs der USA. Die wiederum sind unbeirrbar entschlossen, ihre überlegenen militärischen Potenzen zu nutzen und die Staatenwelt noch ganz anders als bisher gemäß ihren Interessen zu „säubern“ und zu ordnen, zu disziplinieren, aufzumischen und zu kontrollieren. Solcher Selbst-Ermächtigung der Weltmacht treten die degradierten Konkurrenten, zusammen mit betroffenen Nationen anderen Typs, gewaltfrei entgegen. Sie bemühen das Völkerrecht und die Geschäftsordnung der UNO, um die Zulässigkeit des kriegerischen Aufbruchs der USA zu einer gründlich erneuerten „Weltordnung“ in Frage zu stellen – und handeln sich eine rücksichtslose Absage ein. Der Krieg „kommt“, beantwortet alle diesbezüglichen Erkundigungen und macht dem eskalierenden Zank der Diplomaten ein Ende. Fürs Erste jedenfalls. Denn die Opposition gegen das amerikanische Vorgehen ist damit keineswegs vorbei.
Sorgen und letzte Fragen einer demokratischen Öffentlichkeit, bevor der Krieg – endlich – losgeht
Die USA leiten alles Nötige in die Wege, um pünktlich zum Frühlingsbeginn ihren Irak-Feldzug starten zu können; und die demokratische Weltöffentlichkeit geht interessiert mit. Auch diesseits von Atlantik und Ärmelkanal, auch in der BRD, obwohl deutsche Truppen gar nicht mit von der Partie sind. Doch man weiß und fühlt sich betroffen. Es ist schließlich nicht irgendwer, der da Krieg führen will. Sondern Amerika, das schon vor Jahrzehnten die Freiheit Berlins in Vietnam verteidigt hat; die Führungsmacht, der zu folgen immer die halbe Staatsräson der deutschen Bundesrepublik ausgemacht hat; das Mutterland der Marktwirtschaft, dem man neulich noch für seinen „Kampf gegen den Terror“ nichts Geringeres als „unbedingte Solidarität“ versprochen hat. Einerseits spricht also alles dafür, dass es im Irak wieder einmal mit aller Gewalt um die „gemeinsame Sache“ des „Westens“ geht. Andererseits hat die amtierende Regierung den USA eine Absage erteilt; Sache der Deutschen ist deren Krieg nicht. So hin und her gerissen zwischen der gewohnten berechnenden Parteilichkeit für den kollektiven Imperialismus des „Westens“ und dem patriotischen Ehrgefühl, dass unter der imperialistischen Zweitrangigkeit des schwarz-rot-goldenen Vaterlands offenbar schon längst schwer zu leiden hat, stellt die öffentliche Meinung der Nation sich allerhand besorgte Fragen.[1] Vor allem die:
„Muss der Krieg wirklich sein?“
Die Antwort fällt, wie nicht anders zu erwarten, zwiespältig aus. Eines muss auf alle Fälle sein; das weiß jeder, seit die Amerikaner dieses Thema wieder aufgebracht und überlebensgroß aufgeblasen haben – vorher war es eigentlich allen, auch den Profis und Experten, ziemlich egal –: Der Herrscher des Irak ist extrem böse und muss seine „Massenvernichtungswaffen“ unbedingt umgehend abgeben. Notfalls, also wenn er nicht doch noch rechtzeitig „zur Vernunft kommt“, müssen sie ihm wohl oder übel gewaltsam weggenommen werden. So viel versteht sich also allemal von selbst: Staaten wie – nur zum Beispiel – die USA oder die BRD, die in der ganzen Welt gewichtige Interessen zu verteidigen und dafür auch einiges an Druckmitteln parat haben, die sind, jedenfalls in der Sicht ihrer Bewohner, automatisch dafür zuständig und dazu berufen, überall auf dem Globus für anständige, entgegenkommende, nach innen ordentlich durchgreifende und gleichzeitig im Innern wie vor allem nach außen gewaltfreie Regierung zu sorgen. Und eine solche „gute Regierung“ ist die des „Tyrannen von Bagdad“ ganz ohne Zweifel nicht. Gegen das gute Recht des „Westens“, diesem „Schurkenregime“ seine großkalibrigen Waffen wegzunehmen, wenn es denn welche hat, gibt es also keine Einwände. Aber muss dafür wirklich – überhaupt, schon jetzt, jetzt gleich, in der Form – Krieg geführt werden? Da lässt die außeramerikanische und speziell die deutsche öffentliche Meinung sich von ihren national Zuständigen gerne darüber aufklären, dass die Gefährlichkeit des irakischen Großverbrechers doch zweifelhaft, der Beweis dafür noch nicht erbracht und die Chance einer friedlichen Entwaffnung durchaus noch gegeben sei. Die interessante Empfehlung, es bei der Entmachtung eines Despoten doch mal ohne Gewalt zu versuchen, weckt kaum größere Bedenken, weder gegen die Aufrichtigkeit noch wegen eventueller Unzurechnungsfähigkeit der europäischen Machthaber, die den Amerikanern diesen guten Rat erteilen. Es gibt Stimmen, die daran erinnern, dass die Entwaffnung eines Staates ohne direkte militärische Erpressung, nämlich die beschönigend so genannte „Drohkulisse“, die die USA um den Irak herum längst aufgebaut haben, gar nicht zu machen ist; die wollen damit aber keineswegs kritisieren, dass „der Westen“ sich hier wieder einmal einen größeren militärischen Gewaltakt vorgenommen hat, sondern ihr Unverständnis dagegen äußern, dass gewisse westliche Politiker sich bei ein bisschen Krieg so anstellen, wo Gewalt doch per definitionem ursächlich immer nur von Saddam Hussein ausgeht. Die Mehrheit im „alten Europa“ hört dagegen aus der Beschwörung einer noch nicht ausgereizten Möglichkeit, den irakischen Kriegsherrn friedlich zu entmachten, zielstrebig nur das Attribut „friedlich“ heraus und hält ihren kriegsunwilligen Politikern das eigene wohlwollende Missverständnis, die hätten für Gewalt gegen verkehrte Staaten nichts übrig, als enormen moralischen Pluspunkt zugute. Entsprechend kritisch muss in der anderen Richtung gefragt werden:
„Darf dieser Krieg überhaupt sein?“
Europas sonst schweigende Mehrheit, entsprechend befragt, meint: Nein, darf er nicht – auch wenn dem Regime in Bagdad damit natürlich nur Recht geschieht. Denn – so die offenherzige Begründung, die gerade die allergrößten Moralisten völlig überzeugt von sich geben –: Die UNO hat ihn gar nicht genehmigt! Das ist immerhin mal ein schönes Eingeständnis, die wahren Quellen der politischen Moral betreffend: Das große idealistische Friedensgewissen, das von politischer Berechnung nichts wissen will, das sich als ideeller Ratgeber auch noch der höchsten irdischen Instanzen versteht und das sogar dem Recht selbst und denen, die es setzen, den Weg zur weltweiten Gerechtigkeit weisen will, wird ganz unbefangen beim Sicherheitsrat der UNO abgegeben, um von diesem, durch etliche höchst umstrittene Abstimmungsmanöver im Endeffekt bestätigt und beglaubigt, wieder in Empfang genommen zu werden. Immerhin, auch die höchste überirdische Instanz auf Erden, die Stellvertretung des Katholiken-Gottes in Rom, muss Amerikas Krieg ihren Segen versagen; das würdigen auch solche Friedensfreunde, die sich von der päpstlichen Autorität sonst eigentlich nur ungern belehren lassen, als ein weiteres gewichtiges Argument für ihren Standpunkt. Außerdem, das ist am Ende der wichtigste Gesichtspunkt, finden die Friedensbewegten mit ihrem „Nein zum Krieg“ überraschend großen Anklang – bei braven Bürgern, die die Unzufriedenheit ihrer Regierung mit der amerikanischen „Selbstherrlichkeit“ schon längst teilen und ihrem beleidigten Patriotismus gerne mal freien Lauf lassen; aber nicht einmal bloß bei denen. In Deutschland formiert sich ein mittlerer Kinderkreuzzug aus aufgeweckten Schülern, die in zahlreichen wohlwollenden Kommentaren sehr dafür gelobt werden, dass sie ganz anders als die anrüchige alte Friedensbewegung, nämlich „völlig unideologisch“, ohne ausschweifende Begründungen und Debatten darüber, dafür gewaltfrei und in netter Form den anstehenden Krieg irgendwie gar nicht gut finden. Weil die Umfragewerte auch noch überwältigend ausfallen, greift die Partei des Außenministers im Streit mit den „Rechtspopulisten“ von CDU und CSU gerne zu der Heuchelei, die ihr mit ihren kaum 10 Prozent sonst verwehrt ist: Echte Volksvertreter dürften, schon gleich in einer so gewichtigen Frage wie der von Krieg oder Frieden, auf keinen Fall die Meinung der Mehrheit übergehen. Die rechten Amerika-Freunde können sich dieses grüne Bekenntnis schon mal für die nächste Runde im Streit ums deutschnationale Ausländerrecht vormerken. Einstweilen schlagen sie mit dem kongenialen Argument zurück, gerade in existenziellen Fragen müsse eine Regierung, die den Namen verdient, auch gegen die Stimmung im Volk Führung zeigen – und wo sie Recht haben, haben sie Recht: Kein Krieg ohne politischen Führer, der keinen Zweifel duldet! Außerdem müssen sich die „No War“-Jünger eine öffentliche Gewissensprüfung gefallen lassen, die gar nicht zufällig an die Gretchenfragen an Kriegsdienstverweigerer in den einstigen bundesrepublikanischen Anerkennungsverfahren erinnert: Was sie denn machen wollen, wenn demnächst Saddam mit der Giftgas-Granate vor der deutschen Haustür steht; und ob sie denn nicht merken und wie sie das verantworten wollen, dass sie mit ihrer Skepsis gegen den US-Krieg nur den bösen Feind in Schutz nehmen, der bekanntlich sein eigenes Volk vergast, Amerikas Bürger bedroht – und auch wenn letzteres so nicht ganz richtig ist, muss man doch dem durch „NineEleven“ „traumatisierten“ amerikanischen Volk zumindest das Recht zubilligen, sich vor Saddam Hussein wie vor einem fehlgeleiteten Großflugzeug oder einer Briefflut mit Anthrax-Pulver zu fürchten und vorsichtshalber einen Vernichtungskrieg gegen dessen Regime in Auftrag zu geben.
Moralisch ist die Sache also insoweit klar, als man durchaus entgegengesetzter Meinung darüber sein kann, ob dieser Krieg – von wem auch immer – erlaubt ist oder verboten gehört. Doch damit stellt sich erst die eigentlich entscheidende Frage:
„Kommt er“, der Krieg, oder „ist er noch zu vermeiden?“
Schließlich möchte man als mündiger demokratischer Bürger Bescheid wissen, was auf einen zukommt, damit man sich, seelisch zumindest, darauf einstellen kann, und zwar rechtzeitig. Sehr verständlich, dieses Bedürfnis – bei einem Publikum, das zwar mit Hingabe über Recht und Unrecht des angesagten Krieges rechtet, seine private Meinung vielleicht sogar öffentlich vorzeigt, gleichzeitig aber realistisch davon ausgeht, dass vom Ergebnis eines freiheitlich-demokratischen Meinungsstreits ohnehin nichts abhängt, schon gar nicht ein längst beschlossener Krieg; bei Leuten, die sich damit auch schon jedes Interesse abgeschminkt haben, ernstlich in Erfahrung zu bringen, warum „es“ in dieser besten aller Welten immer wieder „zu Kriegen kommt“, und denen es völlig fern liegt, aus dieser Regel Schlüsse auf das wunderbare „System“ weltweiter Marktwirtschaft und Demokratie zu ziehen, dem sie dienen, und auf den Dienst, den sie ihm leisten. Krieg „kommt“ eben, wenn er nicht mehr zu vermeiden ist; bleibt nur noch die Erkundigung, ob und wann es so weit ist.
Ihren eigenartigen Reiz entfaltet diese Frage am besten, wenn sie auf derselben Zeitungsseite, in einer und derselben Talkshow oder in einem einzigen Kommentar mit Auskünften über den fortgeschrittenen Aufmarsch des US-Militärs und den immer offensichtlicheren Kriegswillen der „Falken“ in Washington verbunden wird. Der Krieg, dessen Veranstalter dem Publikum in aller Welt namentlich bekannt gemacht werden, bekommt durch diese Fragestellung etwas angenehm Ungewolltes, Schicksalhaftes, Verhängnisvolles. Neben den Gründen für den Krieg, die man zu wissen meint, gibt man der albernen Vorstellung recht, zum Krieg „käme es“ letztlich doch nur, wenn und weil seine Verhinderung gescheitert sei. Neben den wirklichen Urhebern denkt man sich noch eine andere Macht, oder man denkt sich sogar die Urheber selber als Repräsentanten einer Instanz, der man nachsagen möchte, sie hätte versagt, wenn am Ende ein Krieg „ausbricht“. Das mag in irgend einem höheren oder tieferen Sinn „die Vernunft“ sein; eine „Niederlage“ erleidet auch „die Menschheit“, die sich – wenn man dieses imaginäre Subjekt nur richtig ernst nimmt – im Kriegsfall offenkundig mit sich selbst zerstreitet; eventuell haben auch „wir alle“ es an dem Friedenswillen fehlen lassen, der nun, kein Wunder!, der Bush-Administration abgeht – mit der Diagnose mangelnder Friedensliebe kann man nämlich auch sehr gut von den positiven Kriegsgründen der USA absehen. Letztlich zielt die Frage nach den noch vorhandenen oder bereits verpassten Chancen, eine Militäraktion noch zu vermeiden, aber auf „Versäumnisse“ der Politik
; und das ist schon arg absurd, aber auch der ganze Sinn der Sache. Es ist absurd, weil nichts und niemand anders als „die Politik“, nämlich die der USA, aus lauter gediegenen politischen Gründen Krieg am Golf überhaupt auf die weltpolitische Tagesordnung setzt. Die Sache wird auf den Kopf gestellt, wenn man davon gar nichts weiter, statt dessen aber ganz genau wissen will, was „die Politik“ zur Abwendung eines Krieges getan oder nicht getan hat. Kontrafaktisch, in direktem Widerspruch zu dem, was gerade passiert und für Aufregung sorgt, wird dem Metier des Regierens so als sein eigentlicher Zweck und Auftrag ganz grundsätzlich eben die Aufgabe zugeschrieben, es hätte „Zuspitzungen“ zu vermeiden und auf Biegen und Brechen den Frieden zu wahren. Am Ende sind noch nicht einmal die Scharfmacher in der US-Regierung vor der bohrenden Nachfrage sicher, ob sie wirklich alle Möglichkeiten zur Vermeidung des von ihnen anberaumten Krieges ausgeschöpft hätten – dass das eigentlich ihr Job wäre, wird ihnen und vor allem ihrem Amt schon mit der Frage, also auch dann unerschütterlich zugute gehalten, wenn die Antwort eher negativ ausfällt. Und genau das ist auch der ideologische Sinn der Fragestellung.
Ihr praktischer Nährwert steht damit auch schon fest. Skeptisch oder vertrauensvoll, auf jeden Fall in dem Bewusstsein, da an der richtigen Adresse, bei der kompetenten Instanz gelandet zu sein, richtet sich das aufgeregte Publikum mit seiner Erkundigung, ob der Krieg jetzt „kommt“ oder es eventuell doch noch vorzieht wegzubleiben, an die politische Herrschaft, der demokratische Bürger ihre gesellschaftlichen Geschicke ohnehin unwiderruflich anvertraut haben. Noch die schärfsten Vorwürfe, die gegen die Zuständigen laut werden, weil die mal wieder alles verbaselt hätten, bekräftigt deren Zuständigkeit, ist also ein Stück Unterordnung. Entsprechend gut kommt es an, wenn die Regierungen, die dem US-Unternehmen eine Absage erteilt haben, treuherzig versichern, natürlich wären sie unermüdlich und bis zur letzten Minute in der Mission der Kriegsverhinderung unterwegs, auch wenn schon längst gar nichts mehr dafür spricht, es könnte noch gelingen: Nachdem sie ihre Nation auf eine wohlberechnete Kriegsdienstverweigerung festgelegt und ihr Volk dafür eingenommen haben, bekennen sie sich gern als Anhänger ihrer Anhänger, und die letzteren haben dafür glatt etwas übrig. Gleichzeitig freilich weckt eine so hoffnungsvoll und aussichtslos gegen Amerikas Beschlusslage ankämpfende Regierung einige Zweifel bei dem Teil des fachkundigen Publikums, der in der gesamten Auseinandersetzung um Krieg oder Nicht-Krieg von vornherein nichts anderes im Auge hat als die Reichweite des Einflusses der eigenen Nation auf das Weltgeschehen und der in seiner nationalen Parteilichkeit immer bereit ist, ausbleibende weltpolitische Erfolge und Ergebnisse unterhalb des eigenen patriotischen Anspruchsniveaus dem amtierenden Personal als dessen Versagen und politisches Missmanagement anzulasten. Die kritischen Meinungen der deutschen Öffentlichkeit gehen in diesem Punkt wieder ziemlich auseinander: Mal überwiegt der Glückwunsch an Schröder & Co zur immerhin zusammengebrachten „Koalition der Kriegsgegner“; dann wiederum oder bei anderen herrscht Besorgnis oder auch Unzufriedenheit vor über einen übereilten und riskanten oder sogar überhaupt grundverkehrten, weil national schädlichen Antiamerikanismus, den Deutschland sich – leider noch – nicht leisten kann oder auch gar nicht herausnehmen darf.
Dass „man“ gegen den Krieg mittlerweile nichts mehr machen kann, steht jedenfalls fest. Und weil der ein ziemlich aufregendes Ereignis zu werden verspricht, drängt sich gegen Ende der Vorkriegszeit eine ganz andere Frage in den Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit:
„Was machen eigentlich die Soldaten?“
Im engeren nationalen Sinn geht es in „old Europe“ zwar nicht um „unsere Jungs und Mädels“, was der Frage erst ihren eigentlichen Nachdruck verleihen würde. So viel ist von der altgewohnten „Einheit des Westens“ aber noch allemal übrig, dass außer Frage steht, auf welcher Seite man sich nach der werten Befindlichkeit erkundigt. Außerdem möchte man als Insasse des christlichen Abendlands doch wissen, wie „Menschen wie du und ich“ das verkraften, wenn sie aus dem friedlichen Milieu einer freiheitlich-demokratischen Marktwirtschaft unversehens zum Überfall auf einen rückständigen Verbrecherstaat an den Golf abkommandiert werden; da steht der US-Soldat dem gesitteten europäischen Nachrichtenkonsumenten allemal näher als ein Mitglied der republikanischen Horden des neuen Nebukadnezar. Ganz davon abgesehen, dass man sich als moderner Mensch auch für das interessante technische Gerät interessiert, das die USA in Stellung bringen.
Auch dieses Interesse wird reichlich bedient; es wird geweckt, wo es das Beste zu verschlafen droht; vermittels bewegter Bilder vom unaufhaltsamen Aufmarsch der amerikanischen Armee
und durch einfühlsamen Nachvollzug dessen, wie die High-Tech-Monster, die doch auch Menschen
sind, sich fühlen
. Das nennt sich dann Informationspflicht
; Profis, die ihr gerne genügen, finden sich zuhauf. Eigene Kriegsberichterstatter sind schon vor Ort – sogar Vietnam-Veteran Scholl-Latour wird wieder ausgegraben –, andere werden in amerikanischen Militärcamps trainiert, um beim Schießen nicht im Weg zu stehen und die Regeln für sauberes Filmen und kompetente Erfolgsmeldungen zu lernen, auf dass die Moral an der Heimatfront steht. Die Frontberichterstattung läuft schon vor offiziellem Kriegsbeginn tadellos: Amerikanische SoldatInnen im Wüstensturm beim Training – siegesgewiss, ready to go
. Besuche auf dem Flugzeugträger – riesig, so ein Schiff, hartes Leben zwar, aber auch die Weiber sind begeistert dabei und tun ihren Job
. Demokratie ist offenbar, wenn die Untertanen, die ihren Herren im Frieden wie im Krieg folgen, das Beste aus allen Lebenslagen machen, wenn die Betroffenen
also begeistert mitmachen, egal welche Opfer es kostet. Daher ist das Schlimmste, dass sich das so hinzieht mit dem Startschuss. Immer nur Basketball im Fernsehen, sonst nichts. Langeweile – wenn etwas, dann untergräbt die die Kriegsmoral, und schon deshalb muss es bald losgehen. Auch kostet so ein Aufenthalt am Golf viel, und das täglich, für praktisch nichts. Das alles wieder abzublasen wegen einer friedlichen Lösung, das geht ja gar nicht mehr, jetzt, wo schon alles so prima aufgestellt ist und funktioniert wie am Schnürchen. Ganz abgesehen davon, dass Bush den Krieg ja will. Also, wann geht’s endlich los mit dem angekündigten Höllenfeuer
der 3000 Bomben in 48 Stunden
? Zumal im Frühling die Wüste auch so immer wärmer werden soll.
Daneben werden Stimmungsbilder aus der Heimat der GIs geliefert. Denn das interessiert am Ende schließlich auch noch:
„Steht die Heimatfront?“
Und siehe da: Je näher der Befehl zum Losschlagen kommt, desto enger scharen sich die Amerikaner um ihre Regierung
. Von den bislang zögernden Engländern wird dasselbe erwartet – das ist immer so
, lautet die Analyse. Die Spitze aller verrückten Leistungen des staatsbürgerlichen Gemüts, sich dann, wenn einfach nur noch das pure Töten und Sich-Opfern fürs Vaterland gefragt ist, um so bedingungsloser mit diesem zu identifizieren
– das ist ganz normal, das macht ein Bürger doch immer so.
Aber wenn das schon immer so ist: Ist das auch überall so? Ist das bei den Irakern zum Beispiel auch so, obwohl sie – oder vielleicht weil sie? – keine Demokratie haben? Oder harren sie freudig ihrer gewaltsamen Befreiung? Da hilft nur investigativer Journalismus vor Ort, der sich auch bei diesen Betroffenen
fachkundig macht. Und interessante Befunde zu Tage fördert: Der normale Iraki
kauft Wasser, um während der Bombardierung nicht zu verdursten – nicht dumm, der Herr Volk, auch im Zweistromland. Die Händler bringen ihre Ware in Sicherheit, deren Preise keiner mehr bezahlen kann, der Basar wird bis auf Weiteres geschlossen – kann man irgendwie verstehen. Insoweit also: Alles in Ordnung auch hier, denn alle machen das Beste aus der Situation
; die Stimmung in Bagdad
ist nicht überall gleich gut, aber zweifellos so oder anders vorhanden. Nur Angst haben die Iraker nicht, behaupten sie wenigstens, jedenfalls trauen sie sich nicht, es zu sagen
, sagen die Experten für Diktatur, während US-Boys
sie zugeben
dürfen. Das ist dann wohl die Errungenschaft von Freiheit und Demokratie, die dem Volk dort noch abgeht.
Dank der allgegenwärtigen Medienvielfalt wissen wir es also: Alle warten auf das Unvermeidliche. Und nach dem 48-Stunden-Ultimatum des Präsidenten setzt endlich auch der Börsen-Bulle auf Krieg. Die Aussicht ist mit einem Mal prächtig, die Aktien boomen, der Dollar steigt, der Ölpreis sinkt, die Wirtschaftsexperten erklären, warum: Die Zeit der Unsicherheit ist vorbei
, die Finanzwelt spekuliert auf einen schnellen Sieg
. Leichen für den Aufschwung im Portfolio? Ist das nicht ein bisschen zynisch? Aber ja doch: Das mag zynisch klingen, ist aber so.
Ja dann. Dann ist es auch gut für die kleinen Anleger. Denn erstens geht es nach dem Krieg wieder aufwärts mit der Wirtschaft
, falls nicht gleich der nächste kommt
. Und zweitens gehen die Erwartungen
, die an der Börse gehandelt werden, letztlich eben schon auch moralisch
vollkommen in Ordnung: Das Beste, was passieren kann, ist jetzt ein schnelles Ende des Krieges, das die Opfer gering hält.
Krieg, Geschäft und Moral vertragen sich also im Grunde prächtig. Noch ein Vorteil der Demokratie.
Absurd, aber logisch: Die Diplomatie hat ihre Vorkriegs-Konjunktur
Parallel zur Endphase der amerikanischen Kriegsvorbereitungen eskaliert der Streit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zwischen den kriegsbereiten Alliierten auf der einen, den Kriegs-Gegnern auf der anderen Seite.[2] Es geht um
Form und Schein eines „Gewaltmonopols der UNO“
Dass die diplomatische Auseinandersetzung sich zuspitzt, bevor die Eröffnung der militärischen Auseinandersetzungen hier eine Atempause und eine Umorientierung erzwingt, ist einerseits sehr logisch und sachgerecht. Alle UN-Mitglieder haben ihrem Club eine Zuständigkeit für ihre Streitigkeiten untereinander übertragen. Dessen Charta enthält Regeln, nach denen die Staaten sich bei ihren Affären miteinander und sogar noch bei der Einleitung von Kriegsaktionen richten sollen: eine Geschäftsordnung für die gewaltsame Stornierung aller normalen Geschäfte. Der Weltsicherheitsrat achtet auf die Einhaltung dieses interessanten Regelwerks und befindet über Strafmaßnahmen im Falle seiner Verletzung. Auf die Art fungieren die „Weltorganisation“ und ihr oberstes Beratungs- und Beschlussorgan als Forum, auf dem Staaten für ihre gewalttätigen Anliegen und Vorhaben um Zuspruch oder auch um Unterstützung gegen auswärtige Übergriffe und in jedem Fall um die Verurteilung ihres Gegners werben; dort stellt sich heraus, weltöffentlich und mit einem gewissen Maß an Verbindlichkeit, wie sich die anderen Souveräne dazu stellen, welche Widerstände die Konfliktparteien zu erwarten haben, mit welchem Grad von Zustimmung oder sogar Beistand sie rechnen können usw. Kein Krieg, dessen Vorlauf nicht mit UN-Resolutionen – ggf. mit verhinderten – gepflastert wäre.
Es geht allerdings an der Sache vorbei, wenn unter dem Eindruck der rechtsförmigen Geschäftsordnung für zwischenstaatliche Gewaltanwendung, über die in New York gewacht wird, wegen der gewollten und gepflegten Ähnlichkeit von Resolutionen mit rechtsverbindlichen Erlassen und angesichts der Erbitterung, mit der die Beteiligten darum zu ringen pflegen, so getan oder als der „eigentliche“ Gehalt der UNO-Diplomatie die Fiktion beschworen wird, die Vereinten Nationen besäßen – irgendwie – die letzte Entscheidungshoheit über Krieg und Frieden. Noch keine nennenswerte Gewaltaktion auf dem Globus ist gestartet worden, weil der Staatenclub sie in Auftrag gegeben hätte, und es ist auch noch keine unterblieben, weil der sie nicht gestattet hätte. Militär wird eingesetzt, weil eine bewaffnete Macht eine fremde bewaffnete Gewalt aus sicherheitspolitischen Gründen nicht mehr aushält und sobald genügend Mittel beisammen sind, um mit einiger Aussicht auf Erfolg loszuschlagen. Was diese letztere Berechnung betrifft, kann natürlich der Bescheid, den eine UNO-Resolution erteilt, den Ausschlag geben; doch das liegt nicht am Recht, das damit gesprochen würde, sondern am Kräfteverhältnis, das darin deutlich wird.
Nicht bloß unsachlich, sondern völlig daneben und einigermaßen absurd ist es daher, wenn die USA einen Waffengang gegen ein „unerträgliches“ Sicherheitsrisiko ansetzen und in den dann fälligen Beratungen oder in Bezug auf sie der Anschein erweckt wird, als müsste ausgerechnet Amerika sich mit seinem Vorgehen nach dem Ergebnis richten, zu dem der Sicherheitsrat gelangt. Seit dem Ende der Sowjetunion kommt es bei jeder Beschlussfassung über zwischenstaatliche Streitfragen und Gewaltaffären und erst recht bei der Durchsetzung gefasster Beschlüsse maßgeblich und in letzter Instanz auf die Nation an, der niemand mehr den Rang der „Nr. 1“ streitig macht; wenn am Schein der Rechtsverbindlichkeit von UN-Resolutionen praktisch etwas dran ist, dann ist das die – zwar bloß fallweise, im gegebenen Fall aber entsprechend massiv eingesetzte – überlegene, schiedsrichterlich agierende Gewalt der USA. Umgekehrt ist dieser Staat tatsächlich der letzte, der die Entscheidung über die gewaltsame Durchsetzung von Interessen, die er für „vital“ erachtet, einer anderen Instanz als sich selbst überantworten würde.
Die „Staatenfamilie“ und ihr Völkerrecht: Nutzen und Ärgernis für die Weltmacht
Andererseits ist es überhaupt nicht so, dass die amerikanische Weltmacht ihr Militär einfach losmarschieren lassen würde, wo sie es für fällig erachtet. Im Gegenteil: Fortwährend beschäftigt sie, selbstverständlich ohne sich davon abhängig zu machen, die gesamte restliche Staatenwelt und – unter anderem auch – die UNO mit ihren Sicherheitsproblemen und Gewaltaktionen. Und das ist auch sehr logisch und sachgerecht, gerade wegen der weltweit wirksamen Machtfülle, über die die Nation verfügt. Denn wo immer sie zuschlägt, agiert sie als Weltordnungsmacht, behandelt jede Störung ihres Sicherheitsbedürfnisses als Weltproblem und will das auch allgemein so gesehen und anerkannt haben. Vielleicht bereinigen die USA irgendwo auch mal bloß eine lokale zweiseitige Affäre; grundsätzlich gehen sie aber in jedem Einzelfall mit dem Anspruch ans Werk, ein allgemeinverbindliches Urteil über die Unerträglichkeit einer feindseligen Gewalt zu exekutieren und damit für generell gültige Bedingungen eines friedlichen Verkehrs zwischen den Nationen einzustehen. Sie gebrauchen nicht nur Gewalt, wo sie es für nötig befinden, sondern setzen mit ihrem Gewaltgebrauch Fakten, nach denen andere Staaten sich bei ihrem Gewaltgebrauch richten müssen; und sie erlassen damit nicht bloß faktisch Richtlinien für die Sicherheitspolitik aller anderen Staaten, sondern verlangen Einverständnis mit ihrer Richtlinienkompetenz. Die UNO betrachten sie als ein Institut zur Bekanntmachung ihrer sicherheits- und deswegen immer auch gleich weltordnungspolitischen Einzelfall- wie Grundsatzentscheidungen und zur Einschwörung der Staatenwelt darauf – das jedenfalls ist die positive Seite, die sie dieser Einrichtung und dem dort praktizierten völkerrechtlichen Supra-Nationalismus bislang abgewonnen haben.
Die Kehrseite haben die USA allerdings nie übersehen. Sie besteht darin, dass die organisierte „Völkerfamilie“ dann doch nicht einfach und schon gar nicht automatisch als Akklamationsorgan für amerikanische Entscheidungen funktioniert. Schließlich sind die Mitglieder souveräne Staaten; der gesamte supra-nationale Apparat mit allen seinen rechtsförmlichen Verfahrensweisen, den sie sich in New York eingerichtet haben, beruht auf ihrer wechselseitigen Anerkennung als autonome Rechtssubjekte. Das hat bislang auch die Weltmacht respektiert, eben weil es ihr darum geht, dass lauter anerkannte Staaten ihre Staatsräson an den Fakten ausrichten, die sie setzt, und ihre souveräne Gewalt in den Dienst der Richtlinien stellen, die sie erlässt. Damit ist denen aber auch eine förmliche Entscheidungsfreiheit zugestanden; in der UNO können sie sich, wann immer ihre nationalen Berechnungen ihnen das opportun erscheinen lassen, den Vorgaben und Ansprüchen der Weltmacht entziehen. Die macht sich insoweit, nämlich was die allgemeine Zustimmung zu ihren Direktiven angeht, von fremder Willkür abhängig. Und das ist für die USA im Grunde völlig absurd. Staaten, die sich amerikanischen Anliegen verweigern, missbrauchen die Souveränität, die Amerika ihnen konzediert; sie verspielen damit das Recht auf Respekt, das Amerika ihnen einräumt. Soweit die USA das tolerieren, verleugnen sie sich gewissermaßen selbst – auch wenn sie sich dadurch praktisch natürlich an nichts hindern lassen. Auf alle Fälle handeln sie sich mit dem politischen Nutzen, den sie sich von der Weltorganisation erwarten, zugleich ein andauerndes Ärgernis ein. Mit der UNO und deren völkerrechtlicher Geschäftsordnung leisten sie sich somit im Grunde ein einziges großes Paradox.[3]
Eine Absage an die konventionelle UNO-Diplomatie: Amerikas neues sicherheitspolitisches Anspruchsniveau
Mit diesem Widerspruch mag die US-Regierung sich nicht länger abfinden. Nicht, weil sie damit nicht umzugehen wüsste, sondern aus ziemlich substanziellen Gründen. Sie hat den Sicherheitsbedarf ihrer Nation neu definiert; sie praktiziert dafür eine neue Weltordnungspolitik, die die Ächtung und Beseitigung störender Regierungen verlangt; sie benötigt für die Durchführung dieser neuen imperialistischen Generallinie willige Alliierte ohne Einspruchsrecht. Und dazu passt es einfach nicht mehr, mit der eigenen konkurrenzlosen Weltmacht quasi hinterm Berg zu halten und sich ungeachtet der wirklichen Kräfteverhältnisse formell in eine „Völkergemeinschaft“ aus prinzipiell gleichberechtigten souveränen Subjekten eines für alle gleichermaßen (un-)verbindlichen Völkerrechts einzufügen.
Welche neuen Direktiven die US-Regierung in der Staatenwelt durchsetzen will, das geht aus den bekanntgegebenen Zielen ihres Irak-Kriegs eindeutig genug hervor[4] – ganz zu Unrecht wird ihr vorgeworfen, sie würde ihre Begründungen dauernd wechseln, und die passten gar nicht zueinander.
- Wenn mit Verweis auf die Attentate des 11. September 2001 die Prävention gegen Terror als Grund für einen Krieg gegen den Irak Saddam Husseins angegeben wird, dann beweist das nicht, dass die US-Regierung nichts auseinanderhalten kann – auch wenn es ihr durchaus recht sein mag, dass angeblich zwei Drittel ihrer mündigen Bürger den Mann in Bagdad für den Al-Kaida-Chef halten. Sie stellt damit vielmehr ihre Entschlossenheit klar, die lückenlose Unterdrückung antiamerikanischer Umtriebe, gleichviel ob privater oder staatlicher Natur, weltweit zur Friedensbedingung zu erheben und gewaltsam durchzusetzen.
- Wenn sie die pure Möglichkeit der Existenz von „Massenvernichtungswaffen“ in der Hand antiamerikanisch eingestellter Regierungen oder auch nur deren Bemühung darum als nicht hinnehmbare akute Gefahr für ihre nationale Sicherheit bezeichnet, die mit Krieg ausgeräumt werden müsse, dann verfällt die Bush-Administration nicht dem puren Verfolgungswahn – auch wenn das subjektiv auf manches Mitglied außerdem auch noch zutreffen mag. Sie macht vielmehr radikal ernst mit dem Anspruch auf Unanfechtbarkeit der rund um den Globus allgegenwärtigen, also auch überall zu sichernden vitalen Interessen Amerikas.
- Wenn der vorrangige bis exklusive Zugriff Amerikas aufs irakische Öl zwar nicht direkt als Kriegsziel deklariert, aber immerhin als wichtiges Kriegsergebnis offensiv antizipiert wird, dann mag die Bush-Mannschaft schon auch nebenher eine patriotische Pfründenwirtschaft betreiben. Vor allem aber erteilt sie der Welt eine praktische Lektion darüber, was es bedeutet, wenn einem Rohstoff das Attribut ‚strategisch‘ beigelegt wird: Dann erklärt die höchste politische Gewalt die Sicherheit des Geschäfts mit diesem Stoff zum Teil ihrer Strategie, d.h. ihres Auftrags ans eigene Militär, die Staatenwelt unter Kontrolle zu halten.
- Wenn nicht bloß die Kapitulation, sondern die vollständige Beseitigung des noch herrschenden Regimes zum Kriegsziel erhoben wird, dann ist das durchaus auch der Auftakt zu einem Sittengemälde vom alt-bösen Feind, gegen den die überlegene Macht des Guten moralisch bedingungslos im Recht ist. Die politische Botschaft ist aber noch härter – und schon wieder dieselbe: Die Staatenwelt wird damit bekannt gemacht, dass Amerika die gewaltsame Auswechslung von Regierungen fortan zu den selbstverständlichen Instrumenten seiner Weltsicherheitspolitik zählt.
- Wenn die Bush-Regierung für ihren Krieg mit der Absichtserklärung wirbt, sie wolle auf mittlere Sicht gleich die ganze Golfregion und die arabische Welt insgesamt demokratisieren und an die US-Standards in Sachen Freiheit – fürs Geschäftemachen, für den privaten „pursuit of happiness“, fürs Glauben und Beten usw. – heranführen, dann kommt hier sicher auch die kulturimperialistische Arroganz der Weltmacht zu ihrem Recht. Viel wichtiger ist aber die Ansage, dass Amerika vorhat, mit dem Krieg gegen den Irak und einer dadurch beglaubigten Kriegsdrohung nicht bloß unpassendes Personal von der Macht zu entfernen, sondern Pro-Amerikanismus als Staatsräson zu implantieren.
Und schließlich das Ganze noch einmal andersherum:
- Wenn die Führer der Weltmacht für die von ihnen sehr ausgreifend definierten Sicherheitsbelange ihrer Nation nur ein zureichendes Mittel kennen wollen, nämlich – an Saddam Husseins Irak exemplarisch durchexerziert – Krieg bis zur restlosen Zerstörung der störenden Elemente, dann muss die Staatenwelt sich nicht bloß notgedrungen, sondern dann soll sie sich auch ganz ausdrücklich auf Amerikas überlegenen militärischen Terror als jederzeit einsatzbereites Ordnungsinstrument einstellen. Amerika will die Gleichung, dass seine Sicherheit Unsicherheit für alle anderen Staaten bedeutet.
Dieses Programm ist in der Tat unvereinbar mit einer Diplomatie, die bis hin zum Risiko förmlicher Abstimmungsniederlagen in der UNO die Formen wahrt und die Souveränität der Mitgliedsstaaten als Geschäftsgrundlage des Völkerrechts anerkennt.[5] Mit ihrer neuen Weltordnungspolitik strapazieren die USA nicht bloß, sondern negieren sie den formellen Respekt zwischen Staaten gleich welcher Größe, Stärke und Machart, welcher am Anfang aller rechtsförmigen Beziehungen zwischen ihnen steht. Sie annullieren den verlogenen Schein von Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Nationen, den sie selber bislang für insgesamt nützlich befunden und mehr oder weniger zugestanden haben.
US-Diplomatie bis zum bitteren Ende: Ein ultimativer Tauglichkeitstest für die UNO
Trotzdem: Die USA ignorieren das große Forum der Diplomatie in New York nicht einfach. Ihr Außenminister lässt es sich nicht nehmen, sogar noch das längst beschlossene Vorgehen gegen die Macht des irakischen Präsidenten, den ersten Anwendungsfall der neuen amerikanischen Politik des gewaltsamen Regimewechsels, den formell zuständigen UNO-Gremien zur Beratung und Beschlussfassung zu unterbreiten. Seinen Kollegen im Sicherheitsrat erklärt er ausführlich, sogar mit leicht fasslichen Schaubildern und unter Berufung auf eigens fabrizierte Fälschungen, dass der Irak gar nicht bloß gegen Sicherheitsinteressen der USA – und schon damit gegen die der ganzen Welt –, sondern außerdem gegen Resolutionen der Vereinten Nationen selber verstößt und deswegen nach Völkerrecht und Beschlusslage der höchsten UN-Gremien die Behandlung verdient, die Amerika ihm antun will. Bis zuletzt bemüht die US-Regierung sich um eine Resolution, die nicht bloß so ungefähr wie die mit der Nummer 1441, sondern klar und unmissverständlich ihren Großangriff billigt. Um sich dafür eine Mehrheit zu holen, schreckt sie weder vor Erpressungen noch vor Bestechungsgeldern für nicht-ständige Sicherheitsrats-Mitglieder aus der – bekanntlich sowieso korrupten – 3. Welt zurück; so sehr kommt es ihr darauf an, ihre Gegner – auch wenn sie deren angedrohtes Veto gegen die erstrebte Ermächtigung formell nicht außer Kraft setzen kann – offiziell zur Minderheit zu stempeln und so wenigstens moralisch ins Unrecht zu setzen.
In Anbetracht der Sache, die die USA durchsetzen wollen, ist Minister Powells Gang zur UNO hochgradig absurd – immerhin sollen alle Staaten Amerika das Recht zubilligen, nach Maßgabe seiner eigenen Sicherheitsbedürfnisse in der Staatenwelt kriegerisch aufzuräumen, also aus freien Stücken ihre Souveränität grundsätzlich unter amerikanischen Vorbehalt stellen. Zugleich ist dieses Vorgehen andererseits durchaus logisch und sachgerecht. Die Weltmacht, die ihr Recht über das aller anderen setzt, schätzt eben auch das Recht, das ja nur eines ist und gilt, wenn andere es gegen sich gelten lassen, es also anerkennen und sich ihm unterordnen. Sie will der Welt Führung angedeihen lassen, und das geht nicht ohne Gewalt, die Alternativen ausschließt; eben das sollen die entsprechend beeindruckten Regierungen dann aber auch einsehen und sich führen lassen. Die Staaten der Welt – und da vor allem die von Gewicht und mit eigenen imperialistischen Ambitionen – sollen die einseitige Kündigung der politischen Praxis einer kollektiven Dauerberatung über den globalen Gewalthaushalt schon auch noch selbst wollen und diesen Willen förmlich bekunden. Und dafür könnte und sollte aus amerikanischer Sicht die UNO doch immerhin taugen. Zumindest ist das der Bush-Regierung einen hartnäckigen Versuch wert.
Dabei lässt sie freilich keinen Zweifel, dass sie auf alle Fälle auch ohne Zustimmung der formell zuständigen UNO-Gremien tun wird, was sie für nötig hält, und sich die gewünschte Gefolgschaft auch anders zu beschaffen weiß. Sie kündigt an, bei Bedarf gegen die Geschäftsordnung der „Völkerfamilie“ zu verstoßen, und stellt dazu gleich klar, dass in dem Fall nicht sie sich ins völkerrechtliche Abseits stellt, sondern die UNO ins weltpolitische: Sie würde ihrer weltordnungspolitischen Irrelevanz überführt. Unverhohlen erpresserisch spielt die Regierung in Washington den Umstand aus, dass alle UNO-Programme und Sicherheitsratsbeschlüsse nur so viel praktische Verbindlichkeit besitzen, wie Amerika mit seiner überlegenen und als überlegen anerkannten Militärmacht ihnen verleiht; dass überhaupt die gesamte UNO-Diplomatie nur so viel wert ist, wie Amerika auf dieses Procedere Wert legt und für die Vollstreckung der erzielten Ergebnisse einsteht. Sie blamiert den Schein einer eigenständigen Autorität der Vereinten Nationen und ihres Völkerrechts und stellt ihn gewissermaßen vom Kopf auf die Füße, indem sie die wohlorganisierte Staatengemeinschaft offensiv für sich und ihre Belange als Akklamationsorgan in Anspruch nimmt: als jederzeit aktivierbare große „Koalition der Willigen“ unter amerikanischem Oberbefehl. Für die Weltmacht handelt es sich bei dieser ultimativen Inanspruchnahme sogar um eine Chance, die sie dem Club der souveränen Nationen eröffnet, nämlich die, dem Schicksal der Überflüssigkeit zu entgehen: Amerika gönnt der UNO noch eine Bewährungsprobe, unterzieht sie einem ultimativen Eignungstest für die einzige Funktion, in der die Weltmacht mit der „Weltorganisation“ noch etwas anfangen kann.
Seither gibt es in der Kunst der Diplomatie noch etwas jenseits aller Absurdität: Die US-Regierung führt einen diplomatischen Kampf um die formelle Absegnung ihrer Kriegspolitik – und kämpft damit einen letzten Kampf um die Rettung der UNO. Vor der Bedeutungslosigkeit nämlich, die sie diesem Club für den Fall der Verweigerung androht.
Die Front der Kriegsdienstverweigerer: Ein diplomatisches Nein zu Amerikas Krieg ohne undiplomatisches Nein zu Amerika
Der Streit der Diplomaten in der UNO um die Legitimierung des amerikanischen Irak-Kriegs spitzt sich zu, weil die herausgeforderten Konkurrenten der großen Weltmacht angesichts und trotz der unmissverständlich angesagten Erpressung die verlangte Zustimmung zu einem neuen Ermächtigungsbeschluss verweigern – und weil sie das in einer Form tun, die auf ihre Art auch eine Spitzenleistung diplomatischer Heuchelei darstellt. Weil sie sowieso genau wissen und sich schon längst nichts mehr darüber vormachen können, wie das Entwaffnungs-Ultimatum an Saddam Hussein gemeint ist – nämlich überhaupt nicht auf Erfüllung berechnet, allein zur Konstruktion eines UNO-kompatiblen Rechtsgrunds für Amerikas Feldzug ins Spiel gebracht –, nehmen sie es quasi beim Wort, also so, wie es gar nicht gemeint ist: Sie erklären sich im Ziel einer überprüften restlosen Beseitigung irakischer „Massenvernichtungswaffen“ mit den Amerikanern – und Briten – völlig einverstanden, lehnen „bloß“ den Krieg als verkehrte oder sogar als möglicherweise notwendige, aber zu früh zum Einsatz vorgeschlagene Entwaffnungsmethode ab. Und weil ihnen völlig klar ist, dass das Ultimatum der US-Regierung an Saddam Hussein sich eigentlich an sie im Besonderen und die UNO im Allgemeinen richtet und auf Beendigung aller Umständlichkeiten einer kollektiven Beratung und des Scheins einer gleichberechtigt-gemeinsamen Beschlussfassung zielt, inszenieren sie eine Debatte im Weltsicherheitsrat, die glatt den Anschein erwecken könnte und das auch durchaus erreichen soll, als ginge diplomatisch und nach der UNO-Geschäftsordnung eigentlich alles seinen gewohnten Gang: Die rechtlichen Implikationen und Konsequenzen des Wortlauts einer Resolution stehen zur Beratung – der „VierzehnVierEins“, wie „wir Profis“ vom Schlage J. Fischer zu sagen belieben, quasi Routine also; dem darin angesprochenen Staat wird vorgeworfen, gegen Auflagen verstoßen und nicht hinreichend kooperiert zu haben – auch das nichts Dramatisches, mit solchen Vorwürfen lebt ein Staat wie Israel seit Jahrzehnten ganz prima; es gibt Meinungsverschiedenheiten „unter Freunden“, einen Kampf um Mehrheiten, ein Veto „liegt in der Luft“ – beinahe Alltag im höchsten UN-Gremium. Noch über das Ende der Debatte hinaus wird die Form gewahrt: Die US-Truppen sind schon in die „entmilitarisierte Zone“ an der kuwaitisch-irakischen Grenze eingerückt, die UN-Kräfte im Irak zum sofortigen Verlassen des Landes aufgefordert und bereits unterwegs, die vorbereitenden Bombenangriffe auf irakische Stellungen werden verschärft – da beehren die Außenminister der Kriegsverweigerer den Sicherheitsrat mit ihrer Anwesenheit, um einen weiteren Bericht des Chefs der UNMOVIC-Inspekteure über die Ergebnisse der bisherigen Recherchen „entgegenzunehmen“ und zu diskutieren.
Das alles ist ohne Zweifel absurd; logisch und sachgerecht ist es aber auch. Denn auf die Art bringen die Gegner des amerikanischen Irak-Kriegs das Kunststück fertig, die erpresserische Inanspruchnahme der UNO als Akklamationsorgan durch die USA und deren Kündigung des förmlichen Respekts vor fremder Souveränität zurückzuweisen, ohne das Vorgehen der Amerikaner mit einer Gegenkündigung und Gegenoffensive zu beantworten. Sie trennen sorgfältig, was die US-Regierung gerade nachdrücklich ineins setzt: den von Amerika ausgerufenen globalen Antiterror-Kampf im Allgemeinen sowie die Notwendigkeit einer durchgreifenden Kontrolle der „befugten“ Mächte über „Massenvernichtungswaffen“ in „unbefugten“ Händen auf der einen Seite – dem stimmen sie zu – und, auf der anderen Seite, die Herrschaft des Saddam Hussein im Irak als ersten Anwendungsfall der neuen amerikanischen Präventivkriegs-Strategie gegen unliebsame Regierungen – dass hier ein Fall von „terroristischer Bedrohung“ vorläge, der einen Krieg legitimieren würde, weisen sie zurück und negieren damit genau die Richtlinienkompetenz in Sachen Krieg und Frieden, die die Bush-Regierung gerade für sich reklamiert. Ihr „Nein“ gilt also durchaus dem Prinzip, das die USA mit dem „Fall“ Irak etablieren wollen: der Entscheidungshoheit Washingtons über Legitimität und Fortbestand souveräner Staatsgewalten. Dieser Einspruch wird aber ausdrücklich „bloß“ gegen das von den USA gewählte Verfahren eines sofortigen kriegerischen Vorgehens eingelegt, so als wäre ein Angriffsbefehl gegen den Irak eine bloße Verfahrensfrage und der Streit darum ein Dissens weit unterhalb der Einigkeit in der Sache. Es ergeht eine unmissverständliche Absage an Amerika als allein sich selbst verantwortliche Weltordnungsmacht und zugleich deren Dementi.
Dieses Dementi ist verlogen. Denn gerade mit dem Ansinnen, den Streit um den Irak als einen ums Procedere, um Vor- und Nachteile eines heißen Krieges im Vergleich mit stressfreien Inspektionen zu behandeln, mutet das „alte Europa“ den neuen Weltordnern in Amerika ein Abrücken von der Sache zu, die sie betreiben. Zugleich ist es den Verweigerern aber auch ernst mit ihrer Tiefstapelei. Sie verharmlosen – nicht gerade ehrlich, aber durchaus ernsthaft – ihr „Nein“ zu der neuen weltpolitischen Linie der US-Regierung, weil sie sich dieser gegenüber in einer denkbar schwachen Position wissen. Nicht nur, dass sie in dem akuten Fall nichts mehr ausrichten können – Es ist unmöglich, Bush zu hindern, mit seiner Kriegslogik bis zum Ende zu gehen
(Chirac) –; für sie ist die Lage noch viel ernster. Das Vorgehen der USA konfrontiert sie mit einem ganz fundamentalen Defizit ihrer eigenen Macht. Es führt ihnen vor Augen, wie die Bush-Regierung das Programm präventiver Terrorismus-Bekämpfung meint, dem sie selber zugestimmt haben; wie weit sie dafür geht und wozu sie dafür fähig ist; über welche Kriegsfähigkeit und -entschlossenheit also verfügen muss, wer im 21. Jahrhundert noch neben den USA – und nicht bloß als deren unselbständiges Anhängsel – als Weltordnungsmacht will auftreten können – und wie weit sie dahinter zurückbleiben. Wenn Amerika seine nationale Sicherheit so anspruchsvoll definiert, dass sie nur gewährleistet sei, wenn es mit einer allgegenwärtigen Kriegsdrohung alle potentiellen „Schurken-Regime“ unter Kontrolle bringt, nötigenfalls also auch mit einem Krieg eine als unerträglich angesehene Staatsgewalt beseitigt, dann können eben auch alle konkurrierenden Nationen sich ihrer „globalisierten“ nationalen Interessen und ihrer imperialistischen Aufsichtskompetenz nur sicher sein, wenn sie auf diesem Niveau mithalten können: Sie müssen in der Lage sein, ihrerseits alternativ zu den USA mit Garantien, Angeboten, Drohungen mit und Einsatz von Gewalt anderen Regierungen ihre Existenz zu sichern oder auch zu bestreiten. Andernfalls bleibt ihnen in letzter Instanz nichts anderes übrig, als einschlägige Entscheidungen der US-Regierung entweder mit- oder nachzuvollziehen; in vorletzter Instanz können sie hoffen, dass Amerika ihnen einigen eigenen Spielraum gewährt.
Insofern ist es ironischerweise in der Sache gar keine Heuchelei, wenn die Kriegsverweigerer dem Kriegsziel der USA, der Kontrolle der befugten Mächte über unbefugten Besitz von „Massenvernichtungswaffen“, heuchlerisch zustimmen. Sie erkennen damit an, dass die Fähigkeit, Souveräne zu entmachten, heutzutage zur Grundausstattung eines anständigen Imperialismus gehört, dass sie also nicht umhin können, sich daran zu messen. Eine Heuchelei ist es, wenn sie den Krieg als Weg zu diesem Ziel ablehnen; denn in dem Fall ist einmal wirklich der Weg das Ziel – und seine Ablehnung nichts weiter als das Eingeständnis, dass sie die Fähigkeit dazu, eine Kriegsmacht auf dem von Amerika vorgegebenen Niveau, nicht besitzen. Sie können sich – einstweilen – mit Amerika auf dem Gebiet der globalen Sicherheitspolitik nicht messen; sie haben der Welt keine wirkliche Alternative zur Weltordnungspolitik der USA anzubieten. Deswegen wollen sie sich mit ihrem übermächtigen Partner auf diesem Gebiet aber auch nicht anlegen[6] – dies der Grund dafür, dass sie ihre Absage an Amerikas Weltordnungsanspruch zugleich verleugnen. Sie räumen damit ein, dass sie als ambitionierte Weltpolitiker für ihre nationalen Interessen eine Sicherheitspolitik von der Art, wie Amerika sie ihnen gerade vormacht, ohne und alternativ zu Amerika brauchen, fürs Erste aber nicht hinkriegen und sich deswegen einen wirklichen Bruch mit Amerika nicht leisten wollen.
Der Kampf um Gefolgschaft und die Spaltung der Staatenwelt
Der diplomatische Streit, den die „alten“ Europäer den Amerikanern in New York liefern, zeugt insoweit von dem Dilemma, in das das Vorgehen der Buch-Regierung sie stürzt: Sie lehnen die verlangte Unterordnung ab, sind selber aber unfähig, einer alternativen Ordnung Geltung zu verschaffen, und erkennen daher die Alternativlosigkeit der Ordnung an, die die USA vorgeben und der sie mit ihrer Übermacht Geltung verschaffen. Sie streiten deswegen, aus Schwäche und aus Berechnung, auch gar nicht ernsthaft darum, die USA an ihrem Krieg zu hindern. Sie bemühen sich aber auch nicht mehr um eine Kompromissformel, weil sich angesichts der feststehenden Kriegsentschlossenheit der US-Regierung mit aller diplomatischen Kunstfertigkeit nicht einmal mehr der Anschein einer autonomen Mitbestimmung über Amerikas Vorgehen herstellen ließe. Umgekehrt will die amerikanische Seite auch gar nichts anderes mehr haben als eine Resolution, die die Unterwerfung der „Weltgemeinschaft“ unter die Entscheidungen des US-Präsidenten deutlich zum Ausdruck bringt. Den letzten diplomatischen Vorstoß unternimmt die britische Regierung, und das keineswegs bloß aus den viel beredeten innenpolitischen Gründen, nämlich zur Beschwichtigung der aufgeregten Regierungspartei. Die Politik des britischen Premiers ist selber ein einziger Vermittlungsversuch: Großbritannien schließt sich der amerikanischen Führungsmacht an und gestaltet seinen militärischen Beitrag so substanziell, dass der glaubwürdige Schein eines britisch-amerikanischen Gemeinschaftswerks entsteht. Diese Fiktion versucht Premier Blair noch kurz vor Kriegsbeginn durch eine Resolution zu untermauern, die mit einem auf Unerfüllbarkeit angelegten Ultimatum an den irakischen Machthaber – Saddam Hussein soll sich in seinem staatseigenen Fernsehen der Lüge bezichtigen und den Besitz von „Massenvernichtungswaffen“ zugeben sowie deren Vernichtung nachweisen – den widerspenstigen Verbündeten entgegenkommt, indem sie für deren Zustimmung den Vorwand eines eindeutigen Verstoßes der irakischen Seite gegen UNO-Auflagen konstruiert; zugleich trägt sie dem unbedingten Kriegswillen der US-Regierung Rechnung, indem sie der schlimmstenfalls das Zugeständnis einer letzten Galgenfrist vor dem Angriffsbefehl zumutet. Die Initiative scheitert, noch bevor überhaupt ein Resolutionstext entworfen ist. Das „alte Europa“ beharrt darauf, dem Krieg der USA, den es nicht verhindern kann und deswegen auch nicht behindern will, die Legitimation zu versagen und so dem Führungsanspruch der Weltmacht zumindest die bedingungslose Gefolgschaft zu verweigern. Die US-Regierung ihrerseits will das Widerstreben ihrer Verbündeten nicht einmal der Form und dem Schein nach mit Rücksichtnahme honorieren, sondern ihre „Koalition der Willigen“ zusammenschmieden und die Unwilligen einschließlich der UNO in aller Form ins Abseits stellen; deswegen lehnt sie die britische Initiative nicht etwa höflich ab, sondern blamiert deren Urheber weltöffentlich mit dem Hinweis, Amerika könne den Krieg übrigens auch ohne britische Unterstützung sofort beginnen, falls man in London wegen allzu großer innenpolitischer Schwierigkeiten doch lieber nicht mitmachen wolle – so stabilisiert eine Weltmacht ihre „special relationship“ mit einem Helfershelfer.
Das diplomatische „Tauziehen“ dokumentiert am Ende nur mehr die Unversöhnlichkeit der entgegengesetzten Positionen. Eine praktische Zielsetzung verfolgen beide Seiten damit freilich auch noch. Sie versuchen, möglichst viele „dritte“ Staaten auf ihre Seite zu ziehen; die USA, um ihre Gegner mit einer möglichst umfangreichen Kriegskoalition zu beeindrucken, diplomatisch auszumanövrieren und – auf längere Sicht – wieder auf Linie zu bringen; die Kriegs-Unwilligen, um umgekehrt Amerika mit einem kraftvollen Mehrheitsvotum gegen seinen neuen Kurs zu konfrontieren und darauf zu hoffen, dass es – irgendwann – seine Linie der offensiven imperialistischen Rücksichtslosigkeit nicht mehr durchhalten kann oder nicht weiter fortsetzen will. Tatsächlich kommt eine gewisse Spaltung der „Völkerfamilie“ zu Stande. Sie sortiert sich in solche Mitglieder, die ihre nationale Zukunft im „Schulterschluss“ mit der „letzten verbliebenen Supermacht“ am besten aufgehoben sehen und dafür den Schein nationaler Autonomie in weltpolitischen Dingen gerne in Washington abliefern, und in eine Fraktion der mehr oder weniger „Unwilligen“ auf der anderen Seite. In der geben die Konkurrenten der Weltmacht den Ton an, die sich mit der Rolle des Erfüllungsgehilfen amerikanischer Weltordnungskonzepte und Präventivkriege auch dann nicht zufrieden geben, wenn sie sich eingestehen müssen, dass sie auf sich allein gestellt einen Imperialismus auf dem von Amerika vorgegeben Niveau auf absehbare Zeit nicht hinkriegen. Anklang finden sie bei einer Menge Regierungen, die – in etlichen Fällen aus nicht unberechtigter Sorge um ihren eigenen Fortbestand – nicht auch noch zustimmen wollen, wenn die Amerika ihre Souveränität unter seinen Genehmigungsvorbehalt stellt.[7]
Im Sicherheitsrat bleibt die letztere Partei in der Mehrheit; das angekündigte Veto Frankreichs gegen jede Legitimation des Kriegs der USA stabilisiert die Ablehnungsfront. Die Vereinten Nationen versagen den Vereinigten Staaten die Akklamation. In deren Sicht hat die „Weltorganisation“ sich damit blamiert. Nicht der Weltmacht ist die Instrumentalisierung der Diplomatie für ihren Zweck misslungen, sondern das Instrument hat den Zweck verfehlt, für den allein es da ist: Die UNO ist gescheitert
(Bush), und damit ist das Fenster der Diplomatie geschlossen
(Powell). Dixit, und damit war es auch zu.
„Ende der Diplomatie“? Schön wär’s.
Im Hinblick auf die hierzulande verbreitete, eher konservative Lesart vom Scheitern der Diplomatie
ist noch eines anzumerken. So wenig, wie die Diplomatie jemals dazu da war, einen Krieg zu verhindern, so wenig hat sie diesmal bei der Verhinderung eines Kriegs versagt. So, wie sie schon immer im außenpolitischen Erpressungsgeschäft der Staaten dazu gut war, deren Gegensätze mit der Heuchelei des Ringens um Einvernehmlichkeit auszutragen und zugleich zu übertünchen, so funktioniert sie auch hier – bis sie eben am Ende
ist. Das ist in dem Moment der Fall, in dem die USA die politische Hauptsache, um die es ihnen geht, auch wieder zur Hauptsache machen. Auch ohne völkerrechtliche Legitimation verfügen sie ja über die überlegene Gewalt, Fakten zu setzen und mit denen das zu schaffen, was für alle anderen verbindlich zu sein hat. Das ist dann zwar nicht mehr der alte weltpolitische Rechtszustand im Sinne des Völkerrechts, die korrekte Grundsteinlegung eines neuen aber schon. Dem fehlt nur noch seine Anerkennung durch den Rest der Völkerfamilie – und dafür ist demnächst wieder sehr viel Diplomatie gefragt.
B. Der Krieg: Die Weltmacht kämpft und argumentiert mit „shock and awe“[8]
Seitdem es kracht, der Krieg gekommen ist
, fragen die nicht teilnehmenden Konkurrenten ziemlich nervtötend, ob er’s bringt. Jetzt bezweifeln sie weniger, ob die USA den Irak erledigen und der Staatenwelt ihre Regime aufherrschen dürfen – ihr Feinsinn verlegt sich auf die Prüfung der amerikanischen Gewaltorgie daraufhin, ob die USA „es“ auch können.
Das Material für diese Prüfung liefern der Kriegsverlauf und seine wirklichen wie erwarteten Ergebnisse. Als Maßstab dienen sämtliche Ansagen, mit denen die USA ihren Aufbruch begründet und gerechtfertigt, in denen sie ihre Kriegsziele umschrieben und den Erfolg, den sie meinen, bebildert haben. So gestalten sich Wahrnehmung, Berichterstattung und Kommentare recht übersichtlich. Dem Kriegsgeschehen lässt sich prima entnehmen, ob die Freiheitlichen mit ihren Aktionen im Plan liegen, ob die versprochenen Errungenschaften in greifbare Nähe rücken, inwieweit sich die Segnungen abzeichnen, auf die die Welt warten soll. Oder dass der Verlauf des Zerstörungs- und Tötungswerks ganz im Gegenteil offenbart, dass dieser Krieg ein Irrweg ist, weil die USA gar nicht vermögen, was sie sich an unanfechtbarer Kontrolle zum Zwecke der Weltverbesserung vorgenommen haben. So hauen sich die verschiedenen Lager in wohlausgewogenen Lagebeurteilungen öffentliche Belege dafür um die Ohren, wie viel bzw. wenig der eingeschlagene Weg taugt, um den Irak zivil und die terrorverdächtige Staatenwelt handlicher zu machen. Der Krieg wird zum Material für den fortgesetzten Streit um die richtige Welt- und deren Geschäftsordnung.
„Operation Irakische Freiheit“: Ein „beispielloser Krieg“ für die neue Weltordnung
Die USA setzen sich über alle Bedenken und Einwände hinweg und marschieren mit ihren Alliierten in den Irak ein. Der erste Beweis, auf den die Bush-Regierung es angelegt hat, ist damit schon erbracht: Die Vereinigten Staaten lassen sich nichts verbieten; was sie sich vornehmen, tun sie auch. Und der zweite Nachweis stellt sich auch sofort ein: Keine offizielle Stelle erhebt Einspruch gegen einen „verbrecherischen Angriffskrieg“ oder dergleichen; kein völkerrechtliches Verfahren wird angestrengt, keine politisch bedeutsame Verurteilung der USA wird ausgesprochen; also brechen nicht sie die zwischenstaatliche Geschäftsordnung, die auf den hochgestochenen Namen „Völkerrecht“ hört, sondern die in deren Namen vorgebrachten Einwände sind ihrer Wirkungslosigkeit, die einschlägigen Paragraphen der UNO-Charta ihrer Irrelevanz, ihrer praktischen Ungültigkeit im Falle amerikanischer Kriegsentscheidungen überführt. Die Gegner des Kriegs, die sich bis zuletzt auf die von der UNO gehüteten heiligen Kühe des „Rechts der Völker“ berufen haben, sind düpiert: Wenn Amerika entscheidet, haben sie nichts zu sagen.
Jetzt gilt es also:
„Die Kampagne für Entwaffnung und Regimewechsel hat begonnen. Wir werden kein anderes Resultat akzeptieren als den Sieg.“ (Commander in Chief G.W.Bush)
Und das ist noch das Wenigste. Mit ihrem Kampf bis zum Sieg, so wie der Oberbefehlshaber ihn ansagt, gedenken die USA eine Demonstration abzuliefern: Die Staatenwelt soll erleben und erkennen und sich merken, dass eine US-Regierung nie eine leere Drohung in die Welt setzt, sondern meint, was sie sagt, und vollstreckt, was sie meint; Punkt für Punkt, unbeirrbar, unwiderstehlich und überwältigend erfolgreich. Deswegen geht es nicht darum, dass die alliierten Truppen überhaupt einen Sieg erstreiten, schlecht und recht, oder gar dass sie nicht vorher aufhören. Darauf, wie sie gewinnen, kommt es an, und zwar in mehrerlei Hinsicht: Schockierend müssen die Militärschläge ausfallen, einen heiligen Schrecken verbreiten; Terror vom Feinsten ist fällig, damit alle Feinde Amerikas die völlige Aussichtslosigkeit ihrer Feindschaft einsehen; damit alle wirklichen und potentiellen Sympathisanten des antiamerikanischen Terrorismus ein für alle Mal von ihrer moralischen Verirrung geheilt sind; damit wankelmütige Nationen begreifen und beherzigen, dass sie zur Kooperation mit Amerika keine Alternative haben, weil letztlich ein von modernsten Waffen entfachtes Inferno ihre einzige Alternative ist. Diese Demonstration muss außerdem souverän und mühelos über die Bühne gehen, um die zuguckende „Völkerfamilie“ unwidersprechlich davon zu überzeugen, dass dieser Krieg tatsächlich kein Einzelfall ist, sondern ein allgemeingültiger Präzedenzfall, zu jeder Zeit und an jedem Ort zu wiederholen, wenn es einer US-Regierung darauf ankommt; im Sinne dieses Beweisziels gilt es anschaulich vorzuführen, dass auf amerikanische Kriegsmüdigkeit nicht zu hoffen, eher mit einer Selbstermunterung der Vereinigten Staaten zu unbefangenerem Einsatz ihrer Militärmacht zu rechnen ist. Die Lektion gilt nicht bloß mehr oder weniger ohnmächtigen „Schurken“-Regimes. Auch und nicht zuletzt die bedeutenderen Mächte mit eigenen „geopolitischen“ Interessen sollen realisieren, dass die USA in der Lage, bereit und entschlossen sind, überall und in jede fremde Interessensphäre hinein zuzuschlagen, wo eine Regierung in Washington einen antiterroristischen Ordnungsbedarf entdeckt; was ja immerhin bedeutet, dass keine andere Großmacht sich ihrer Interessen an und in irgendeinem „dritten“ Staat sicher sein kann und kein Land mehr noch irgendeine Freiheit hat in der Wahl seiner imperialistischen Paten. Die Demonstration eines total „asymmetrischen“ Kräfteverhältnisses zwischen amerikanischer und irakischer Militärmacht muss daher auch der kritischen Analyse durch die militärischen Profis der rivalisierenden Partner Amerikas standhalten und schon gleich den Experten der öffentlichen Meinungsbildung das Maul stopfen, die den alliierten Truppen lange andauernde Kämpfe und unabsehbare eigene Verluste prophezeien und bereits Wetten anbieten, ab wann die amerikanische Öffentlichkeit nicht mehr mitspielt.
Also warten die Amerikaner am Golf mit einem noch nie dagewesenen, geschweige denn so konzentriert zum Einsatz gebrachten Aufgebot an modernsten Kriegsmitteln auf. Mit der Darbietung exklusiver und konkurrenzloser Massenvernichtungswaffen, die ihr Besitzer nicht versteckt, sondern gebraucht, mit einer „Boden-Luftoffensive“, der Invasion von „250.000 High-Tech-Soldaten“ und dem Abwurf „tausender Präzisionsbomben“ wollen die USA einen erklärtermaßen beispiellosen Krieg
gewinnen: einen Krieg, der dem Feind keine Abwehrchance lässt, ihm im besten Fall seine Ohnmacht so drastisch vor Augen führt, dass seine Soldaten gleich kapitulieren, wozu sie per Flugblatt und Radio auch nachdrücklich aufgefordert werden. Das Vorzeigen der eigenen Waffenkammer wie der Test der 9,5 Tonnen schweren „Mother of all bombs“ kurz vor Kriegsbeginn ist ebenso Teil dieser „psychologischen Kriegsführung“ wie das Abfeuern von „3000 Raketen in 48 Stunden“. Zum Beweis, wie leicht ihnen dieses Feuerwerk fällt und dass sie mit zwei Kriegsschauplätzen noch lange nicht überfordert sind, führen die USA zeitgleich in Afghanistan die „Operation Tapferer Schlag“ gegen Al Kaida-Kämpfer durch, und die Weltpresse kapiert natürlich sofort, worum es geht: Saddam und Bin Laden an einem Tag, das wäre ein Triumph!
Dabei nimmt die Weltmacht sich allen Ernstes vor, neben der Entfaltung eines Feuerzaubers, der den Feind in einen „Schock“-Zustand versetzt und die Welt mit „Ehrfurcht“ erfüllt, auch noch zu demonstrieren, dass sie es dafür noch nicht einmal nötig hat, wie einst in Dresden oder Hiroshima ganze Städte anzuzünden und alles kaputt zu machen, was doch einer neuen Verwendung im Sinne und Dienste amerikanischer Interessen zugeführt werden soll. Von Satelliten oder sonstwie präzise gesteuerte Bomben und Raketen sollen die regierenden „Schurken“ in ihren Palästen liquidieren und ihre kasernierten Garden auslöschen, während nebenan der Alltag des Volkes unter Sirenengeheul und voller Beleuchtung weitergeht. So soll in seinem militärischen Vollzug die imperialistische Idee des ganzen Unternehmens sichtbar werden: Aus einer ansonsten ganz brauchbaren Staatenwelt wird das „Krebsübel“ des – sei es wirklich, sei es potentiell – bewaffneten Antiamerikanismus sauber herausoperiert. Wieder einmal wird Krieg also „nicht gegen das Volk“ geführt – „nur“, das freilich um so härter, gegen seine uniformierten „Söhne“ –; angesichts der „80% Präzisionsbomben“, die seine Mannen abwerfen, erklärt der zuständige Minister mit dem ihm eigenen Sarkasmus den Krieg überhaupt zu einem „Akt der Humanität“ (Rumsfeld) – ein schöner Einfall, die verbesserte Technik, die eine unerwünschte Streuwirkung verringert, die erwünschte Trefferquote also erhöht, als Schonung all der Iraker zu verkaufen, die das Spitzengerät dankenswerterweise nicht erwischt.
Beabsichtigt ist also ein Gesamtkunstwerk aus Ehrfurcht gebietendem militärischem Terror und einem dabei bewiesenen Differenzierungsvermögen, das dem Terror das Odium des Blindwütigen nehmen soll, um ihm statt dessen das Gütesiegel der Unentrinnbarkeit hinzuzufügen. Das muss der staunenden Völkergemeinschaft selbstverständlich präsentiert werden; „hautnah“, damit es dem eigenen wie dem auswärtigen Publikum unter die Haut geht und hier Kriegsbegeisterung, dort Pro-Amerikanismus stiftet. Hunderte Journalisten sind deswegen nicht bloß in den militärischen Alltag der kämpfenden Truppe „eingebettet“, sondern in die Beweisführung der US-Regierung: „Shock and awe“ sollen überall zu sehen sein; Menschen in aller Herren Länder gucken Krieg am Fernseher, dürfen fragen, wie’s zur Halbzeit in Bagdad steht, und sollen erleben, wozu amerikanische Jungs im Ernstfall fähig sind.
Imperialistische Betroffenheit in Europas amerika-kritischem Lager
Die Kriegs-Kritiker aus dem „alten Europa“ finden sich mit Kriegsbeginn in eine denkbar peinliche Zuschauerrolle versetzt. Zwangsweise wohnen sie einer Vorführung überlegener Kriegsgewalt bei, die nicht zuletzt auf sie gemünzt ist und auf ihre Kosten geht: Ihre Einwände gegen die Legitimität des amerikanischen Vorgehens sind als vollständig irrelevant blamiert; aus dem Geschehen, das am Golf und überhaupt neue strategische und weltordnungspolitische Fakten schafft, sind sie ausgemischt und können nichts dagegen machen.
Stellung nehmen können sie immerhin; und das tun sie auch. Von ihrer Linie, den Kriegszweck heuchlerisch zu billigen, um den Krieg als verfehlte Methode – und damit Amerikas eigentliche „Botschaft“ – in Zweifel zu ziehen, gehen sie dabei nicht ab. Sie passen sie der neuen Sachlage an und werfen sich auf die kritische Begutachtung der angewandten „Methode“, nämlich der Art und Weise, wie die USA ihren Krieg führen. Öffentlich bezweifeln sie die Aussichten auf einen dermaßen reibungslosen Erfolg, wie die Amerikaner ihn zu inszenieren gedenken, „warnen“ vor unabsehbar verlustreichen Häuserkämpfen in Bagdad; gar nicht klammheimlich hoffen sie auf Schwierigkeiten der USA, den Beweis ihrer überall und jederzeit aktionsbereiten militärischen Supermacht zu führen, den sie ganz zu Recht als schwere Niederlage in ihrem Bemühen um ein Stück konkurrierender Weltordnungsmacht fürchten. Freilich können sie sich über das reale Kräfteverhältnis vor Ort so sehr viel dann doch nicht vormachen. Deswegen nehmen sie die Absurditäten der US-Ideologie vom menschenfreundlichen Befreiungskrieg dankbar auf: Während Präsident Bush sich in die Pose des Beschützers aller orientalischen Witwen und Waisen wirft und verspricht, das Zweistromland vom „Tyrannen“ zu befreien, der sein Volk vergewaltigt und Babies verhungern lässt
– der Afghanistan-Witz von den Bomben gegen Schleierzwang in passender Neuauflage: Imperialismus als Frauenhaus und Kinderhilfswerk… –, beschwören die Kollegen Chirac und Schröder vorauseilend die Schrecken des Krieges, ein Katastrophenszenario mit Massen von „unschuldigen Opfern“, gewaltigen Flüchtlingsströmen und dergleichen mehr. Die demokratische Öffentlichkeit trifft stimmungsmäßig Vorsorge mit dem aufklärerischen Hinweis, das ganze Grauen des Krieges würde „wieder einmal“ gar nicht richtig ‚rüberkommen; vor allem deswegen, weil kriegskritische Spitzenreporter aus der „alten Welt“ von den US-Militärs überhaupt nicht so zuvorkommend behandelt werden, wie es der Maßstab gebietet, an dem man Amerikas Freiheitskampf am Golf blamieren möchte. Noch schöner, weil noch weniger zu entkräften sind die Einwände auf der nächsthöheren ideologischen Ebene: In dem Maß, wie sich die Bush-Regierung darauf versteift, ihren Feldzug als einen solchen für die Demokratisierung des Irak und der Region überhaupt zu verkaufen, finden die Kriegs-Gegner Gefallen an dem Bedenken, ob sich diese wunderbare Staatsform erstens überhaupt, zweitens mit militärischen Mitteln, drittens ausgerechnet in den Nahen Osten exportieren lasse. Natürlich sind sich beide Seiten völlig einig in der fraglosen Wertschätzung dieses Exportartikels; niemand denkt sich mehr dabei als das dumme Ideal freiheitlicher Herrschaft, niemand zweifelt deswegen auch daran, dass das Ding selbstverständlich eigentlich überall hin gehört. Dass die Bush-Leute ihre Kriegsziele so gerne mit dem Ehrentitel „Demokratisierung“ belegen, wirft deswegen für die europäischen Verächter der Veranstaltung keinen Schatten auf das propagierte hohe Gut; schon gar nicht den einer Ahnung, dass es um die Verallgemeinerung des Systems bürgerlicher Herrschaft und dabei um die imperialistischen Interessen der demokratischsten aller Gewaltherrschaften auf der Welt geht, und dass deswegen diesem Inbegriff der Menschenwürde ein flächendeckender militärischer Terror als Startbedingung durchaus gut zu Gesicht steht. Zweifel möchte man an der Bereitschaft und, mit allem Respekt, an der Eignung des Adressaten angemeldet haben, mit seinem so „ganz andersartigen kulturellen Hintergrund“ und seiner völligen Unvertrautheit mit den Sitten und Gepflogenheiten der einzig menschengemäßen Staatsordnung das von Mister Rumsfelds Soldaten überbrachte politische Care-Paket aus Amerika überhaupt sachgerecht entgegenzunehmen und zu verwenden. Dabei geht es nicht so sehr darum, den Arabern kollektive politische Unreife nachzusagen. Hauptsächlich möchte man den Absendern in Washington sträfliche Naivität bei ihrem Weltbeglückungsunternehmen vorwerfen und, auf der Ebene wenigstens, ein sicheres Scheitern vorhersagen. Die kongeniale Antwort lässt natürlich nicht auf sich warten: Die härtesten Vertreter der Gleichung, wonach wahre Freiheit samt kapitalistischem „pursuit of happiness“ nur in den USA so richtig zu Hause und letztlich doch nur dem eingeborenen Ami zweifelsfrei angeboren ist, bestehen großmütig darauf, dass letztlich sogar noch im Araber ein kleiner Amerikaner steckt; bei Hitlers Deutschen hätte sich dieses Geheimnis der Menschennatur doch auch schon aufs Schönste bewahrheitet…
Der Krieg kommt unterdessen in Fahrt.
Die wechselnden Botschaften des Kriegsverlaufs
Die ersten zwei Wochen: Ein Blitzkrieg unter aller Kritik
Amerikanische Raketen und Flugzeuge bringen enorme Sprengladungen punktgenau ins Ziel. Sie erwischen Saddam Hussein zwar nicht persönlich, dafür aber vieles von seinen letzten Machtmitteln, hunderte bis tausende Soldaten vor allem. Freilich gibt es auch die vorhergesagten „Kollateralschäden“ an Kliniken und belebten Marktplätzen; die Schuld daran teilen sich letztlich unvermeidliche technische Pannen, für die niemand etwas kann, auf alliierter Seite und die Bösartigkeit eines Regimes, das seine Zivilisten, wo auch immer sie herumlaufen, als „menschliche Schutzschilde“ missbraucht und sich überhaupt in verbrecherischer Weise weigert, seine Waffen samt Personal und Rüstungsindustrie säuberlich getrennt von allem sonstigen nationalen Inventar zur Vernichtung durch US-Bomber in der Wüste aufzustellen. Der Vormarsch am Boden kommt gleichfalls enorm schnell voran, auch ohne gescheite Nordfront und vor allem ohne jede Behinderung durch den zentralen Kriegsgrund der Alliierten: Von irgendwelchen Befürchtungen hinsichtlich irakischer „Massenvernichtungswaffen“ wird Rumsfelds „Blitzkrieg“ nicht irritiert, geschweige denn aufgehalten. Aus Gründen, die den militärkundigen Beobachtern ein völliges Rätsel bleiben, ist weder von der vom Pentagon postulierten „roten Linie“ um Bagdad herum etwas zu bemerken, bei deren Überschreiten angeblich mit letzten Verzweiflungstaten des „sterbenden Regimes“ zu rechnen wäre, noch von einer „Strategie der verbrannten Erde“, wie man sie von einem größenwahnsinnigen Diktator eigentlich erwartet hätte; nicht einmal strategisch wichtige Brücken werden von der irakischen Armee rechtzeitig gesprengt.
An der militärischen „Entwicklung“ liegt es jedenfalls nicht, dass sich in den ersten 20 Tagen sogar bei manchen Meinungsmachern auf alliierter Seite Bedenken über den Kriegsverlauf breit machen: Saddam doch nicht an Tag 1 erwischt! Unerwartete Verluste gegen einen unterlegenen Feind! Schon wieder Opfer durch „friendly fire“ und technisches Versagen! „Überraschender Widerstand“ der feindlichen Armee schon vor Bagdad! „6000 Raketen pro Woche“ und noch immer keine Kapitulation! „Unfaire Guerilla-Taktik“ der Iraker, die im eigenen Land „aus dem Hinterhalt“ schießen, die langen Nachschublinien angreifen, alliierte Truppen in Kämpfe verwickeln und sogar Gefangene machen! Fehlt womöglich doch die Nordfront? Hat Rumsfeld verfrüht zuschlagen lassen und verspätet für 100.000 Mann Verstärkung gesorgt? Wurde der Feind unterschätzt oder die falsche Strategie gewählt? Warum schwenkt das Volk keine US-Fahnen: Versteht es unsere Flugblätter nicht, will es vielleicht gar nicht befreit werden? Usw. Die Skeptiker an der Heimatfront messen das Kriegsgeschehen allen Ernstes an dem Ideal eines sofortigen perfekten Erfolgs, auf dem Schlachtfeld wie bei der Vereinnahmung des „befreiten“ Volkes; von diesem Maßstab her registrieren sie Defizite und spiegeln auf die Art ein Problem wider, freilich eines der allerhöchsten imperialistischen Güteklasse, das ihre Führung tatsächlich hat. Der geht es nämlich um den überall sichtbaren Beweis eines „noch nie da gewesenen“ Krieges. Darum und dafür spielen Dauer und Reibungslosigkeit des Zerstörungs- und Tötungswerks eine extra Rolle; darum sollen Raketen nicht nur Bunker brechen, sondern auch gleich jeden Widerstandswillen; darum will Amerika Iraker sehen, die sich der Übermacht nicht nur beugen, sondern vor ihr den Hut ziehen. Eine Supermacht, die ihren Krieg nicht als Kampf von halbwegs gleich zu gleich, sondern als Rollkommando überlegener Gewalt anlegt, erwartet wenig Widerstand und verdient auch keinen: Nur von diesem Standpunkt aus ist die Weigerung des „sterbenden Regimes“, seine Verwerflichkeit zu gestehen und abzutreten, „überraschend“ und belegt ein zweites Mal dessen Vernichtungswürdigkeit; nur von diesem Standpunkt aus ist die anfängliche Gegenwehr der irakischen Armee verwunderlich und der Nationalismus des Volkes eine Entdeckung wert; nur von diesem Standpunkt ist die Vorführung alliierter Kriegsgefangener ein völkerrechtswidriger Angriff auf das Foltermonopol der USA. Von dem Standpunkt aus beurteilt zieht der Krieg sich bereits nach wenigen Tagen in die Länge und fehlt ihm der gebührende Glanz. Keine Frage, welcher „Schluss“ daraus folgt: Weiter machen, besser machen.
Im nicht-schießenden Teil Europas sieht man sich bestätigt: Der Krieg „bringt es nicht!“ „Jeder Tag, den der Krieg andauert“, beweist das mehr. Die Kritiker nehmen Maß am angestrebten Beweis fragloser amerikanischer Übermacht und notieren ‚Irrweg & Unvermögen‘ in ihr Kriegstagebuch. Was die USA im Irak tun, ist schlecht, weil es schlecht gemacht wird. Einen „Krieg, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat“, haben die USA versprochen – nach 3 Tagen ruft die Welt: Alles schon da gewesen! Auf einen Blitzkrieg hat man uns eingestellt: Nach Woche 1 warten wir noch immer gespannt auf den Vollzug von Entwaffnung und Regimewechsel. Wo bleiben das ruhmreiche Überfallkommando am Boden und die Enthauptung aus der Luft? Jeder tote alliierte Soldat, jedes „friendly fire“, jeder abgestürzte Flieger, jeder Tag, den der Vormarsch „stockt“, eine kleine Niederlage: Droht den USA schon wieder „ein Desaster wie in Vietnam“? Und „das Märchen vom chirurgisch sauberen Krieg“ ist ja wohl gar nicht wahr, wenn überall „tote Zivilisten“ herum liegen: So gewinnt man keine Anhänger, weder im Kriegsgebiet noch sonstwo auf der Welt! Als hätten Bush und Rumsfeld Datum und Uhrzeit des Sieges vorhergesagt und Heldentode beim Umlegen des Feindes gar nicht eingeplant; als wüsste man nicht, dass „Kollateralschäden“ in Wohnvierteln zwar tragisch sind, aber immer Untertanen der fremden Obrigkeit treffen, kriegslogisch also nie die ganz Falschen; als müsste das abstruse Ideal vom sauberen Krieg gegen seine amerikanischen Erfinder verteidigt werden: so zieht das kriegs-kritische Europa Bilanz. Reportagen über Sandstürme, wehrhafte Fedajin und tote Kinder – in dem Ton: ‚Nicht mal die Natur und einen schwachen Feind beherrscht der Ami: Wie will er da die Welt beherrschen?!‘ – und Filmberichte, auf denen keine Jubeliraker zu sehen sind, bebildern den Befund, den man gerne hätte: Der Krieg bringt es nicht! Amerika mag der gute Hegemon sein wollen, aber seht, er ist dazu nicht fähig! Uns überzeugt dieser Krieg nicht! Was so viel heißen soll wie: Wenn die Macht der USA nicht so durchschlagend wirkt, wie die Supermacht das anstrebt, dann ist das Recht, das sie daraus herleitet, auch nicht sakrosankt.[9]
Immerhin bleibt bei aller kaum verhohlenen Genugtuung über – wirkliche oder vermeintliche, auf jeden Fall der Demonstrationsabsicht der „Supermacht“ abträgliche – militärische Schwierigkeiten und Rückschläge der US-Armee die ‚Solidarität der Demokraten‘ wenigstens auf dem Feld der politischen Humanität im Prinzip auch diesseits des Atlantik noch intakt. Sympathie mit der irakischen Seite kommt nicht auf, allenfalls die berechnende mit deren Opfern, und da selbstverständlich bloß mit den „unschuldigen“. Das flächendeckende Abschlachten der uniformierten Volksteile aus überlegenen Positionen heraus ist keine, schon gar keine kritische Erwähnung wert; die dafür verwendeten technologisch hochstehenden Massenvernichtungswaffen wie Streubomben gegen „harte“ und „weiche“ Ziele oder auch die panzerbrechende Uran-Munition stoßen wegen der unbeabsichtigten und unkontrollierbaren Nach- und Spätwirkungen nicht explodierter Teile bzw. des radioaktiven Staubes auf menschenrechtliche Kritik. Der „Martyrerkult“, der selbstverständlich keiner ist, um die paar verstorbenen alliierten Soldaten bezeugt im Kontrast dazu, wie gut der gesamtwestlich-demokratische Rassismus noch funktioniert.
Die Wende: Ein Erfolg, der Mittel und Zweck heiligt
Am 21. Kriegstag nehmen amerikanische Truppen praktisch ohne Gegenwehr die Hauptstadt militärisch in Besitz. Die feindliche Führung entkommt zwar, wahrscheinlich, einem neuerlichen Bombenattentat der US-Luftwaffe auf ein Lokal, in dem man sie vermutet hat, taucht aber endgültig ab. In keinem Stadtviertel kommt es auch nur ansatzweise zu dem „langen und blutigen Häuserkampf“, dem „Albtraum“ aller vorher befragten Experten; die Marines zerren nicht mehr als ein paar eingeschüchterte Familien vor ihre Flinten und die Kameras, die ihnen beim Erobern über die Schulter gucken. Und blitzartig kehrt sich alles um. Der Erfolg blamiert alle Einwände gegen die angewandten Mittel; wären nicht zwei westliche Fernsehleute als Opfer einer kaum zufällig auf das Journalisten-Hotel in Bagdad abgefeuerten amerikanischen Panzergranate zu beklagen, gäbe es erst mal gar keinen Stoff für Beschwerden mehr. Was das Pentagon angepackt hat und wie, das erweist sich rückwirkend als goldrichtig. Weil bzw. soweit mehr als die angebliche Untauglichkeit der Vorgehensweise gar nicht zum Einwand gemacht worden ist, ist der Krieg durch den Sieg glanzvoll ins Recht gesetzt.
Dieses Ergebnis wird nachdrücklich zur Schau gestellt, damit auch jeder die Bedeutung des amerikanischen Triumphes mitkriegt. Der faktischen Entmachtung des alten Regimes folgt seine moralische Liquidierung. Dafür leisten die albernen Symbole des nunmehr beendeten undemokratischen Personenkults den siegreichen Demokraten, die sich in dem Metier bestens auskennen, einen letzten guten Dienst: In aller Welt, in beliebig vielen Wiederholungen, gerne auch in Zeitlupe zeigt das freiheitliche Fernsehen den Sturz einer Saddam-Statue in Bagdad, offenbart die billige Röhrenkonstruktion, die im Innern für einen Schein von Stabilität gesorgt hat, vervielfältigt den verdienten Applaus der Massen für die Panzer der neuen Herren, die dem Befreiungsakt logistisch zum Erfolg verhelfen. Das Schauspiel bedient nicht bloß die Bombenstimmung daheim in Amerika. Es zielt direkt auf die Moral der arabischen Völkerschaften ringsum, die ihre patriotischen Hoffnungen – auf ein neues arabisches Zeitalter, auf eine neue islamische Sittlichkeit, auf Entschädigung für alle Niederlagen im Kampf gegen Israel und alle Demütigungen durch Israels Schutzmacht… – auf Saddam Hussein und dessen „Widerstand“ gegen das übermächtige Amerika gesetzt haben. Der Erfolg ist durchschlagend. Was sich in der arabischen Welt an Widerstandsgeist geregt, zum Teil auch in großmächtigen Pro-Hussein-Demonstrationen Luft gemacht hat, bricht schlagartig in sich zusammen. Die allgemeine Fassungslosigkeit straft alle Experten Lügen, die militante Reaktionen der arabischen Massen auf Amerikas militärischen Terror prognostiziert hatten; Recht behalten die Praktiker der Volkspsychologie in Washington, die als erfahrene Demokraten auf die unwiderstehliche Überzeugungskraft erfolgreicher Gewalt bei der Erziehung von Untertanen setzen.
Dieser Erfolg komplettiert die Botschaft, die mit der problemlosen Einnahme Bagdads an die widerspenstigen Verbündeten und ambitionierten Rivalen der Weltmacht ergeht und vom zuständigen Minister mit dem Bekenntnis erläutert wird, er für seinen Teil fände den Vorgang der symbolischen Liquidierung Saddam Husseins ungefähr genauso „breath-taking“ wie neulich den „Fall des Eisernen Vorhangs“, und wie damals beginne auch jetzt ein neues Kapitel der wunderbaren Ordnung, die Amerika der Welt spendiert. Denn mit dem „end of state“ im Irak steht ja wohl fest: Nicht bloß – wie von den Kriegs-Verweigerern stets eingeräumt – das Ziel der USA, auch der eingeschlagene Weg der militärischen Gewalt geht in Ordnung. Und was sich soeben im Irak, gegen den Tyrannen von Bagdad, so glanzvoll als richtig erwiesen hat, das kann in der damit angebrochenen Zukunft nicht verkehrt sein: Amerikas Freiheit zur Kriegführung ist das neue Grundgesetz der Welt. Der US-Präsident selber stellt das auch noch persönlich mit einer zurückhaltend-bescheidenen Würdigung des Etappensiegs von Bagdad klar: Für die Sicherheit der neuen Ordnung, so seine Warnung an eventuelle Überreste der alten Herrschaft im Irak, die zugleich vom Rest der Staatenwelt als wohlmeinende Drohung ernst genommen und beherzigt werden sollte, gibt es noch einiges zu tun – Victory is certain but not complete.
Das „alte Europa“ ist natürlich beeindruckt. Es kommt um das Eingeständnis nicht herum, dass die USA tatsächlich vermögen, wozu sie wild entschlossen sind. Während Kriegsteilnehmer England sich immerhin seines Gewaltbeitrags als Befreier von Basra rühmen kann, der außerdem viel netter zu den Menschen war als die „US-Rambos“, hat das Lager der Kriegsdienstverweigerer ein Problem: Den Sieg der Alliierten hat es nicht bestellt, erst recht nichts für ihn getan; dem Kriegsergebnis, mit dem nun wieder Frieden herrscht, will man seine Anerkennung weder einfach erteilen, noch kann man sie ihm versagen. „Für eine schnelle Beendigung der Kampfhandlungen“, für „den Frieden“ haben Fischer und de Villepin immerzu „geworben“; nun haben sie ihn und damit das Ergebnis, das sie gar nicht haben wollten: Natürlich herrscht nicht „der Frieden“, sondern Amerika. Also feilen sie an eindeutig zweideutigen Komplimenten ohne Adresse – Schröder: Jeder Tag, den der Krieg eher zu Ende geht, ist ein guter Tag!
– und gequälten Respektsbekundungen für eine neue Weltlage, an der eh nichts mehr zu ändern ist – der Sieg der USA müsse „de facto“ anerkannt werden und gebiete, „ob es uns gefällt oder nicht“, einen „pragmatischen Umgang“. Damit beurkunden sie einerseits, dass sie nicht umhin können, sich der normativen Kraft amerikanischer Übermacht zu beugen. Andererseits melden europäische Imperialisten, die es zu „Pragmatismus“ drängt, unüberhörbar an, dass sie nicht nur irgendwie dabei sein wollen, wenn über den Irak und am „Fall“ Irak darüber entschieden wird, wie es nach dem Blitzsieg der USA überhaupt weiter geht mit der Weltordnung: Im Bewusstsein ihrer beschränkten Mittel wollen sie trotzdem so mitmischen, dass die USA nicht allein die Herrschaft ausüben und sich exklusiv den Nutzen der Nachkriegsordnung reservieren. Die Auseinandersetzung geht damit in die nächste Runde.
C. Nach der Schlacht: Opfer, Sieger, Verlierer und ein neu eröffneter Streit zwischen den einen und den anderen Aufbauhelfern
Für manche Nationen zeigt das Ende des Krieges wie schon sein Anfang, wie dringend erforderlich die Mitwirkung Europas und die Schirmherrschaft der UNO sind, wenn es gilt, die zweifelhafte Hinterlassenschaft des amerikanischen Feldzugs im Nahen und Mittleren Osten zu verwalten. Die Vertreter dieser Richtung berufen sich für ihren Antrag, das Procedere nach dem Sieg betreffend, wie selbstverständlich auf die Kriegsziele der Alliierten, die echten wie die verlogenen Titel für deren Unternehmen – die Heuchelei aus der Vorbereitungsphase wird eisern beibehalten. Wie zuvor sehen die Veranstalter das jedoch ganz anders. In dem Antrag, zur alten Geschäftsordnung „zurückzukehren“ und die „Völkergemeinschaft“ mit Hilfe und mit „nation building“ im Irak zu beauftragen, erkennt die US-Regierung unschwer den Drang ihrer widerspenstigen Partner und Rivalen, sich nach Abwicklung des Kriegsprogramms als Weltordner zurückzumelden und ihr die Rücksichtnahme wieder aufzunötigen, die sie gerade gekündigt hat: Sie lehnt dankend ab. Ganz im Sinne ihres kriegsvorbereitenden Entwurfs für einen entwaffneten und Saddam-losen Irak besteht sie auf der Zuständigkeit der Sieger – derer, die weder Kriegsmühen noch -kosten gescheut haben – für die Zurichtung des besiegten Staates. Von der Warnung, das irakische Volk würde die Ausübung der Staatsgewalt durch die Besatzungsmacht wie ein Besatzungsregime empfinden, lassen die USA sich jedenfalls nicht beeindrucken. Ungerührt planen sie die künftige Ausübung der Macht am Golf und versäumen es nicht, die Reparationsfrage anzugehen: Das Öl versprechen sie dem irakischen Volk, dem sie auch gleich die passenden Partner für Förderung und Handel zuweisen.
„Chaos“ im Irak und Amerikas Prioritäten
Mit Kriegsbeginn ist das von den Vereinten Nationen gemanagte „Öl für Lebensmittel“-Programm, von dem, wie man jetzt mal wieder erfährt, zwei Drittel der irakischen Bevölkerung abhängen, storniert worden. Der Krieg zerstört – teils absichtlich, weil bei einer nationalen Infrastruktur zivile Notwendigkeit und potentieller militärischer Nutzen kaum auseinander zu halten sind, teils mehr nebenher, „kollateral“ – weitere elementare Lebensbedingungen, die Wasserversorgung vor allem und die medizinische Betreuung. Der Sieg, die Vertreibung der bösen Staatsmacht aus Bagdad, fügt dem Kriegselend die Erfahrung hinzu, dass der von außen bewerkstelligte Zusammenbruch staatlicher Autorität nicht die Träume der Anarchisten erfüllt, sondern die Schrecken der Anarchie freisetzt: Vorübergehend nicht mehr unterdrückte Massen plündern, was ihnen wie Reichtum vorkommt, und zerstören, was sie nicht plündern können; der Überlebenskampf einer mittellosen Bevölkerung nimmt die denkbar irrationalsten und brutalsten Formen an; Banden jeglichen Zuschnitts und sogar ehrbare Besatzungssoldaten und Journalisten aus dem Reich des marktwirtschaftlichen Überflusses vergreifen sich am momentan herrenlosen irakischen „Volksvermögen“. So kommt einiges Belegmaterial für die kritisch gemeinte und ausgiebig breitgetretene Allerwelts-Weisheit zusammen, dass mit einem gewonnenen Krieg „der Frieden“ noch überhaupt nicht „gewonnen“ sei – wie auch: Der militärische Sieg ist erst einmal nichts weiter als der Endpunkt des militärischen Zerstörungswerks.
Zur „Logik“ des militärischen Triumphes gehört es deswegen auch, dass das angerichtete Chaos den Sieger einigermaßen ungerührt lässt, soweit es nicht seine eigenen Belange tangiert. Insofern passt der Kommentar des zuständigen US-Ministers zu den Verwüstungen, die von Plünderern in Bagdad angerichtet und von Fernsehreportern übermittelt werden, sehr gut zur Lage: Unkosten der Freiheit wären das; Exzesse, für die man Verständnis haben müsse; im ersten Genuss neu gewonnener Freiheit ließen Menschen sich auch schon mal zu Gesetzesübertretungen hinreißen, um später dann um so großartigere Dinge zu vollbringen… Für die Ölindustrie des Irak und deren Verwaltungszentrale in Bagdad lässt die US-Armee diese Wildwest-Logik des allmählichen Übergangs von der Anarchie zum Kapitalismus freilich nicht gelten; die Petroleumquellen und alle Unterlagen darüber werden sofort okkupiert und sorgfältig gesichert. Das muss schon im Interesse des irakischen Volkes sein, dem die Bodenschätze des Landes ja letztlich gehören und das deswegen ein von Washington garantiertes Recht darauf hat, dass an diesen „Schätzen“ möglichst bald möglichst viele Dollars verdient werden. Firmen, die sich darauf bestens verstehen, hat die US-Regierung auch gleich bei der Hand: Schon vor Kriegsbeginn hat sie sich der Frage gewidmet, welche Akteure aus dem Heimatland des kapitalistischen Erfolgs dem Irak eine marktwirtschaftliche Zukunft als Geldquelle spendieren sollten; mittlerweile hat sie ihre Auswahl getroffen; nun verliert sie keine Zeit bei der Ankurbelung des Ölgeschäfts.
Vorrang hat daneben natürlich die Erledigung der wichtigsten sicherheitspolitischen Aufgaben, zu denen die Sicherheit der Zivilbevölkerung und ihres Überlebens vorerst freilich nicht gehören kann. So lassen die US-Autoritäten sich durch ein bisschen Vandalismus in Bagdad und anderswo nicht von der Tatsache ablenken, dass sie ihren selbsterteilten Auftrag zur Liquidierung des Personals der alten „Schurken“-Herrschaft noch gar nicht erfüllt haben: Eine handlich und einprägsam in Spielkartenform gestaltete Liste von 55 steckbrieflich gesuchten Haupt-Bösewichtern muss abgearbeitet werden. Was erst recht keinen Aufschub duldet, das ist ein wichtiges Stück Ordnungspolitik über die Grenzen des Irak hinaus: die Einschüchterung der beiden Anrainerstaaten Syrien und Iran, die für Washington ungefähr in dieselbe Kategorie von „Problemländern“ gehören wie der glücklich bewältigte Fall Irak. Zum einen sollen die Mullahs und das Regime in Damaskus den USA beim Einsammeln des restlichen Personals der alten irakischen Führung nicht in die Quere kommen, sondern zur Hand gehen. Zum andern und vor allem aber geht es darum, den Schwung und die Wucht der siegreichen Vorwärtsbewegung der alliierten Streitkräfte unverzüglich für die Vorwärtsstrategie der neuen amerikanischen Weltordnungspolitik in der Region fruchtbar zu machen. Gegen Iran und vor allem Syrien werden im Laufe des Krieges bereits Anklagen von gleicher Art wie die Kriegsgründe im Fall Irak erhoben: Verbindungen zum „Terror“ und Bemühungen um „Massenvernichtungswaffen“. Die Vorwürfe steigern sich mit dem Vormarsch der Truppen zu ernsten Drohungen, die schon die Befürchtung aufkommen lassen, die Bush-Regierung wollte ihr erfolgreiches Überfallkommando gleich weitermarschieren lassen; dass sie so weit nicht geht, gilt als eine Art Verzicht und fast schon als Zeichen der Mäßigung. So wird den Adressaten auf alle Fälle nachdrücklich vor Augen geführt, dass hinter dem Anspruch der Weltmacht auf Botmäßigkeit, also auf Bescheidenheit beim Rüsten sowie auf Beihilfe zur Ausrottung des Antiamerikanismus, die drohende Gegenwart, nun in unmittelbarer Nachbarschaft, einer unbedingt überlegenen siegreichen US-Militärmacht steht. Das muss sein, um den Zuständigen in Damaskus und Teheran jede politische Entscheidungsfreiheit zu nehmen und, dasselbe umgekehrt, jeden Versuch einer außeramerikanischen Einflussnahme auf diese Länder in die Schranken zu weisen: eine „strategische Dividende“ des militärischen Erfolgs, die man sich in Washington unverzüglich sichert.
Eine dritte ordnungspolitische Aufgabe liegt der US-Regierung auch noch vorrangig am Herzen; dafür hat sie sogar einen Haufen zusätzliches Personal übrig: Sie nimmt die Suche nach Saddam Husseins „Weapons of Mass-Destruction“ mit eigenen Inspekteuren in die Hand. Mit der Existenz solcher Waffen und der Unfähigkeit der UNMOVIC, ihre prompte und restlose Beseitigung zu garantieren, ist ja immerhin die Unaufschiebbarkeit des Krieges begründet worden – Bush vor dem Einmarsch: Wir beenden ein Regime, dessen Aggressionen und Massenvernichtungswaffen es zu einer einzigartigen Bedrohung für die Welt machen.
Dabei geht es den USA allerdings nicht um die nachträgliche Entdeckung des ominösen „rauchenden Colts“ als Rechtfertigungsbeweis für ihren Angriff; und deswegen geht auch die Warnung, etwaige Funde amerikanischer Fahnder unterlägen automatisch dem Verdacht auf Fälschung, ins Leere. Für die US-Regierung hat sich mit der Beseitigung der alten irakischen Führung auch die Frage, wie gefährlich sie wirklich gewesen sein mag, erledigt[10] – Bush nach dem Krieg: Kein Terrornetz auf der Welt wird Massenvernichtungswaffen vom Regime erhalten, denn dieses Regime gibt es nicht mehr.
(Zitate nach SZ, 3.5.) Das 1000 Spezialisten umfassende militärische Suchkommando soll vielmehr ermitteln, zu welchen ABC-Kapazitäten es der unter Embargo gesetzte Feindstaat gebracht hat, und dafür sorgen, dass alle derartigen Potenzen unter eigene Kontrolle genommen bzw. zerstört werden, um so „das mögliche Wiederauftauchen dieser Bedrohungen in der Zukunft“ ein für allemal auszuschließen (US-Zentralkommando, 15.4.). Wichtig ist der Bush-Regierung vor allem, der UNO die Untersuchungen, zu denen sie durch einen Beschluss des Sicherheitsrats beauftragt wurde, aus der Hand zu nehmen und so gleich Klarheit darüber zu stiften, dass alle völkerrechtlich abgesegneten politischen Kompetenzen der Vereinten Nationen erloschen bzw. ohne störenden Rest an die Siegermacht übergegangen sind. Diese Klarstellung duldet nämlich keinen Aufschub.
Hinter diesen wesentlichen und drängendsten Notwendigkeiten einer Nachkriegsordnung am Golf muss die Betreuung des eroberten Volkes erst einmal zurückstehen. Aber natürlich bleibt auch die irakische Bevölkerung nicht auf Dauer sich selbst überlassen. Wo die ganze Welt sie schon so nachdrücklich dazu ermuntert, lässt die US-Regierung ihre Soldaten auch allgemeinere Ordnungsaufgaben erledigen und bei Gelegenheit Plünderer verhaften; schon damit sich nicht unkontrolliert und eigenmächtig Bürgerwehren aus Leuten bilden, die sich durch den Zusammenbruch ihres Staatswesens nicht so recht befreit und im Sinne Rumsfelds zu „großartigen Dingen“ herausgefordert fühlen. Darüber hinaus wären die Alliierten als Besatzungsmacht eigentlich auch dafür zuständig, so etwas wie eine Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. In dem Punkt üben sie sich allerdings in weiser Selbstbeschränkung und begnügen sich weitgehend mit der scharfen militärischen Kontrolle von Hilfslieferungen, die von verschiedenen karitativen NGOs ins Land gebracht werden; da macht die US-.Regierung schon ziemlich konsequent ernst mit ihrem Versprechen, sich keineswegs als Besatzer aufführen zu wollen und dem Volk des Irak seine Selbstverantwortung wegzunehmen. Die übt nur vorläufig als verlängerter Arm der US-Militärmacht ein amerikanischer Zivilverwalter aus, dem alsbald eine einheimische Regierung zur Seite treten soll; für ihre eigene Kolonialverwaltung müssen die Iraker schon so rasch wie möglich selber sorgen. Auf eigens arrangierten Zusammenkünften einheimischer wie aus dem Exil reimportierter Stammes-, Volks-, Partei-, Religions- und sonstiger Führer und unter sorgfältiger Ausschaltung von Sympathisanten des iranischen Mullah-Regimes nehmen Experten aus Washington eine erste Musterung vor, um brauchbare Marionetten zu rekrutieren. Für die demokratische Legitimation der ausgesuchten Figuren sorgt zur Genüge der freiheitliche Meinungsstreit und Machtkampf zwischen den verschiedenen Ministerien und Drahtziehern im Heimatland der Demokratie.
Nichts von alldem stellen die USA irgendwie zur Diskussion. Sie wüssten gar nicht, mit wem es darüber etwas zu verhandeln gäbe. Das heißt aber keineswegs, dass sie ganz allein und nur auf eigene Rechnung tätig würden. So war ihr „Unilateralismus“ schon vor dem Krieg und während seiner Abwicklung nicht gemeint: Eine „Koalition der Willigen“ haben sie ja immerhin um sich geschart. An die ergeht jetzt das ehrenvolle Angebot, Teilaufgaben beim „Wiederaufbau“ eines irakischen Staatswesens zu übernehmen. Auf Basis der gebotenen Anerkennung des Kriegsergebnisses, des Einverständnisses mit dem Alleinverfügungsrecht der USA, ist überhaupt die Staatengemeinschaft zu Hilfsdiensten eingeladen. In diesem Sinn, und weil außerdem der wichtige britische Verbündete so sehr darauf drängt, kann Präsident Bush sich sogar eine Rolle für die UNO vorstellen und lässt sich auf einer Pressekonferenz mit Premier Blair in Nordirland dazu herbei, diese Rolle „wichtig“ und „vital“ zu nennen. So ganz ist die Sache damit diplomatisch und weltpolitisch allerdings doch noch nicht gegessen.
Humanität, Geschäft und Saddams „Massenvernichtungswaffen“ in neuer Funktion: Kriegs-Gegner ringen um Teilhabe am Nachkriegs-Imperialismus der USA
Ob eingeladen oder nicht: Alle möglichen Länder, und die Kriegs-Gegner zuallererst, melden Ansprüche auf Berücksichtigung ihrer Interessen bei der Neugestaltung des Irak an. Dabei steht natürlich allemal die tiefe Sorge um die Menschen an Euphrat und Tigris im Vordergrund; nachdem schon die Flüchtlingsströme ausgeblieben sind, für die doch schon Auffanglager wie noch nie eingerichtet worden waren, will man nun um so mehr den daheimgebliebenen Opfern von Krieg und Elend helfen. Dies allerdings nur in strikter Trennung von der amerikanischen Besatzungsmacht; schließlich ist man erstens ausschließlich in humanitärer Mission unterwegs. Zweitens und vor allem gilt es alles zu vermeiden, was den Humanisten aus dem „alten Europa“ als nachträgliche und quasi rückwirkende Legitimation des amerikanischen Vorgehens ausgelegt werden könnte. Deswegen kann die Menschlichkeit nur zuschlagen, wenn nicht die Vereinigten Staaten, sondern die Vereinten Nationen darüber wachen. Die förmliche Unterstellung des Irak unter das Regime der UNO – darüber, wer dann wiederum als formeller Auftragnehmer der „Völkergemeinschaft“ praktisch tätig wird, könnte man mit der US-Regierung ja reden – empfiehlt sich außerdem schon wegen der zweifelsfreien Legitimität, die einer neuen irakischen Herrschaft damit zuwachsen und andernfalls für immer fehlen würde. Aus den Geschäftsinteressen, die sich mit diesem Plädoyer für Mensch- und Rechtlichkeit verbinden, wird dabei interessanterweise überhaupt kein Geheimnis gemacht. Ohne Umschweife wird eine gerechte Beteiligung am Geschäft mit dem „Wiederaufbau“ des über Jahre zerrütteten und nun noch abschließend kriegerisch zerstörten Landes sowie mit seinem Erdöl eingeklagt; mit unverhohlener Geldgier werden die so zu verdienenden Milliarden hochgerechnet, als läge da der Ausweg aus der nicht enden wollenden Wirtschaftskrise. Gerade die führenden Mitglieder der Anti-Kriegs-Koalition haben bereits mit dem alten Regime Vorverträge über Investitionen, Förderlizenzen und Ölhandel abgeschlossen, außerdem beträchtliche Schulden des Saddam-Regimes einzutreiben; auf nichts davon will man verzichten. Deswegen und überhaupt will man auf keinen Fall von der puren Gefälligkeit der amerikanischen Siegermacht abhängig sein.
Die ist selbstverständlich überhaupt nicht bereit, von ihrem Zugriffs- und Regelungsmonopol auch nur die geringsten Abstriche zu machen: Das politische Sagen haben diejenigen, und die sollen auch das Geschäft mit dem Nachkriegsbedarf und den Öl-Ressourcen des Landes machen, die – nach den gefühlvollen Worten der Sicherheitsberaterin C.Rice – Leben und Blut für die Befreiung des Irak gegeben haben
. Immerhin haben die Gegenspieler aber ein Druckmittel in der Hand, und das bringen sie mit ihren Beschwörungen der Unerlässlichkeit humanitärer Nothilfe fürs darbende irakische Volk unter UNO-Regie auch mit allem gebotenen Zynismus ins Spiel: Die US-Regierung selber hat ein materielles Interesse daran, für die ärgerlichen Unkosten der Volksversorgung sowie einer halbwegs funktionierenden Verwaltung nicht allein aufkommen zu müssen, sondern auf die Geldmittel des durch den Krieg unterbrochenen „Oil for Food“-Programms zuzugreifen. Die liegen aber auf Konten der UNO, sind der amerikanischen Verfügungsmacht insoweit also erst einmal entzogen. Einige Scharfmacher und Scharfmacherinnen auf Seiten der Kriegs-Gegner möchten es dabei auch belassen, nach dem Kindergarten-Motto: Wer zerstört, zahlt!
(so ähnlich die deutsche Ministerin für Entwicklungshilfe, die damit erstmals ihrem Volk so richtig aus der Seele gesprochen haben dürfte). Weltpolitik auf dem Boden der von Amerikas Truppen geschaffenen Tatsachen funktioniert jedoch anders. Da wird beiderseits – und unter beiderseitiger heftiger Beschwörung des Massenelends, das auf gar keinen Fall politisch funktionalisiert werden darf – um Entgegenkommen gefeilscht: um das Geld der UNO auf der einen, ein Stück Anerkennung der UNO auf der anderen Seite. Das rotgrüne Deutschland, das Gelegenheiten sucht, um sich endlich wieder wirksam in das Ringen um imperialistische Kompetenzen einzuschalten, vermittelt in aller Bescheidenheit einen Kompromiss, der den Streit im Wesentlichen in der Schwebe hält: Erst einmal, für 45 Tage, lebt das stornierte Programm wieder auf; die Notversorgung geht zu Lasten der UNO-Treuhand-Konten, dafür aber auch unter UNO-Regie vonstatten. Ein bisschen wenigstens ist die Weltorganisation wieder eingekauft ins Geschehen; in anderthalb Monaten sieht man weiter…
Der Kompromiss ist das Vorspiel zu der eigentlichen Auseinandersetzung um Amerikas Anspruch auf alleinige Hoheit über Land, Leute und Bodenschätze des Irak und den Anspruch der anderen auf Mitbestimmung und Beteiligung. Dem selbstverständlichen Siegerrecht der USA setzen deren Konkurrenten hierbei ein Erpressungsmittel von äußerst fragwürdiger Durchschlagskraft entgegen: einen Rechtstitel, den sie ausgerechnet den unnachsichtigen Bemühungen der USA um die vollständige Ächtung und Knebelung der alten irakischen Staatsmacht durch die gesamte „Völkerfamilie“ verdanken. Noch gelten nämlich die Sanktionen, die den Außenhandel des Irak strengsten Auflagen sowie der Überwachung und treuhänderischen Abwicklung durch einen besonderen UNO-Ausschuss unterwerfen und erst aufgehoben werden dürfen, wenn UNMOVIC-Inspekteure dem Land die völlige Säuberung von „Massenvernichtungswaffen“ attestieren und der Sicherheitsrat dieser Feststellung zustimmt. Dafür sind auch die Stimmen von Frankreich und Russland nötig. Daran muss die US-Regierung sich jetzt erinnern lassen.
In der Sache ist das natürlich absurd. Was die Amerikaner über Jahre hinweg an Fesseln und Einschränkungen für den Irak haben festschreiben lassen, hat natürlich dem von ihnen identifizierten „Schurkenregime“ des Saddam Hussein gegolten und hat sich mit dessen Beseitigung erledigt. Ihrer völkerrechtlichen Form nach richten sich die beschlossenen Sanktionen aber nun mal gegen einen Staat. Der besteht auch nach seiner Okkupation durch die US-Militärmacht irgendwie weiter. Insofern unterliegen also auch – paradoxerweise, aber was heißt das schon bei einer „Rechtslage“! – die USA selbst, soweit sie mit dem Recht des Siegers die Souveränität des Irak exekutieren, und jede von ihnen installierte Nachfolge-Regierung den mehrfach bekräftigten Sanktionen aus der Saddam-Zeit, bis diese vom Sicherheitsrat in aller Form außer Kraft gesetzt worden sind. Mit dieser wunderbar verrückten Rechtsposition versuchen die durch Amerikas Krieg und Sieg fürs Erste vollständig ausgemischten Führungsmächte der Anti-Kriegs-Koalition Politik zu machen. Dabei ist ihnen völlig klar, dass ihr völkerrechtlicher „Trumpf“ für eine wirklich handfeste Erpressung nicht in Frage kommt. Ein diplomatisches Geschäft können sie sich aber gut vorstellen: Mit einer formvollendeten Annullierung des alten Kontrollregimes durch die oberste UNO-Instanz wäre Amerika die diplomatischen Vorbehalte gegen sein Regime über den Irak und gegen sein neues staatliches Geschöpf am Golf los; umgekehrt hätten die USA die Rolle des Weltsicherheitsrats als oberste Aufsichtsinstanz über zwischenstaatliche Gewaltanwendung und damit die Bedeutung der anderen ständigen Mitglieder dieses Gremiums wieder anerkannt; und das sollte sich nach dem Willen dieser Mächte auch in Form von Mitentscheidungsbefugnissen beim Nachkriegs-Regime über den Irak im Besonderen, damit natürlich auch über das Weltgeschehen im Allgemeinen auszahlen. Geld für alte Schulden und Beteiligung an neuen Geschäften würden dabei außerdem herausschauen, zählbaren Nutzen bringen und zugleich den wiedergewonnenen Einfluss materiell beglaubigen.
Ein solcher Deal hängt freilich völlig davon ab, ob die USA überhaupt bereit sind, der UNO doch wieder eine Bedeutung als Instrument zur rechtsförmlichen Verallgemeinerung ihrer imperialistischen Entscheidungen beizumessen, und wieviel ihnen ein erneuerter prinzipieller weltordnungs- und weltwirtschaftspolitischer Konsens mit den Konkurrenten und Rivalen wert ist, die sich ihrer „Koalition der Willigen“ verweigert haben. Dabei steht so viel von vornherein fest: Wenn die USA sich überhaupt um ein UNO-Votum zur förmlichen Aufhebung der Irak-Sanktionen bemühen, dann betrachten sie das nicht als eine Forderung, für deren Erfüllung sie etwas zu bezahlen hätten, sondern als ein Zugeständnis von ihrer Seite, für das sie einen Preis diktieren; und zwar mindestens den, dass die „Völkergemeinschaft“ ihnen freie Hand im Irak gibt, sich aus allen Gewaltfragen dort völlig heraushält, also genau die Rolle eines Akklamationsorgans übernimmt, die sie bei der Inszenierung des Krieges abgelehnt hat; wenn das klar ist, darf die UNO sich an humanitären und Versorgungsfragen zu schaffen machen. Ihren Konkurrenten gegenüber sehen die USA sich ebenso wenig in der Position, dass sie denen Angebote zu machen hätten, um sich eines grundsätzlichen Einvernehmens zu versichern; umgekehrt können Russland und die „alten Europäer“ zufrieden sein, wenn Amerika sie überhaupt wieder zu einer Kooperation mit sich zulässt, sie gewissermaßen in die „Koalition“ aufnimmt, der sie sich verweigert haben, und dafür weiter keinen Preis verlangt – jedenfalls keinen höheren als den, zu Amerikas Bedingungen mitzumachen und Einwände zu unterlassen.
Beide Seiten testen also einander: Die USA erkunden die Bereitschaft ihrer Rivalen, ihnen freie Hand zu geben und sich ihren weltpolitischen Vorgaben zu fügen, um einer Ausgrenzung aus dem von Amerika dominierten Weltgeschehen zu entgehen; die andern versuchen auszuloten, wieviel Respekt vor ihrem autonomen Einmischungswillen und ihren Wirtschaftsinteressen die Weltmacht ihnen konzediert. Und es sieht so aus, als ob Amerikas Konkurrenten sich über das Kräfteverhältnis und die normative Kraft der von den USA gesetzten Fakten nicht allzu viel vormachen. Die Repräsentanten des „alten Europa“ geben sich jedenfalls deutlich mehr Mühe als ihre Kollegen von der Siegermacht, um ein Entgegenkommen der anderen Seite zu werben. Es hat nichts von einer Drohung, wenn der französische Außenminister warnt, eine Nation könne zwar alleine den Krieg, aber nicht den Frieden gewinnen
; und der deutsche Außenminister bezichtigt die USA nach wie vor nicht der Illegitimität ihrer Politik, wenn er die UNO als die einzige Instanz empfiehlt, die sich auf preiswertes „Nation-building“ verstehe und die Kriegsergebnisse zweifelsfrei legitimieren könne. In ihrem Bemühen um Wiederzulassung zum Weltordnungs-Business gehen Frankreich und Deutschland gemeinsam schon dazu über, gar nicht mehr nur auf ihren formellen Kompetenzen als UNO-Sicherheitsrats-Mitglieder und auf den angeblichen Segnungen eines intakten, allgemein anerkannten Völkerrechts herumzureiten, sondern in ihrer Eigenschaft als NATO-Staaten eindeutige Angebote zu unterbreiten: Nicht bloß im UNO-Auftrag, sondern notfalls auch ohne einen solchen im Rahmen der nordatlantischen Allianz wären sie bereit, das US-Militär am Golf zu „entlasten“. So ähnlich, wie die USA vor dem Krieg Bündnisverpflichtungen ins Spiel gebracht haben, um auf dem Umweg über die angeblich gefährdete Südostgrenze des Bündnispartners Türkei die widerspenstige Bundesrepublik in ihren Aufmarsch gegen den Irak hineinzuziehen, erinnern Deutsche und sogar Franzosen die Weltmacht nun an die nordatlantische Bündnis-Solidarität, die doch so weit reichen sollte, die Nachkriegsordnung am Golf zur gemeinsamen Sache des insoweit wiederbelebten „Westens“ zu machen und ihnen ein Recht auf Mitwirkung zu sichern. Nicht als emanzipationswillige EU-Mächte, sondern als Junior-Partner der alten Kriegsallianz fragen sie an, wieviel den Amerikanern das Einvernehmen mit Europa noch wert ist – und haben die ersten Antworten bereits erhalten. Vermittels schlichter Nicht-Befassung erteilt die Bush-Regierung dem Antrag auf Mitwirkung der NATO beim neuen amerikanischen Nahost-Regime eine Abfuhr. Sie blamiert dessen Urheber außerdem gezielt und wirksam mit der Art und Weise, wie sie sich aus dem Kreis ihrer NATO-Partner ihre Helfershelfer für die gewaltsame Befriedung des Irak heraussucht: An sämtlichen Bündnis-Instanzen und -Gremien vorbei, ohne Konsultation oder auch nur Information der übrigen Mitglieder, sammelt sie unter den Befürwortern ihres kriegerischen Vorgehens Freiwilligen-Meldungen zu Kontrolldiensten ein und erteilt Aufträge. Ganz gezielt würdigt sie die einzige nennenswerte Macht des soeben für die NATO akquirierten „neuen Europa“ einer auffälligen „strategischen Partnerschaft“, ernennt Polen zur federführenden Aufsichts- und militärischen Ordnungsmacht in einer speziell dafür einzurichtenden irakischen Besatzungszone und ermuntert den sich überaus geehrt fühlenen Warschauer Verteidigungsminister zu dem Angebot an die BRD, als Anhängsel der polnischen Armee, also in der Rolle des nachdrücklich ins letzte Glied zurückgestuften Erfüllungsgehilfen, auf ein Stück Zweistromland aufzupassen, in dem die Polen in den besseren Zeiten des Warschauer Pakts noch für eine stabile Infrastruktur gesorgt haben… Den Franzosen wird ausdrücklich und höchst undiplomatisch eine Bestrafung, wie immer die aussehen soll, für ihre Illoyalität gegenüber der Führungsmacht in Aussicht gestellt. So werden die europäischen Kriegs-Gegner mit ihren entgegenkommenden Einmischungsversuchen konsequent ausmanövriert und ernsthaft in Verlegenheit gebracht: Statt dass die USA sich um Absolution für ihren nicht genehmigten Krieg bemühen, müssen dessen Kritiker sich für ihren Einspruch gegen das imperialistische Selbstbestimmungsrecht der Weltmacht entschuldigen und können sich noch nicht einmal dann sicher sein, weltpolitisch wieder Fuß zu fassen.
So gewinnt Amerikas „neue Weltordnung“ des permanenten, mal virtuellen, mal aktuellen Anti-Terror-Kriegs erste Konturen. Passend zum irakischen Fall und paradigmatisch für absehbare wie unabsehbare künftige Fälle konstruiert die US-Regierung sich frei nach eigenem Ermessen multistaatliche Bündnisse unter ihrem Oberbefehl, verteilt darin Rechte und Pflichten, gewährt ökonomische Chancen, grenzt auf der anderen Seite ebenso souverän Mächte aus, die sich dem dekretierten Anliegen entzogen und damit unbeliebt gemacht haben. Damit setzt sie nicht bloß Fakten, an denen kein Staat so ohne weiteres vorbei kommt, sondern etabliert ein Regelwerk der zweckmäßigen Unterordnung, das auf alle Fälle schon mal bei den „begünstigten“ Mitmachern Anerkennung findet, das aber auch denen als neuer Ordnungsrahmen Eindruck macht, die sich erst einmal ausgegrenzt finden. Auf die Art ändern sich schön langsam die internationalen Sitten: Amerika ist dabei, die Umgangsweise der Staaten miteinander im Sinne einer ständigen Reflexion auf die Allzuständigkeit und auf eventuelle Vorbehalte und Einsprüche Washingtons umzuprägen. Es bleibt nicht dabei, dass die USA sich mit ihrem Krieg über herkömmliche rechtsförmige Verfahrensregeln zwischenstaatlicher Gewaltanwendung hinwegsetzen und praktisch Recht behalten, weil sie sich eine Ausnahme von der Regel leisten können. Mit ihrem Sieg und dessen Konsequenzen etablieren sie die Ausnahmestellung, die sie sich zumessen, als neue Regel. Sie setzen neues Völkerrecht und haben damit deswegen und in dem Maße Erfolg, wie und weil ihre Gegenspieler dagegen nichts zustande bringen, was als wirksamer Einspruch ernst zu nehmen wäre.
Mit diesem Erfolg zerstören sie allerdings auch Einiges. Sie blamieren nicht bloß den Schein eines verbindlichen supranationalen Ordnungsrahmens, den prinzipiell gleichberechtigte Souveräne untereinander ausgemacht hätten. Sie annullieren damit immerhin auch alle Momente von Verlässlichkeit, die mit diesem Schein in der Konkurrenz der Nationen Einzug gehalten haben. Und sie gehen sehr weit mit der Kündigung ihrer wichtigsten überkommenen Bündnisbeziehungen. Diese Kündigung betrifft wieder nicht bloß den Schein des „animus in consulendo liber“ (Wahlspruch der NATO), einer freien Beratung zwischen irgendwie gleichberechtigten Partnern, sondern das zur Gewohnheit gewordene Bemühen, für das imperialistische Regime über die übrige Staatenwelt ein gemeinsames strategisches Interesse zu finden, eine gemeinsame Linie festzulegen, eine „gemeinsame Sache“ zu definieren. Amerika liquidiert das – immer schon widersprüchliche, aber Jahrzehnte lang aufrecht erhaltene – imperialistische Kollektiv des Westens
, oder was davon ein Dutzend Jahre nach dem Ende des kollektiven Gegners im „Osten“ noch übrig geblieben ist. Damit schwächt und beschränkt es seine europäischen Partner – einerseits. Die geben sich nämlich andererseits nicht geschlagen, sondern finden sich herausgefordert; zu härterer Konkurrenz und strategischer Rivalität. Gegen das Siegermonopol der USA auf Ausbeutung und Kontrolle des Irak und seiner Umgebung können sie aktuell nichts ausrichten. Aber dass sie sich so etwas auf Dauer nicht bieten lassen, kündigen sie auch schon an. Fortsetzung folgt.
[1] Die Einwände der Friedensbewegung gegen Amerikas neuen Irakkrieg werden hier nicht noch einmal durchgenommen; deren Beiträge Zur unendlichen Debatte über den gerechten Krieg und ungerechtfertigte Gewalt in der Weltpolitik
haben wir in GegenStandpunkt 1-03, S.46 bereits ausführlich gewürdigt.
[2] Fronten und Verlaufsform dieser Auseinandersetzung analysiert der Artikel Amerikas Kreuzzug gegen den Terror – 2. Etappe: Der Irak-Krieg
in GegenStandpunkt 1-03, S.31.
[3] Dass dieses Verhältnis sich überhaupt stabilisiert hat, die förmliche Respektierung fremder Souveränität auch durch die Weltmacht zu einer verlässlichen Gewohnheit des internationalen Erpressungsgeschäfts geworden ist, geht wesentlich aufs Konto der Sowjetunion, die mit ihrer gleichrangigen Gegenmacht die tatsächliche Respektierung ihrer so systemwidrig gebrauchten Souveränität erzwungen hat und in der Lage war, eigenen Verbündeten auch gegen den Willen Amerikas ihren Bestand als abweichend regierte Staaten zu sichern. Die in dieser Fähigkeit enthaltene und gelegentlich auch wahr gemachte Drohung, gegen die Verletzung der Souveränität dritter Staaten gegebenenfalls wirksam einzuschreiten, hat die USA genötigt, auch dann bei ihrer Linie der – eingeschränkten – Weltherrschaft per Einschwörung souveräner Staaten auf amerikanische Interessen zu bleiben und deren Souveränität auch dann zu respektieren, wenn die ihre Freiheiten immer wieder in der ärgerlichsten Weise antiamerikanisch missbraucht haben.
[4] Zum Kriegsprogramm der Bush-Regierung haben wir bereist in den letzten drei Nummern des GegenStandpunkt ausführliche Artikel vorgelegt; zuletzt in GegenStandpunkt 1-03, S.31 den schon angeführten Aufsatz über die 2. Etappe
in Amerikas Kreuzzug gegen den Terror
. Deswegen fassen wir uns hier kurz.
[5] Wie die amtierende Führung der USA das sieht, mag ein Zitat aus einem ‚Nachruf auf die UNO‘ illustrieren, den der als intellektuelle Großmacht unter Präsident Bushs Ratgebern verschriene Sicherheitsberater Richard Perle zum Selbstverständnis Amerikas beigesteuert hat: Saddam Husseins Schreckensherrschaft wird bald zu Ende sein. Er wird schnell verschwinden, aber nicht alleine. In einer abschließenden Ironie der Geschichte wird er die UN mit sich reißen. Gut, nicht die ganze UNO. Die Abteilung für ‚gute Taten‘ wird überleben, die Bürokratien für wenig riskante friedenserhaltende Maßnahmen werden bleiben, die Schwatzbude am Hudson wird weiterhin schnattern. Was verschwinden wird, ist die Vorstellung von den UN als Grundlage einer neuen Weltordnung. … zum besseren Verständnis wichtig, den intellektuellen Schiffbruch der liberalen Vortäuschung von Sicherheit durch internationales Recht, das von internationalen Institutionen verwaltet wird, im Kopf zu behalten. … Wir dürfen uns nicht im Geiste einer Nachkriegs-Aussöhnung, um deren Herstellung Diplomaten immer bemüht sind, mit der furchtsamen, lähmenden Vorstellung versöhnen, die Weltordnung würde von uns fordern, vor Schurkenstaaten zurückzuschrecken, die ihre eigenen Bürger terrorisieren und unsere Bürger bedrohen. …
usw. (The Guardian, 21.3.03)
[6] Dass jedes ernsthafte Bestreben einer imperialistischen Macht, auch ohne die USA eigene weltpolitische Anliegen gewaltsam durchsetzen zu können, von den USA als feindselige Unternehmung eingeschätzt und behandelt würde, hat die Bush-Regierung in ihrer sicherheitspolitischen Agenda dem Rest der Welt und hier insbesondere ihren Rivalen und Konkurrenten nachdrücklich und unmissverständlich angesagt. Näheres hierzu in dem Aufsatz über Die amerikanische Militärstrategie für das neue Jahrhundert
in GegenStandpunkt 2-02, S.147.
[7] Sogar die Türkei traut sich was, und zwar praktisch Folgenreicheres als alle anderen Kriegs-Gegner: Sie verweigert den Durchmarsch einer kleinen US-Armee durch ihr Gebiet in den Nordirak und zwingt damit das Pentagon immerhin zu einer nicht unbedeutenden Umdisposition. Dieser Akt der Widerspenstigkeit ist um so auffälliger, weil der südöstlichste NATO-Partner seiner amerikanischen Führungsmacht gerade vorher noch bündnispolitisch zu Diensten gewesen ist: Mit der Fiktion eines drohenden irakischen Angriffs auf die Türkei wurde die NATO mobilisiert, nämlich zur Verlegung von AWACS-Flugzeugen an die irakische Nordgrenze genötigt, und darüber die strikte Absage insbesondere der Deutschen an jegliche Kriegsbeteiligung ein wenig aufgebrochen. Außerdem stehen mehrere Milliarden Dollar an Hilfszahlungen und Kredite aus den USA – oder zumindest die Zusage einer derartigen Unterstützung – auf dem Spiel. Dennoch lässt – wider allgemeines Erwarten – weder die türkische Regierung die schief gegangene Abstimmung im Parlament so lange wiederholen, bis das Ergebnis stimmt, noch interveniert die Armee.
[8] ,Awe‘ kommt von derselben indogermanischen Wurzel wie das deutsche ‚angst‘: Mittelengl. ‚awe‘ [sprich zweisilbig: awe] skandinavisch ‚age‘ [sprich: age] mit den Bedeutungen ‚Schrecken, Ehrfurcht‘, so auch noch im heutigen Isländischen: ‚agi‘ = Schrecken, Ehrfurcht. Verwandt mit – englisch ‚to ail‘ = to feel pain, to give pain me. ‚eilen/ailen‘ ‚eglen‘ angelsächs. ‚eglan/aglan‘ = beunruhigen, schmerzen, weh tun; – gotisch ‚agis‘ = Furcht, Schmerz, Qual; – althochdeutsch ‚egiso‘ mittelhochdt. ‚ege‘ = Furcht, Schrecken (keine Fortsetzung im Neuhochdt.); – irisch ‚eagal‘ = dass. – (alt)griechisch ‚áchos‘ = Betrübnis, Schmerz, Leid, Trauer. Diese Wörter haben sich entwickelt aus der idg. Wurzel ‚agh-‘ = ‚eng, dicht, fest‘ samt verbalen (festziehen, einengen, einschnüren …) und substantivischen Ableitungen. Diese Wurzel gibt es schon im Idg. mit n-Infix ‚angh-‘ = eng; einengen, einschnüren, bedrängen, erdrosseln … Davon kommen u.a. – neuhochdeutsch ‚Angst‘, ‚bange‘ & (mit Umlaut wg. i-Stamms im Ahd.) ‚eng‘, ‚Enge‘ samt Ableitungen; – lat. ‚angere‘ = zusammenschnüren, (er)würgen; änstigen, beunruhigen, quälen; ‚angustus‘, ‚angustiae‘, ‚anxius‘ u.a.; – altgr. ‚ánchein‘ = angere – neugriech. ‚ánchos‘ = Todesangst und Wörter ähnlicher Bedeutung in anderen idg. Sprachen. (Walter Skeat, Etymological Dictionary of the English Language, 1978; Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Akademie-Verlag 1989)
[9] Insofern können regierende Europäer dem Umstand, dass Saddam Hussein sein Volk noch ein paar Tage lang im „Heiligen Krieg“ verheizt, durchaus Positives abgewinnen. Die Schwierigkeiten, die Republikanische Garden und patriotische Selbstmordattentäter Amerika bereiten, sind Futter für ihre Botschaft: Leicht tun sich die Alliierten nicht. Eine zynische Ironie der Geschichte: Es ist, als ließen die minderbemittelten Konkurrenten der USA, die zur Verhinderung des Irak-Kriegs weder aufgelegt noch fähig waren, Saddam und seine Leute eine Art Stellvertreterkrieg führen – für die Lösung eines Problems, das sie mit dem Krieg und seinem Veranstalter haben.
[10] Für Bushs europäische Verbündete, die sich vor dem Krieg am heftigsten dafür eingesetzt haben, notfalls mit Hilfe von Fälschungen der Welt- und vor allem ihrer heimischen demokratischen Öffentlichkeit die Existenz der brisantesten „Terrorwaffen“ in den „Schreckensarsenalen“ des Tyrannen von Bagdad zu „beweisen“, ist die ganze Geschichte im Nachhinein nie mehr gewesen als eine Facette im Feindbild, die von einer sei es aus Dummheit, sei es böswillig begriffsstutzigen Presse fälschlich zu einem echten Kriegsgrund aufgeblasen worden sei. Englands Außenminister Straw, dessen Regierung bekanntlich vor dem Krieg noch extra ein Buch mit „evidenten Beweisen“ veröffentlicht hatte: Die Leute versuchen jetzt irgendwie, den Eindruck zu erwecken, dass die Entscheidung für eine Militäraktion ganz davon abhing, dass man nachher chemisches und biologisches Material finden würde. Das war nicht der Fall.
(SZ, 26.4.) Ähnlich Ana Palacio, Außenministerin Spaniens: Sie (Palacio) wies darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt die Entdeckung von Massenvernichtungswaffen bloß im Hinblick auf die öffentliche Meinung wichtig ist – wegen der medialen Wirkung, die sie gehabt hat.
(El País, 23.4.)