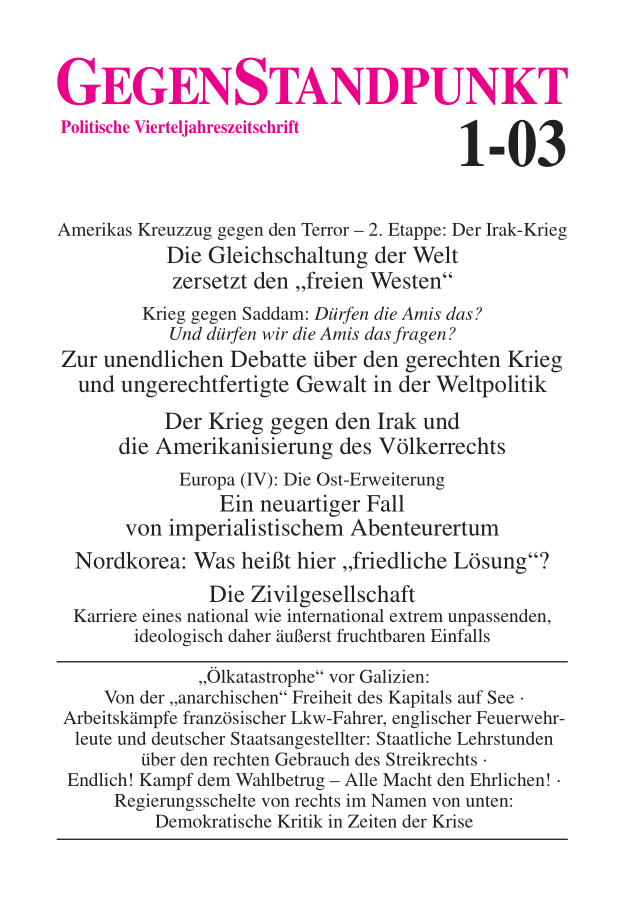Krieg gegen Saddam: Dürfen die Amis das? Und dürfen wir die Amis das fragen?
Neueste Beiträge zur unendlichen Debatte über den gerechten Krieg und ungerechtfertigte Gewalt in der Weltpolitik
Wegen des Irak-Kriegs hebt eine engagierte Debatte über die alte und ewig neue Frage des gerechten Krieges an; schon wieder mit manch originellem Argument von Seiten der Befürworter. Auf der anderen Seite bricht ein größerer Protest los. Dessen Veranstalter machen sich zwar, ebenso wie ihre dementsprechend befragte Massenbasis, keine Illusionen über ihre „Chancen, den Krieg noch zu verhindern“. Das Eine haben sie aber erreicht: Auch dieser Krieg geht nicht über die Bühne ohne einen ganzen Haufen schlechter Einwände.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- I. „Nein zum Krieg – Ja zum Frieden!“ Denn „Krieg bedeutet das Scheitern der Politik“ und „darf nicht zum normalen Mittel der Politik werden!“
- II. „Kein Beweis!“
- III. „Kein Blut für Öl!“ – schon gar „Nicht in unserem Namen!“
- IV. Der Sieg geht in Ordnung; aber „Was kommt danach?“ „Krieg ist doch keine Lösung!“
- V. „Krieg nicht ohne UNO-Mandat!“ – und vor allem „Kein Alleingang der USA!“
- VI. „Kein Antiamerikanismus!“
- VII. „Das alte Europa antwortet Herrn Rumsfeld“
Krieg gegen Saddam: Dürfen die
Amis das? Und dürfen wir die Amis das
fragen?
Neueste Beiträge zur unendlichen
Debatte über den gerechten Krieg und ungerechtfertigte
Gewalt in der Weltpolitik
Die USA bereiten gemeinsam mit Großbritannien Krieg gegen den Irak vor. Erklärtes Ziel ist die Beseitigung des dort herrschenden Regimes. Den Rest der Staatenwelt stellen sie damit vor weitgehend vollendete Tatsachen, fordern Zustimmung und von ihren Verbündeten Beihilfe ein, ohne einem anderen Staat Einfluss auf ihre Planung und ihr Vorgehen einzuräumen, und sorgen damit, gerade bei ihren Verbündeten, für viel Verdruss.
Das alles geschieht sehr öffentlich. Ausgiebig werden die Völker von dem bevorstehenden Krieg in Kenntnis gesetzt. Täglich erläutert die US-Regierung ihre Vorgehensweise; skeptische Verbündete tragen ebenso vor breitestem Publikum, sogar zu Wahlkampfzeiten und in wahlkämpferischer Absicht, ihre Bedenken und Einwände vor. In der demokratischen Öffentlichkeit auf der ganzen weiten Welt fällt beides auf fruchtbaren Boden. Eine engagierte Debatte über die alte und ewig neue Frage des gerechten Krieges hebt an; schon wieder mit manch originellem Argument von Seiten der Befürworter. Auf der anderen Seite bricht ein größerer Protest los. Dessen Veranstalter machen sich zwar, ebenso wie ihre dementsprechend befragte Massenbasis, keine Illusionen über ihre „Chancen, den Krieg noch zu verhindern“. Das Eine haben sie aber erreicht: Auch dieser Krieg geht nicht über die Bühne ohne einen ganzen Haufen schlechter Einwände.
I. „Nein zum Krieg – Ja zum Frieden!“ Denn „Krieg bedeutet das Scheitern der Politik“ und „darf nicht zum normalen Mittel der Politik werden!“
Es gibt eine altehrwürdige und schlechthin unverwüstliche Sorte Kriegskritik, die zeichnet sich durch einen besonders hohen Abstraktionsgrad und entsprechend allgemeine Anwendbarkeit aus und genügt daher auch dem Anti-Irakkriegs-Protest zu großen Teilen als geistige Munition: Man stellt sich die „unvorstellbare“ Brutalität des Kriegsgeschehens vor, ist dagegen – eine leichte Übung, die Pazifisten und Militärs, Kriegspolitiker und Zivilisten, EuropäerInnen wie AmerikanerInnen von Heidemarie Wiezorek-Zeul bis Condoleeza Rice allesamt gleich gut beherrschen –; dann wünscht man sich und allen anderen „unschuldigen Opfern“ stattdessen Frieden, verlangt von den Politikern den Verzicht auf Krieg – und hat damit schon den ersten groben Fehlgriff hinter sich. Denn was der Frieden wert ist, den man der Menschheit im Allgemeinen und den Irakis im Besonderen an den Hals wünscht, wird mit dem Übergang zum Krieg gerade drastisch offenbar: In dem großen Stil bombardiert und geschossen wie jetzt angesagt wurde nicht, das ist wahr; die Gründe dafür, dass jetzt Großbombardements und blutige Kämpfe angesagt werden, sind aber – wann denn sonst? – in genau den Jahren und durch genau die „Verhältnisse“ – wie auch sonst? – geschaffen worden, die nun im Blick auf das, was jetzt aus ihnen folgt, mit dem Ehrentitel ‚Frieden‘ geadelt werden. Wer speziell im Fall des angesagten Irakkriegs im Namen des Friedens Einspruch einlegt, der muss einiges verpasst oder jedenfalls für die Dauer seines Einspruchs vergessen haben; nämlich dass der Frieden, der am Golf bitte nicht aufgekündigt werden sollte, in zwölf Jahren punktuellem Bombenterror, Drangsalierung der Staatsführung durch ein scharfes Embargo und flächendeckender Drangsalierung des Volkes durch seine Regierung und die umfassende Quarantäne der UNO, massenhafter Verelendung und, nicht zu vergessen, wachsender amerikanischer Unzufriedenheit mit der Fortexistenz eines unwiderruflich geächteten Feindes bestanden hat. Und was in dem Fall gilt, das gilt generell: Die Kriege, die die Staaten immer wieder einmal auf die Tagesordnung setzen, hängen mit dem Friedenszustand zwischen ihnen notwendig zusammen; denn was im Krieg zum großen Knall ausartet, sind keine anderen Interessengegensätze, Konflikte und Feindschaften als die, die – jenseits der puren Tatsache, dass eben noch nicht „militärisch eingegriffen“ wird – den wirklichen Inhalt des Zustands namens Frieden ausmachen. Wer also nichts weiter verlangt, als dass die Politiker, was immer sie sonst tun, ihre Finger vom Krieg lassen, der ist vielleicht ein guter Mensch oder naiv; vor allem aber stellt er sich ignorant gegen alles, was bis zum Kriegs„ausbruch“ an Gewalt und gewaltträchtigen Affären in der Staatenwelt läuft, und gegen die Kriterien, nach denen die Veranstalter den Übergang zum sachgerechten Einsatz ihrer Rüstung für fällig erachten – die haben sie sich übrigens auch zu keinen anderen als den bisherigen Friedenszeiten zugelegt.
Diese Ignoranz wird fast schon zum Programm, wenn
Kriegsgegner nicht bloß unter dem Eindruck eines
angesagten Krieges zu diesem „Nein!“ sagen und nach
Frieden rufen, sondern mit der Erkenntnis glänzen, Krieg
wäre – grundsätzlich, immer und überhaupt – das Ende
der Politik
oder, noch tiefer empfunden, das
Scheitern von Politik
. Dass Politiker
solchen Stuss in die Welt setzen, ist nur allzu
verständlich: Die mögen es einfach nicht, dass man die
gewalttätigen Folgen ihres Handwerks, die Übergänge zu
Gewaltaktionen, zu denen sie – und sonst keiner! – befugt
und fähig sind, und die wüsten Resultate, die sie –
niemand sonst! – herbeikommandieren, ihnen, ihrem Amt und
ihrem Handwerk zurechnet. Deswegen bestehen sie gerne und
mit Nachdruck auf einer Unterscheidung, die noch viel
blödsinniger ist, als es z.B. die Behauptung wäre, die
Atombombe wäre „das Ende“ der Atomphysik oder mit dem Bau
von Panzern wäre die Fahrzeugindustrie „gescheitert“:
Politik hätte mit Krieg überhaupt
nichts zu tun – als entstünde Krieg in irgendeinem
politikfreien Raum; als gehörten zum Alltag der Politik
nicht all die zwischenstaatlichen Gemeinheiten und
Erpressungen, die irgendwann zu dem gleichfalls
politischen Beschluss führen, einen Gegner mit
Militärgewalt fertig zu machen; als wäre überhaupt jemand
anders als die Profis staatlicher Herrschaft zu der Sorte
Konflikt fähig, für deren sachgerechte Austragung sie
wohlweislich eine möglichst weitblickende
Rüstungspolitik betreiben; und als wären
ausgerechnet sie mit ihrer Profession am Ende und müssten
vor der „Kriegslogik“ – so eins der hier einschlägigen
verlogenen Sprachbilder – kapitulieren, wenn sie
ernst machen und ihre politische
Zielsetzung an ihrem ausgemachten Feind mit
Waffengewalt exekutieren. Wie gesagt: Dass Politiker
Politik und Krieg so unterschieden wissen möchten, ist
klar; damit verschaffen sie sich schließlich für ihr
gesamtes Treiben bis hin zur Kriegserklärung das
allerbequemste, nämlich ein denkbar grundsätzliches und
pauschales Alibi. Aber deswegen müssen doch nicht
ausgerechnet Kriegsgegner diesen Unsinn
nachbeten. Wenn sie schon gegen den von – in dem Fall:
Amerikas – Politikern angesagten Krieg sein wollen, dann
wäre es doch das Erste und nicht zu viel verlangt, die
Spruchweisheit vom „Scheitern der Politik“, auch und
gerade wenn sie vom bundesdeutschen Parlamentsvorsteher
kommt, zurückzuweisen und den Vertretern dieses Handwerks
ihr Alibi zu zerpflücken. Doch das Gegenteil ist der
Fall. Unbeschadet aller Reflexionen und Einwände, die sie
sonst noch auf Lager haben – und die auch nicht besser
sind –, halten die protestierenden Massen und ihre
friedensfreundlichen Wortführer ausgerechnet von dem
„Vorwurf“ besonders viel: Politiker würden mit ihrem
Gewerbe quasi abdanken, wenn „es“ auf irgendwelchen
undurchschaubaren Wegen doch, trotz aller
Politik, „zum Krieg kommt“. Ausgerechnet Kriegsgegner
nehmen damit das tatsächlich praktizierte staatliche
Gewaltgeschäft, dessen Name nun einmal „Politik“ heißt,
gegen sein finales Produkt in Schutz, so als könnten sie
ihrem Gemeinwesen und ihren Politikern so viel
Brutalität, wie im Krieg von Staats wegen exekutiert,
einfach nicht zutrauen und selbst dann nicht zurechnen,
wenn „es“ dann doch wieder einmal so weit gekommen ist;
als wollten sie ihr Vertrauen in die Politik und
deren Macher vor jeder Infragestellung retten, wenn die
zu Aktionen übergehen, mit denen sie endgültig nicht mehr
einverstanden sein können.
Dabei wissen sie es selber besser und machen das sogar im nächsten Atemzug zum Argument – auf Widerspruchsfreiheit darf man sie einfach nicht festnageln wollen –, wenn sie nämlich in aller Bescheidenheit darauf bestehen, Krieg dürfe nicht zum normalen, quasi alltäglichen Handwerkszeug der Politik werden. Kein Wunder, dass sie sich hier schon wieder mit den Politikern gut verstehen, oder jedenfalls mit all den Präsidenten, Kanzlern und Außenministern, die den bevorstehenden Krieg gerade mal nicht beantragt haben und deswegen darauf herumreiten, Krieg dürfe nur in ganz extremen Ausnahmesituationen sein, über deren Eintritt selbstverständlich schon wieder niemand anders als sie zu befinden hat. Der Gedanke wird aber auch nicht besser, wenn er zu der Maxime radikalisiert wird – die so dann doch kein „Verantwortungsträger“ unterschreiben würde –, Krieg dürfe überhaupt kein Mittel der Politik (mehr) sein oder (wieder) werden. Tatsächlich braucht es kein historisches Langzeitgedächtnis, um darauf zu kommen, dass Krieg ein nicht gar so abseitiges Mittel der Politik ist; und für einen Gegner dieses Mittels dürfte es auch nicht zu viel verlangt sein, von dem Mittel einen Schluss auf die Sache zu ziehen, die ohne Gewalt offenbar nicht auskommt. Mit ihrem Imperativ, so dürfe es aber nicht sein, sind die Kriegsgegner und Friedensfreunde aber schon über jede derartige Folgerung hinaus. Krieg wird als Methode verworfen; jeder unvoreingenommene Blick auf die Sache: auf die Politik, in deren Dienst die Methode der Vernichtung fremder Staatsgewalt immer wieder einmal, mit Rüstung von langer Hand vorbereitet, zum Einsatz kommt, wird verweigert. Und nicht nur das: Reichlich voreingenommen wird der politische Zweck, für den Krieg angesagt wird, pauschal abgesegnet; er wird nicht bloß nicht kritisiert, sondern sogar in irgendeiner harmlos klingenden Fassung gebilligt und für politisch schwer in Ordnung befunden, um daraus den Schluss zu ziehen, die gute Sache müsste sich doch auch anders, ohne Waffengewalt erledigen lassen. Im Fall des angesagten Irakkriegs klammern dessen Gegner sich an die Vorstellung, es dürfte eigentlich doch nur um eine etwas größer angelegte Minensuchaktion gehen, die von den UN-Inspekteuren wie von einer Art THW der Völkergemeinschaft ganz zivil zu erledigen wäre. So wollen sie es jedenfalls von ihren Schröders und Fischers vernommen haben. Dabei überhören sie glatt die Drohung, die diese Politiker ihrer „Vision“ einer „friedlichen Lösung“ voranstellen; sie übersehen sowieso die Heuchelei, mit der da die Führer einer militärisch zweit- bis drittrangigen Macht vom Kriegsprogramm, dem kriegerischen Aufmarsch und dem seit 12 Jahren auf niederem Level unnachgiebig geführten Luftkrieg der USA praktisch ausgehen und zugleich diplomatisch abstrahieren, um sich als Anwälte einer unkriegerischen Verwirklichung der amerikanischen Kriegsziele aufzuspielen. Und schon gar nicht hören sie auf die Versicherung der US-Regierung, dass die politischen Ziele, um die es ihr geht, nur mit Krieg zu verwirklichen sind: Von einer solchen nationalen Sache wollen sie nichts wissen – in dem Zusammenhang jedenfalls nicht, wenn es ihnen gerade um ihr Dogma geht, Politik müsste letztlich doch ohne Krieg auskommen können, die ehrenwerte Sache einer ehrenwerten Nation gewaltlos durchzusetzen sein. Unbelehrbar durch die Aktionen der größten und ehrenwertesten Militärmacht der Erde bestehen sie darauf, Krieg als verfehlte Methode abzulehnen, ohne der Sache eine Absage zu erteilen, für die Staaten rüsten, allzeit kriegsbereit sind und nötigenfalls Krieg führen.
Und das ist überhaupt erst der Einstieg in einen ideellen Rechtsstreit mit den Kriegsherren aus Amerika, in dem kein Fehlschluss ausgelassen wird, nur um die Bush-Regierung vor dem albernen Idealbild einer wohltätigen Weltherrschaft ins Unrecht zu setzen.
II. „Kein Beweis!“
Die US-Regierung versieht ihren weltöffentlich geplanten und vorbereiteten kriegerischen Überfall auf den Irak mit einer Rechtfertigung, die an Deutlichkeit und Eindeutigkeit wenig zu wünschen übrig lässt. Es geht ihr darum, ‚den Krieg zu unseren Feinden zu tragen, bevor die uns und unsere Alliierten angreifen können‘. Die Ansage gilt jeder irgendwie organisierten Kraft und schon gleich jeder Regierung, die „gegen Amerika“ ist und in der Lage sein könnte, sich Mittel zu verschaffen, mit denen sie Amerika, den Amerikanern oder den amerikanischen Interessen gewaltsam Schaden zufügen könnte: Eine solche mögliche Bedrohung muss eliminiert werden, bevor eine wirkliche Bedrohung daraus werden kann. Ihre moralische Rechtfertigung bezieht diese pauschale und universale Präventivkriegsdoktrin – und das ist wirklich mal ein neuer Einfall in der „Theorie“ des gerechten Krieges – aus dem einmaligen Schaden, den das Land durch die Attentate auf das WTC in New York und das Pentagon vor eineinhalb Jahren erlitten hat: Die Toten legitimieren vorsorgliches Zuschlagen gegen alles und jeden, den die US-Regierung unter den „Angriff“ vom 11.9.2001 subsumiert. Um Saddam Hussein als Gefahr zu identifizieren, gegen die präventive Gegenwehr rechtens ist, genügt die Tatsache, dass die USA schon einmal einen richtigen Krieg gegen ihn geführt haben und dass er trotzdem einen Staat regiert und schon damit unzweifelhaft die Möglichkeit besitzt, irgendetwas gegen Amerika zu unternehmen: Sein einstiger Kriegs- und fortgesetzter Selbstbehauptungswille beweisen, dass er Böses im Schilde führt; dass ihm auch noch Mittel zu Gebote stehen, sich zu behaupten, begründet den schwer zu widerlegenden Verdacht, ist nämlich genaugenommen der fertige Beweis, dass er seine Mittel benutzt, um sich Amerika zu widersetzen, also zu schaden. Reichlich ausgestreute Informationen über „Saddams Schreckensherrschaft“ im eigenen Land bebildern die Bosheit des Feindes, helfen dem für eine demokratische Kriegsbereitschaft für nötig erachteten Abscheu auf die Sprünge und beschwichtigen zugleich humanitäre Bedenken gegen Massaker am irakischen Volk, die im Zuge der Beseitigung seines Despoten fällig werden dürften.
Es ist nicht eben viel Übersetzungskunst nötig, um in dieser Kriegsmoral den Kriegsgrund der USA ausfindig zu machen. Die Weltmacht erklärt sich erstens für extrem empfindlich, insofern sie im Prinzip immer und überall – und in einer so wichtigen Region wie dem Golfgebiet schon gleich – sehr leicht zu treffen und zu schädigen ist; nicht gerade vital, aber in ihren vitalen Interessen; denn mit denen und den materiellen Mitteln, mit denen sie diese geltend macht, ist sie schlichtweg überall präsent. Sie ist durch die damit gegebenen universellen und permanenten Bedrohungen zweitens insofern extrem leicht aufs Äußerste herauszufordern, als sie schon wegen dem Anspruchsniveau ihrer Interessen und um der Glaubwürdigkeit ihrer Mittel willen auf absolutem und uneingeschränktem Respekt bestehen muss: In jeder Affäre, bei jeder Feindseligkeit steht nicht bloß dieses oder jenes Interesse und der eine oder andere Besitzstand auf dem Spiel, sondern ihre Anerkennung als maßgebliche Weltmacht; und die setzt sie entweder immer und überall durch, oder sie ist gleich verloren und Amerika zur relativen Macht unter anderen zurückgestuft. Drittens kann Amerika sich diesen Anspruch auf totalen Respekt bloß deswegen, deswegen aber auch wirklich leisten, weil es – darauf versäumt der US-Präsident bei keiner Gelegenheit mit Stolz und Nachdruck hinzuweisen – über die militärischen Kapazitäten verfügt, jeden identifizierten Feind zuverlässig zu vernichten: Die Weltmacht sieht sich über jede Notwendigkeit erhaben, mit Kräften, die sie für feindlich und gefährlich befindet, einen ‚modus vivendi‘ zu suchen. Insofern liefert der US-Präsident mit seinem Krieg gegen das unbotmäßig-feindlich-gefährlich-böse Regime in Bagdad ein drastisches Lehrstück darüber und mit seiner freigiebig verkündeten Kriegsmoral gleich auch noch den fast klartextmäßigen Kommentar dazu, wie Imperialismus heute funktioniert.
Umso erstaunlicher ist es, wie verständige Menschen, die sich herausgefordert fühlen, sich aus europäischer Distanz heraus einen Vers auf Amerikas Kriegsansage zu machen, mit diesen Klarstellungen der US-Regierung umgehen: Sie mögen sie nicht glauben! Die von amerikanischer Seite beschworene Gefahr, die in der Tat wenig über den Irak, aber alles Nötige über den Anspruch der amerikanischen Weltmacht auf Unanfechtbarkeit verrät, halten sie für vorgeschoben; die Gefährdungsanalyse, die deutlich macht, dass die US-Regierung durch die fortdauernde Selbstbehauptung ihres erklärten Feindes ihr allerwichtigstes Gut tatsächlich gefährdet sieht, nämlich die Glaubwürdigkeit ihrer Macht, erklären sie für unglaubwürdig. Dabei leisten sich die friedensfreundlichen Bush-Kritiker sogar die Peinlichkeit, dem US-Präsidenten das Feindbild, mit dem der Mann die Untragbarkeit seines Kollegen in Bagdad für die in Washington beheimatete zivilisierte Menschheit noch für den dümmsten Geschmack illustriert, komplett abzunehmen. Das gesamte christliche Abendland, das sich mindestens 10 Jahre lang um die unsäglichen Staatsverbrechen des Saddam Hussein so gut wie überhaupt nicht gekümmert hat und darüber auch jetzt nur weiß, was die amerikanische und britische Kriegspropaganda mitteilt, gibt sich auf einmal kundig, seit der Mann auf Amerikas Abschussliste steht, bricht pflichtschuldigst oder überzeugt – oder sogar beides – in Verwünschungen seiner Unmenschlichkeit aus, sobald der Name fällt; kein Kriegsgegner will sich Parteilichkeit für den „Tyrannen von Bagdad“ nachsagen lassen; jeder gibt die tiefe und ehrliche Überzeugung zu Protokoll, dass der Unmensch weg muss; in dem Punkt will sich von Mister Bush kein Friedensfreund übertreffen lassen. Und nicht nur das: Auch die denkbare Möglichkeit, an der die US-Regierung ihr Verdikt über das irakische Regime festmacht, die Sache mit den ‚Weapons of Mass-Destruction‘, deren Besitz und, womöglich, Weitergabe an antiamerikanische Terroristen den Leuten in Bagdad jederzeit zuzutrauen sei, wird den amerikanischen Kriegsmoralisten Wort für Wort abgenommen; bis auf den einen letzten Punkt, nämlich den Nachweis eines tatsächlich einsatzbereiten bedrohlichen Waffenarsenals im Irak; und auch noch darin gehen die Irakkriegs-Gegner mit den Irakkriegs-Veranstaltern konform, dass die Existenz eines solchen Arsenals oder auch von einschlägigen Produktionsanlagen unbedingt als Ernstfall zu werten wäre, man also sofort etwas dagegen zu unternehmen hätte. Dem polemischen Bild von der irakischen Gefahr schenken sie also vollen Glauben – und vermissen nicht mehr und nicht weniger als den letzten Beweis:
„Die Notwendigkeit eines Präventivkrieges begründet die US-Regierung damit, dass der Irak immer noch oder wieder Massenvernichtungswaffen besitze und in engem Kontakt mit Terrororganisationen stände. Dafür gibt es derzeit keine Beweise. Weder sind Kapazitäten für den Herstellung von Massenvernichtungswaffen wahrscheinlich, noch eine Kooperation mit islamistischen Terroristen, zu denen das Baath-Regime Saddam Husseins immer eine große Distanz gewahrt hat.“ (Resist-Kampagne, Bundesausschuss Friedensratschlag)
Da können Präsident und Außenminister der US-Administration noch so eindeutig darauf aufmerksam machen, wie sie die Sache mit den irakischen Massenvernichtungswaffen meinen: dass sie im Falle ihres alten Feindes dessen pure Existenz für das entscheidende Vergehen und die bloße Möglichkeit einer Schädigung für die Tat nehmen; dass die tatsächliche Ausforschung irakischer Industrieanlagen durch UN-Experten eine diplomatische Konzession und kein Verfahren zur Ermittlung von Gründen für ihre definitive Feindschaft ist; dass es ihnen wirklich nicht um die Bewältigung einer akuten Angriffsgefahr, sondern um die präventive Eliminierung einer Möglichkeit geht; dass es sich bei der ständigen Rede von „Massenvernichtungswaffen“ um die leicht fassliche Volksausgabe ihrer Kriegsgründe handelt – die guten Leute von der Friedensfront reklamieren die „smoking gun“. Sie weigern sich einfach zu bemerken, dass ein „rauchender Colt“ die Gefährlichkeit des Irak sowieso nur dann „beweist“, wenn man die ganze Konstruktion der USA mitmacht, also die Existenz einschlägiger Waffen in Saddams Händen schon für den Willen zu ihrer Anwendung nimmt – dass es dann aber auf diesen „Beweis“ auch nicht weiter ankommt. Da mag die Bush-Regierung noch so nachdrücklich darauf bestehen, dass ihr Urteil über die Gemeingefährlichkeit des irakischen Regimes sowieso feststeht; dass es nur durch dessen Beseitigung zu entkräften ist; dass vorgelegten „Beweisen“ also nur dann und insoweit „Beweiskraft“ zukommt, wie sie bestätigen, dass Saddam Hussein ein Störenfried ist; dass sie prinzipiell nicht beweisen können, dass die USA sich an ihm nicht zu stören brauchen – die Kriegsgegner verlangen den Nachweis eines echten Arsenals in falscher Hand, einer wirklichen knackigen Bedrohung der USA, um der Bush-Regierung abzunehmen, dass die amerikanische Weltmacht die Fortexistenz des Saddam-Regimes definitiv nicht länger erträgt. Und weil sie den nicht serviert kriegen – zumindest „derzeit“ nicht –, glauben sie der US-Regierung ihren Kriegsgrund einfach nicht. Von „gefährdeter Weltmacht“ wollen sie nichts hören – das erschreckt sie nicht, das nehmen sie Bush einfach nicht ab, dass die Weltmacht sich durch den Irak allen Ernstes herausgefordert sieht.
Und dafür haben sie sogar ihrerseits einen „Beweis“, auf den man als Pazifist auch erst einmal kommen muss: Mit einem großen dicken Zeigefinger deuten sie auf Nordkorea, das, wenn es denn wirklich um ein so sauberes Anliegen wie die Beseitigung von Massenvernichtungswaffen in Schurkenhand gehen soll, viel dringlicher zu entwaffnen wäre als der Irak. Woher wissen diese Friedensfreunde eigentlich, dass Nordkorea Atomwaffen baut? Woher haben sie die Gewissheit, dass diese Waffen, wenn es sie denn gibt, weit gefährlicher sind als all die atomaren Arsenale, von denen man weiß, dass es sie wirklich gibt? Woher beziehen sie ihre Maßstäbe für die Identifizierung der dortigen Regierung als unberechenbar und deswegen gefährlich? Und vor allem: Wie kommen sie auf die Idee, dass es ausgerechnet schon wieder Sache Amerikas sein müsste, den Nordkoreanern ihre Atomwaffen gegebenenfalls wegzunehmen? Die Antwort ist sehr schlicht und auf alle Fragen dieselbe: Sie haben mitbekommen, dass die USA Nordkorea zu einem Problemfall prinzipiell gleicher Art wie den Irak Saddam Husseins erklärt haben. Nun nehmen sie Amerikas eigene Feindschaftserklärung gegen das Land am anderen Ende des asiatischen Kontinents her, um die Kriegsgründe, die Amerika gegen den Irak ins Feld führt, wegen Inkonsequenz für unglaubwürdig zu befinden. Sie lassen sich von Bush & Co darüber belehren, dass Irak und Nordkorea ganz ähnliche Weltordnungs- und Aufsichtsfälle sind, weigern sich aber, den amerikanischen Weltordnungs- und Aufsichtsanspruch zur Kenntnis zu nehmen, der die beiden Ländern zu ähnlichen Fällen macht, und wollen stattdessen die Welt darüber belehren, dass die „Bush-Krieger“ es mit diesem Anspruch gar nicht ernst meinen, weil sie ihn sonst in umgekehrter Reihenfolge vollstrecken müssten.
Bewiesen ist damit allerdings nur eins: dass die Irakkriegs-Gegner das, was sie den Amerikanern nicht glauben, nämlich dass es denen um die Befreiung der Welt von falsch kontrollierten Waffenarsenalen geht, für einen ziemlich guten, jedenfalls verständlichen und moralisch diskutablen Kriegsgrund halten würden, wenn es den Amerikanern bloß wirklich darum ginge, was aber nun einmal nicht der Fall ist. Und mit dieser Fehlanzeige starten sie in die nächste Runde.
III. „Kein Blut für Öl!“ – schon gar „Nicht in unserem Namen!“
Wenn die Bush-Regierung ihren Krieg in Wahrheit gar nicht gegen fremde Waffen und den Terrorismus führt: Was will sie dann? Die Anti-Irakkriegs-Bewegung plädiert auf niedere Beweggründe:
„Ganz offensichtlich geht es den Regierungen der USA und Großbritanniens dabei nicht um Menschenrechte und Demokratie, nicht primär um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder um angebliche Massenvernichtungswaffen, sondern um politische und wirtschaftliche Interessen in einer der ölreichsten Regionen der Erde.“ (Aufruf der Friedensbewegung zum 15. Februar 2003)
Ob die Friedensbewegten an einem – immerhin: – Krieg für Menschenrechte und Demokratie irgendetwas seltsam finden würden, teilen sie in dem Zusammenhang nicht mit. Sie zählen einfach auf, was sie offenbar für moralisch immerhin vertretbare Motive für einen Militäreinsatz halten würden, um diese zu vermissen und einen finsteren Verdacht zu äußern: Den präventiven Angreifern ginge es, statt um ideale Ziele, um Interessen, schnöde materielle Interessen „in einer der ölreichsten Regionen der Erde“. Und wieso braucht es wegen solcher Interessen einen Krieg?
„Mit einer Invasion wollen sich die USA den Zugriff auf das größte Erdölvorkommen der Welt im Irak sichern und ihre Vormachtstellung in der Region weiter ausbauen. Das irakische Regime soll durch eine den US-amerikanischen Ölkonzernen freundliche Regierung abgelöst werden. Ohne Regimewechsel hätten die USA weiter keine Kontrolle über diese wichtigen Vorkommen, während europäische und russische Ölkonzerne schon seit Jahren Verträge mit dem Irak geschlossen haben.“ („Nein zum Krieg“ – Resist-Kampagne)
Kein Zweifel: Kriegsziel der USA ist der gesicherte Zugriff auf die Ölvorkommen in der Golf-Region; schließlich handelt es sich da um den allerwichtigsten Energierohstoff der Weltwirtschaft und insofern um eine bedeutende Quelle kapitalistischen Reichtums. Das schließt – den offenherzigen Ankündigungen der Bush-Regierung zufolge – auf der einen Seite das Recht Amerikas ein, nach dem Sieg nach eigenem Gutdünken über den geschäftlichen Zugriff auf die irakischen Ölquellen zu bestimmen: Wenn die USA schon Mühe und Kosten einer Besetzung des Irak und eines Besatzungsregimes auf sich nehmen – alles längst in alternativen Szenarios durchgerechnet –, dann wollen sie auch in gerechtem Umfang, also exklusiv von den Erträgen profitieren, die aus dem Land herauszuwirtschaften sind. Dass sie sich diese Mühe nicht nehmen lassen und die komplette militärische Unterwerfung des Irak herbeiführen, hat seinen Grund auf der anderen Seite in dem äußerst anspruchsvollen Bedürfnis der Weltmacht USA nach Sicherheit ihrer „vitalen Interessen“, die sich nicht zuletzt auf die ölreichen Regionen des Globus richten. Hinreichend sicher findet und fühlt sie sich nämlich nur und erst dann, wenn sämtliche Gewaltverhältnisse innerhalb wie zwischen den souveränen Staaten, die auf den Quellen des kapitalistischen Reichtums hocken, vollständig und unangefochten unter ihrer Kontrolle sind; das hält sie schlicht für eine existenzielle weltordnungspolitische Notwendigkeit. Und mit der ist weder ein Bin Ladin vereinbar noch erst recht die Existenz eines Potentaten, der sich noch an der Macht hält, obwohl er bereits einen Krieg gegen Amerika verloren hat, und der auf Grund der Reichtumsquellen, über die er gebietet, trotz Embargo sogar an Mittel herankommt, um sich an der Macht zu halten: Der „Tyrann“ muss einfach weg. So: über den totalen Kontrollanspruch der kapitalistischen Weltmacht mit ihren weltweit ausgreifenden materiellen Interessen, hängen der „Feldzug gegen den Terrorismus“, den die Bush-Regierung ausgerufen und begonnen hat, das Geschäft mit fossilen Energieträgern, hinter dem US-Konzerne weltweit hinterher sind wie der bekannte Teufel hinter der armen Seele, und der Krieg gegen Saddam Hussein miteinander zusammen. Und deswegen ist in der wohlgeordneten Welt von Demokratie und Marktwirtschaft nichts normaler als ‚Blut für Öl‘. – Ist das gemeint?
Die Friedensfreunde, die in empörtem Tonfall über ihre Entdeckung berichten, dass beim angesagten Golfkrieg Ölinteressen im Spiel sind und nach einem Sieg der US-Armee amerikanische Unternehmen die besseren Karten haben, meinen es ein bisschen anders. Sie wollen gar nicht kritisch festhalten, dass und inwiefern und warum in der vom Freien Westen kontrollierten Welt die Sicherheit des Ölgeschäfts ein vollkommen hinreichender Kriegsgrund ist; sie wollen vielmehr ziemlich genau auf das Gegenteil hinaus: auf die Botschaft, etwas so Banales und Berechnendes wie die Eroberung nationaler Vorteile beim Geschäft mit dem Öl dürfe kein Kriegsgrund sein. Der objektive und nach allen Regeln des modernen Imperialismus auch objektiv notwendige Zusammenhang zwischen ökonomischen Interessen, politischem Kontrollbedarf und militärischem Zuschlagen interessiert sie nur in dem einen Sinn: Den Zusammenhang wollen sie nicht gelten lassen. Theoretisch nicht: Dass sie in einer Welt leben, in der – über ein paar imperialistische Vermittlungsstufen, am Ende aber sogar – die Kontrolle übers Öl für die maßgeblichen Instanzen der Weltpolitik allemal Krieg begründet, nehmen sie nicht so ernst und nicht so tragisch, dass man deswegen gleich die gesamte demokratisch-marktwirtschaftliche Verfassung der Staatenwelt kritisieren müsste; am Ende kämen sie gar nicht mehr zu ihrem beherzten „Nein!“, wenn sie den Krieg nicht mehr als unpassende Ausnahme von der Regel einer im Ganzen doch friedlichen und überhaupt nicht gar so schlimm eingerichteten Welt ablehnen könnten. Ihr Ehrgeiz geht dahin, mit dem Gestus des sofortigen praktischen Eingriffs den Zusammenhang zwischen Öl und Krieg aufzulösen, die kriegerische Konsequenz einer fürs Weltgeschäft notwendigen Sicherheitspolitik quasi außer Kraft zu setzen. Und weil das praktisch dann doch nicht zu machen ist, finden sie es nur umso wichtiger, die imperialistischen Kriegsgründe auf alle Fälle moralisch nicht gelten zu lassen, den Zusammenhang zwischen Ölkontrolle und Angriffskrieg ins Unrecht zu setzen: In einer Welt voller Kriegsgründe, Herrschaft über Reichtumsquellen allemal nicht der unbedeutendste, darf das Ölgeschäft ganz einfach kein Kriegsgrund sein! Die Schäbigkeit des Motivs „Öl!“ hat es ihnen angetan; so weit soll die Welt nicht herabsinken, dass sie die Profite von Ami-Konzernen als zureichenden Grund für Krieg passieren lässt. Zumindest gehört an dieser Stelle Protest eingelegt: Kein Blut bloß für Öl! Und wenn die Sache schon nicht zu verhindern ist, dann sollen die Verantwortlichen wenigstens nicht noch behaupten dürfen, das geschähe „in unserem Namen“ – ein Anliegen, das naturgemäß dort das stärkste Echo findet, wo die Regierungen im Namen ihres Volkes den Krieg vorbereiten, von Weltbürgern aus aller Herren Ländern aber durchaus geteilt wird.
Und das ist nur allzu folgerichtig. Es ist nur konsequent, wenn der Protest gegen den Irakkrieg so ausdrücklich zu einer Sache der persönlichen Ehre erklärt wird. Er bewegt sich nämlich mit allen seinen Einwänden gegen unglaubwürdige Ideale und in Wirklichkeit niedrige materialistische Motive des angesagten Krieges auf der Ebene der Rechtfertigungen, die Politiker ihrem Volk schuldig sind, wenn sie es mit seinem Geld und einiger Lebensgefahr für seine „Söhne“ für eine größere Zerstörungsaktion in Anspruch nehmen, die in jedem anderen Zusammenhang als Verbrechen zutiefst geächtet würde. Mit einer moralischen Verkaufsstrategie begleiten sie ja ohnehin ihr gesamtes herrschaftliches Treiben; und je mehr sie ihre Bürger praktisch als Manövriermasse ihrer Staatsgewalt beanspruchen, umso angelegentlicher vereinnahmen sie dieselben Leute als sittliche Persönlichkeiten, die allem, worüber sie nichts zu bestimmen haben, umso mehr zustimmen sollen. Damit die Rechnung aufgeht, liefern sie gratis und in jeder gewünschten Menge edle Motive für ihr Tun, um derentwillen man ihnen Respekt und Beifall nicht versagen könne. Und von dieser Ebene der öffentlich zur Schau gestellten Moral der Politik kommen die Friedensfreunde einfach nicht herunter. Die Inszenierung von Kriegsvorbereitungen als Schauprozess gegen einen Schurken; die auf Vereinnahmung berechnete Beschwörung von größten Menschheitsgefahren für den Fall, dass nicht rechtzeitig zugeschlagen wird; die Fiktion einer moralischen Entscheidungssituation, vor die jeder Einzelne, zumindest ideell, letztlich genauso gestellt wäre wie seine mühseligen und beladenen entscheidungsbefugten Machthaber – diesen ganzen staatsbürgerlichen Zirkus um den Krieg herum kritisieren sie nicht, im Gegenteil: Der ist ihr eigentliches Element. Sie geben enorm viel auf die ideelle Entscheidungskompetenz, die ihnen komplementär zu ihrer praktischen Ohnmacht angetragen wird. Stolz behalten sie sich ihr Urteil über die sittlichen Rechtfertigungen vor, die ihre Befehlshaber ihnen unterbreiten, prüfen deren Glaubwürdigkeit oder tun wenigstens so. Dabei legen sie noch nicht einmal gesteigerten Wert auf die Fiktion, von ihrer Meinung hinge tatsächlich irgendetwas ab. Ihre Urteilsbildung ist keine Sache der praktischen Wirkung, sondern eine Angelegenheit des moralischen Selbstbewusstseins, mit dem sie sich ideell der Verhältnisse und Ereignisse annehmen, die ihnen praktisch sowieso aufgedrückt werden. Auf der Ebene sehen die Kriegsgegner sich herausgefordert; nämlich dazu, mit vernehmlichem Protest zu dokumentieren, dass sie verlogene Rechtfertigungen durchschauen, unedle Motive nicht billigen, dass man ihnen nichts vormachen kann, und dass sie einer unglaubwürdigen Führung – wenn schon sonst nichts, dann doch immerhin und mit aller Entschiedenheit – die moralische Gefolgschaft verweigern. Das sind sie den „unschuldigen Opfern“ schuldig – oder, was auf dasselbe herauskommt, ihrem ehrbaren Staatsbürger-Namen, in dem, ob sie das wollen oder nicht, diese und andere Opfer hingemacht werden.
Die Taten, zu denen es manche der derart bewegten Irakkriegs-Gegner drängt, sind logischerweise von genau diesem Strickmuster. Gegen die offiziellen Kriegsmoralismen, die sie sich nicht zu erklären wissen, dafür aber umso entschiedener ablehnen, schlagen sie auf derselben Ebene zurück und zeichnen vom US-Präsidenten ein Bild, das genau so schäbig ist wie das Kriegsmotiv, das sie entlarvt haben wollen. Enthüllungsjournalisten enthüllen seine Vergangenheit als Unternehmer und Manager in der Ölbranche, sind sich nicht einmal dafür zu schade, nicht bloß seine dort gescheffelten Millionen, sondern auch noch sein Versagen beim Geld-Scheffeln anzuprangern; seine Einbindung in die branchenüblichen kapitalistischen Seilschaften dient ihnen als „smoking gun“ in der Frage seiner wahren Kriegsgründe. Ganz Radikale versteigen sich zu der rhetorischen Retourkutsche, der eigentliche „Schurke“ in der Weltpolitik wäre, womöglich noch vor Saddam, der Kriegstreiber in Washington; mit Bush-Masken lässt sich das Ganze auch noch karnevalsmäßig ausschmücken. Dabei leidet noch die heftigste Empörung an dem einen Schönheitsfehler, dass sie sich von nichts anderem nährt als von dem Ideal einer in allem Ernst nur den sittlich höchsten Werten verpflichteten und hingegebenen Staatsführung und einer wohltätigen Weltordnungspolitik – also von demselben Idealbild, das die Apologeten des bevorstehenden Golfkriegs von der kriegsbereiten US-Administration zeichnen. Man wüsste die Machthaber gar nicht zu blamieren, wenn man nicht diesen Maßstab zur Hand hätte; und indem man sie daran blamiert, wird er nur bedingungslos bekräftigt. Deswegen wird aus der Verurteilung der Figuren auch nie ein Urteil über die Staatsräson, die diese Figuren exekutieren und die sie in ihrer Person, durchaus zur Kenntlichkeit verzerrt, repräsentieren. Im Gegenteil: Noch in seinen verwegensten Verunglimpfungen operiert der Protest mit der gutgläubigen Unterstellung, eigentlich und von der wahren „Sache der Nation“ her gesehen dürfte und könnte das alles doch nicht wahr sein; eigentlich stünde es der Weltmacht Amerika doch an, segenspendend durch die Staatenwelt zu ziehen und, was sie kann, zum Guten zu wenden; so jedenfalls wäre letztendlich und eigentlich jenes großartige amerikanische Gemeinwesen beieinander, zu dem man als US-Bürger unverbrüchlich steht und dem man als Weltbürger Respekt zollt, auch wenn dort unglückseligerweise momentan ein Öl-Cowboy das Sagen hat…
Weil das so ist, weil die Einwände gegen Amerikas Führung von einer ziemlich bedingungslos guten Meinung über deren eigentliche Aufgaben getragen sind, deswegen ist das Anprangern der „Bush-Krieger“ auch keineswegs das letzte Wort der Friedensbewegung zur Causa Irak. Schließlich melden sich da – mit ein paar wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen – lauter hochanständige, verantwortungsvolle, bei ihrem politischen Verantwortungsbewusstsein gepackte Citoyens zu Wort; und die können es bei einer noch so falschen Absage an den Oberkommandierenden des amerikanischen Feldzugs einfach nicht bewenden lassen. Sie haben noch etliche konstruktive Einwände auf Lager.
IV. Der Sieg geht in Ordnung; aber „Was kommt danach?“ „Krieg ist doch keine Lösung!“
Die US-Regierung lässt es sich nicht nehmen, speziell für die Region, gegen deren ölreiches Kernland sie einen Waffengang zur Entwaffnung in die Wege leitet, noch ein spezielles sittlich wertvolles Kriegsziel zu formulieren: Demokratie möchte man nach Arabien exportieren, einen Prozess der Modernisierung gleich im gesamten Nahen und Mittleren Osten einleiten, die Segnungen freier Märkte verbreiten und so von Grund auf für die Stabilität der politischen Herrschaft sorgen, Sicherheit und Frieden stiften, nicht zuletzt in Israel und um Israel herum. Und dergleichen mehr.
Auch diese Deklaration zeichnet sich dadurch aus, dass sie schon ihre eigene Klarstellung enthält. Man braucht den angegebenen Zweck nur im Zusammenhang mit dem dafür zweckmäßigen Mittel zu sehen, und man ist umfassend darüber im Bilde, was die demokratische Weltmacht anzurichten und zu erreichen gedenkt: Der Frieden, den sie will, taugt nur etwas, wenn er das Resultat eines von ihr glanzvoll gewonnenen Krieges ist, die ganze Region also unter dem heilsamen Schock amerikanischer Machtentfaltung steht. Stabilität gibt es nur, wenn keine politisch ernst zu nehmende Kraft in der Region und erst recht kein souveräner Staat sich mehr irgendwelche Eigenmächtigkeiten traut und wenn außerdem Amerikas Militärmacht vor Ort präsent ist, um die politischen Entwicklungen notfalls direkt zu lenken. Demokratie ist das Synonym dafür, dass Amerika in jeder Hinsicht von Regierungen wie Völkern als Vorbild in politisch vernünftiger Lebensführung anerkannt und nachgeahmt wird, was nur dann gewährleistet ist, wenn ein Sieg der amerikanischen Waffen die ganze Region von der Überlegenheit des „american way of life“ überzeugt, indem er sowieso keine Alternativen mehr zulässt. Und so weiter. Wenn Amerikas siegreicher Krieg der Vater all der in Aussicht gestellten politischen Segnungen ist, an denen die arabische Welt genesen soll, dann sind diese Segnungen eben auch nichts anderes als die Effekte eines praktischen Beweises amerikanischer Übermacht, Teilaspekte oder Konsequenzen gewaltsam etablierter, auf Amerika als Urheber und Garanten zugeschnittener neuer Gewaltverhältnisse. So erfährt man einmal aus erster Hand, was es mit den Normen und Werten der demokratisch-marktwirtschaftlich zivilisierten Welt wirklich auf sich hat – noch ein Lehrstück in Sachen Imperialismus.
Doch auch da hören die Irakkriegs-Gegner nicht hin. Sie teilen umgekehrt der Bush-Administration – oder wem auch immer – ihren Merksatz mit: „Krieg ist keine Lösung“ – im Gegenteil:
„Eine Intervention im Irak wird die vielen Konflikte in der Region weiter anheizen und möglicherweise völlig außer Kontrolle geraten lassen. Die innenpolitische Situation im Nahen Osten würde weiter destabilisiert und Wasser auf die Mühlen fundamentalistischer Strömungen gegossen.“ (Resist-Kampagne)
Der schlichte Rückschluss von der Aktion, die die USA starten, auf das Problem, das sie damit tatsächlich zu lösen gedenken, und auf die Ziele, für die sie wirklich das allein geeignete Mittel darstellt, ist die Sache dieser Kritiker offensichtlich nicht. Stattdessen glauben sie dem Präsidenten auf einmal doch ziemlich viel von der schönfärberischen Darstellung seiner Kriegsziele; genug jedenfalls, um ihm mit dem wohlmeinenden Bedenken zu kommen, dafür wäre kriegerische Gewaltanwendung am Ende doch nicht das geeignetste Mittel, und er sollte über aller sicher berechtigten Siegesgewissheit doch die Ungewissheiten und Unwägbarkeiten des „Danach“ nicht vergessen.
Das ist einerseits sehr idealistisch, nämlich statt an den offenkundigen Kriegszielen am Ideal einer wohltätigen Ordnungsmacht entlang gedacht. Noch besser als die Bush-Leute selber, die überhaupt erst diese Notwendigkeit „entdeckt“ und zum gewichtigen Imperativ nah- und mittelöstlicher Ordnungspolitik ausgerufen haben, möchte die Friedensbewegung darüber Bescheid wissen, dass den „fundamentalistischen Strömungen“ dort das Wasser abgegraben und die innenpolitische Szene der arabischen Länder befriedet werden muss. Im Hinblick auf dieses Ziel kann sie vor Krieg nur warnen – und lässt sich eben auch durch die klare Auskunft der US-Regierung, ohne gewonnenen Krieg würden die regionalen Konflikte erst so richtig aus dem Ruder laufen, nicht umgekehrt ihrerseits darüber aufklären, dass nach der objektiv verbindlichen Auffassung der demokratischen Supermacht Stabilität in der Region nur durch Bombenterror von ganz hoch oben herab und durch die gewaltsame Sistierung aller abweichenden Umtriebe zu erreichen ist, weil sie nämlich genau genommen in nichts anderem besteht. Bei allem Idealismus sind die konstruktiv gesonnenen Kriegsgegner mit ihren Einwänden andererseits jedoch sehr nah an den imperialistischen Realitäten. Dass es Sache der besorgten „westlichen“ Welt im Allgemeinen und der USA im Besonderen sein muss, die „Konflikte in der Region“ unter Kontrolle zu halten, damit sie nicht „völlig außer Kontrolle“ – wessen Kontrolle denn eigentlich? – „geraten“, und sich um „die innenpolitische Situation im Nahen Osten“ zu kümmern, die man offenbar auf keinen Fall dem „Nahen Osten“ selber überlassen kann: das ist den Friedensbewegten mit ihrem hohen Verantwortungsgefühl völlig selbstverständlich. An der Verteilung der Zuständigkeiten für Frieden und Sicherheit in der Staatenwelt haben sie nichts auszusetzen; die ist im Gegenteil die feste Grundlage ihres eigenen Einmischungsbedürfnisses. Daher wählen sie auch gleich die richtige Adresse, wenn sie die regionale Konfliktlage im einzelnen begutachten und den Amerikanern den Vorwurf nicht ersparen können, sie hätten sich viel zu sehr aus dem israelisch-palästinensischen „Friedensprozess“ herausgehalten und besser erst einmal diese „Front“ bereinigt, bevor sie im Irak eine neue eröffnen: Die Einmischung, die die Bush-Regierung mit der Anerkennung des israelischen Anti-Terror-Kriegs gegen die Palästinenser als Teil ihres großen Feldzugs gegen den antiamerikanischen Terrorismus in aller Welt tatsächlich praktiziert, wird in dem Vorwurf zwar schon wieder im Namen eines zuckersüßen Ideals von Frieden im Heiligen Land mit Ignoranz gestraft; dass aber vor allen anderen die Herrschaften aus den Vereinigten Staaten für die Verhältnisse zwischen Jordan und Mittelmeer zuständig, dass sie letztlich die eigentlichen Herrscher der ganzen Region sind, das wird mit der Versäumnisrüge in Sachen Palästina-Politik nicht bloß als imperialistische Tatsache zur Kenntnis genommen, sondern als einzig „stabiles“ Ordnungselement uneingeschränkt affirmiert.
Bei so viel affirmativ-kritischem Realismus inmitten ihres heillosen Idealismus ist es kein Wunder, dass die Friedensbewegten, die sich im Gestus des welterfahrenen, politisch mit allen Wassern gewaschenen Warners vor unabsehbaren Gefahren gefallen, mit ihren Mahnungen und Einwänden ganz auf der Linie der über ihre Führungsmacht verdrossenen Verbündeten der USA liegen und Wort für Wort mit den Stellungnahmen insbesondere der deutschen Bundesregierung übereinstimmen. Dabei kann von idealistischer Weltfremdheit bei den zweitklassigen Profis des weltpolitischen Geschäfts ganz sicher nicht die Rede sein. Die sind von Amts wegen wirkliche Realisten der Weltordnung, mischen sich genau so universell ein wie ihre erstklassigen Kollegen aus den USA und würden das gerne auch genau so machtvoll tun können wie ihr einstweilen unschlagbar überlegener Verbündeter; sie leiden darunter, dass sie den Amerikanern in puncto Macht und Kontrolle über die Welt nicht das Wasser reichen können, sind ganz besonders unzufrieden mit ihrer groben Vereinnahmung durch die Bush-Regierung für deren neuen Nahost-Krieg, kleiden ihren Verdruss diplomatisch in die Form von Verzögerungs- und kleineren Störmanövern; dabei und dafür bedienen sie sich der fertig vorliegenden gestanzten Friedensrhetorik, vom „Scheitern der Politik“, wenn die „Kriegslogik“ los geht, bis zur Nerverei mit der Nachfrage, wie die Amerikaner sich eigentlich eine schiedlich-friedliche Nachkriegsordnung in dem nahöstlichen Sauhaufen vorstellen – und machen damit bei ihren friedensbewegten Bürgern einen enorm guten Eindruck. Dabei ist allemal klar: Wenn Schröder, Fischer & Co von „Problemen“ wissen wollen, die durch Krieg nicht gelöst, sondern nur verschlimmert würden, und „Konzepte“ für die Zeit „danach“ anmahnen, dann denken sie pflicht- und amtseidgemäß immer nur an das Eine und Selbe, nämlich an ihr Deutschland: wie es in und vor allem nach dem Krieg dasteht und sich einen Einfluss erobern kann. Und wenn diese Amtsträger sich unter Verweis auf nicht bereinigte, sondern verschlimmerte „Konflikte“ vom Krieg der USA distanzieren, dann haben sie die wenig glanzvolle Vasallenrolle im Auge, die die Führungsmacht mit ihrem Kriegsbeschluss ihnen und ihrer Nation zumutet. Die Phrasen über die sittliche Fragwürdigkeit eines Angriffskriegs und unabsehbare politische Folgeschäden auch eines Sieges der amerikanischen Waffen kommen den regierenden Demokraten der zweiten Staaten-Garnitur aber umgekehrt gerade recht und sehr zupass, um ihr hochanständiges nationales Publikum, und zwar nicht einmal bloß die friedensbewegte Minderheit, sondern das mangels regierungsamtlicher Kriegshetze auch wenig kriegsbegeisterte Gesamtvolk, moralisch für sich einzunehmen.
Dieser Zynismus ihrer regierenden imperialistischen Praktiker scheint die Bewegung der Irakkriegs-Gegner freilich völlig kalt zu lassen. Wenn die Diagnosen ihrer nationalen Führung sich wortgleich mit den ihrigen decken und die amtierenden Chefs mit dem „Protest der Straße“ ausnahmsweise einmal voll einverstanden sind, dann „begreift“ die „Bewegung“ das im Gegenteil als quasi amtliche Beglaubigung der Ernsthaftigkeit, nämlich vor allem der Realitätstüchtigkeit ihres „Widerstands“ – eine Tugend, auf die verantwortungsbewusst agierende Weltbürger den allergrößten Wert legen. Souverän ignorieren die Kriegsgegner das politische Kalkül der Regierung, mit der sie sich gemein machen; das national-imperialistische ebenso wie die berechnende Reflexion auf die Moral des Publikums. Von einem Unterschied, einem Gegensatz womöglich zwischen ihrer Abneigung gegen einen Krieg und dem regierungsamtlichen beleidigten Nationalismus, der sich als Kriegsgegnerschaft aufspielt, wollen sie nichts bemerken.
Am Ende gibt es den gar nicht?!
V. „Krieg nicht ohne UNO-Mandat!“ – und vor allem „Kein Alleingang der USA!“
Auf ganz sicherem Terrain wissen sich die Irakkriegs-Gegner, wenn sie den Kriegstreibern in Washington den schwergewichtigen Vorwurf um die Ohren hauen, sie wären dabei, mit einem ungenehmigten Alleingang das „Gewaltmonopol“ der UNO zu missachten und sich mit der „Arroganz der Supermacht“ über die großartige Errungenschaft des Völkerrechts hinwegzusetzen. Sehr milde der DGB:
„Die weltweite Auseinandersetzung mit dem Terrorismus und mit den Massenvernichtungspotentialen, insbesondere in den Händen von Diktatoren, ist Sache der Völkergemeinschaft und nicht eines einzelnen Landes, auch wenn es sich um die derzeit einzige Supermacht handelt. Wenn ein globales Gewaltmonopol als ultima ratio in Anspruch genommen werden muss, dann darf dies nur nach den Regeln des Völkerrechts geschehen.“ (Erklärung des DGB zum Irak-Konflikt, 13.2.03)
Mit dieser Mahnung ist zumindest schon mal bei der deutschen Arbeiterbewegung die Friedensliebe beim Standpunkt bedingter Kriegsbereitschaft angelangt. Ohne jede Vorbedingung billigt der Verein den von den USA gesetzten Imperativ, die Welt habe sich fortan vor allem anderen mit „dem Terrorismus“ sowie den „Massenvernichtungspotentialen“ in Tyrannenhand „auseinanderzusetzen“; da will er auch durchaus nicht so verstanden werden, als wollte er wieder nur auf den Vorwurf hinaus, die USA meinten es mit dieser Aufgabenstellung womöglich gar nicht wirklich ernst. Beim Vollzug dieser „Auseinandersetzung“ sind ihm genau zwei einschränkend gemeinte Bedingungen allerdings äußerst wichtig.
Erstens muss völlig klar sein und bleiben, dass Krieg nur als letztes Mittel in Frage kommt – die Kampforganisation des deutschen Proletariats redet von dem anstehenden Gemetzel schon gleich in vornehmer diplomatischer Zurückhaltung, will in dem Zusammenhang noch nicht einmal das Wort „Gewalt“ ohne „-monopol“ in den Mund nehmen: „globales Gewaltmonopol als ultima ratio in Anspruch genommen…“ Ihrem Bundeskanzler und dessen Außenminister nimmt sie damit das Wort aus dem Mund – und stellt sich so mit ihrer ganzen Autorität hinter den Zynismus, mit dem regierende Macht- und Befehlshaber einen Freibrief als Einschränkung zu verkaufen pflegen. Denn welcher Krieg würde je nach der Maxime geführt, es gäbe natürlich noch ganz andere „Lösungen“ und eine bessere „ratio“ als die „ultima“, man hätte sie nur gerade eben nicht zur Hand?! Die ganze Emphase, mit der alle Verantwortlichen bei jeder Gelegenheit betonen, Krieg würde ganz bestimmt nur dann geführt, wenn vorher alle anderen Methoden, das erklärte Kriegsziel zu erreichen, gewissenhaft durchprobiert worden seien, läuft schlicht auf die Ansage hinaus, ihn ganz bestimmt zu führen, sobald seine Initiatoren „mit ihrer Geduld am Ende“ sind. Dass er das letzte Mittel sei, heißt doch bloß, dass er das ultimative Mittel ist. Dem deutschen Publikum wird diese banale Wahrheit sogar eigens in aller Offenheit vorgeführt und genau so erläutert: Das Feilschen der deutschen Diplomatie um Resolutionen des EU-Ministerrats und des UN-Sicherheitsrats, die im Zusammenhang mit dem Irak von „Gewalt“ als „letztem Mittel“ reden, wird von denen, die es angeht, als „Einschwenken“ auf die Kriegslinie der USA gehandelt, weil damit dem Krieg als irgendwann dann doch fälligem Instrument der Weltordnung das Plazet erteilt wird; Opposition und sachverständige Journalisten lassen es sich angelegen sein, die Menschheit genau darüber ausgiebig aufzuklären. Dass die Regierung deswegen nicht darauf verzichtet, die Sache andersherum zu betonen, so als wäre sie gerade damit beschäftigt, einen unnachgiebigen Abwehrkampf gegen anglo-amerikanische Leichtfertigkeit beim Waffeneinsatz zu führen, ist verständlich; ohne solchen Zynismus ist Außenpolitik nicht zu machen und nicht zu verkaufen. Weniger verständlich ist die Weigerung der Anti-Irakkriegs-Bewegung, sich aufklären zu lassen. Unerschütterlich hört sie aus der zu Protokoll gegebenen Gewaltbereitschaft der rotgrünen Regierung nur die Bedingung, aus der Bedingung eine Einschränkung und aus der Einschränkung das Versprechen einer Absage heraus. Von Heuchelei will sie nichts bemerken, wenn ihr Außenminister ein ums andere Mal beschwört – bei seinen US-Kollegen sind sie da viel empfindlicher und merken gleich alles –, es wäre „noch nicht zu spät“ und er deswegen für Krieg noch lange nicht zu haben. Stattdessen fordert sie die Berliner Regierung auf, „Konsequenz“ an den Tag zu legen – wahrscheinlich, damit Krieg nicht doch unversehens zum drittletzten Erpressungsmittel gerät.
Eine zweite einschränkende Bedingung verlangt die Bewegung der „ultima ratio“ außerdem noch ab, und die ist genau so absurd: Ein UNO-Beschluss muss sie legitimieren. Ohne anständige Resolution geht Krieg auf keinen Fall in Ordnung – und wer das ernst meint, der kann sich dem Umkehrschluss nicht entziehen, dass er mit einer entsprechenden Entscheidung der „Völkerfamilie“ dann aber auch abgesegnet ist. Je entschiedener und selbstgewisser das „Nein zum Krieg“ sich darauf beruft, der US-Präsident hätte sich seinen Krieg noch gar nicht erlauben lassen und träte die UNO-Charta und ähnliche Höchstwerte der zivilisierten Menschheit mit Füßen, umso vollständiger wird es hinfällig, wenn in New York im Sinne Washingtons entschieden wird; je heftiger auf Amerikas Entschlossenheit eingeprügelt wird, den Krieg notfalls auch „im Alleingang“ zu führen, umso weniger bleibt von dem Anti-Kriegs-Standpunkt übrig, wenn Bush doch noch seine „Koalition der Willigen“ zusammen bringt Mit ihrem Rekurs auf die Vereinigung der Machthaber aller Länder und die Geschäftsordnung ihres diplomatischen Kräftemessens machen die Kriegsgegner ihre Friedensliebe letztinstanzlich davon abhängig, wie an der New Yorker Diplomatenbörse die Mehrheiten ausfallen, wie gewisse privilegierte Mächte sich ihr Veto im Sicherheitsrat einteilen und wer alles mitmacht. Und das halten sie selber offenbar für ganz in Ordnung so. In anderen Zusammenhängen mögen sie wissen – mitgeteilt wird es sowieso in allen Nachrichten aus dieser Welt der diplomatischen Gemeinheiten und Heucheleien –, dass es sich bei der UNO um den organisierten Marktplatz für zwischenstaatliche Erpressungsgeschäfte bis hin zum Krieg handelt. Für die Zwecke ihres Protests erkennen sie in den Vereinten Nationen jedoch die Inkarnation der Präambel ihrer Geschäftsordnung, eine Völkergemeinschaft mit höchster sittlicher Autorität in Gewaltfragen. Da hilft es schon wieder nichts, dass die USA mit ihrer UNO-Diplomatie diesen albernen Idealismus gerade nachdrücklich vom Kopf auf die Füße stellen und dem erlauchten Verein den Dienst an ihrem Krieg abfordern, für den er in der schnöden Realität wirklich bloß taugt: dass er ihrem Vorgehen den Stempel mehrheitlicher und damit allgemeiner Billigung aufdrückt. Die Friedensfreunde, die nichts weniger leiden können als die Selbstherrlichkeit der Mächtigen, halten unverdrossen an der umgekehrten Lesart fest: Wenn die Weltmacht die Fakten setzt, die die Konkurrenz der souveränen Mächte tatsächlich bestimmen, und außerdem die UNO mit ihrem Regelwerk für die Organisation einer allgemeinverbindlichen Zustimmung in Anspruch nimmt, dann interpretieren sie sich dieses klare und eindeutige Verhältnis in unverwüstlichem Idealismus genau umgekehrt zurecht: als Herrschaft „der Allgemeinheit“ – wenn schon nicht über die realen Kräfteverhältnisse, so doch wenigstens über deren „normative Kraft“.
Damit folgen sie schon wieder Wort für Wort den Sprachregelungen ihrer Berliner Obrigkeit, die tatsächlich ganz andere, sehr handfeste Gründe dafür hat, die einsamen Entscheidungen der US-Regierung mit einem Appell an die UNO und der Forderung nach einer völkerrechtlichen Lizenz „anzugreifen“. Für die Inhaber der bundesdeutschen Staatsmacht hat die Einschaltung der „Völkergemeinschaft“, neben dem moralischen Extraprofit, eine nicht zu verachtende politische Funktion: So schalten sie ein ganz bestimmtes Mitglied dieser „Gemeinschaft“, nämlich sich in die Beschlussfassung über Krieg und Frieden auf der Welt ein, können über zweckmäßig konstruierte Umständlichkeiten bei der Bedienung des Interesses der USA an allgemeiner Zustimmung zu ihren Beschlüssen Einfluss auf diese Beschlüsse gewinnen oder das wenigstens versuchen, auch wenn sie sich über die Wucht dieser Handhabe nicht viel vormachen und viel besser als ihre friedensbewegten Bürger wissen, wie es in der UNO tatsächlich um das Verhältnis zwischen ideellem Gewaltmonopolisten und wirklicher Weltmacht bestellt ist. Um ein solches politisches Geschäft geht es denen jedenfalls; genau dafür taugt ihnen jene Menschheitsinstanz mit Sitz in New York und allerhöchster sittlicher Autorität. Daraus machen die Berliner Weltpolitiker auch weiter gar kein Geheimnis: Sie geben damit an, wie geschickt sie um „Einfluss“ gerungen – und müssen sich nachsagen lassen, wie ungeschickt sie sich dabei angestellt und wie sehr sie Deutschlands Bedeutung in der Welt dadurch geschadet – hätten. Dabei bemessen sich Einfluss und Bedeutung nicht nach der Gewaltlosigkeit der Sache, der sie irgendwo zum Durchbruch verholfen hätten, sondern schlicht danach, ob und inwieweit Deutschland als Mitentscheider und Drahtzieher, bei welchen Beschlüssen auch immer, in Erscheinung tritt oder eben seiner relativen Irrelevanz überführt wird. Was die Bundesregierung an „friedenspolitischen“ Positionen formuliert, steht ganz im Dienst dieses diplomatischen Ringens um eine respektable und respektierte Position im engen Kreis der wirklich Mächtigen – und nicht etwa umgekehrt das Ringen um Einfluss im Dienst der „Friedenswahrung“ –; ihr Beharren auf einer UNO-Lizenz fürs Kriegführen ist das Material für den angestrebten praktischen Nachweis, dass selbst die USA mit ihrem Alleingang nicht ganz an Deutschland vorbeikommen. Ihr Widerstand gegen den amerikanischen Kriegskurs hat sein Ziel und sein Erfolgskriterium darin, ein komplettes Entscheidungsmonopol der USA zu verhindern; der Imperativ „Kein Alleingang!“ ist da wirklich die ganze und politisch für sie entscheidende Sache. Dass sie diesen Kampf führen und dafür im Übrigen auch national wie international Anerkennung einheimsen wollen, hindert die rotgrünen Herrschaften in Berlin freilich nicht, gleichzeitig ihrem auf Frieden gestimmten Publikum gegenüber die umgedrehte Lesart zu vertreten und ihr Ringen um Einfluss auf Amerikas Kriegskurs als Einsatz für den Frieden hinzustellen.
Und schon wieder finden sich die Irakkriegs-Gegner, die bei US-Politikern jede Heuchelei sofort durchschauen und denen noch nicht einmal ihren Klartext glauben, zu grenzenlosem Einverständnis bereit: So möchten sie es unbedingt sehen, dass die Rotgrünen Deutschlands ganzes Gewicht für das Ideal eines friedlichen Fortgangs der Weltgeschichte geltend machen. Zu den Regierungen, denen gewisse hochangesehene Repräsentanten des Friedensgedankens eine wohlabgewogene Rüge erteilen müssen, zählen sie das Berliner Kabinett jedenfalls nicht; eher schon zu ihresgleichen: jenen „Zivilgesellschaften“, die
„wir … auf(fordern), sich mit uns allen Hegemoniebestrebungen und Kriegsstrategien zu widersetzen und sich für eine friedliche Lösung der dringendsten Menschheitsprobleme einzusetzen. Einzelne Regierungen sind bereit, die über 50 Jahre gültigen völkerrechtlichen Regeln, die für die Sicherung des Friedens in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind, ohne Not aufzugeben.“ (Appell der Träger des Aachener Friedenspreises, 27.1.03)
Einzig das Bedenken können die Veranstalter der größten Friedensdemonstration der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte ihrem sozialdemokratischen Kanzler nicht ersparen: er hätte die goldrichtige Grundsatzentscheidung, sich Amerikas „Hegemoniebestrebungen“ und der Selbstherrlichkeit der „Bush-Krieger“ zu widersetzen, eventuell doch zu bedenkenlos für niedere Wahlkampfzwecke benutzt und wäre aus Popularitätsgründen womöglich bereit, davon auch wieder abzurücken. Deswegen erteilen sie ihrer Bewegung den Auftrag, für die richtige öffentliche Stimmung zu sorgen und so dem regierenden SPD-Chef „den Rücken zu stärken“, damit er nicht ins amerikanische Kriegslager umfällt. Damit ist der Schulterschluss komplett; und die Einigkeit reicht über das Stichwort „Frieden“ schon ein ganzes Stück hinaus: Auch für die Anti-Irakkriegs-Bewegung fällt ihre Friedensliebe mit patriotischer Abgrenzung gegen die übermächtige Supermacht aufs Glücklichste zusammen.
Die Übereinstimmung ist nicht zufällig. Sie besteht auch nicht in einer bloß äußerlichen Deckungsgleichheit gewisser Konsequenzen aus eigentlich völlig disparaten Standpunkten; auch wenn es natürlich nicht das diplomatische Kalkül der weltpolitischen Profis ist, das die Friedensbewegten bewegt. Deren Antrieb entstammt schon noch einer Idealvorstellung von staatlicher Gewalt und einem menschheitsdienlichen Friedensauftrag, den diese bedingungs- und berechnungslos zu erfüllen hätte und den sie einklagen müssten. Normalerweise befinden sich Pazifisten damit in der unangenehmen Lage, ihr Friedensideal gegen die eigene Regierung hochhalten zu müssen, weil die mal wieder Krieg vorbereitet, für fällig hält, am Ende führt und damit lauter Dinge tut, die ein Friedensfreund für Verstöße gegen ihre eigentliche Aufgabe hält. Für diese Auffassung kann er sich sogar auf das Bild berufen, das die Repräsentanten und Apologeten des bürgerlichen Gemeinwesens selber von der Würde des Gewaltmonopols und der Berufung seiner Sachwalter zeichnen. Mit ihrer unbedingten Treue zu diesem Ideal auch und gerade dann, wenn Krieg angesagt ist, geraten die Pazifisten aber sofort nicht bloß mit ihrer real existierenden Regierung aneinander, sondern auch in einen ziemlich tragischen Konflikt mit der Loyalität zu ihrem Heimatvereinsvorstand, die sie überhaupt nicht kündigen wollen. Schon deswegen ist pazifistisches Bekennertum normalerweise eine Minderheiten-Angelegenheit; die Staatsgewalt tut sowieso das Ihre, um Bewegungen, die ausgerechnet für den und womöglich sogar in dem Fall einer kriegerischen Kraftanstrengung des gesamten Gemeinwesens Protest einlegen möchten, mit politischen und polizeilichen Mitteln klein zu halten und moralisch ins Abseits zu drängen. Das alles ist beim Protest gegen Amerikas Irakkrieg einmal ganz anders. Da ist es eine fremde Regierung, die in Washington, die sich an den Idealen wahrer Friedensliebe versündigt; da hat der Pazifismus die eigene Obrigkeit sogar auf seiner Seite, weil die ihr nationales Interesse durch das amerikanische Vorgehen verletzt sieht. Der Geist des wahren Patriotismus, der Friedensfreunde beflügelt, braucht sich an dem realen, von der Regierung praktizierten Patriotismus nicht zu reiben – und wird von diesem nicht aufgerieben –, weil beides zusammenfällt. Umgekehrt kann sich die ganz normale staatsbürgerliche Voreingenommenheit für die eigene Nation auf einmal ganz gut in dem Friedensidealismus wiederfinden, den eine abgeklärte Öffentlichkeit ansonsten teils als Kinderkram verachtet, teils als besserwisserische Abweichung von der gebotenen Loyalität ächtet: Mit ihrer Kritik an Amerikas Krieg nehmen die Idealisten des Patriotismus nicht bloß ihrer Regierung das Wort aus dem Mund, sondern sprechen, endlich einmal, dem normalen, national richtig eingestimmten Staatsbürger aus dem Herzen.
So können sich die Wortführer einer kleinen radikalen Minderheit – unverhofft, aber durchaus nicht zufällig – eines massenhaften Zulaufs zu ihren Demonstrationen erfreuen. Dort müssen sie nur ein wenig aufpassen, dass ihnen nicht zuviel un-cooles Vokabular von früher in ihre Ansprachen rutscht, das noch den Geist des Widerspruchs gegen die „Realpolitik“ der eigenen Nation widerspiegelt. Das schaffen sie ganz gut; alle „linkssektiererischen“ Streitereien um die richtige politische Oppositionslinie haben sie hinter sich gelassen oder nie angefangen. So geht die Anti-Irakkriegs-Bewegung voll und mit voller Absicht darin auf, als das friedensidealistisch gute Gewissen des durch die „Arroganz der Supermacht“ beleidigten deutschen Nationalismus und als dessen öffentlicher Lautsprecher zu fungieren. Dieser regierungsamtlich ausgerufene und beglaubigte Standpunkt geht seinerseits allerdings nicht ganz in dem friedensbewegten Protest gegen Amerika auf. Und deswegen ist die einschlägige Bewegung auch noch immer nicht ganz fertig, wenn sie diesen Protest abgeliefert hat: Mit einer gewissen Umständlichkeit im bundesdeutschen Nationalgefühl hat sie sich auch noch auseinander zu setzen.
VI. „Kein Antiamerikanismus!“
Es ist ja wirklich nicht so, dass die rotgrüne
Bundesregierung sich nicht auf die moralische Agitation
für einen Krieg verstünde, den sie für nötig
befindet, oder dass der demokratischen Öffentlichkeit der
Nation keine guten Gründe für einen Krieg einleuchten
würden, wenn schon die USA mitsamt ihrer so vorbildlich
freien öffentlichen Meinung sich dafür stark machen. Erst
vor vier Jahren, gleich zu Beginn ihrer
Regierungskarriere, haben Fischer und Scharping gemeinsam
mit dem unvergesslichen Jamie Shea von der NATO
demonstriert, wie gut sie einen ganz ordentlichen
Bombenkrieg gegen einen total unterlegenen Gegner
verkaufen können; unter anderem nach dem Muster:
zwar allerlei Bedenken und Einwände irgendwie
zulässig finden, aber darauf bestehen, dass sie
angesichts der Bösartigkeit des Feindes und der einfach
nur guten Absichten der eigenen Seite weniger als gar
nichts zählen können. Ein paar weiterführende, von der
britisch-amerikanischen Kriegspropaganda jetzt wieder
aufgegriffene Beiträge zum unerschöpflichen Thema des
gerechten Krieges sind ihnen damals schon
gelungen.[1]
Und natürlich fallen die Feindbilder, mit denen die
Bush-Regierung für ihren Irakkrieg Stimmung macht, auch
diesseits des Atlantik auf fruchtbaren Boden; die
Gleichung „Saddam = böse“ gilt selbstverständlich auch
für die Berliner Regierung, und sie wird nicht zuletzt
von denen vorbehaltlos geglaubt und anerkannt, die Bush
und Rumsfeld nicht glauben wollen, dass die es damit
wirklich ernst meinen. Nur werden eben diesmal
hierzulande alle durchaus anerkannten guten Gründe für
Gewalt gegen das irakische Regime – jedenfalls
einstweilen noch, vor dem christlich-abendländischen
Aschermittwoch – mit einem zwar
eingeklammert, um
zu dem noch gewichtigeren anti-irakkriegerischen
aber
überzugehen.
Doch dabei bleibt es nicht. Kaum hat die Anti-Kriegs-Meinung gute Gründe für und noch bessere Einwände gegen den Krieg richtig auf die Reihe gebracht, da wird die Kritik selber insgesamt unter einen Vorbehalt gestellt, der – man denkt, das gibt’s gar nicht, wo es doch schon ums politisch Allerexistenziellste, um Krieg & Frieden gehen soll; aber das gibt’s eben doch – politmoralisch auf einer noch höheren Ebene angesiedelt ist: Sie mögen zwar berechtigt sein, die Einwände gegen Amerikas Krieg, aber dabei muss glasklar sein und bleiben: Nichts gegen Amerika! „Antiamerikanismus“ wäre grundfalsch und fast schon so böse wie Saddam, der bekanntlich ganz schwer gegen Amerika ist.
Ein absurder Einfall – sollte man meinen: Ausgerechnet den Veranstalter soll man von der Kritik am Krieg ausnehmen?! Gegen wen soll man denn sonst Einwände erheben wenn nicht gegen die Nation, die alle Mittel aufbietet, um einen Großangriff erfolgreich durchzuziehen? Wessen Militär plant denn gerade und macht demnächst, wenn nichts mehr dazwischen kommt, den Übergang vom Drohen zum Vernichten? Aber seltsam: Nicht bloß bekennende Befürworter eines neuen Golfkriegs, nicht bloß Bush-Anhänger diesseits und jenseits des Atlantik verbitten sich Kritik und Nörgelei an der Weltmacht; und nicht bloß von außerhalb wird der Anti-Irakkriegs-Bewegung der Imperativ entgegengehalten, mit ihrem „Nein!“ gefälligst gleich hinter dem „selbstherrlichen“ Angriffskrieg und deutlich vor dem Angreifer Halt zu machen. Von den Kriegsgegnern selbst ist jederzeit, auf Nachfrage oder schon ungefragt zur Einleitung ihrer Protest-Statements, das Bekenntnis zu haben, dass sie zwar gegen den Krieg „als solchen“ sind, aber nicht eigentlich gegen die Nation, die ihn führt, nur, quasi notgedrungen, gegen Teile der gegenwärtig regierenden Administration – dass die nichts wäre ohne die Nation, die auf sie hört, und dass umgekehrt noch die nettesten Menschen in ihrer Eigenschaft als Nation nichts weiter sind als die mehr oder weniger machtvolle Manövriermasse ihrer Regierung, das bleibt sowieso ganz außer Betracht. Und spätestens dann, wenn es einen friedensbewegten Patrioten drängt, den Chef der amerikanischen Militärmacht als „Öl-Cowboy“ zu beschimpfen, drängt es ihn selbst oder seine Umgebung zu einer Freundschaftserklärung an das großartige Land, das bekanntlich keine Mühen gescheut hat, um „uns“ die Freiheit zu bringen und beizubringen – sollte jemand das vergessen, dann steht jederzeit der deutsche Außenminister bereit, um sich im Namen aller anständigen Deutschen für diesen unvergesslichen Dienst zu bedanken. Sogar das wollen die tapferen Irakkriegs-Gegner, vom Bundestagspräsidenten Thierse abwärts, erst und nur von den Amerikanern beigebracht gekriegt haben – von allein wären sie wohl nie darauf gekommen –, dass die Freiheit, die „wir“ den Amerikanern verdanken, glatt das Recht einschließt, zu demonstrieren und auf Demonstrationen sogar, man denke!, in aller kritischen Solidarität dem transatlantischen Freund, ohne dessen Nachhilfeunterricht die Deutschen wahrscheinlich bis heute die Klappe gehalten hätten, die Meinung zu sagen. Diese Meinung besteht also erstens einmal darin, die Distanzierung vom Krieg der USA in eine Ergebenheitsadresse an die amerikanische Nation einzuwickeln. Und sie geht zweitens folgerichtig so weiter, dass jeder Kritik die Versicherung auf dem Fuße folgt, man hätte damit selbstverständlich nur Amerikas eigenes Bestes im Auge. Die Werte – des Völkerrechts, der gleichberechtigten Bündnispartnerschaft, des UNO-Gewaltmonopols und dergleichen mehr –, an die man die durchgeknallten „Bush-Krieger“ leider Gottes erinnern müsse, seien drittens sowieso überhaupt keine anderen als diejenigen, für die die USA selber seit jeher am allerkonsequentesten stehen und einstehen; auch in der Hinsicht ist man also eigentlich amerikanischer als die Amerikaner. Und unter den leibhaftigen Angehörigen dieser großartigen Nation – auch das weiß jeder, der gegen die dortige Regierung den Mund aufmacht, und beruft sich viertens darauf – gibt es welche, sogar richtig Prominente, die mit dem Kriegskurs ihrer Herrschaften nicht einverstanden sind und damit gleich einen doppelten Beweis liefern: Es gibt wirklich, jenseits der amtierenden Administration, jenes sagenhafte andere, eigentliche, zutiefst dem Guten verpflichtete Amerika, gegen das niemand etwas gesagt haben möchte; und wenn schon eingeborene US-Bürger persönlich gegen den Krieg ihrer Regierung sind, dann kann Kritik daran ja wohl unmöglich Amerika-feindlich sein.
All diese beredten Versicherungen, wie der eigene Protest gemeint sei und wie vor allem nicht, erfüllen – egal, ob nur geheuchelt oder außerdem sogar ehrlich gemeint – den peinlichen Tatbestand der Entschuldigung; und das ist schon sehr verräterisch. Daraus wird nämlich erstens deutlich, dass die vorgebrachten Einwände mit der Frage, ob sie stimmen oder nicht, sowieso nichts zu tun haben, sondern ganz auf der Ebene der quasi persönlichen moralischen Wertschätzung liegen und dort auch bleiben wollen. Das Dementi einer antiamerikanischen Einstellung verrät zweitens, dass der patriotische Friedensgeist, der sich so moralisch gegen Amerikas Krieg verwahrt, selbstverständlich in dem Maße antiamerikanisch ist, wie er national ist – und dass drittens ein nationaler Moralismus mit so entschieden antiamerikanischer Stoßrichtung aus übergeordneten Gründen doch auch wieder nicht sein soll. Dieselben Leute, die die ideelle Parteinahme für oder gegen den Irakkrieg zur politischen Gewissensentscheidung für jeden anständigen Bürger erklären und mit bestem patriotischem Gewissen gegen Krieg votieren, weil die Heimat an der Stelle selber auf Distanz zu den USA gegangen ist, machen sich jenseits der Gewissensfrage des Friedens aus ihrem moralischen Unwerturteil über die amerikanische Politik selber ein Gewissen, weil Antiamerikanismus sich für anständige Deutsche einfach nicht gehört. In deren Nationalismus ist offenbar ein Mindestmaß an Pro-Amerikanismus als moralischer Bremsklotz eingebaut. Die Gegenprobe liefert die christliche Opposition, die es an „Stolz, ein Deutscher zu sein“, ja wirklich nicht fehlen lässt, von den Gegnern des Irakkriegs aber ausdrücklich einklagt, was die sowieso liefern, nämlich eine unverbrüchlich Amerika-freundliche Einstellung, und außerdem, was die schuldig bleiben, nämlich eine bedingungslose Wertschätzung, die auch die amtierenden Kriegstreiber in Washington einschließt.
Was da in der Welt der öffentlichen und öffentlich zur Schau gestellten politischen Moralität an innerem Gewissenskonflikt des deutschen Nationalismus aufbricht, sobald sich einmal eine Mehrheit der Nation zu moralischer Distanzierung von dem großen freiheitlich-demokratischen Vorbild herausgefordert und berechtigt fühlt, hat einen sachlichen Grund in der Staatsräson dieser Nation. Die ist nämlich selber durch einen gewissen Zwiespalt gekennzeichnet: den Widerspruch zwischen einem in die Konstitution dieser Republik eingebauten subalternen Vasallentum, das ein souveränes Gewaltsubjekt, und eine imperialistisch so ambitionierte Nation wie die deutsche schon gleich, nicht wirklich aushält, und dem unbestreitbaren und bislang auch noch nicht wirklich bestrittenen nationalen Nutzen dieser Subalternität; denn seinem Vasallen- und Schmarotzerverhältnis zur amerikanischen Weltmacht hat dieser Staat tatsächlich die Reichweite der Macht zu verdanken, zu der er es gebracht hat. Die Geschäftsgrundlage und die Ambitionen des bundesdeutschen Imperialismus vertragen sich letztlich nicht; wie heftig diese beiden „Seiten“ der nationalen Staatsräson mittlerweile auseinander streben, wird in dem Zwergenaufstand der rotgrünen Regierung gegen die transatlantische Führungsmacht in der Irakfrage kenntlich; die Intransigenz der amerikanischen Regierung gerade im Umgang mit ihrem deutschen Verbündeten trägt das Ihre dazu bei, dieses fundamentale Drangsal des deutschen Strebens nach Weltgeltung zu schärfen. Genau das spiegelt auch der Streit zwischen Regierung und Opposition wider, in demokratisch sachgerecht verzerrter Form: Der Oppositionsvorwurf fatalster „handwerklicher Fehler“ in der Amerika-Politik der Regierung geht einerseits über das übliche „Die können es nicht!“ hinaus, immerhin soll die Regierung damit einen „Grundpfeiler“ der deutschen Nachkriegspolitik „beschädigt“ haben; er rührt durchaus an die Sache, den Widerspruch zwischen imperialistischer Grundlage und freiem imperialistischem Gebrauch der nationalen Macht, mahnt zur Lösung dieses „Problems“ andererseits aber gar kein grundsätzlich anderes, sondern eben nur ein „handwerklich“ besseres Vorgehen an; umgekehrt will die Regierung mit ihrem Gegenvorwurf der vaterlandsvergessenen pro-amerikanischen „Liebedienerei“ an die Adresse der Oppositionschefin auch nicht auf die Grundsatzentscheidung hinaus, bundesdeutsche Weltpolitik fortan allein aus eigener Kraft und auf eigene Rechnung zu betreiben. Der Widerspruch in der nationalen Staatsräson ist aber virulent geworden. Und exakt das spiegelt sich in dem seismographisch empfindlichen Gewissenshaushalt des bundesdeutschen Patriotismus wider. Gerade da, wo er sich mit dem besonders guten Gewissen einer ganz vaterlandseigenen Friedensliebe zu einem ziemlich entschiedenen Antiamerikanismus durchringt, stößt er auf sein letztes moralisches „Tabu“: die Pflicht zum Pro-Amerikanismus. Der mögen sich auch die Wortführer der Anti-Irakkriegs-Bewegung nicht entziehen; schon um nicht doch gleich wieder ins moralische Abseits zu geraten.
Ganz zu Ende ist die Angelegenheit allerdings auch damit noch nicht. Patriotismus, diese dem Staatsbürger „angeborene“ Parteilichkeit für die „eigene“ Nation, hält vieles aus, vor allem viel moralische Enttäuschung über das eigene Vaterland und dessen Führung, weil darin der Glaube an die eigentliche sittliche Güte des Gemeinwesens unverwüstlich weiterlebt. Was diese Gesinnung deswegen nicht aushält, das ist die Zumutung, einer anderen Nation mit genau so bedingungsloser Parteilichkeit zu Diensten zu sein und das als moralische Schranke für das eigene staatsbürgerliche Selbstbewusstsein anzuerkennen. Gleich zwei derartige „Tabus“ hat der bundesdeutsche Nachkriegs-Nationalismus sich jedoch angetan. Das eine, die unbedingte politische Gutheißung des Judenstaats durch die staatsbürgerlichen Erben der nationalsozialistischen Judenmörder, hat gerade erst, nicht ganz unversehrt, die Attacke des nordrhein-westfälischen Fallschirmjäger-Offiziers von der FDP überstanden. Das andere, das Gebot des Pro-Amerikanismus, drückt in dem Maße aufs deutsche Gemüt, wie die deutsche Nation an ihrer Abhängigkeit von der amerikanischen Führungsmacht leidet. Und diese Gemütslage findet in der nassforschen Art, in der Amerikas Führungsfiguren den Deutschen gegenüber auf Gefolgschaft bestehen, einen gerechten Anlass, auf noch höherer Ebene einmal kräftig „zurückzuschlagen“. Mit dem anstehenden Gemetzel im Irak hat es jedenfalls überhaupt nichts mehr zu tun, wenn Deutschlands oberste ideelle Sittenwächter sich herausgefordert fühlen, dem nationalen Stolz gegen den transatlantischen Vormund einmal nachdrücklich zu seinem Recht zu verhelfen. Die tun es nicht unterhalb der allerhöchsten Kulturstufe; schon deswegen, weil man die rohen Amis einmal so richtig spüren lassen will, was eine abendländische Kulturnation ist und warum die sich von irgendwelchen welthistorisch unerfahrenen Rambos schon gleich gar nichts sagen lassen muss. So kommt es, wie es kommen muss:
VII. „Das alte Europa antwortet Herrn Rumsfeld“
Es ist ein kleiner Scherz, der dem deutschen
Nationalismus die gute Gelegenheit serviert, sich endlich
von seiner anti-anti-amerikanischen Gewissensqual zu
befreien. Die Frohnatur an der Spitze des Pentagon ist so
frei, die gewissen „Probleme“, die seiner Weltmacht bei
ihrer Mission im Irak von einigen ihrer europäischen
Vasallen bereitet werden, nicht nur in der für ihn
typischen Manier zu würdigen: Er lässt die betreffenden
Nationen auch noch deutlich wissen, dass sie für
ihn ein Problem
sind. Deutschland und Frankreich:
das sind Nationen, die den Zug der weltpolitischen
Moderne verpasst hätten, Repräsentanten eines alten
Europa
, die sich an den Exemplaren des neuen
,
das an Amerikas Seite steht, ein Vorbild nehmen sollten –
und das ist für Patrioten endgültig zu viel an nationaler
Demütigung. Sich von einem dieser Parvenüs der Neuen Welt
auch noch sagen zu lassen, dass das eigene Vaterland auf
dem welthistorischen Abstellgleis parkt: Das tut nicht
nur sehr weh, das fordert die Vertreter der europäischen
Kulturnationen nachgerade zum Gegenschlag heraus. Wenn
sie, die an der Degradierung ihrer Nation durch die
Weltmacht schon genug zu leiden haben, etwas endgültig
nicht mehr ertragen können, dann ist es die
ehrabschneidende Einlassung eines Ami, sie wären mit
allem, was ihnen hoch und heilig ist, irgendwie nicht
mehr auf der Höhe der Zeit. Also zeigen die
Repräsentanten der Wiege aller menschlichen
Zivilisiertheit und politischen Kultur einmal, wo –
intellektuell und kulturmäßig betrachtet – die wahren
Cro-Magnons residieren; wer da also wem etwas zu sagen
hat, in Sachen alt und neu und deswegen überhaupt.
Von der Zeitung mit dem klugen Kopf dahinter um
Stellungnahme gebeten, lassen sich die Vertreter des
europäischen Geistes nicht lange bitten und liefern die
gewünschte Reaktion auf eine amerikanische
Provokation
(dieses und folgende
Zitate aus: „Das alte Europa antwortet Herrn Rumsfeld“,
FAZ, 24.1.03). J. Habermas,
der deutsche Philosoph, ist als Fachmann für
tiefere Geistesverwandtschaften mit seinem Urteil als
erster gefragt, wenn sich über die Frage von Krieg und
Frieden transatlantisch die Meinungen entzweien. Einer
wie er, der sich so gründlich darauf verlegt hat,
zwischen der Politik, die Staaten betreiben, und den
legitimatorischen Titeln, auf die sie sich dabei berufen,
grundsätzlich nicht mehr unterscheiden zu wollen, weiß
sich mit seinem gut ausgebildeten Abstraktionsvermögen
auch in politischen Streitfragen ganz selbstverständlich
zum Richter berufen. Er braucht sich bei der Ausübung
seines Amtes nämlich mit denen selbst und damit mit der
politischen Sache, die da Nationen in Gegensatz
zueinander bringt, gleich gar nicht erst abzugeben: Für
ihn ist die Weltmacht und alles, was sie politisch
unternimmt, Geist – das säkulare Selbstverständnis der
Neuen Welt zehrt von einem christlichen Erbe, von der
Parteinahme für den ordo rerum novarum
. Europa und
die Politik, die es treibt – das ist auch Geist,
und zwar der, der ursprünglich aus dem Mutterschoß allen
politischen Philosophierens kam, nach Amerika ging,
wieder über den Teich zurückgeweht wurde und sich dann
hierzulande als eine normative Denkungsart gegen alte
Mentalitäten durchgesetzt
hat, Derivat des
amerikanischen Geistes
also, der nach 1945 die
Welt beseelte. Steht so fest, dass alle Politik diesseits
wie jenseits des Atlantik ohnehin nur den normativen
Pfaden folgt, die ein
christlich-demokratisch-humanistisch gesonnener und stets
dem ‚Neuen‘ verpflichteter Weltgeist ihr vorgibt, hat der
Philosoph alles beieinander, was er zu einer profunden
politischen Urteilsbildung im aktuellen Fall braucht –
ein amerikanischer Minister, der Europa ‚alt‘ heißt, ist
selber von gestern, ätsch: In der Kritik seiner
europäischen Freunde begegnen ihm die preisgegebenen
eigenen, die amerikanischen Ideale des 18. Jahrhunderts.
Aus dem Geiste dieser politischen Aufklärung sind ja die
Menschenrechtserklärung und die Menschenrechtspolitik der
Vereinten Nationen, sind jene völkerrechtlichen
Innovationen hervorgegangen, die heute in Europa eher
Anhang zu finden scheinen als in der ziemlich alt
aussehenden Neuen Welt.
Ein Fall von Selbstentzweiung
ein und derselben, so uramerikanischen wie
erzeuropäischen normativen Denkungsart
, die uns in
Europa beim Umgang mit Menschen und Völkern in Fleisch
und Blut übergegangen ist, liegt da also vor, und das
lässt tief blicken. Atavismus ist nämlich im Programm des
Weltgeistes nicht vorgesehen, und wenn der Mann auf die
Kritik seiner europäischen Freunde
nicht hören
will, so ist er der Beweis, dass der wirkliche
Fortschritt aller menschlichen Zivilisation und mit dem
zusammen das wahre Amerika ihren festen Wohnsitz längst
in Europa eingenommen haben. Darauf lässt sich gut
aufbauen. Einmal auf die Ebene gezerrt, wer wen besser
alt aussehen lässt, ist nämlich überhaupt keine Frage
mehr, wer bei diesem weltpolitischen Kräftemessen die
besseren Karten hat.
P. Sloterdijk, der andere
deutsche Philosoph, weiß auch schon längst, dass das
westliche Wesen, an dem der Rest der Welt zu genesen hat,
nicht mehr aus dem Mutterland der Freiheit, sondern von
Europa aus exportiert wird – das alte Europa, durch
Frankreich und Deutschland ehrenvoll vertreten, ist die
avancierte Fraktion des Westens
. Jetzt kann er es
endlich laut heraussagen, und sein Votum auch noch auf
eine ganz spezielle Art begründen – mit dem
hervorragenden geschmacklichen Eindruck nämlich, den die
politischen Führer Europas bei ihm grundsätzlich zu
hinterlassen pflegen. Für ihn sind alle Fragen von Macht
und Gewalt solche der Kultur, in die der
Weltgeist sich kleidet, und die ist entweder vorhanden
oder nicht. So hat man sich ihm zufolge in Europa eben
unter dem Eindruck der Lektionen des zwanzigsten
Jahrhunderts zu einem postheroischen Kulturstil – und
einer entsprechenden Politik – bekehrt
, während man
in Amerika mangels entsprechender Lektionen noch immer
den Konventionen des Heroismus
frönt, die Banausen
wie J. Wayne erfunden haben. Geschichts- und
kulturphilosophisch betrachtet, liegen Helden wie
Rumsfeld und Bush
mit ihren Flugzeugträgern also
einfach nur peinlich daneben, sind sie doch von dem in
den europäischen Kulturnationen längst ad absurdum
geführten Glauben erfüllt, dass es die Gewalt ist, die
frei macht, und dass Kultur und Gesetze nur bei schönem
Wetter gelten
. In Wahrheit verhält es sich genau
andersherum, kommt die ganze Macht und Herrlichkeit von
Staaten nicht aus den Läufen von Gewehren, sondern aus
den Schäften der Schreibfedern, mit denen Dichter und
Denker wie er die auch bei Regen gültigen Benimmregeln
der Politik abfassen. Und weil Politik für Philosophen
erstens das ist, als was sie sich sie denken,
und weil sie sich zweitens von einem Rowdy aus USA ihren
patriotischen Geschmack nicht schlecht machen lassen
wollen, legen sie gleich noch einen Kopfstand obendrauf
und fragen nicht sich, sondern einfach mal in Washington
an, wer hier eigentlich blind gegenüber allen wahren
machtpolitischen Realitäten ist: Der Streit geht um
den Sinn von ‚Realität‘: Rumsfeld meint, die USA
betrieben Realpolitik; die Problematischen in Europa
denken eher, dass in Washington der Realinfantilismus an
der Macht ist.
Auf diese Weise denken schon einmal
zwei realpolitisch ziemlich problematische,
nationalmoralisch dafür umso perfektere Exemplare
europäischen Denkens vor sich hin, bleiben dabei aber
natürlich nicht allein.
Was ‚Realitätsverluste‘ angeht, ist auch P.
Schneider Fachmann: Natürlich darf und soll
man sich gegen die Anwürfe aus dem Weißen Haus wehren.
Wenn den Deutschen und Franzosen jetzt gesagt wird, sie
hätten den Realitätssinn verloren, muss man die
amerikanische Regierung darauf aufmerksam machen, dass
niemand den Realitätssinn gepachtet hat.
Für seinen
höchstpersönlichen Fall folgt daraus, dass er so ziemlich
der einzige ist, der für die Realität den rechten Sinn
entwickelt und sich damit das Recht gepachtet hat, alle
anderen auf ihre diesbezüglichen Defekte hinzuweisen: Den
Minister Rumsfeld, weil der sich einfach
vergaloppiert
, wenn er von den Deutschen
Gefolgschaft im Krieg gegen Saddam verlangt; und den
Kanzler Schröder, dessen Nachholbedarf in Sachen
Realitätssinn
sich aus der Entdeckung des Dichters
und Denkers ergibt, dass einer, der einen Staat von
Inspektoren entwaffnet haben, aber in keinerlei
Interventionen
einwilligen will, irgendwie nicht
ganz von dieser Welt
ist. Wer A wie Aufsicht sagt,
muss auch B wie Bomben nachlegen: Soviel zumindest von
den Realitäten der politischen Welt hat er als Mann von
feiner europäischer Kultur aus Übersee gelernt, und
überhaupt ist es so, dass die europäischen Kulturnationen
als Hort aller weltpolitischen Sittlichkeit sich
keineswegs nur gegen eine amerikanische ‚Provokation‘ zu
verwahren haben. Zum Aufstellen gegen die
Macht der Barbarei
, die ein anderer origineller
Dichter in Amerika regieren sieht, weiß man sich dank des
eigenen Kultur-Adels mindestens genau so berechtigt, und
da sind dem Mr. Rumsfeld einige richtig dankbar dafür,
dass sie vom Verdrucksen ihres Antiamerikanismus endlich
zu seiner wahrhaft vaterländischen Sublimierung schreiten
können: Ich betrachte die Schelte des listigen
Verteidigungsministers als eine Ehre
, lässt ein
deutscher Poet mit Namen Grünbein
wissen, und wo bei einem wie ihm die Ehre sitzt, gibt er
gleich darauf bekannt – ungefähr dort, wo sie auch bei
dem letzten großen Deutschen saß, der sich mit ziemlich
heroischem Politik- und Kulturstil, letztlich aber doch
wenig erfolgreich in die imperialistische Konkurrenz
eingemischt hatte: Was sich da anbahnt, ist der
Übergang in ein neues Zeitalter der Weltpolitik. Europa
formiert sich als dritte Kraft im Spiel der Supermächte.
Und wir können sagen, wir sind dabeigewesen.
Ja, was
für ein Glück für Europa und Segen für den Rest der
Menschheit, wenn auch wir bei den Kriegen der neuen
Weltordnung als ‚dritte Kraft‘ mit dabei sind. Und noch
ein schönes Dankeschön an den greisen Ami, der mit seiner
losen Bemerkung die Gründung der Weltmacht Europa endlich
unabweisbar gemacht hat. Von einem Professor für deutsche
Geschichte diesmal, der aus dem Wort ‚alt‘ problemlos die
Notwendigkeit eines weltpolitischen Befreiungsschlages
durch Europa abzuleiten vermag – gut möglich, dass uns
diesen Rumsfeld wieder die Vorsehung geschickt hat:
Aus der Äußerung des amerikanischen
Verteidigungsministers ergibt sich die Notwendigkeit,
dass sich Europa (…) als Weltmacht konstituiert und von
der Dominanz der Vereinigten Staaten frei macht.
In
der linksrheinischen Kulturnation plant man sie schon,
die garantiert guten, weil von der ewigjungen Weltmacht
Europa aus geführten Militäreinsätze. Ein M.
Tournier: Ich bin glücklich, dass Frankreich
und Deutschland zusammenfinden, um gegen einen
amerikanischen Einmarsch im Irak zu protestieren. Man
kann diesen Krieg mit keinem Argument rechtfertigen
,
weswegen er einen Krieg einfach nur bedingungslos
rechtfertigen muss, bei dem zuerst Europa im Irak
einmarschiert: Die beiden Länder müssten jetzt eine
Armeeeinheit in den Irak schicken, um das Volk zu
schützen und gegen die amerikanische Aggression zu
verteidigen.
Kollege A. Glucksmann
fragt sich ohnehin schon seit geraumer Zeit, wo die
Panzer und Raketen der gesamteuropäischen
Volksbefreiungsbewegung eigentlich bleiben. Im Irak
werden sie schmerzlich vermisst – das Land wird von
einem Tyrannen beherrscht. Das Volk hat ein Recht darauf,
von ihm befreit zu werden
–, aber auch in Russland –
was mich erstaunt, ist (…) dass niemand gegen den
tatsächlichen Krieg protestiert, wie ihn die Russen in
Tschetschenien führen
–, in Libyen, und – wie man
dann eine Woche später vom Leitartikler des
Konkurrenzblattes aus München hört – im ganzen Rest der
Welt. Der macht sich darum verdient, alle diese
kultur-imperialistischen Projektionen einer europäischen
Weltmacht, die sich dank der Sprachwahl des
amerikanischen Kriegsministers endlich frei Bahn
verschaffen dürfen, eigens noch mal in ein höchst reales
politisches Muss zu übersetzen. Das wurde den Völkern
diesmal vom Weltgeist aus Königsberg in den Schoß gelegt:
„215 Jahre nach Immanuel Kant braucht Europa eine neue Aufklärung. Nicht mehr der Mensch muss sich aus selbstverschuldeter Unmündigkeit befreien. Das Individuum hat sich der obrigkeitlichen Bevormundung schon entledigt – nicht aber die Staatenwelt Europas. 215 Jahre nach Kant lebt sie in selbstverschuldeter Unmündigkeit: Die europäische Politik ist nicht in der Lage, sich ihres Verstandes ohne die Leitung durch die USA zu bedienen. Diese Unmündigkeit ist selbstverschuldet, weil ihre Ursache nicht im Mangel des Verstandes, sondern der gemeinsamen Entschließung und des Mutes liegt. „Sapere aude!“, hat Kant gefordert (…). Das ist der richtige Kommentar zu dem devoten Brief von acht europäischen Staaten an die Adresse von George W. Bush (…).In der Weltgeschichte war der Krieg stets das mächtigste Movens zur Identitätsentwicklung von Staaten. Man hatte hoffen können, dass nun die EU ein neues Exempel setzt: Identitätsentwicklung durch Ablehnung von Krieg (…). De Gaulle wollte Europa als ‚dritte Kraft‘ neben und nicht hinter den USA und der Sowjetunion etablieren; heute geht es darum, Europa als selbständige Kraft neben und nicht hinter der Weltmacht USA zu positionieren (…). Europa muss sich emanzipieren, muss zu einem europäischen Europa werden – nicht aus Großmannssucht, sondern um als Zivilmacht den Kampf der Kulturen als neue weltpolitische Konfliktformation zu verhindern.“ (SZ, 31.1.)
Allmählich kann man nachvollziehen, warum man in der Neuen Welt diese Europäer mit ihrer großen Kultur nicht leiden kann: Ein gelernter Jurist, der von einer komplett gelungenen Emanzipation der Menschheit von obrigkeitlicher Bevormundung zu berichten weiß; der die Ausübung politischer Herrschaftsgewalt für eine Sorte von Verstandesgebrauch hält; der die Reichweite der weltpolitischen Ambitionen seines gesamteuropäischen Vaterlandes durch geistige Gängelung von höherer Seite beschnitten sieht; der dann aber überhaupt nichts durchs ‚sapere‘, dafür aber alles vom ‚aude!‘ in Ordnung gebracht haben will; der es daher nicht aushält, wenn Europa nicht endlich mutig in die Konkurrenz um die Weltmacht einsteigt – der dann aber noch immer meint dazusagen zu müssen, dass dies weiß Gott kein Wille zur Großmacht, sondern wirklich nur ein ziviler Dienst am Weltkulturerbe ist: Das hält ein geistig wenig Zivilisierter so leicht nicht im Kopf aus!
Bleiben noch die Wortmeldungen zweier Denker, die im
Feuilleton der FAZ nicht mehr wohlgelitten sind und
dementsprechend bei der großen intellektuellen Enquete
nicht zu Wort kamen. An sich schade, denn G.
Grass ist als Nobelpreisträger für Literatur
selbstverständlich auch in Kriegsdingen deutscher
Experte. God’s Own Country soll das sein, das da zum
Feldzug rüstet? – das glaubt er nicht, das weiß er
besser. Von einem Dichter nämlich, der die wahren
Befehlsstrukturen der göttlichen Beschlussfassung schon
im 18. Jahrhundert erkannt hat: s’ist Krieg! S’ist
Krieg! O Gottes Engel wehre,/ Und rede Du darein!/ s’ist
leider Krieg – und ich begehre –/ Nicht schuld daran zu
sein!
Ein kleiner Reim nur, sicher, jedoch: Viele
Ausrufezeichen stützen die erste Strophe dieses
Gedichtes, dem die Vergeblichkeit seiner Warnung Dauer
garantiert hat. Deshalb, weil es so viele Schlachten
überdauert hat, setze ich es an den Anfang meiner Warnung
– ‚Und rede Du darein!‘ –, die als Dreinrede, wie ich
befürchte überhört werden wird.
Solcherart gestützt
auf die Wucht von Ausrufungszeichen, mit denen das
poetische Vaterunser sein Flehen um den Beistand höherer
Mächte im Allgemeinen und um private Lossprechung von dem
Übel im Besonderen vorbringt, macht der Interpret sich
dann auf seine Weise an seine moderne ‚Dreinrede‘. Von
der ist er selbstverständlich sicher, dass sie vielleicht
von der FAZ, sonst aber überhaupt nicht überhört werden
wird. Denn bei den bekannten Fragen, die er aufwirft –
Wieder einmal droht Krieg. Oder wird nur mit Krieg
gedroht, damit es nicht zum Krieg kommt?
Gegen wen
wird dieser Krieg, der so tut, als drohe er nur,
geführt?
–, will er natürlich nicht mit allzu
befremdlichen Antworten anecken. Die sollen ja nur auf
die eine Antwort hinaus, die so oder anders schon alle
wissen: Ich weiß, diese Fragen sind müßig; die
Arroganz der Weltmacht gibt Antwort auf jede
, und von
dieser Antwort geht der Übergang weiter und zielstrebig
hin zur einzig noch verbleibenden Frage, die den Dichter
umtreibt: Ich weiß nicht, ob die Vereinten Nationen
standhaft genug sind, dem geballten Machtwillen der
Vereinigten Staaten zu widerstehen.
Ja, wer weiß das
schon. Hauptsache ist, dass ein deutscher Intellektueller
von den Herren, die ihn und seine Landsleute regieren,
genau das wissen will: Springen sie
endlich für den Engel ein, nach dem Matthias Claudius
schon vor 200 Jahren geseufzt hat?! Zur diesbezüglichen
Hoffnung
sieht der moderne Dichter sich jedenfalls
berechtigt, haben doch wir Deutschen aus
selbstverschuldeten Kriegen gelernt
, sind also als
die geläuterten Bösen der Weltgeschichte grundsätzlich
nur noch zum Guten berufen und müssen deswegen
einer arroganten Weltmacht und ihrem Krieg ein Nein!
entgegenstellen. Und weil in diesem Fall das Nein! der
patriotischen Moral an einen anderen Staat
adressiert ist, sich nicht als wertvoller Beitrag zur
Orientierung des Geistes im Innenleben der Nation,
sondern als Vehikel zu deren Formierung nach
außen versteht, gilt auch bei den Dichtern und
Denkern das ungeschriebene Gesetz der Außenpolitik,
wonach man gegenüber Dritten zusammenzuhalten hat. Für
die ‚Moralkeule‘, die der Nobelpreisträger einfach nicht
mehr aus der Hand gibt, hat deswegen auch ein M.
Walser Verwendung, der sie neulich erst
überhaupt nicht mehr hat ertragen können. Wenn er sie
endlich bei einer anderen als der eigenen Nation anmahnen
kann, und wenn diese noch dazu die Weltmacht ist, von der
Deutschland gerade drangsaliert wird: Dann kann auch er
nicht genug von „Vergangenheitsbewältigung“ haben. Dann
schwingt er sich zum Richter über Amerika auf und gibt
sich höchst erstaunt darüber, dass man dort dem deutschen
Vorbild noch immer hinterherhinkt – das Erstaunliche
ist ja, dass Amerika durch den Vietnamkrieg nichts
dazugelernt hat
(Rheinischer
Merkur, 23.1.). Damit hat er alles moralische
Recht auf seiner Seite, den Irakkrieg im Namen
Deutschlands und Europas als weltgeschichtliche
Provokation
zu brandmarken, nur um dann zu verstehen
zu geben, dass ihn die letztlich doch nur zuversichtlich
stimmt: Wenn er Europa zur Geburt verhilft, dann
hat ‚der Vater aller Dinge‘ eben auch sein Gutes –
dieser Kriegsführungswille Amerikas ist historisch
verhängnisvoll. Was Amerika jetzt bietet, wird Europa
einigen. In der Antwort auf diese Provokation wird Europa
zum ersten Mal politisch handeln.
[1] Nachzulesen ist das
in den Anmerkungen zur nationalen Debatte über den
Nutzen eines gerechten Krieges
in GegenStandpunkt 2-99, S.121.