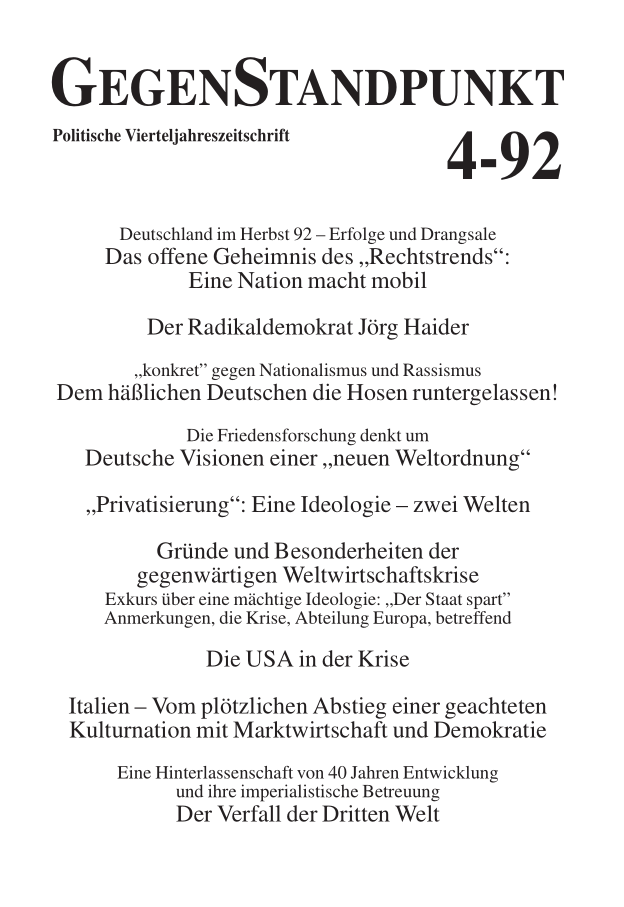Exkurs über eine mächtige Ideologie:
„Der Staat spart“
Eine Ideologie, die in der Krise aufkommt, in der die Geldqualität auch relativ starker Währungen fraglich geworden ist. Wie der Staat das Geld in Kraft setzt, von ihm lebt und es sich als „Steuer- und Schuldenstaat“ beschafft. Die Konkurrenz der Währungen als Vergleich der internationalen Tauglichkeit der Staatsschulden mit der entsprechenden Sortierung der Staaten sowie dem Rückbezug auf Löhne und Sozialausgaben als „staatliche Kosten“, an denen für die Konkurrenzfähigkeit der Nation gespart werden muss.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Exkurs über eine mächtige Ideologie:
„Der Staat spart“
Ein gewöhnlicher Haushalt, dessen Haushaltsvorstände sich mit Arbeit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, spart, weil seine Einnahmen nicht ausreichen, um die lebensnotwendigen Aufgaben bestreiten zu können. Er legt Geld auf die hohe Kante, um später größere Anschaffungen bestreiten zu können oder um für schlechte Zeiten ein wenig gerüstet zu sein: für Zeiten, da man seinen Arbeitsplatz verliert oder eine Krankheit dazwischenkommt; für die Zeit, da mit dem (vorzeitigen oder regelrechten) Übergang ins Rentenalter die Einkünfte rapide sinken.
Ein gewöhnlicher Haushalt macht Schulden, weil der Verdienst aus der Arbeit nicht reicht, um sich die Lebensmittel zu beschaffen, die man notwendig braucht oder die man sich leisten will. Zinszahlungen und Schuldentilgung sind die Last, die die Verschuldung mit sich bringt.
Ein gewöhnlicher Haushalt muß an dem, was er sich leistet und für seinen Lebensunterhalt ausgibt, sparen. Er muß sich sein Geld einteilen, und das gleich aus drei Gründen: weil Lohn und Gehalt sowieso knapp bemessen sind; weil für die Zukunft Geld zurückgelegt werden muß und weil Schulden zu bedienen sind.
Gegenwärtig wird in Deutschland – und anderswo in Europa auch – allenthalben verkündet, der Staat laboriere an demselben Problem wie der gewöhnliche Haushalt – und zwar in noch viel größeren Dimensionen.
Eine Anstalt, die mit Hoheitsbefugnissen ausgestattet ist, die sich auch auf die Beschaffung ihrer Einnahmen und die Gestaltung ihrer Ausgaben erstrecken, definiert ihre „finanzielle Lage“. Die sei prekär, problematisch und brisant. Eine Anstalt, die beide Seiten ihres Haushalts per Gesetzgebung regelt, behauptet öffentlich, sie sei in Verlegenheit: Der Staat verkündet aus berufenem Munde seiner Regierenden, er müsse sparen – habe also dieselben Probleme, sich einzuteilen wie jene Haushalte, in denen sich Geld lediglich in der Funktion des Zirkulationsmittels einfindet und in der Bezahlung des Konsums verschwindet.
Eine Anstalt, die ihre Schulden in Milliarden und Billionen berechnet, die andererseits den Rückhalt ihrer Einkünfte im Zugriff auf ein halbes Prozent des Einkommens von Müllmännern gewährleistet sehen will – der Staat präsentiert sich als Inhaber eines Geldbeutels, in dem zu wenig ist.
Eine Anstalt, die ihre ausgabeträchtigen Projekte auf Jahre hinaus plant, benützt ihren legitimen Zugriff auf die Revenue von Millionen, um sich die Vermehrung ihrer Schulden leisten zu können: Der Staat zwingt massenhaft Leute zum Sparen, verordnet ihnen Verzicht – und erklärt ihnen das aus seiner Not, die ihm das Haushalten gebietet.
Wenn diese kleine Verwechslung anschlägt, löst der Staat eine Diskussion aus, in der sich Regierung, Opposition und Gewerkschaften, das Parlament und die Stammtische einig sind, daß es ums Sparen geht. Vorwitzige Diskutanten finden sich genug – solche, die bezweifeln, ob der Staat auch wirklich, genug und an der richtigen Stelle spart. Und weit und breit kommt keine Sau auf die Idee, daß ein Staatshaushalt mit Sparen nichts zu tun hat.
Das eigentümliche Verhältnis des Staats zum Geld schließt nämlich ökonomische Praktiken ein, die – verglichen mit dem Umgang, den die diversen Sorten Bürger mit dem Geld pflegen – alle etwas Außerordentliches an sich haben. In ihnen kommt Sparen überhaupt nicht vor, weil der Staat nicht mit der Einteilung einer begrenzten Masse von Zirkulationsmitteln befaßt ist. Er beschafft sich die Zahlungsmittel, die er zum Kauf von Waren und Diensten braucht, einerseits durch die Konfiszierung von privatem Reichtum. Und seinen weitergehenden Geldbedarf deckt er durch einen eigenartigen Handel mit seinen Schulden.
I.
Der bürgerliche Staat, der über eine Gesellschaft gebietet, in der Geld Mittel und Zweck der Reichtumsvermehrung ist, setzt das (nationale) Geld in Kraft und garantiert dessen Funktionen: Am Geld werden die Werte aller Waren und überhaupt alles bewegliche und unbewegliche Eigentum gemessen – Geld ist in dieser Funktion Maß der Werte und Maßstab der Preise. In seiner zweiten Funktion vermittelt Geld den Händewechsel der Waren und überhaupt jeden Eigentumswechsel – Geld als Zirkulationsmittel. Mit diesen beiden Funktionen des Geldes haben die Millionen Lohnarbeiter in der Marktwirtschaft zu tun, die für Geld arbeiten gehen, damit es dann für den Kauf von Lebensmitteln, die ihren in Geld gemessenen Preis haben, den Kapitalisten festlegen, wieder verschwindet.
In seiner dritten Funktion wird Geld nicht mehr nur ideell (Maß der Werte) oder bloß in einer Mittlerfunktion (Zirkulationsmittel) genutzt, sondern als Verkörperung abstrakten Reichtums schlechthin und um seiner selbst willen. Wenn der Käufer eine Ware erwirbt, bevor er sie bezahlt, muß er – um zum Fälligkeitstermin seine Schuld begleichen zu können – selbst Ware veräußern zu dem alleinigen Zweck, an Geld zu kommen. Die Verwandlung von Ware in Geld ist dabei Selbstzweck. Im Gläubiger-Schuldner-Verhältnis, das hier vorliegt, fungiert Geld als Zahlungsmittel. Der Zweck, Geld zu beschaffen, wird dem Inbegriff des Geldes, Verkörperung des abstrakten Reichtums zu sein, gerecht, wenn es Kapital wird; wenn es vorgeschossen wird zu dem Zweck, vermehrt zurückzufließen. Mit Geld als Zahlungsmittel und Geld als Kapital haben diejenigen Bürger zu tun, die in der staatlich gesicherten Eigentumsordnung über Privateigentum verfügen, das sie zur Geldvermehrung nutzen können, wofür Schulden keine Last, sondern ein Mittel sind.
II.
Die politische Herrschaft, die ihren Bürgern die „Marktwirtschaft“ verordnet, hält sich nicht an das Gerücht, daß „der Markt“ mit seinen ehernen Gesetzen von Angebot und Nachfrage ein gedeihliches Wirtschaftswachstum verbürgt, so daß sich der Staat „heraushalten“ kann.
Erstens sind Recht und Ordnung dauerhaft zu gewährleisten, wo freie Bürger mit ihrem Eigentum um Eigentum konkurrieren, also das Geldverdienen auf Kosten anderer das gesamte „gesellschaftliche Leben“ bestimmt.
Zweitens beruht das Prinzip privater Bereicherung darauf, daß nicht alle gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. In der Abteilung Sozialstaat bekennt sich die politische Gewalt dazu, daß sich das Wachstum von Kapital – der ökonomische Inhalt der Staatsraison – nicht verträgt mit der Notwendigkeit der Mehrheit ihrer Bürger, von Lohnarbeit leben zu müssen. Der Staat organisiert das Überleben in der Armut, welche sich mit den „Sachzwängen“ des Geschäfts einstellt.
Drittens nimmt sich die öffentliche Gewalt ständig auch der anderen Klasse an, deren Fortkommen schließlich „die Wirtschaft“ ausmacht. Für das Gelingen des Geschäfts stiftet der Staat manche wichtige Voraussetzung, nennt diesen Zweig der Marktwirtschaft „Infrastruktur“ und nimmt den Straßenbau, die Energieversorgung, das Informationswesen etc. unter seine Regie.
Viertens ist er die Bedingung schlechthin für das Zusammenwirken von Eigentum und Arbeit, indem er das Funktionieren und die Früchte seiner Marktwirtschaft vor fremdem Zugriff schützt. Sein Gewaltmonopol über den nationalen Laden schließt die militärische Gewalt gegen andere Nationen ein. Solange der Soldatenstand gegen konkurrierende Souveräne den Frieden sichert, hat der Staat die Aufgabe, per Außenpolitik der einheimischen Geschäftswelt den Zugang zu den Reichtümern zu verschaffen, die sich unter fremder Herrschaft befinden. Eine Aufgabe, die ihn als Garanten seines nationalen Geldes fordert, das er als Treuhänder des internationalen Handels braucht. Für die Bilanzen, die die eigenen Geschäftsleute gegenüber dem Ausland erwirtschaften, steht er mit einem Schatz gerade, der sich in Qualität und Menge als internationales Zahlungsmittel bewähren muß.
Fünftens schließlich steht und fällt also jede Staatsfunktion mit der ökonomischen Macht, die der politische Souverän in seine Verfügung bringt. Was er für die Blüte der von ihm regierten Marktwirtschaft tun kann, hängt davon ab, wie reich die Nation ist. Im selben Maß, wie sich die öffentliche Gewalt als öffentlicher Dienst an den gültigen Interessen in der marktwirtschaftlichen Ordnung betätigt, beansprucht sie umgekehrt ihren Unterhalt und ihre Stärke, auf Kosten des privaten Reichtums, den ihre Vertreter gerne zum (obersten) „Wert“ erklären. Freilich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungen, auf die es in der Marktwirtschaft ankommt.
III.
Für die Sicherung der „allgemeinen Produktionsbedingungen“ der kapitalistischen Gesellschaft, in der alles seinen Preis hat – von Justiz und Polizei bis zu den diversen Abteilungen der Politik; von der Unterhaltung eines Ausbildungswesens bis zu den Autobahnen; vom Kindergeld bis zu den Subventionen an die Wirtschaft; von den schönen Künsten bis zur Wehrmacht usw. –, braucht der Staat Geld. Er verschafft es sich, indem er von allen seinen Bürgern Steuern und andere Zwangsabgaben erhebt.
Bei dieser hoheitlichen Geldbeschaffung ordnet er sich selbst der privaten Geldvermehrung, die die Quelle des Reichtums der Nation ist, unter. Der Staat erweist dem Maß des gesellschaftlichen Reichtums, das er in Kraft gesetzt hat, dem Geld, Respekt. Sein Gewaltmonopol „mißbraucht“ er nicht, um die Güter und Dienste, die er für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt, einfach zu nehmen. Er eröffnet einen Haushalt und macht ihn zum Bestandteil des „Wirtschaftskreislaufs“, in dem er eine ebenso notwendige wie berechenbare Größe darstellt. Soweit er beliefert wird und „Dienste“ sicherstellt, bezahlt er dafür – läßt also alle von seinen Bedürfnissen Abhängigen in der Form von Lohnempfängern und Geschäftsleuten am „Markt“ teilnehmen.
Und umgekehrt sind seine Steuern vom Wachstum der Wirtschaft abhängig: Wenn die Gewinne allgemein steigen, wenn die Masse der Lohnarbeiter, die in Beschäftigung sind, zunimmt, dann registriert der Fiskus höhere Steuereinnahmen. Auch kennt der Staat bei aller Freiheit, die er hat, alle möglichen Steuern einzutreiben und per Gesetzesbeschluß die Abgabenlast für seine Bürger zu erhöhen, eine Grenze, die zwar nicht absolut ist, aber im Prinzip staatlicherseits anerkannt wird. Diese Grenze ist schwer zu entdecken, wenn der Staat bei den unselbständigen Lohnarbeitern absahnt und – wie das gegenwärtig wieder zu beobachten ist – ziemlich willkürlich bestimmt, was dem Leben des kleinen Mannes so an Steuern zuzumuten ist. Aber selbst Politiker haben ein Bewußtsein davon, daß eine über die Steuer bewirkte Verunmöglichung der Reproduktion der Mitglieder der Arbeiterklasse deren Funktion, der Wirtschaft das Wachstum zu erarbeiten, negativ beeinträchtigen könnte. Klarer wird die Sache mit dem prinzipiellen Vorbehalt des Staates gegenüber einem bedingungslosen Schröpfen seiner Bürger, wenn es sich um seine Lieblingsbürger handelt, die selbständigen Geschäftsleute der Nation. Gegenüber diesen betuchten Bürgern, die Eigentum haben und es vermehren wollen und sollen, nimmt der Staat Rücksicht auf den Umstand, daß der steuerliche Abzug von ihrer Revenue zwar sein muß, aber ihnen nicht die Mittel entziehen darf, die sie zur Geldvermehrung benötigen. In der Steuer- und Haushaltspolitik wird ausdrücklich in Rechnung gestellt, daß Steuern faux frais sind, falsche Kosten, weil sie der Staat verpulvert und sie damit nicht nur dem Wachstum der Wirtschaft nicht dienen, sondern die Grundlage und das Mittel des privaten Wachstums, den Geldreichtum, beschränken. – Den aktuellen Beweis für diese staatliche Sichtweise kann gegenwärtig jeder zur Kenntnis nehmen: Im Zuge der allgemeinen Steuererhöhungen hält die Bonner Regierung an ihrem Beschluß fest, die Unternehmensteuern zu senken.
IV.
Dem Widerspruch, daß die staatlichen Funktionen für die Aufrechterhaltung der Klassengesellschaft und die Sicherung und Förderung des ökonomischen Zwecks der kapitalistischen Gesellschaft unverzichtbar sind, andererseits die Kosten dieses Gebrauchs der Macht für die Bürger einen erheblichen Abzug von ihren Lebens- und Geschäftsmitteln darstellen, begegnet der Staat damit, daß er sich von seinen Beschränkungen als Steuerstaat emanzipiert. Die Steuerschraube unbedingt und nach seinem Bedarf andrehen will er nicht, weil das die Quellen des Reichtums der Nation – das Funktionieren des Kapitals, an dem ihm gelegen ist – zum Versiegen bringen würde. Deswegen macht er sich in seiner Machtausübung von den Konjunkturen der Wirtschaft und dem daraus erwachsenden Steueraufkommen auch unabhängig. So weit geht seine Unterwerfung wiederum nicht, daß er die notwendigen Dienste der Politik für das Funktionieren der Klassengesellschaft, für den inneren und internationalen Erfolg seiner Wirtschaft einschränken oder nur so schlecht verrichten würde, wie die Steueraufkommen, die gerade einlaufen, es erlauben. Das würde – nicht einmal nur zum Beispiel – bedeuten, daß das entscheidende Machtmittel der Außenpolitik, die Wehrmacht, nur so gut schießen und abschrecken könnte, wie die Steuereinnahmen es zulassen. Ein unhaltbarer Zustand für jeden Staat, der in seinem Programm nichts geringeres festgeschrieben hat als die Erschließung sämtlicher innerer und äußerer Reichtumsquellen für die Vermehrung von Kapital! Der also weder Bescheidenheit noch Erhaltung irgendeines „status quo“ zu seinen Tugenden zählt!
Von den im Steuerstaat gegebenen Einschränkungen der Souveränität und ihrer Machtmittel nach innen und außen macht sich die Staatsgewalt frei, indem sie sich Kredit nimmt. Diese Staatsverschuldung hat mit dem Schuldenmachen der kleinen Leute nichts zu tun; sie ist auch nicht zu verwechseln mit den Schulden von Kapitalisten, die für und wegen ihres Geschäfts Kredite aufnehmen. Der Staat macht keine Schulden, sondern er macht = produziert sie. Dieser Weg steht ihm offen, weil er der Garant des in seiner Gesellschaft umlaufenden Geldes, also ohnehin mit seiner Gewalt befugt ist, Wertzeichen und Kreditzetteln die Funktionen des Geldes zu sichern. Höchstförmlich verkauft er Schuldscheine (Bundesschatzbriefe, Finanzierungsschätze, Schuldscheindarlehen, Bundesobligationen…), festverzinslich, an Banken und Versicherungen, an private Geldbesitzer – und organisiert den Abzug von Reichtum aus dem privateigentümlichen Zirkus als Versorgung des Marktes mit Zahlungsfähigkeit. Er mischt kräftig mit in der Vermehrung von Eigentumstiteln, deren Gültigkeit er mit seiner hoheitlichen Gewalt allein garantiert. Während seine Schulden die Angebotsseite des Geld- und Kapitalmarkts vergrößern und eine solide Basis für die Erweiterung des Kredits abgeben, gibt er das an Land gezogene Geld aus und sorgt für „Liquidität“ bei allen, wo er Kunde ist. Die Rückzahlung seiner Schulden und die Zinszahlungen vollzieht er durch erneute Manöver derselben Art; er verkauft Schuldscheine…
Die Eigentümlichkeit des Staatskredits besteht darin, daß der Staat dem Maßstab der Kreditwürdigkeit wie sonst im Geschäftsleben nicht unterworfen ist. Und anders als beim privaten Kredit, der mit der Erwartung und im Vorgriff auf künftige erfolgreiche Geschäfte genommen wird, bei deren Gelingen die Schulden bedient und getilgt werden, mit deren Mißlingen aber auch mancher Kredit platzt, werden die Kosten der Staatsschuld mit neuer Staatsschuld bewältigt. Von einer Schuldenrückzahlung im eigentlichen Sinne kann also nicht die Rede sein und von einer Deckung der Staatsschuld durch die Steuer auch nicht. Deshalb können Wirtschaftsfachleute errechnen, daß 1992 in Deutschland jede siebte Steuermark bereits für die Zahlung von Zinsen für Staatsschulden gebunden ist, und besorgt feststellen, daß Ende 1992 die deutsche Staatsschuld auf 1273 Milliarden Mark angewachsen sein wird und dann über 40% des Bruttosozialprodukts beträgt. – Staatskredite sind Kredite der Extraklasse, die bei ihrem Schöpfer keine ökonomische Deckung haben, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, hinter denen nur die Garantie der Staatsmacht steht, die sie aus dem Nichts schafft.
V.
Gleichwohl erhebt der bürgerliche Staat bei seiner Verschuldung einen ökonomischen Anspruch. Die Wertpapiere, die er emittiert, sollen so gut wie Geld sein, als Mittel der Geldvermehrung dienen, also Kapital sein und von der Wirtschaft so benutzt werden. Der Staat besteht darauf, daß das fiktive Kapital (und das sind Staatsschulden) wirkliches Kapital wird, also eine tatsächliche Vermehrung des abstrakten Reichtums darstellt, daß seine Schulden damit als Quelle und Instrument der staatlichen Macht taugen, also keine mehr sind.
Dieser ökonomische Anspruch der Staatsgewalt kommt schon zum Tragen in der Form, in der der Staat Kredit nimmt. Mit dem Kauf der staatlicherseits angebotenen Wertpapiere wird das Anrecht auf einen Zins erworben, den der Staat zu zahlen hat. Für den Gläubiger des Staats wirkt also seine Geldanlage wie Kapital: Er verleiht Geld, das sich und damit es sich vermehrt.
Damit die Staatsschuldscheine Käufer finden, legt der Emittent einen Zins fest, der mit den aktuellen Zinsen auf dem Geld- und Kreditmarkt konkurrieren kann. Aber der Absatz der Staatspapiere ist auch abhängig vom Vorhandensein von Überschüssen, die diese Papiere erwerben. Diese Überschüsse repräsentieren „vergangenes Kapital“ (Marx); sie sind Produkt erfolgreicher Geldvermehrung oder einfach Erspartes, das das Grundrecht der Marktwirtschaft, nach dem Geld rechtmäßig Geld heckt, in Anspruch nimmt.
Schließlich antizipiert der Staatskredit „zukünftige“ Kapitalvermehrung, indem er den Kredit vermehrt, der der Wirtschaft für ihre Geschäfte zur Verfügung steht. Der Besitz von Staatsschulden eignet sich nämlich hervorragend – die Bonität dieser Papiere ist unschlagbar – für den Bedarf an Kredit, den die Privateigentümer je nach Lauf der Geschäftskonjunkturen benötigen. Und die Geschäftswelt weiß das zu schätzen; sie beleiht die Staatsschuldentitel, die sie in der Hand hat, bei den Banken. Letztere hinterlegen diese Papiere und eigene, die sie beim Bund gekauft haben, bei der Bundesbank, wenn sie Kreditmittel oder Liquidität brauchen. So geschieht eine wunderbare Verdopplung und Verdreifachung von Kredit: Mit seiner Zahlungsfähigkeit bedient und erweitert der Staat auch die Zahlungsfähigkeit seiner Wirtschaft.
Daß aber die politisch erzeugte Kreditvermehrung dazu führt, daß ein Mehr an Geldreichtum daraus wird, ist mit der Art und Weise staatlicher Kreditschöpfung nicht garantiert. Dieses ideale Ergebnis vermag die Staatsgewalt nicht sicherzustellen. Ob und wieweit aus den Staatsschulden echtes Geld wird, hängt davon ab, was die Leute, die die Wirtschaft sind, aus und mit dem staatlich geschaffenen Kredit machen und welche ökonomischen Erfolge sie dabei erzielen.
Die erste und notwendige Wirkung des politischen Finanzgebarens ist zunächst einmal eine negative: die allseits bekannte Inflation des nationalen Geldes. An der politisch in die Welt gekommenen zusätzlichen Zahlungsfähigkeit bedient sich die Geschäftswelt, indem sie ihr Warenangebot, wie gewohnt, zu den Preisen auf den Markt bringt, die dort zu erzielen sind. Die zusätzlichen Kreditmittel in allen möglichen Händen eröffnen da manche Gelegenheit zu Preiserhöhungen, und zwar, dank der ununterbrochen sprudelnden politischen Quelle dieser Mittel, dauerhaft. Das hat zur Folge, daß allgemein und immerzu die Kaufkraft des Geldes sinkt. Das Zahlungsmittel, welches die Verfügung über gesellschaftlichen Reichtum garantiert, entwertet sich, so daß auf diese Weise die Zahlungsfähigkeit der ganzen Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen wird.
Diese fortschreitende Geldentwertung gehört zur kapitalistischen Normalität. Wirtschaft und Staat rechnen mit ihr. Nicht das Faktum überhaupt, sondern der Grad der Inflation signalisiert Erfolg oder Mißerfolg der nationalen Wirtschaft und zeigt den Zustand des Nationalkredits an. Je höher die Inflationsrate, desto schlagender wird offenbar, daß die von Staats wegen vermehrten Kredite nicht zur Erzeugung und Vermehrung abstrakten Reichtums genutzt werden, sondern fiktiv geblieben sind und die komplizierte Weise des staatlichen Gelddruckens nur wertgeminderte Papierzettel vermehrt hat. Diese Entwertung des Geldes führt immer wieder einmal dazu, daß es im Maße der Entwertung untauglicher wird, in ihm ein Geschäft zu unternehmen, weil der Grad der Inflation die Geldgewinne beschränkt bis verunmöglicht. Aber auf den einfachen Gedanken, daß Inflation nichts weiter als ein Fremdwort für das Maß ist, in dem sich der Staat systematisch an den Erträgen der Marktwirtschaft bedient, kommt niemand. Am allerletzten die wirtschaftspolitischen Fachleute, die zum Sparen raten und wissen, was sie meinen.
Der Anspruch des Staats, den er mit seiner Verschuldung erhebt, daß der von ihm geschaffene Kredit dem Wachstum dient, zu Kapital wird und sich so gutes Geld vermehrt, ist augenfällig und ziemlich endgültig nicht in Erfüllung gegangen in den sogenannten Weichwährungsländern. Dort herrscht eine rasante Geldentwertung, die zur Folge hat, daß das Geld der Nation nur noch als inneres Zirkulationsmittel genutzt wird; zur Bezahlung der Löhne und Gehälter, die deren Empfänger wieder ausgeben für ihren Lebensunterhalt und dabei den enormen Schwund der Kaufkraft des Geldes zu spüren bekommen. Für die Geschäftsleute und den Staat selbst sind die Umlaufsmittel des „weichen“ Nationalkredits ein sehr zweifelhaftes Mittel. Sie sind deshalb darauf aus, an harte Währungen bzw. an Devisen in gutem Geld zu gelangen.
Die sogenannten Hartwährungsländer haben auch ihre Geldentwertung. Daß sie so niedrig ausfällt – gegenwärtig rechnet der Kenner so zwischen 3 bis 12 Prozent, obwohl die Staatsschuld in ganz anderen Größenordnungen aufgestockt wurde –, hat einen einfachen Grund. In diesen Ländern führt die Staatsverschuldung zu einer wirklichen Vermehrung des abstrakten Reichtums, des Geldes, den die private Wirtschaft gewinnt und an dem der Staat seinen Anteil nimmt. In diesen Ländern wirkt der erfolgreiche Gebrauch des staatlich geschaffenen fiktiven Kapitals durch die Wirtschaft der Vermehrung des umlaufenden Kredits entgegen. Welches Wunder dadurch zustandekommt, daß die Geschäftswelt dieser Nationen die Rentabilität ihres Kapitals im Vergleich zum Ausland und auf dessen Kosten steigert. Der Gesichtspunkt des Vergleichs, quasi theoretisch, gehört in den flammenden Aufrufen zur „Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit“ des eigenen „Standorts“ zum guten Ton des wirtschaftspolitischen Sachverstands. Weniger Aufhebens wird von der Konsequenz des praktischen Vergleichs auf dem Weltmarkt gemacht: Daß die Pflege des „Standorts“, die durch vermehrten und produktiveren Einsatz von Kapital erfolgt, eine Strategie darstellt, die ausdrücklich auf die Schädigung anderer Nationen gerichtet ist, will niemand so richtig betonen.
Klar ist dies dennoch und herauskommen tut es auch.
VI.
Auf der Grundlage des Konkurrenzkampfes, den sich die Kapitalisten auf sämtlichen Märkten und um sie liefern, konkurrieren die Nationen um ihre Anteile am Weltmarkt. Während die Unternehmen in aller Herren Länder auf das Wachstum ihres privaten Vermögens achten, sind die Herren dieser Länder mit den Bilanzen ihrer Nation befaßt. Sie registrieren an der Summe der Geschäfte, die unter ihrer Hoheit ablaufen, in welchem Maß ihnen der von allen hochgeschätzte Welthandel den erwünschten Zugriff auf Reichtum gewährt. Dabei spielt einerseits die Besteuerung ihre Rolle, andererseits entscheidet sich an den Bilanzen des auswärtigen Handels, was die Staatsschulden als internationales Zahlungsmittel taugen. Und darauf kommt es an, wenn sich das Geschäft, an dem die Nation partizipiert, um ihm zum Wachstum zu verhelfen, sein Wachstum durch die Benützung auswärtiger Partner verdient.
- Nationen, von deren Territorium aus Überschüsse auf dem Weltmarkt erzielt werden, verbuchen diese nicht nur in ihrer Handelsbilanz; die Nachfrage nach ihrer Währung, die aus der Realisierung dieser Überschüsse entsteht, bewirkt eine Entlastung ihres Kredits insofern, als der für den Außenhandel erforderliche Staatsschatz in Form von Devisenreserven verfügbar ist – Reserven, für die andere Nationen garantieren.
- Nationen, die Defizite verzeichnen, müssen umgekehrt für die Fortführung der Weltmarktsgeschäfte der mit ihrer Währung operierenden Unternehmen den Nationalkredit erweitern; die Schwächung der Kaufkraft ihres Kreditgeldes, die sie damit verursachen und in öffentlichen Meldungen einer Inflationsrate bestätigen, hat ihre Wirkungen auf die Auslandsgeschäfte.
- Dafür, daß die als Umlaufsmittel zirkulierenden Staatsschulden nicht mehr dasselbe wert sind wie zuvor, sorgt der Geldmarkt, wo gemäß Angebot und Nachfrage der Preis der nationalen Währungseinheit relativ zu anderen ermittelt wird. In der Veränderung der Wechselkurse erfahren die Nationen, in welchem Maß ihr einheimisches Kapital (nicht) in der Lage war, die Produktion und weltweite Realisierung von Überschüssen zu bewerkstelligen. An der Praxis der Staatsverschuldung ändert das Ergebnis in beiden Fällen nichts – sie geht schlicht weiter, aus „guten Gründen“.
- In den Nationen mit gefallenem Wechselkurs hält der von Experten gespendete Trost, die Verluste hätten auch einen Vorteil, weil Exporte jetzt für auswärtige Käufer billiger seien, nicht lange vor. Denn der für Besitzer gestärkter Währungen erleichterte Kauf von nationalen Exportartikeln steigert vielleicht deren Kauflust, aber keineswegs die Rentabilität der Exportunternehmen, die sich aus dem Verhältnis von Kostpreis und erlöstem Überschuß ergibt. Deswegen folgt der guten Nachricht von den verbesserten Exportchancen stets die schlechte auf dem Fuß – der Import wird schwieriger, und mancher Importartikel geht sogar in den Kostpreis von Exportunternehmen ein. So sieht sich der Staat genötigt, Schulden mit der Zielsetzung drucken zu lassen, die Konkurrenzfähigkeit der nationalen Wirtschaft herbeizusanieren und zu subventionieren.
- Ein echter Trost hingegen stellt sich bei den erfolgreichen Nationen ein. Die Berechnung derer, die sich auf den Geldmärkten um eine profitable Unterbringung ihrer anlagesuchenden Summen bemühen, beschert ihnen eine zusätzliche Nachfrage nach ihrem Geld. Besagte Anleger entscheiden sich nämlich bei allen Sorten Anlagen, die der Weltmarkt so offeriert, allzugerne für solche in einer Währung, die Sicherheit verspricht. Nationen mit gutem Geld nehmen dieses Interesse dankbar an und zum Anlaß, ihren Kredit zur Betreuung und Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit zu erweitern. Sie können es sich leisten, sämtliche Staatsfunktionen aufwendiger zu versehen.
- Die Gunst, die das internationale Geldkapital den Nationen erweist, deren Geldsorte „attraktiv“ ist, verleitet Haushaltskünstler und Nationalbanker zu kosmetischen Operationen, die den Interessen der profitsuchenden Gläubiger entgegenkommen. Das für diese Nachfrager erhebliche Datum der Verzinsung ihrer Anlage ist von den Verwaltern von nationalen Geldern zum Hebel erklärt worden, dessen Einsatz eine Nachfrage erzeugt, die der Gang der Geschäfte für sich nicht bewirkt. Das Eingehen der „Märkte“ auf solche Angebote führt zur Verschiebung von Geldern in Länder, die sich auf „Hochzinspolitik“ verlegt haben. Oder auch nicht.
Im ersten Fall erweist sich der Zins, der für den Beitrag des weltweiten Geldkapitals zur Stabilisierung des nationalen Kreditwesens entrichtet wird, als sehr untaugliches Instrument. Er verursacht Kosten und die ärgerliche Diagnose, daß ein immer größerer Anteil des Staatshaushalts auf die Bedienung vergangener Schulden entfällt. Diese Erfahrung blieb auch der Ausnahme-Weltmacht USA nicht erspart, die hohe Zinsen und das besondere Vertrauen in Anschlag gebracht hat, das sie als politisch-militärische Aufsichtsinstanz der Weltordnung genießt.
Im zweiten Fall wird der Zins, den eine Nationalbank durch allerlei Manipulationen an seinem „Niveau“ beeinflußt, gar nicht erst als Angebot gewürdigt. Und zwar mit dem Argument, daß ein verläßlicher Gewinn aus der Höhe des Zinses nicht zustandekommt, weil und solange die anderen Garantien fehlen, die einen Nationalkredit zur sicheren Bank machen. Gewöhnlich kann sich dieses Mißtrauen auf die Daten berufen, die eine auf die Attraktion von Geldkapital sinnende Nation selbst über ihre Wirtschaftslage vermeldet. Wenn die sich während ihrer Zinsoffensive laut Sorgen darüber erlaubt, ob das erhöhte Zinsniveau des Landes nicht vielleicht die ohnehin geschwächte Konjunktur „abwürge“, ist schon einiges entschieden. Nicht deswegen, weil die Vorstellung von den niedrigen Zinsen, die den Unternehmen des Landes zur Rentabilität verhelfen und der „Investitionsbereitschaft“ Beine machen, stimmen würde. Vielmehr wegen des Eingeständnisses, daß der nach Instrumenten ihrer Gesundung suchenden Nation das Instrument abgeht, an dem alles hängt.
VII.
Währungs- und Finanzpolitik sind das Instrumentarium des Staates, mit dem er die Schaffung und Erweiterung des nationalen Kredits bewerkstelligt. Daß eine Regierung und ihre Nationalbank mit Hilfe dieser Techniken, durch ihre gekonnte Handhabung auch die Tauglichkeit ihres Kredits als internationales Zahlungsmittel sichern oder gar steigern können, ist zu bezweifeln.
Einmal aufgelegt, ist jede Staatsschuld nämlich der Konkurrenz ausgesetzt, welche das Geschäft auf dem Weltmarkt belebt. Der täglich an den Börsen auf den neusten Stand gebrachte Vergleich zwischen den nationalen Umlaufsmitteln bezeugt nicht nur die Wichtigkeit, die der puren Anerkennung nationaler Münze durch das Ausland zukommt. Diese abstrakte Bestätigung der Verwendbarkeit von Kreditzeichen auch außerhalb der Grenzen der zuständigen Garantiemacht zieht den entscheidenden Test durch „die Märkte“ nach sich. Die befinden darüber, in welchem Maße eine Geldeinheit, deren Anzahl vom sie betreuenden Staat rege vermehrt wird, Weltgeld ist; was sie als Verfügung über jede beliebige Sorte Reichtum auf dem Globus zählt.
Und diesen Test steuern die finanzpolitischen Währungshüter nicht, wenn sie Kurse und Geldströme zu beeinflussen suchen – sie reagieren auf die ständig wechselnden Zwischenergebnisse der Konkurrenz. Wenn sie mit Auf- und Abwertungen, mit Zins„signalen“ und Geldmengenzielen etc. die Brauchbarkeit ihres Geldes „verteidigen“, wenn sie in währungspolitischen Institutionen gemeinsam mit ihren Konkurrenten das Funktionieren des europäischen und Weltwährungs„systems“ betreuen, dann sind sie nicht „Herr der Lage“. Jede ihrer für notwendig befundenen Korrekturen belegt, daß sie sich anpassen – an Resultate der Konkurrenz, die sie zur Anerkennung der veränderten Konkurrenzbedingungen und ihrer vorläufigen Festschreibung zwingen.
In dieser Hinsicht freilich sind währungspolitische Entscheidungen dann keineswegs Zeugnisse der „Ohnmacht“ von Nationen, was die Fähigkeit zur „Konsolidierung“ des über Staatsverschuldung in Umlauf gebrachten Geldes anlangt. Immerhin werden bei der Neufestlegung von Sortenkursen, über die so schön komplizierten und nur Fachleuten verständlichen Techniken des internationalistischen Geld- und Kreditwesens, die in der gelaufenen Konkurrenz ermittelten Unterschiede zwischen den Nationen nicht einfach zu Protokoll gegeben. Der Mißerfolg, den manche Nationen an ihren Bilanzen ablesen, wird – übersetzt in eine aussagekräftige Zahl, die relative Schwäche des nationalen Geldes – ihnen erst von den erfolgreichen Konkurrenten vorgelesen. Und dann zum Diktat von Schranken für die weitere Teilnahme am Welthandel. Umgekehrt teilen sich die erfolgreichen Nationen selbst – ganz ökonomisch sachzwang-gemäß – nützliche Rechte zu für den künftigen Gebrauch des Weltmarkts. Am schönsten nehmen sich solche Aktionen der „Neugestaltung“ oder „Neuordnung“ aus, wenn sie gemeinsam als unausweichliche Konsequenz aus den Daten der Weltwirtschaft abgeleitet und beschlossen werden.
VIII.
Staaten, die sich auf Konferenzen und Gipfeln die gemeinsame Überzeugung abholen, daß ihr Kreditgeld in erheblichem Maße seine internationale Kaufkraft eingebüßt hat – „wie die Märkte gezeigt haben“ –, verlieren nicht nur den Wert, den ihre Zettel nun höchstoffiziell und in Prozenten beziffert nicht mehr haben. Sie sind auch auf der Liste der Verdächtigen, welche „die Märkte“ ständig führen; eine Vermehrung ihrer Zahlungsfähigkeit nach dem alten Brauch, neue Staatsschulden in Geld umzumünzen, würden diese Märkte gnadenlos bestrafen und den Beweis, der galoppierende Inflation heißt, führen. Diese Drohung kann auch gleich von den Währungshütern befreundeter Konkurrenten ausgesprochen werden. Dann ist die Verbilligung jeden Stücks Reichtum aus dem Land mit der teigigen Währung für jeden ausländischen Interessenten ebenso ausgemacht wie die umgekehrte Rechnung. Die „Hausaufgabe“, die den Finanz- und Wirtschaftsministern der plötzlich zu stark verschuldeten Nation mit auf den Heimweg gegeben wird, heißt „Stabilisierung des Haushalts“. Aus der Diagnose, hier habe ein Staat kreditmäßig über die Verhältnisse gelebt, die ihm die Welthandelsleistungen des Kapitals erlauben, das von seinem Boden aus und mit seiner Geldgarantie operiert, folgt: Diese Nation hat keinen Kredit mehr, und wenn sie als Souverän des nationalen Geldes neuen schafft, verliert dieser die Anerkennung als internationales Zahlungsmittel. Sie ist gehalten, ihre Freiheit zur Verschuldung einzuschränken; als Verlierer der letzten Runden in der Weltmarktkonkurrenz steht ihr Haushaltsgebaren unter „internationaler Kontrolle“. Bei Strafe des Ausschlusses aus dem Verein derer mit tauglichem Weltgeld hat sie ihr Geld solide zu machen.
Ganz nebenbei und sehr grundsätzlich unterwirft sich eine Nation, der dieses Mißgeschick widerfährt, einer sehr weitgehenden Entziehungskur. Der Entzug der Lizenz zur Verschuldung gemäß dem Bedarf, den sie hat, verwehrt ihr auch den Einsatz von nationalem Kreditgeld zur Sanierung ihrer „Wirtschaft“, zur Wahrnehmung ihrer Rolle als ideellem Gesamtkapitalisten, der den von seinem Standort aus mit seinem Geld erstinstanzlich tätigen Geschäftsleuten ihre Konkurrenzfähigkeit zurechtregiert.
In Ländern, wo sich die Regierenden darauf verlegen, die Tauglichkeit ihres Kredits als international gediegenes Geld zu retten, wird die Parole „Der Staat spart!“ zum Programm. Wie bei den sogenannten Entwicklungsländern, die gar kein anderes Regierungsprogramm kennen und nie in den Genuß einer anständigen Bilanz mit internationaler Zahlungsfähigkeit gekommen sind, ist die Durchführung dann irgendwie „unsozial“. Und die Schulden steigen weiter, aber nicht, weil die Nation zum Zwecke ihres Vorteils in der Konkurrenz sie macht und anwendet. Sondern weil sie die Lasten der erlittenen Niederlage sachgerecht zu tragen hat.
IX.
Wenn allerdings die Parole „Der Staat spart!“ auch dort auf die Tagesordnung kommt, wo die Regierenden stolz auf ihre starke Währung sind und sich als Standortverwalter der Meisterklasse rühmen; wenn in Nationen, die offensichtlich auf Kosten der anderen ihre Schulden zum unangefochtenen Kaufmittel und Spekulationsobjekt der ganzen Welt hergerichtet haben, plötzlich die Sorge um die Solidität um sich greift; wenn die Kanzler und Minister auch bei den Gewinnern den Erfolg einer erfolgreichen Praxis anzweifeln, so daß die Überlegenheit der nationalen Reichtumsproduktion per Beteiligung am Weltmarkt zwar erreicht ist, aber für unsicher gilt, dann ist Krise. Dann ist zwar der eigene Nationalkredit mehr wert als der anderer Staaten, aber seine Geldqualitäten sind fragwürdig geworden – und werden mit jeder Meldung über Geschäfte, die nicht mehr gehen, erneut zum Argument für ein Haushalten neuen Typs.
X.
Die Art und Weise, wie diese Veranstaltung durchgezogen wird, macht deutlich, daß der Begriff des Sparens in der Welt von Staat, Kapital und Kredit einfach keinen Platz hat. Einerseits läßt ein Staat wie der deutsche, den seine Wirtschaft zum einflußreichen Gläubiger seiner europäischen Nachbarn und Partner, aber auch ferner Kontinente gemacht hat, auf seine Freiheit zur Verschuldung nichts kommen. Er verzinst nicht nur ordnungsgemäß seine „Altlasten“, damit auch niemand an seinem Willen und der Fähigkeit zweifelt, für sein Geld geradezustehen. Er legt auch neue Schulden auf, und zwar ausdrücklich mit dem Ziel, die Qualitäten seines Standorts über die „schweren Zeiten“ hinweg zu erhalten und auszubauen. Genau spiegelbildlich zu den unterlegenen Nationen, denen er vorschreibt, sich mit dem Ergebnis der internationalen Konkurrenz, also mit weniger ökonomischer Macht, definitiv abzufinden, verfährt er mit sich selbst. Die relative Stärke seines Geldes ist der Ausweis seines Rechts, es zur Pflege deutschen Kapitals auszugeben; und dieselbe Pflicht leitet er aus den Schwierigkeiten ab, die der Verwendung seines Kredits als Kapital entstanden sind – nicht zuletzt deswegen, weil er reihum sämtliche Partner in Zahlungsschwierigkeiten gewirtschaftet hat. An den unschlagbaren Geschäftsbedingungen, die deutscher Kredit dem Standort Deutschland finanziert hat, soll nichts vernachlässigt werden, auch wenn gegenwärtig die Konkurrenz um die Verteilung von Verlusten unter den Nationen geführt wird statt um die Anteile am „Wachstum“.
Andererseits ist mit dem „Sparen“ durchaus eine Umstellung größeren Stils angesagt. Das Sparen findet in den Sphären statt, wo es schon immer hingehört – beim Volk, und der Staat erzwingt es, indem er privates Einkommen verstaatlicht.
Berechtigt hierzu weiß die Nation sich allemal. Erstens verfügt sie über die Befugnis, Steuern einzutreiben. Zweitens hat sie in ihrer Abteilung „Sozialstaat“ ansehnliche Teile des nationalen Arbeitslohns von staatlichen Entscheidungen abhängig gemacht. Drittens wissen ihre Führer, daß das deutsche Volk, insbesondere aber sein gewerkschaftlich organisierter Teil, eine unerschütterlich gute Meinung von seiner deutschen Heimat hat. Staat und Kapital gelten ihm als rundum positive Existenzbedingung, weil von ihnen „unsere Arbeitsplätze“ und auch sonst viele Dinge abhängen, die uns von Ausländern so wohltuend unterscheiden. Diese Würdigung nützt der Kreis der politischen Auserwählten, um per „Solidarpakt“ das Einverständnis zu den Opfern zu sichern, die eine Nation in Schwierigkeiten verordnen darf und muß. Daß der Staat sich wieder einmal als sehr negative Lebensbedingung erweist, wenn er die seit Jahren akkumulierte Armut schlagartig steigert, tut nichts zur Sache…
Bleibt noch die Rechnung zu klären, die der Staat mit der Schröpfung des Fußvolks verbindet. Denn so gewaltig die Wirkung von wüsten Steuererhöhungen aller Art, von der Entlastung sozialstaatlicher Kassen und von Lohnsenkungen auf den privaten Haushalt von Millionen ist – zur Begleichung oder Rückzahlung der Staatsschulden reicht sie nicht. Das ist aber auch nicht der Anspruch der Krisenbewältiger. Für sie geht es um den Teil der Staatskasse, mit dem sich der Souverän ohne den Umweg der Verschuldung direkt beim Bürger schadlos hält. Die Steuern sind für die Finanzwarte der Nation das, was sie sich nehmen können – also Index der Finanzierung, welche sich der Staat leisten kann, ohne sich auf Risiken einzulassen, die mit den Techniken des Kredits verbunden sind. Und wenn er den Sozialkram, ohne sich um sein tatsächliches Funktionieren groß zu kümmern, genauso wie die Löhne als staatliche Kost behandelt und sie senkt, dann kommen durchaus stattliche Summen zustande. Summen, die nicht die Staatsschulden begleichen, aber den Haushalt der Nation enorm entlasten. Was ihrer Freiheit zur nötigen Verschuldung zugutekommt.
So ist das Programm „Der Staat spart!“ nicht nur ein origineller Titel für eine Etappe im Konkurrenzkampf zwischen imperialistischen Nationen, die um die in ihrem Nationalkredit zusammengefaßte ökonomische Macht bemüht sind. Es schließt auch einen an Deutlichkeit nicht zu überbietenden Umgang mit der Manövriermasse der kapitalistischen Demokratien ein: „Das Volk ist zu teuer!“ ist durchaus keine verkehrte Lesart der Überschrift für eine Veranstaltung, die ihren tieferen politökonomischen Grund überhaupt nicht verbirgt. Wer in einer „kritischen Lage“, die vor allem die Nation trifft, so rücksichtslos den Grad von Armut und Elend steigert, braucht die Ausgemusterten der letzten Jahre ebensowenig wie die, die jetzt hinzukommen. Für ihre Konkurrenz brauchen Kapital und Staat gar nicht so viel brave Lohnarbeiter, wie es gibt. Weniger leisten da genug, wenn nicht mehr, wenn sie dank Sozialpakt für geringeren Lohn auch wieder mehr arbeiten.