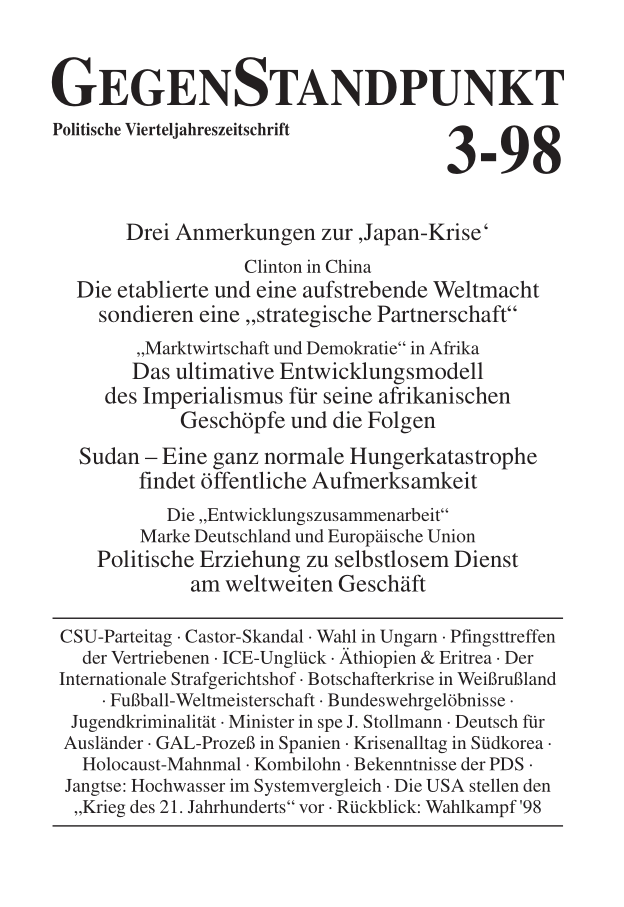Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Weltpolitik als Strafgericht
Der internationale Strafgerichtshof – ein Konkurrenzunternehmen der europäischen Diplomatie zum Rechtsanspruch amerikanischer Weltpolitik
Eine globale Strafjustiz soll die im Regierungsauftrag ausgeübte Gewalt in legale und illegale scheiden, und das alles institutionalisiert von Gewaltmonopolisten, die den Strafgerichtshof als Hebel ihrer Diplomatie, aber nicht selber auf der Anklagebank sitzen wollen. Die USA drohen, alles dafür zu tun, dass dieser diplomatische Affront gegen sie, keine Zukunft hat. Das „Gesellenstück der deutschen Diplomatie“ kriegt zu spüren, dass Recht und überlegene Gewalt zur Durchsetzung von Sanktionen gegen Staaten untrennbar zusammen gehören.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Weltpolitik als
Strafgericht
Der internationale Strafgerichtshof
– ein Konkurrenzunternehmen der europäischen Diplomatie
zum Rechtsanspruch amerikanischer Weltpolitik
1. Fünf Wochen lang treffen sich 159
Staaten in Rom zu einer Konferenz, um als ein Bollwerk
gegen das Böse
(UN-Chef Annan im
Eröffnungsappell) den ICC (International Criminal
Court) ins Leben zu rufen. Unter den versammelten Staaten
herrscht breiter Konsens
darüber, daß der ICC
als solcher eine ‚gute‘ Sache sei und als eines der
wichtigsten noch fehlenden Glieder im modernen
Völkerrecht längst schon hätte verwirklicht werden
müssen
(NZZ 11./12.7.98).
Ein bißchen besser soll die politische Welt werden, indem
die Urheber von Menschenrechtsverletzungen wie
Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit
zur Verantwortung gezogen werden.
Trotz der vermeldeten Einigkeit über die Notwendigkeit
und moralische Güteklasse einer solchen Institution steht
schon im Vorfeld fest, daß die schwierigsten
internationalen Vertragsverhandlungen seit
Jahrzehnten
(SZ
18./19.7.) anstehen. Besonders viel Weitsicht
verlangt diese Prognose nicht, schließlich sind
internationale Rechtsangelegenheiten Machtfragen zwischen
Staaten. Diese Tatsache, daß das umstrittene Strafgericht
eine ziemliche Grundsatzfrage aufwirft, weil es
erheblich in die Souveränität der Staaten
eingreifen
(ebd.) wird,
ist für die Berichterstatter allerdings ein einziger
Stachel des moralischen Eifers, das Böse, wenn es denn
aus dem zwischenstaatlichen Verkehr schon nicht zu tilgen
geht, dann wenigstens zu ahnden: Über solche kleinen
Schwierigkeiten
könnten sich die Staaten mit ganz
viel gutem Willen doch gut hinwegsetzen. Die Unterordnung
der nationalen Politik unter internationales Recht liegt
nämlich angeblich ohnehin im Trend: In Rom schlägt die
Stunde der Visionäre. Eine Zeitenwende in der
internationalen Zusammenarbeit scheint gekommen, das
Etikett historisch ist angebracht
(SZ 16.6.). Daß die wunderbare Vision
einer globalen Strafjustiz, die die im Regierungsauftrag
ausgeübte Gewalt in legale und illegale scheidet und
dabei auch noch den Unterschied zwischen legitimer und
illegitimer im Auge behält, allerdings auch zur bloßen
Illusion verkommen kann, soll daran liegen, daß es
Nationen gibt, die ein solches Gericht nur
angeblich
mögen, weil sie dessen Kompetenzen
möglichst enge Grenzen
setzen wollen. Derartige
Torpedierungsversuche
(taz,
20.7.), die die Freunde des Völkerrechts dann doch
nicht ganz an eine Zeitenwende zum Positiven glauben
lassen, wiegen um so schwerer, als in der sogenannten
Verhindererkoalition
nicht nur solche Staaten zu
finden sind, die oft wegen Menschenrechtsverletzungen
am Pranger stehen und daher kein Interesse an einem
schlagkräftigen Tribunal haben
(SZ 13.6.); auch vorbildliche Demokratien
wie die Weltmacht USA und Frankreich als renommierter
Eurostaat widersetzen sich dem Plan der Koalition der
Gleichgesinnten
. Während die hiesige
Konferenzbeobachtung bei letzterer die selbstlose und
deshalb so glaubwürdige Bereitschaft erkannt haben will,
zugunsten eines starken und unabhängigen internationalen
Justizorgans notwendige Abstriche von nationalen
Vorteilsrechnungen zu machen – Sie gingen viele
Kompromisse ein, manche am Rande des gerade noch
Erträglichen
–, stellen sie vor allem bei den USA nur
das bornierte Beharren auf Souveränitätsrechten fest.
Hämisch wird Amerika vorgerechnet, sich in
erstaunlicher Gesellschaft mit Irak, Libyen, China,
Rußland, Israel und Indien
zu befinden, obwohl es,
getreu der Volksweisheit von der sauberen Weste, das
Recht nicht zu fürchten bräuchte. Umso unverständlicher
erscheint es ihnen, daß ausgerechnet der Staat, der
mehr als alle anderen den Anspruch der Weltgerechtigkeit
auf seine Fahnen geschrieben hatte, das Weltgericht bis
zuletzt bekämpft
(Welt,
20.7.).
2. So schwankt die Stimmung zwischen
Hoffnung, die der fraglos guten Sache gilt, und Skepsis,
ob der Grundsatz Menschenrecht bricht Staatenrecht
nicht doch an engstirnigem Nationalismus scheitert. Es
fragt sich allerdings, woher die Fans dieser Einrichtung
ihr Urteil haben, die Bemühung um ein internationales
Recht dürfe nicht zur bloßen Konkurrenzaffäre
von Nationen degradiert werden, und was sie so sicher
macht, dieses Verhalten träfe nur auf eine der beiden
Fraktionen zu. Die Streithähne und ihr Konferenzobjekt
jedenfalls bezeugen das Gegenteil: Im Verhältnis zwischen
Staaten, die die Reichweite ihrer Macht ständig durch
andere Souveräne beschränkt sehen, ist das
Völkerrecht ein berechnend eingesetzter Berufungstitel
für nationale Interessen und wird nicht etwa dazu
erniedrigt – davon legt die Konferenz zur
Schaffung von Weltgerechtigkeit
selber lebhaft
Zeugnis ab.
Die Staaten bringen in Rom zu Papier, wozu sie sich, auch
und gerade nach dem Ende des Kalten Krieges, für fähig
halten: Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, Angriffskrieg
. Der auf dem
Konferenztisch liegende 170-Seiten-Katalog der
Grausamkeiten ist, wie das Strafgesetzbuch im Inneren,
ein getreues Sittenbild dessen, was in der Gesellschaft –
in diesem Fall in der Gesellschaft von Staaten – üblich
ist. Sie geben damit aber nicht nur zu Protokoll, welche
Gewaltmittel sie alle sich zur unbedingten Sicherung
ihres Gewaltmonopols gegen äußere und innere Feinde
zugelegt haben und wie alltäglich die Bereitschaft zu
deren Einsatz ist; sie bekunden auch ihren Willen, die
Brutalitäten im Staatsauftrag in Normalität
und
sogenannte Exzesse
zu scheiden. Indem
Kriegsverbrechen
zur Anklage gebracht werden
sollen, ist Krieg als landläufiges Mittel
staatlichen Verkehrs im Prinzip gebilligt, für das feste
Regeln gelten und eingehalten werden müssen; die
Einführung des Rechtstatbestandes Verbrechen gegen die
Menschlichkeit
faßt den Umgang staatlicher
Gewalthaber mit Abweichlern, Verbrechern und
Oppositionellen ins Auge und zweifelt nicht etwa die
Notwendigkeit und Berechtigung von Repression an, sondern
versucht sich an der Definition eines Übermaßes; usw. Mit
derartigen Unterscheidungen wird die Aufgabe gestellt,
einzelfallweise zu ermitteln, ob da Grenzen überschritten
wurden oder beispielsweise eine militärische
Tötungsaktion noch dem Kriterium der „Verhältnismäßigkeit
der Mittel“ genügt. Ein solches Urteil kommt
aber prinzipiell nie ohne Parteinahme für oder gegen die
grundsätzlichen politischen Anliegen des Täters
,
nämlich der in ihren Exekutoren angeklagten Staatsgewalt
aus: Je nach dem leuchtet massive Brutalität als
optimales Vorbeugungsmittel gegen noch viel mehr „Leid &
Gewalt“ ein oder bestätigt bloß den Verdacht, daß da böse
Zwecke verfolgt werden. Die Prüfung, ob schuldhaft, also
absichtlich gegen die Trennlinie zwischen berechtigter
und unberechtigter Anwendung politischer Gewalt verstoßen
wurde, setzt die Fakten ins Verhältnis zu den
guten Gründen, die noch jeder Staat und jeder
politische Verein für seine gewaltsamen Aktivitäten
geltend macht, prüft also in Wahrheit deren
Gewicht und Glaubwürdigkeit und ist folglich
immer eine politische Stellungnahme zu den
Ansprüchen auf souveräne Durchsetzung und
Ordnungsstiftung, die von den jeweiligen staatlichen oder
pseudostaatlichen auftraggebenden Subjekten erhoben
werden.
Es ist darum kein Zufall, daß die zum Vorbild für die
Schaffung eines Internationalen Strafgerichtshofs
angeführten Fälle, wo Staaten über Staaten wirklich zu
Gericht gesessen haben, an einer Hand abzuzählen und
immer in der Folge eines eindeutig entschiedenen
militärischen Kräftemessens zustande gekommen sind.
Verfahren wie die Nürnberger Nazi-Prozesse bis zum
Bosnien-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag setzen
voraus, daß die Gewaltfrage entschieden sein
muß, bevor Recht gesprochen und exekutiert
werden kann: Nur die Entmachtung der Herrschaft durch
überlegene auswärtige Gewalt ermöglicht es, die von ihr
als Staat unternommenen Taten wie
Vergehen gegen ein für sie gültiges Gesetz zu
behandeln und ihre Führer, die für Weltkriege
oder Vernichtungsprogramme politisch verantwortlich
zeichneten, wie normale Verbrecher
anzuklagen, die Menschenrechtsverletzungen
begangen haben. Die Absicht einer solchen Siegerjustiz
ist deutlich: An den Personen wird klargestellt,
daß die Sache, der sie gedient haben, sich nicht
mehr ins Recht zu setzen vermag, weswegen die durch sie
gebotenen und gerechtfertigten Taten nur noch
als Ergebnisse eines bösen Willens zählen. Die
Leute werden bestraft, um eine
Politik zu ächten; das Volk,
das die verurteilte und gescheiterte Politik mitgetragen
hat, ist allemal mitgemeint und soll daraus lernen, wem
fortan seine Loyalität gebührt.
Das Beispiel soll nun Schule machen – aber
wie: Auch ohne faktische Entmachtung und daraus
folgende moralische Widerlegung eines politischen Akteurs
soll dessen verbindliche und womöglich praktisch wirksame
Verurteilung möglich werden. Dafür muß der
Schein, es ginge tatsächlich bloß um
Schuld und Sühne, also nicht um die Beurteilung
eines politischen Zwecks, sondern exklusiv um die
angewandten Mittel, einigermaßen übertrieben werden:
Überparteiliche Richter, ausgestattet mit ganz
„sachlichen“ Tatbestandsmerkmalen und einem staatlicher
Justiz nachempfundenen Ermittlungsapparat, sollen
unpolitisch Recht sprechen und damit ziemlich
weitreichende rein sittliche Wirkungen erzielen:
Die frühzeitige und öffentlich gemachte
Ankündigung
eines umfangreichen Verbots- und
Strafenkataloges soll präventive und abschreckende
Wirkung
zeitigen – und zwar nicht mehr nur für
Kriegsverbrechen
, sondern für alle Fälle
mißbräuchlicher Anwendung politischer Gewalt. Damit soll
klargestellt werden, daß alle Taten, die
Nationen, Bürgerkrieger und Staatenneugründer im Zuge der
Wahrnehmung ihrer höchsten Interessen, Ansprüche und
Rechte zu unternehmen pflegen – und deren mögliche
Zunahme in der ‚Neuen Weltordnung‘ die Planer des
Weltgerichts freimütig antizipieren –, der mißtrauischen
Aufmerksamkeit der Völkergemeinschaft der Vereinten
Nationen unterliegen. Und dabei ist doch allen klar, daß
die Aufmerksamkeit sich nicht bloß nebenbei auf die guten
politischen Gründe erstreckt, die noch jeder derartige
politische Täter hat und nach den brutalen
Gepflogenheiten der modernen Staatengemeinschaft auch mit
vollem Recht als Rechtfertigungsgrund für eine Menge
Terror geltend machen darf, sondern genau diese guten
Gründe meint, also auf jede – werdende oder
fertige – Staatsraison zielt, die sich irgendwie
auffällig bemerkbar macht.
Die Aussicht, bei diesem weltumspannenden diplomatischen
Beurteilungswesen zumindest dabei zu sein, hat 159
Nationen nach Rom gelockt. Und zwar in sehr eindeutiger
Absicht und Eigenschaft: Auf die Gelegenheit an der Seite
der „Völkergemeinschaft“ als Ankläger zu
fungieren, der das Recht hat, Fälle internationaler
Untaten zu definieren und vom Weltgesetzbuch abweichende
Täter dingfest zu machen, sind sie natürlich
alle scharf. Die Ironie bei der Sache: Aus dem
gleichen Grund, weswegen sie die Kompetenzen eines
Weltgerichts als Hebel ihrer Diplomatie
schätzen, fürchten sie es; auf der Anklagebank
will sich selbstverständlich keiner der
Gewaltmonopolisten wiederfinden. Weil die eine
Möglichkeit aber ohne die andere nicht zu haben ist,
geraten die Vertragsverhandlungen nicht nur zu den
schwierigsten seit Jahrzehnten
, sondern auch zu
den merkwürdigsten und verlogensten. Unter UNO-Flagge
kommen 159 Nationen als konkurrierende Souveräne
zusammen und sehen sich zu dem äußerst diffizilen
Kunststück herausgefordert, einen 170-Seiten-Text, mit
freilich noch 1400 eckigen Klammern und 900
Optionstexten,
akribisch daraufhin abzuklopfen,
ob ihnen die vorgeschlagenen Befugnisse des ICC als
perspektivischen Anklägern und Mit-Richtern mehr
schmecken oder als potentiell Betroffenen eher mißfallen.
Darüber sollen sie sich dann einigen.
Es ist also ein Gerücht, die Frontlinie der Konferenz
verliefe zwischen Freunden und Feinden des Völkerrechts:
Rivalisierende Nationalisten treffen sich in
Rom, die sich von der ICC-Gründungsinitiative für ihre
Diplomatie etwas versprechen oder eben nicht. Kein
Wunder, daß sich da in erster Linie die imperialistischen
Hauptmächte aufgerufen sehen, die, im Unterschied zu
anderen Anwesenden, tatsächlich weltumspannende
Interessen haben und es sich nicht nehmen lassen
wollen, diesen den Charakter einer global anerkannten
Ordnung zu verleihen. Damit entbrennt notwendig
der Streit, wessen Handschrift
der Vertragstext
trägt.
3. An der Definition der Unabhängigkeit des ICC scheiden sich die Mächte. Bezeichnenderweise: Denn die von den sogenannten Gleichgesinnten – an vorderster Front den Deutschen – erhobene Forderung nach einem unabhängigen, mit weitreichenden Kompetenzen ausgestatteten Strafgericht versteht die weltweit kompetenteste Macht, die USA, als Versuch zur Relativierung ihrer Stellung in der Welt. Zur Klarstellung, daß eine von ihrem Einfluß unabhängige Gerichtsbarkeit nicht in Frage kommt, macht die amerikanische Regierung zumindest schon einmal die Anbindung des ICC an den UN-Sicherheitsrat – und dabei denkt sie nicht an die anderen vier, sondern an ihr Vetorecht – zur Bedingung ihrer Zustimmung:
„Die vorgesehene Unabhängigkeit des Gerichts, zu der es gehört, auch ohne konkreten Auftrag des UN-Sicherheitsrates, Fälle von Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgen zu können, lädt zum Mißbrauch ein. Verbrecherische Staatenlenker wie Slobodan Milosevic oder Saddam Hussein könnten den Gerichtshof nutzen, um amerikanische Soldaten, die etwa auf Bitten der internationalen Gemeinschaft gegen sie eingesetzt worden sind, aus propagandistischen Gründen zu verklagen. Der Vertrag ‚bewertet nicht in angemessener Weise die wichtige Rolle, die Amerika und sein Militär weltweit spielen‘, sagt Rubin.“ (Sprecher des US-Außenministeriums, FR 20.7.)
So weisen die USA mit der diplomatisch gebotenen
Höflichkeit darauf hin, daß sie ebenso daran gewöhnt wie
darin verwöhnt sind, den weltweiten Gebrauch ihrer Macht
mit der Wahrnehmung internationalen Rechts ineins zu
setzen, und keine Veranlassung sehen, anderen Staaten –
und dabei denken sie keineswegs nur an die genannten
‚Schurkenankläger‘ – autonome Befugnisse bei der Be- und
Verurteilung von Verstößen gegen das Völkerrecht
einzuräumen. Daß irgendein dahergelaufener Ankläger
aus eigenem Antrieb
einen Prozeß anstrengen können
soll, kommt für die mächtigste der Rechtstaatlichkeit
verpflichtete Nation
(Scheffer,
Clintons Chefdelegierter in Rom) nicht in Frage:
Dadurch würde Unbefugten doch glatt die Möglichkeit
eröffnet, die Rechtmäßigkeit amerikanischer
Friedensmissionen anzuzweifeln. Wenn die USA gegen diese
Vorstellungen die angemessene
Berücksichtigung
ihrer wichtigen Rolle
einfordern, ist dies die im
Grunde nicht kompromißfähige Offensive, daß sie für ihre
Soldaten einen Ausnahmestatus beantragen: Sie berufen
sich auf ihre „Rolle“ als Weltordnungsmacht Nr. 1, die
sich in ihrer Handlungsfreiheit unter keinen Umständen
beschränken lassen will und deshalb an einem
supranationalen Institut nur dann ein Interesse hat, wenn
es die eingerichteten Machtverhältnisse festschreibt und
rechtsförmig legitimiert.
Mit diesem absoluten Zuständigkeitsanspruch für Recht und Ordnung auf der Welt, vorgetragen von der Weltmacht als Vertreter von Weltgerechtigkeit, muß das Modell von einem unabhängigen ICC konkurrieren. Seine Vorreiter nehmen den diplomatischen Kampf auf, weil sie ganz offensichtlich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen wollen, ihren weltpolitischen Ambitionen ein Forum zu verschaffen.
4. Wider Erwarten und aller Skepsis
zum Trotz
– so oder ähnlich beginnen alle Berichte
vom Ausgang der Konferenz, denn sie dürfen vermelden, daß
sich nach fünf Wochen zähen Verhandelns eine Mehrheit von
120 Staaten für die Gründung des ICC entschieden hat. Daß
sich die Position der Deutschen und der anderen
„Gleichgesinnten“ so klar durchsetzen konnte – am Ende
gehören sogar die ständigen Sicherheitsratsmitglieder
Frankreich, das sich als einzige europäische Macht gegen
die Einrichtung einer permanenten Strafjustiz
ausgesprochen hatte, wie auch Rußland zu den Befürwortern
–, darf als Gesellenstück der deutschen Diplomatie
(SZ 20.7.) gewertet werden.
Natürlich war mit dem wunderbaren Votum gleich die
Aufgabe verbunden, neben der Reichweite und Befugnis des
Gerichts auch die Straftatbestände sowie die Rechte des
möglichen Angeklagten zu definieren; das hat dann doch
einige kompromißlerische Abstriche vom Ideal einer
strafenden Weltgerechtigkeit nötig gemacht:
„Das Gericht hat … keine Kompetenz, wenn der Staat, in dem die Verbrechen begangen wurden oder dessen Staatsangehörige unter Verdacht stehen, das Statut nicht unterzeichnet hat… Als Völkermord gelten… Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden definiert als… Als Kriegsverbrechen gelten unter anderem… Für den Angriffskrieg wurde keine Definition festgeschrieben; gemäß der Charta der der Vereinten Nationen soll der UN-Sicherheitsrat entscheiden, ob es sich um einen Angriffskrieg handelt oder nicht… Der Ankläger kann Ermittlungen ‚motu proprio‘ (auf eigene Initiative hin) einleiten. Vorher muß aber ein Ausschuß, bestehend aus Richtern unterschiedlicher Nationalitäten, die von den Mitgliedsstaaten ausgewählt wurden, entscheiden, ob es genügend Anhaltspunkte für eine Strafverfolgung gibt. Die Ermittlungen dürfen erst 12 Monate nach der Annahme einer entsprechenden UN-Resolution beginnen.“ Usw.
Recht muß also Recht bleiben, auch im Krieg und auch
dann, wenn es zwar gelingt, den Angriffskrieg unter
Verbot zu stellen, die Definition aber, was das Verbot
umfassen soll, vertagt werden muß; aber was Recht ist,
das bleibt die offene Frage zwischen lauter
rechtsetzenden Souveränen, also eine pure internationale
Machtfrage. Und fraglich bleibt erst recht, ob und
wieviel sich von einem eventuellen Rechtsspruch
allenfalls durchsetzen läßt. Denn daß der erzielte
Kompromiß nur ein diplomatisches
Gesellenstück
ist, ist nach der guten die
schlechte Nachricht:
„Das Meisterstück wäre es, Amerika in den kommenden Jahren von der Teilnahme am Völkertribunal zu überzeugen. Denn um sich durchzusetzen, braucht das Weltgericht Vollstreckungshilfe durch einen Weltpolizisten. Und der heißt immer noch USA.“ (SZ 20.7.)
Wie sehr also die verbindliche Festlegung eines
internationalen Rechts eine Fiktion ist, weil seine
Überzeugungsmacht, im Unterschied zur nationalen
Rechtsprechung, nur davon lebt, daß es von
allen Staaten aus den genannten Berechnungen
anerkannt wird, fällt den Euphorikern spätestens dann
auf, wenn sie an dessen Durchsetzung denken. Plötzlich
werden sie ganz realistisch und bemerken, daß nach
erfolgter Rechtsprechung die verhängte Strafe gegen den
Willen anderer Staaten durchgesetzt sein will.
Dafür fehlt dem ICC die Macht eines
Weltpolizisten
. So landen letztendlich auch sie
bei dem Eingeständnis, daß Recht und überlegene
Gewalt untrennbar zusammengehören.
5. Auf den notwendigen Zusammenhang von Rechtsetzung und -durchsetzung pochen die USA gemäß ihrer Lesart. Schon im Vorfeld des Kompromisses hieß es in Reaktion auf einen deutschen Plan, Kriegsverbrecher auch nicht dem Vertrag beigetretener Staaten verfolgen zu können:
„Sollte das Gericht gemäß dem deutschen Vorschlag Kriegsverbrecher verfolgen können, müßten die USA ihre Verpflichtungen in Übersee überdenken. Dies gelte auch für Europa“ (SZ 15.7.) –
da hierzulande die Parole ‚Ami go home!‘ nicht so beliebt ist, zog man seinen Entwurf dann zurück. Die Reaktion der USA auf den dann erzielten Kompromiß läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, daß sie den Vorstoß der europäischen Konkurrenz für vermessen halten und entsprechend beantworten werden:
„Dies ist das Gericht, vor dem wir und andere gewarnt haben, stark auf dem Papier, aber schwach in der Wirklichkeit.“ (Scheffer, Leiter der US-Delegation)
Dieser Kommentar ist keineswegs bloß als Genugtuung darüber zu verstehen, daß der ICC ohne Amerikas Beteiligung nur bedingt handlungsfähig ist. Vielmehr beinhaltet er die Drohung, daß die USA alles dafür tun werden, daß diese diplomatische Aktion, die sie als Affront empfinden, keine Zukunft hat. Klartext redet der Sondergesandte Scheffer, wenn er den US-Senatsausschuß für auswärtige Angelegenheiten damit beruhigt, daß Amerika nicht bereit ist, als Vollstreckungsgehilfe einer Gerichtsbarkeit zu fungieren, die nicht ausschließlich seinen Ansprüchen genügt, sondern seinerseits auf Unterordnung der Abstimmungssieger von Rom dringt:
„Die Administration hofft, daß andere Regierungen in den kommenden Jahren die Vorteile einer potentiellen Beteiligung der Vereinigten Staaten am Vertrag von Rom erkennen und die fehlerhaften Vorschriften des Vertrages korrigieren.“ (Amerika Dienst 15)
Stützen kann sich diese Hoffnung auf die Ankündigung, daß die USA
„ihr wirtschaftliches und politisches Gewicht nutzen werden, um in den kommenden Monaten möglichst viele Länder davon abzuhalten, den Vertrag von Rom zu ratifizieren.“ (FR 20.7.)
Außerdem bleibt in der Zwischenzeit die
Herausforderung der internationalen Gerechtigkeit
bestehen: In dieser Frage werden die USA – ICC hin oder
her – auch in Zukunft nichts anbrennen lassen und den
Beweis antreten, daß die Durchsetzung ihres
Rechts eine gemeinsame Verpflichtung
ist:
„Die Vereinigten Staaten werden weiterhin eine Führungsrolle bei der Förderung der gemeinsamen Verpflichtung aller gesetzestreuen Regierungen übernehmen, diejenigen vor Gericht zu bringen, die jetzt und in Zukunft abscheuliche Verbrechen begehen.“ (Scheffer vor dem Senatsausschuß)
So wird der angepeilte Traum der Weltgerechtigkeit
in Form einer Weltstrafgerichtskammer ein mangelhafter
Ersatz für das äußerst lebendige Ideal der Weltherrschaft
bleiben.