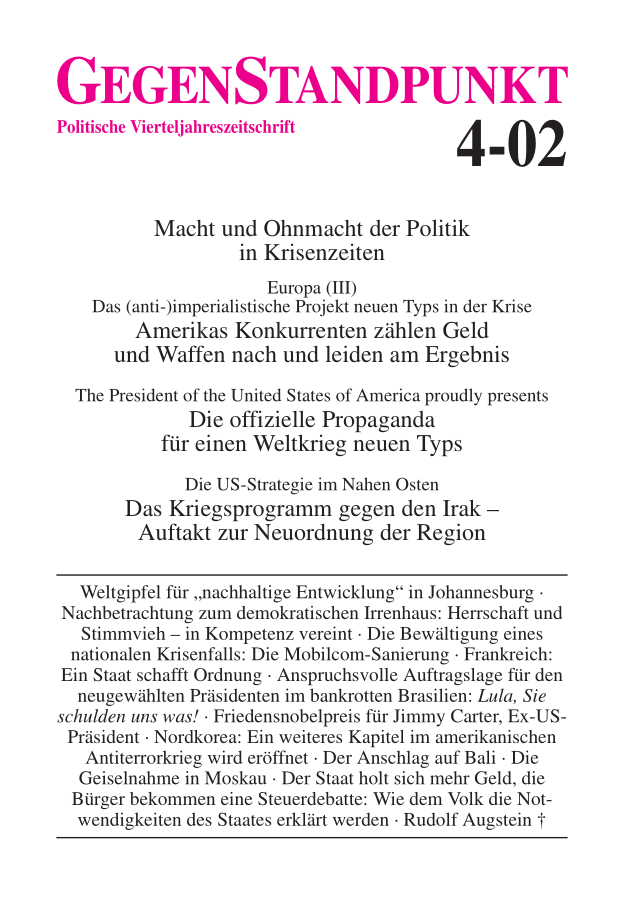Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Auch nach der Wahl stets in Verantwortung gegenüber dem Wähler – die kleinen Volksparteien arbeiten ihr Ergebnis auf:
Berechnend, intrigant, machtversessen
Nach der Bundestagswahl begeben sich PDS und FDP auf die selbstkritische Suche nach dem vergeigten Erfolg in Sachen Stimmenfang. Die Ostpartei leistet sich dafür eine „fundamentale Krise“ bis zur Zerreißprobe: soll die Partei „realen Einfluss“ gewinnen dadurch, dass sie alles Oppositionelle aus ihrem Programm streicht oder doch eher Wählerstimmen als „gestaltende Opposition“ ergattern. Die FDP inszeniert eine „Führungskrise“, begräbt in der Person Möllemanns ihre erfolglose „18%“-Strategie und zweifelt an der Führerautorität eines Westerwelle. Und bei den Grünen, die mit ihrem „Joschka“ so erfolgreich waren beim Machterhalt, führt der Streit um „die Trennung von Amt um Mandat“ geradewegs zur Frage,ob die Parteiführung alle Freiheiten hat, die sie zum erfolgreichen, echt-grünen Führungsanspruch braucht.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Auch nach der Wahl stets in
Verantwortung gegenüber dem Wähler – die kleinen Volksparteien arbeiten ihr
Ergebnis auf:
Berechnend, intrigant,
machtversessen
Der Wähler hat seinen Dienst getan. Er hat sich nach
gründlicher Prüfung der beiden ihm zur Auswahl stehenden
Alternativen mehrheitlich dafür entschieden, sich doch
weiter von seinen alten Herren regieren zu lassen, und
die tun ihm den Gefallen gerne. Für eine Opposition hat
er gleich mit gesorgt, so dass auch für die nächsten
Jahre im demokratischen Rahmenprogramm für Unterhaltung
gesorgt ist und immer wieder von neuem die spannende
Frage aufgeworfen werden darf, wer das Staatsnotwendige
wohl am glaubwürdigsten durchzusetzen imstande ist;
diejenigen, die das gerade erledigen, oder die, die sich
danach drängen, Verantwortung für Deutschland zu tragen.
Insofern ist in der Wahl alles prima gelaufen. Freilich
nicht für alle gleichermaßen. Allen zugleich kann der
Wähler es natürlich nicht recht machen, die ihn da mit
der freundlichen Bitte um Ermächtigung angehen. Zum
relativen Erfolg, zu dem er dem einen Wahlverein
verhilft, indem er ihn mehrheitlich an die Macht wählt,
gehört blöderweise stets der relative Misserfolg derer,
denen er seinen Zuspruch versagt. Diese Verteilung seiner
Gunst will von den unterschiedlich mit ihr Bedachten nach
der Wahl aufgearbeitet
werden. Für die Parteien
nämlich gibt die Prozentzahl, die sie als ihren
Wahlerfolg vorweisen können, über sehr viel mehr Auskunft
als nur über das aggregierte Stimmengewicht ihrer Wähler.
Für sie ist diese Ziffer die alles entscheidende
Kennziffer des Erfolgs, den sie als Partei
überhaupt haben. Ihr entnehmen sie, wie gut alle
ihre Finessen und Strategien der Vertrauenswerbung beim
Wähler verfangen haben, wie weit sie es also gebracht
haben bei der Beförderung ihres obersten Daseinszwecks,
dem eigenen Personal zur Macht im Staat zu verhelfen.
Waren sie dabei vergleichsweise erfolgreicher
als die Konkurrenten, ist dies für sie damit
gleichbedeutend, im Grunde alles genau richtig
gemacht zu haben, also auch in Zukunft mit der so
werbewirksamen Selbstdarstellung goldrichtig zu liegen.
Umgekehrt steht bei denen, für die der Wahlausgang
enttäuschend ausgefallen ist, zwar schon immer fest, dass
im Wesentlichen der Wähler sich getäuscht und die
Verkehrten gewählt hat. Aber da ihnen nach eigenem
demokratischen Dafürhalten der Erfolg nun einmal gebührt,
werden demokratische Parteien – insbesondere bei ganz
großen Enttäuschungen – schon auch selbstkritisch. Wo sie
so offensichtlich nicht als das attraktive Angebot an die
nationale Wählerschaft verfangen, zu dem sie sich mit so
viel Aufwand hergerichtet haben, müssen schon auch
sie etwas verkehrt gemacht haben – bei
der glaubwürdigen Darstellung ihres berechtigten
Anspruchs auf die Ausübung der Macht. Die selbstkritische
Suche nach dem Grund für den vergeigten Erfolg geht
mithin nahtlos in die Entdeckung eines Hebels für
demnächst wieder erfolgreiche Stimmenwerbung über.
PDS: Opposition zerstreitet sich bei der Suche nach brauchbarer Wählerbasis
Für die parlamentarischen Vertreter ostdeutscher
Unzufriedenheit aller Art kommt das Wahlergebnis dem
Größten Anzunehmenden Unglück einer demokratischen Partei
gleich. Sie hat zwar nur ein Prozent verloren, aber eben
das entscheidende, das die parlamentarische Teilhabe am
Machtgetriebe ausmacht. Ihren vom Hochwasser geschädigten
Landsleuten hat der Kanzler schon extrem glaubwürdig
vermittelt, dass vor einem nationalen Notstand erstens
alle Deutschen gleich, zweitens die von diversen Nöten
Geschlagenen naturgemäß dort am besten aufgehoben sind,
wo der Fluss der Geldmittel dirigiert wird, also bei dem,
der gerade die Macht hat. So viel an bekundeter
Solidarität
und Tatkraft
hat sich für den
Kanzler ausgezahlt, für die rührige ostdeutsche
Standesvertretung vor Ort das Sandsackschleppen dagegen
nicht, und die Konsequenz ist bitter: Das
Wahlziel, wieder im Parlament zu sitzen und bei allen die
Republik betreffenden politischen Fragen zwar nicht
entscheidend, aber eben doch mit-entscheidend dabei zu
sein und damit automatisch die demokratische
Aufmerksamkeit zu genießen, auf die es schließlich in
Hinsicht auf den Wähler ankommt, hat man verfehlt. Also
betreibt die Partei Ursachenforschung. Allein schon der
Umstand, dass man nun nicht mehr im Berliner Parlament
vertreten ist, stellt allen vor Augen, wie politisch
bedeutungslos
man schlagartig geworden ist. Eine
Führung
hat die Partei zwar, aber wenn sie von der
nicht erfolgreich an die Macht geführt wird, hat sie
offensichtlich nicht die richtige. Das merken die
Verantwortlichen an der Spitze endlich auch in dieser
Partei auf dieselbe Weise, die in der etablierten
Konkurrenz üblich ist: Zu verdanken habe die PDS ihren
Misserfolg der blassen Figur
, die den Vorsitz hat;
bei dieser spröden
, grauen Maus
, die in
ihrer Verkniffenheit
und ewigen
Nein-Sagerei
ungefähr so attraktiv ist wie ein
Plattenbau, müsse man sich doch gar nicht wundern, dass
man beim Wähler nicht ankommt; da brauche es schon
mindestens so smarte Sympathieträger wie etwa diejenigen,
die erst ihre Vorsitzende nach Strich und Faden schlecht
machen, um ihr dann den Autoritätsverslust
zur
Last zu legen, für den ihre Kritiker sorgen, und mit der
verantwortungsvollen Frage aufwarten zu können, wer den
Laden überhaupt noch zusammenhält
; wer ihm die
inhaltliche Neuorientierung
verpasst, die – auch
so ein Umschlag von Quantität in Qualität – mit dem
Scheitern an der 5%-Hürde unabweisbar fällig geworden
ist; und vor allem: Wie diese Erneuerung
auszusehen habe.
Das ist nicht so einfach zu ermitteln. Denn da gibt es
auf der einen Seite die Reformer
mit ihren
Vorstellungen, wie es der PDS gelingen könnte, realen
Einfluss im konkreten Interesse ihrer Wähler(innen) im
gesamten Bundesgebiet
zu gewinnen. Zu diesem Zweck
nehmen sie Maß am ‚realen Einfluss‘, den die Partei im
Zuge ihrer konstruktiven Mitarbeit an der Seite der SPD
in den ostdeutschen Landesregierungen ja zweifellos hat.
Erfolgreiche Teilhabe an der Macht auf unterer Ebene
sichert für sie den Erfolg bei der Eroberung der Macht
auf der Ebene darüber, und erfolgreich hat man an der
Macht eben nur teil, wenn man deutlich zu verstehen gibt,
dass man genau dies und nichts sonst will. Also hat es
endlich ein Ende zu haben mit dem Gestus einer –
irgendwie immer noch auf ‚grundsätzlicheren Wandel‘
dringenden – oppositionellen ‚Kraft‘, die der
Wähler mit seinem Kreuzchen für die PDS mandatieren soll.
Schluss muss sein mit dem unklaren rückwärts gewandten
Bild zwischen orthodoxen Kommunisten, DDR-Nostalgikern
und pragmatischen Reformern
, welches zwar nicht
unklar ist, aber keinesfalls konstruktive
Vorwärtsgewandtheit, sondern glatt noch den Eindruck
vermittelt, man meine es mit dem Ruf nach politischen
Korrekturen ernster als mit der Einsicht, dass solche
Korrekturen alle Mal den Einfluss auf, also die
Beteiligung an den Staatsgeschäften voraussetzen. Es
braucht endlich – so die Reformer – vor allem anderen das
tätige Bekenntnis zu ‚grundsätzlicher
Verantwortungsbereitschaft‘ zum Mitregieren. Das
inhaltlich eindeutige Profil
, das die Partei als
Ersatz dringend benötigt, stellt dann alles Nötige über
die demokratische Orthodoxie klar, die diesen
Nostalgikern des parlamentarischen Opponieren-Könnens
vorschwebt. Es ergibt sich schlicht aus ihrem Entschluss,
zu einfach gar nichts mehr ‚bloß‘ ‚Nein‘, vielmehr
umgekehrt zu allem, was in den Umkreis einer
verantwortungsvollen Regierungsarbeit fällt, ein
prinzipielles ‚Ja!‘ zu sagen. Einfach nur noch mit dem
Willen, Gesamtdeutschland zu dienen, dem Wähler seine
Aufwartung zu machen, ihn nicht mehr mit irgendwelchen,
sondern nur mit wirklich umsetzbaren Vorstellungen
zu ködern, dazu in die Gesellschaft schauen, welche
Fragen hier anstehen
, und alle diese ‚Fragen‘ auf ein
und dieselbe Antwort hinauslaufen zu lassen, auf die
nämlich, dass sie bei einer mit-regierenden PDS in besten
Händen sind – kurz: mit dem demonstrativen Willen zur
konstruktiven Mitarbeit beim Berlin-Sanieren und anderen
Staatsnotwendigkeiten im größer gewordenen Deutschland in
die dauerhafte Rolle des Mehrheitsbeschaffers der SPD
hineinzuwachsen: Das wäre er in etwa für die
Reformer
, der neue politische Inhalt
, der
dieser Partei Profil
verleihen soll.
Das ist nicht nach dem Geschmack aller. Nicht, dass Frau
Zimmer und ihrem Anhang angesichts des schlechten
Wahlausgangs nicht auch die Dringlichkeit einer
Erneuerung
des Erscheinungsbildes ihrer Partei vor
Augen stünde. Nicht, dass dieser Gegenfraktion um die
Parteispitze
noch ein ernsthaftes ‚Nein‘ zum Gang der
deutschen Politik am Herzen läge, für den die Partei nach
ihrem Dafürhalten beim Publikum werben sollte – nur dass
bei der fälligen Renovierung des Profils
der
Partei das alte gleich ganz weggeschmissen werden soll:
Das missfällt dem amtierenden Vorstand. Er setzt darauf,
dass eine Partei, die es mit der glaubwürdigen
Inszenierung von Opposition immerhin in die Parlamente
gebracht hat, dies demnächst schon auch wieder in Berlin
schaffen wird, wenn sie nur als oppositionelle
Kraft
wieder echt glaubwürdig ist, d.h. sich
genügend von der SPD unterscheidet, um als
Wahlalternative Stimmen zu gewinnen. Daher:
Bedingungslose Regierungsbildung, Zustimmung um jeden
Preis – das ist Opportunismus
, und der ist mit Frau
Zimmer aber so etwas von überhaupt nicht zu machen.
Natürlich will schon auch sie beim Bilden von Regierungen
unbedingt dabei sei – aber bei Wahlen eben nicht als
bloßer Mehrheitsbeschaffer der SPD antreten. Natürlich
stimmt auch sie dafür so manchem zu – aber eben nicht
immer sofort und von Haus aus, sondern von Fall zu Fall
und stets reiflich überlegt: Gestaltende
Opposition
heißt der Terminus technicus, mit dem der
Wille zum Mitregieren in den Parlamenten den bewährten
Schein noch ein wenig am Leben erhalten soll, er wäre
dann, wenn er zum Zuge kommt, so etwas wie eine
Gegenmacht. Und davon, wie er absolut frei von
jedem Opportunismus zum Zuge kommen könnte, hat Frau
Zimmer auch eine präzise Vorstellung. Ein
Mitte-unten-Bündnis
schwebt ihr da vor, welches
ganz einfach darüber zustande kommt, dass die
Mitte
, zu der sich – wie alle anderen
Volksparteien – jetzt auch die gute PDS rechnet, sich zum
geborenen parlamentarischen Repräsentanten jeder Sorte
Unzufriedenheit – womit auch immer – erklärt, die sie
unten
, in der Gesellschaft, vorfindet. Wenn sich
die Vertretung ostdeutscher Unzufriedenheit als nicht
Erfolg versprechend genug erweist, dann muss man eben auf
alles zurückgreifen, was man in Gesamtdeutschland an
mutmaßlich Unzufriedenen vorfindet, und die wissen
lassen, wo die politische Kraft
ist, nach der sie
suchen. ATTAC, frustrierte Pazifisten, allein erziehende
Mütter, Arbeitslose in Ost und West – wer immer sich von
den Regierenden in welchem Interesse auch immer zu wenig
bedient wähnt: In der PDS hat einfach jedes
gedeckelte Anliegen seine perfekte politische Vertretung
parat stehen – und muss sie nur noch wählen.
Das sind so die Zerreißproben
einer demokratischen
Partei. Wenn sie bei ihrer bisherigen Stammwählerschaft
keinen Anklang mehr findet: Findet sie ihn dann wieder,
wenn sie sich gleich als Organ für
gesamtdeutsch-konstruktives Co-Regieren Seit’ an Seit’
mit der SPD profiliert
? Oder besser darüber, dass
sie sich aus dem gesamtdeutschen Kollektiv noch eine
besondere Klientel herauspickt, der sie sich als eben
dieses Organ besonders empfehlen kann? Und weil man sich
in diesem Haufen vorerst noch mehrheitlich mehr von
Letzterem verspricht, bleibt in der Republik das
Parteiprofil ‚Opposition‘ weiterhin wählbar. Das ist gut
so, denn sonst haben die Leute ja alles, was sie zum
Leben so brauchen. Freilich – beide Fraktionen der PDS
leiden daran, dass das Bild parteilicher Geschlossenheit
hinter einer Führung, die allein schon wegen der
Akklamation durch ihre Partei das volle Vertrauen der
Wähler verdient, über diese Auseinandersetzung ziemlich
leidet – und werfen sich eben das wechselseitig als
größtes Verbrechen vor. So bieten sie einer Klientel, die
nichts so sehr schätzt wie eindeutige ‚Führungskraft‘,
das Schauspiel einer Partei, die sich vor lauter
demokratischem Erfolgsdrang wechselseitig mit dem Vorwurf
parteischädigenden Verhaltens traktiert. So hat es die
PDS zu voller demokratischer Reife gebracht – und
zerbricht daran.
FDP: Demokratischer Klärungsprozess der allerwichtigsten Sachfrage – eindeutige Führung!
Auch für die Führungsriege der FDP steht angesichts des
enttäuschenden Wahlausgangs fest, dass eine
Strategiediskussion
Not tut, der Misserfolg bei
der letzten Wahl allein durch Konsequenzen
wettzumachen geht, die den Erfolg bei der nächsten zu
sichern versprechen. Und dazu begibt man sich auch hier
erst einmal selbstkritisch auf die Suche nach dem Grund
für den – eigentlich unfassbaren – Attraktivitätsverlust
beim Wähler. Die Sachverständigen kommen zu dem Ergebnis,
dass die Partei in Gestalt ihrer Führungsriege
einiges falsch gemacht haben muss. Deren
demonstrative Selbstdarstellung als unschlagbare
Erfolgsnummer: als machtbewusste und siegessichere Kraft
mit ‚Projekt 18‘, eigenem Kanzlerkandidaten und
haufenweise Hanswurstiaden; der unglaubliche Mut zum
Tabu-Bruch
in der deutschen Juden-Frage, der
entschlossene Kampf dort und anderswo um eine
Emanzipation der Demokraten
, auf dass neben allen
besser verdienenden auch noch ganz viel andere gestandene
Nationalisten endlich entdecken mögen, was in einem
nassforschen Rechtsanwalt mit gelbem WoMo wirklich
steckt: Im Prinzip gehört sich das zwar für eine Partei,
die als einzige glaubwürdig für frischen Wind
in
der Politik sorgt. Wenn aber eine solche Inszenierung
beim Adressaten nicht wie erhofft verfängt, dann muss
sich da jemand mutwillig am Erfolgsrecht der Partei
vergangen haben. Dann muss einer Schuld daran
sein, dass es für sie nicht zur Besetzung der
Regierungsbank gereicht hat – und dann ist auch klar,
wer da als Schuldiger allein in Frage kommt:
Jürgen Möllemann heißt der Keil zwischen der Partei und
denen, die sie hätten wählen sollen. Auf dessen
Machtinstinkt
, Machtwillen
, Mut
,
Tatkraft
und alle anderen Ingredienzien, die eine
demokratische Führerpersönlichkeit, die auch er
zweifellos ist, zu eben dieser machen, geht zwar alles
zurück, was das moderne Erscheinungsbild
dieser
Partei so unverwechselbar prägt: Ohne den politischen
Genius
und das Sendungsbewusstsein
dieses
Mannes kämen die Liberalen womöglich noch immer bloß mit
drei unverwechselbaren Pünktchen im Namen daher! Aber der
Mann will einfach nicht einsehen, dass die von ihm
erfundenen Insignien erfolgreichen Machtstrebens nicht
automatisch ihren Erfinder zur berufenen Inkarnation
dieser demokratischen Führungstugenden machen, wenn es
schon einen auserkorenen FDP-Kandidaten für dieses
Führungsamt gibt. Der Kampf um die Parteiführung muss
auch einmal ein Ende haben, und ein Verlierer – im Sport
wie im fairen Wettstreit der parteiinternen Intriganten,
Hausmachten und Seilschaften – muss nun einmal mit seiner
Niederlage leben. Stattdessen lässt der Jürgen M. nicht
locker. Kaum setzt der studierte Guido dem gelernten
Grundschullehrer liebevoll auseinander, dass auch im
wirklichen Leben pro Dampfschiff nur ein Kapitän
vorgesehen und die Stelle in der Partei leider schon
vergeben ist, ignoriert der das einfach. Da kürt die
Partei einen Führer, der endlich wieder etwas hermacht
und mit Möllemanns Unterstützung noch viel mehr hermachen
könnte – und der lässt nicht davon ab –
eigensinnig
und eigenmächtig
, wie er nun
einmal ist –, sich als die wahre Autorität in
Sachen Erneuerung der liberalen Mitte
zu
profilieren. Kaum im letzten Machtkampf
gegen
Westerwelle und dessen Gefolgsleute unterlegen,
provoziert er den nächsten, missachtet verdiente
Autoritäten, schafft es sogar, Hamm-Brücher, das
garantiert zählebigste Fossil aus der Besenkammer
altliberaler Aura, zu vergraulen, und wenn einer
demokratischen Partei – im Vorfeld einer Wahl schon
gleich – etwas schadet, dann so etwas: Der Verdacht, der
von ihr für die Führung der Staatsgeschäfte aufgestellte
Spitzenmann wäre nicht einmal dazu imstande, seinen
eigenen Laden geschlossen auf Linie zu bringen. Der weiß
also nach der Wahl nicht nur, wem er sein schlechtes
Ergebnis zu verdanken, er weiß auch sofort, was er da zu
tun hat: Der lästige Störenfried muss weg, und zwar in
einer Weise, die auch seinen kaum weniger lästigen Anhang
in der Partei endgültig mundtot macht.
Es ist bei der Sorte von Argumenten, die den
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess in
demokratischen Parteien am nachhaltigsten zu bestimmen
pflegen, auch klar, wie man ein politisches
Urgestein
(Jürgen M. über
sich), das sich nicht in die parteiinterne
Hierarchie einpassen will, in handliche Brocken
zerkrümelt: Man bemüht die ‚Sachargumente‘, die bei der
Klärung von Führungsfragen zählen, und untergräbt den
konkurrierenden Führungsanspruch, den man loswerden will,
indem man die Person erledigt, die ihn anmeldet
– und zwar so gründlich, dass man ihr nicht bloß die
politische Kompetenz zum Führen abspricht, sondern dem
bisher geschätzten Führungsmitglied der Partei mehr oder
weniger politkriminelle Machenschaften auf Kosten der
Partei anhängt. So kommt es zu dem grandiosen Spaß, dass
die parteieigenen Profis der Akquisition von Geldern auch
einmal in eigener Sache tätig werden. Sie, die genau
wissen, wie man an allen Parteifinanzierungs- und
sonstigen Gesetzen vorbei anonyme Großspenden bar wie
unbar so portioniert, dass sie ohne größeres Aufsehen
dort auch ankommen, wo sie hin sollen, kennen ihr
ungeliebtes Gegenüber bestens, nämlich als einen, der
sich in ihrem Gewerbe mindestens so gut auskennt wie sie
– nicht zuletzt von dessen Könnerschaft auch auf diesem
Gebiet hat die Partei in den goldenen Zeiten eines Flick
profitiert. Da sind also Spezialisten fürs Vertuschen
‚schwarzer Kassen‘ und anderer Konten unter sich, und das
wird einem von ihnen zum Verhängnis. Das Flugblatt, mit
dem Möllemann kurz vor der Wahl noch einmal auf sich und
die Drangsale einer nach Emanzipation von jüdischen
Sittenwächtern dürstenden deutschen Seele aufmerksam
gemacht hat, legt man ihm jetzt nochmals zur Last. Was in
dem überhaupt steht, ist längst vergessen und kümmert im
Übrigen sowieso niemanden. Erstens zählt daran nur, dass
er die gerade mühsam hergestellte und auch von der FDP
für zweckmäßig erachtete Übereinkunft des offiziellen
Nationalismus bezüglich des ‚deutschen
Sonderverhältnisses gegenüber den Juden‘ wieder in Frage
stellt und damit die Wähler polarisiert statt gewinnt.
Zweitens kommt der schlagendste Einwand gegen den Autor
vom FDP-Schatzminister: Nicht sauber finanziert
war er, der berüchtigte Flyer
! Und mit derselben
Technik, die sich in der Konkurrenz zwischen den Parteien
schon so gut bewährt und sogar einen Kohl – und dessen
‚Kronprinzen‘ gleich mit – erledigt hat, geht es diesmal
einem stellvertretenden Vorsitzenden des eigenen Haufens
an den Kragen: „Konten offen legen!“, „Namen nennen!“ –
das sind die überzeugenden Sachargumente, mit denen die
Führung einer demokratischen Partei einen Konkurrenten
erledigen und sich beim Rest uneingeschränkt Respekt
verschaffen will.
Freilich, auch in diesem Fall wird die Partei samt einer
teilnehmenden demokratischen Öffentlichkeit der Sache
nicht recht froh. Denn – wer hätte das gedacht! – es
stellt sich heraus, dass erstens so ziemlich jeder in der
Partei, den es etwas anging, Westerwelle einschließlich,
von Möllemanns Vorhaben informiert gewesen ist; dass
zweitens ‚sein‘ Landesverband erst recht Bescheid gewusst
und mitgemacht hat. Von wegen also ‚Alleingang hinter dem
Rücken und auf Kosten der Partei‘ – der Mann hat
schließlich gewusst und vertreten, was er in seinem
und der FDP Interesse vorhat. Also zieht die
‚Affäre Möllemann weitere Kreise‘, das Ansehen manch
anderer Figur leidet mit – und vor allem: Der Mann, der
sich mit der radikalen Ausmerzung Möllemanns endgültig
als unangefochtener Führer und künftiger Erfolgsgarant
der Partei etablieren wollte, gewinnt durch die
Inszenierung dieser Korruptionsaffäre einfach nicht das
Profil, das ihm zusteht, weil sich die klare
Trennungslinie zwischen dem Un-Politiker Möllemann und
der aufrecht und einig geführten FDP einfach nicht
umstandslos genug ziehen lassen will. Prompt leidet die
Mehrheit der Partei am Ansehensverlust, den Westerwelle
und damit die Partei durch den mangelnden Erfolg
der parteiinternen Intrige erleidet. Also bekräftigen die
entsprechenden Figuren, dass sie nach wie vor und jetzt
erst recht auf ihn als ihre Führungspersönlichkeit bauen
– wir haben bewusst auf einen Generationenwechsel
gesetzt, und dabei bleibt es
(Gerhardt) –, und mit Möllemann wird auch
gleich die durch den Misserfolg ein wenig unglaubwürdig
gewordene ‚18-Prozent-Strategie‘ miterledigt: Dem Wähler
wird versprochen, ihm für das nächste Mal mit der
Verkündigung ‚realistischerer Erfolgsperspektiven‘ und
mit einem bis dahin endgültig unangefochtenen Spitzenmann
die schlagenden Gründe zum FDP-Wählen zu liefern. Das ist
dann das neue ‚Profil‘ und die ‚Sacharbeit‘, die es jetzt
verstärkt ‚rüberzubringen‘ gilt. Auch das geht in
Ordnung, denn das Wahlergebnis hat es ja gezeigt: Von
etwas anderem als einer knackigen Autorität beim Führen,
die von ihrer Zugkraft beim Wähler überzeugt ist
und dabei die eigene Partei im Rücken hat, lässt
der Wähler sich nicht beeindrucken.
Die Grünen: Kleiner demokratischer Betriebsunfall auf einem ansonsten glanzvoll inszenierten Jubelparteitag
In der Wahl erfolgreiche Parteien haben – das steht mit
ihrem Erfolg ja fest – selbstverständlich alles genau
richtig gemacht. Die Strategie
der Grünen, wie
alle anderen Wahlvereine auch auf die Personen
zu setzen, die das Zeug zum Führen haben, hat sich
bewährt
. Der unglaublich geniale Einfall hat sich
für sie ausgezahlt, den beliebtesten Politiker
in
Deutschland, den sie zufällig in ihren eigenen Reihen
haben, zu dem Argument auszubauen, weswegen man
grün wählen soll, und im Übrigen darauf zu vertrauen,
dass auch bei dessen Kollegen die erfolgreiche Teilhabe
an der Macht einfach die beste Werbung für eine
Verlängerung des rot-grünen Mandats ist. Das hat
geklappt, das Führungsteam um Joschka
hat der
grünen Partei zu unverhofften Prozentzahlen verholfen,
und solches gehört sich gebührend gefeiert: Der
Akklamation der Parteiführung durch den Wähler soll eine
nicht minder glanzvolle durch die eigene Parteibasis
folgen, und dazu bittet die Führung zum Parteitag. Auf
dem läuft alles wie geschmiert. Das Regierungsprogramm
wird abgesegnet. Auf dem kleinen Symbol grünen
Regierungserfolgs – der Abschaltung des Alt-Reaktors
Obrigheim – wird nicht bestanden. Schließlich geht es um
das hohe Gut weiterer grüner Regierungsbeteiligung,
welche den Atomausstieg
allein sichern kann. Die
Stimmung ist heiter und gelassen. Man lässt sich durch
den kleinen Obrigheim-‚Schatten auf dem
Koalitionsvertrag‘, der ansonsten mit seinen Einigungen
über Sozialeinsparungen, Steuererhöhungen,
Kapitalförderung, Bundeswehr-Ordnungsmissionen usw. nur
eitel Sonnenschein verbreitet, nicht behelligen – und
dann passiert doch noch etwas nicht Vorhergesehenes. Die
beiden Vorsitzenden der Partei möchten in ihrem Laden
nämlich auch noch an einer formalistischen Nebenfront für
modernen Schliff sorgen, wollen sich endlich so, wie dies
in den anderen Wahlvereinen längst üblich ist, als
Leitfiguren ihres Parteivolks auch an der für die
Entscheidung der politischen Machtfragen entscheidenden
Stelle profilieren können, also jede Beschränkung bei der
‚Bündelung‘ entscheidender Führungsfunktionen in einer
Hand ganz los werden – und man lässt sie nicht. Es ist
ein Scherz: Eine Partei, die sich geschlossen hinter
ihren Führern formiert hat; die sich endlich zu der
Einsicht durchgerungen hat, dass der Frieden nur mit
Kriegen, die liebe Umwelt unter den gegebenen Umständen
nur mit Kernenergie zu sichern ist, und die am liebsten
gleich nur noch mit Joschka wählen!
für sich
wirbt, will von dem Statut nicht lassen, wonach bei ihr
eine Trennung von Amt und Mandat
vorgesehen ist.
Ein Haufen, der astrein als Ermächtigungsmaschinerie
seines Führungspersonals funktioniert, und alles
durchwinkt, was er an politischer Beschlussfassung
absegnen soll, möchte doch noch ein wenig an dem Symbol
festhalten, mit dem die Partei in ihrer Gründerzeit den
Schein institutionalisiert hatte, es wäre sie,
die ihren Spitzenleuten beim Regieren die Richtlinien der
Politik eingibt, diese in letzter Instanz kontrolliert
und so dafür sorgt, dass Grüne auch an der Macht
ehrlich-grün-basismäßig-gestützte Überzeugungstäter sind.
Wie gesagt: In jeder Hinsicht überlebt hat sich dieser
formalistische Unsinn schon längst und eine Mehrheit in
dieser Partei sieht dies auch genau so. Eine
Sperrminorität
aber fürs Erste nicht.
Traditionsgrüne
wie das personifizierte grüne
Nein-zum-Krieg-Symbol Ströbele halten dagegen, dass
die Parteispitze eine eigenständige Auffassung vertreten
können (muss). Parteivorsitzende, die auch Abgeordnete
sind, können weniger gut eine abweichende Meinung
vertreten, als wenn sie unabhängig sind
(SZ, 22.10.02) – und dafür, dass man mit
einer eigenständigen und sogar abweichenden Meinung den
Regierenden nicht nur die nötige politische
Handlungsfreiheit verschaffen, sondern sich damit auch
noch als besonders glaubwürdiger Apostel für
alles grüne Gute erfolgreich Stimmen an Land ziehen kann,
ist er ja das beste Beispiel. Die Einsicht, dass die
Beteiligung an der Regierungsverantwortung ihre eigenen
Notwendigkeiten mit sich bringt und auf jeden Fall
Richtlinie auch grüner Politik zu sein hat, lässt sich
eben konstruktiv mit der Darstellung guter Absichten der
Partei verbinden, die so gesehen immer noch viel mehr und
viel Besseres vorhat, als dann mit der SPD leider
‚umzusetzen‘ geht. Auf diesen Schein besonderer grüner
Verantwortlichkeit und Skrupelhaftigkeit beim Mitregieren
wollen Leute wie Ströbele nicht verzichten. So wird die
Abstimmung an einer lächerlichen Nebenfront zur
politischen Hauptsache und der Scherz vollends zur
Groteske: Weil es die amtierende, politisch in
nichts beschränkte Führungsmannschaft nicht hinbekommt,
diesen allerletzten Rest einer formellen Distanz zwischen
sich und ihrer Basis wegzuräumen; weil es ihr nicht wie
gewünscht gelingt, den lieben Delegierten mit
überzeugender Zweidrittelmehrheit das Bekenntnis
abzuluchsen, einfach nur weiter so prima wie bisher als
Kanzler- und Joschkawahlverein funktionieren zu wollen –
wird ihr das, man glaubt es kaum, als Schwäche
angelastet! Und dann macht sich auch noch allseitige
Betroffenheit
breit. Aus der Frau
Parteivorsitzenden, die so gerne auch andere daran
teilhaben lässt, wie sehr bei ihr das Herrschen über
fremde Leute zum persönlichen Glücksempfinden geworden
ist, bricht es diesmal umgekehrt heraus – sie weint
Tränen! Echte! Und nicht minder betroffen sind auch noch
ausgerechnet die, die ihr die Gala versaut haben. Auf
keinen Fall wollte
ein Ströbele, was jetzt
eingetreten ist
, dass es nämlich so aussieht, als
wenn wir das wirklich gute Team, diese beiden
Parteivorsitzenden, demontieren
(ebd.). Doch auch wenn die schöne Feier
des guten Teams diesmal ein wenig daneben gegangen ist –
die Basis, durch die Entschlossenheit ihrer Führung, es
bei diesem Ergebnis nicht bewenden zu lassen, belehrt,
wird’s schon wieder richten – und dabei natürlich so
glaubwürdig bleiben wie eh und je. Vielleicht stimmt sie
einfach so oft ab, bis das Ergebnis passt. Vielleicht
stimmt eine Urabstimmung
ab, und dann passt das
Ergebnis. Vielleicht bleibt aber auch die ‚Trennung‘ der
Regelfall, der dann durch jede Ausnahme, welche die Basis
beschließt, aufs Neue bestätigt werden kann. Hauptsache,
der Wähler bekommt auch hier, was er sich bestellt: eine
grüne Parteiführung, die auch noch mit ihrer Partei im
Rücken für die Erledigung der dringenden Staatsaufgaben
überall als Repräsentant präsent ist, wo es im Staat
darauf ankommt, die also durch und durch aus solchen
besteht.