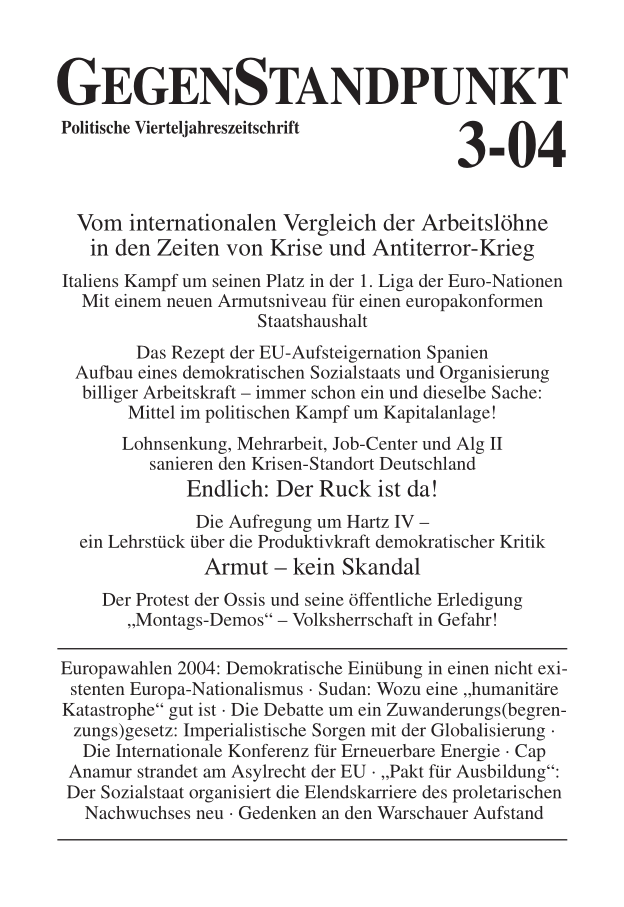Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Deutschland kümmert sich um den Sudan:
Wozu eine „humanitäre Katastrophe“ gut ist
Die Opfer „ethnischer Vertreibungen“ im West-Sudan werden ideell adoptiert und nicht bloß der bekannten deutschen Mildtätigkeit ans Herz gelegt, sondern zum Anlass genommen für flammende Appelle an die ‚internationale Gemeinschaft‘: Die dürfe nicht wie vor 10 Jahren beim Massenmord von Hutus an Tutsis „wegschauen“, sondern müsse einschreiten und mit überlegener Gewalt einen neuen Völkermord verhindern.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Deutschland kümmert sich um den
Sudan:
Wozu eine „humanitäre Katastrophe“
gut ist
Den ganzen Frühsommer über unterhält die deutsche Öffentlichkeit ihr Publikum mit einer ‚humanitären Katastrophe‘ größeren Ausmaßes im West-Sudan: Die mörderischen Auswirkungen eines Aufstands bzw. seiner Niederschlagung durch Militär und Milizen werden umfänglich ins Bild gesetzt und beklagt. Über die Hintergründe der Schlächtereien und Vertreibungen wird auch das eine oder andere bekannt: über Erdöl, das mal wieder eine wichtige Rolle spielt; über ‚ethnische Konflikte‘, in denen es um die Nutzung des Landes geht und die sich mit den umstrittenen Herrschaftsverhältnissen im benachbarten Tschad verquicken; der derzeitige Hauptfeind der Menschheit, der ‚Islamismus‘, soll diesmal nicht von großer Bedeutung sein… Wie dem auch sei, die Opfer werden ideell adoptiert und nicht bloß der bekannten deutschen Mildtätigkeit ans Herz gelegt, sondern zum Anlass genommen für flammende Appelle an die ‚internationale Gemeinschaft‘: Die dürfe nicht wie vor 10 Jahren beim Massenmord von Hutus an Tutsis „wegschauen“, sondern müsse einschreiten und mit überlegener Gewalt einen neuen Völkermord verhindern.
„Wenn es nach den meisten Menschen auf dieser Welt ginge, dann wären längst UNO-Friedenstruppen im Westsudan und würden die Massenvertreibungen, wenn nicht gar den Völkermord verhindern… Und was tut die Bundesregierung?“ (Ulrich Wickert im Tagesthemen-Gespräch mit Heidemarie Wieczorek-Zeul, 20.5.)
Die Bundesregierung ist einer Meinung mit ihrer aufgeregten 4. Gewalt, entsendet den Außenminister nach Khartum zwecks ernstlicher Abmahnung der sudanesischen Regierung, und die so hart befragte Zuständige für Berlins Wirtschaftliche Zusammenarbeit erklärt am 26.5. im Bundestag:
„Wir sind in der Verantwortung, alles zu tun, damit im West-Sudan Menschenleben gerettet werden. Ethnische Vertreibungen werden wir nicht hinnehmen! Die Taktik der verbrannten Erde darf nicht aufgehen! Unser Ziel ist, den Vertriebenen die Wiederkehr in ihr Land zu ermöglichen.“
So viel ist klar: Ein mitfühlender Mensch, dem Elend und
Gemetzel auf der Welt aufs Gemüt schlagen, würde sich
schlicht lächerlich machen mit der Ansage an die
sudanesische Regierung, er wäre nicht länger
bereit, deren Gewaltaktionen hinzunehmen. Auch
der kritische Nachrichtenmoderator, der mit moralischer
Empörung den Weltlauf kommentiert, würde sich blamieren,
wenn er seine Redaktionskonferenz beschließen ließe,
den Vertriebenen die Wiederkehr in ihr Land zu
ermöglichen.
Nicht lächerlich ist die Sache, weil
hier ein Mitglied der Bundesregierung eine
Regierungserklärung abgibt und weil es sich um
die deutsche und nicht um irgendeine Staatsgewalt
handelt, die sich so zu Wort meldet – Politiker aus
inferioren Nationen würden auch nicht besonders ernst
genommen, wenn sie bei sich zu Hause einer fremden
Staatsmacht Null-Toleranz für deren Machenschaften
ankündigen würden. So wie die Berliner Minister für
Außenpolitik und Entwicklungshilfe können nur
Machthaber reden, die erstens fähig und
zweitens gewillt sind, über zwischen- und
innerstaatliche Gewaltaffären auf dem Globus wirksam
Aufsicht zu führen, und denen niemand damit kommen kann,
sie sollten sich gefälligst nicht in die „inneren
Angelegenheiten“ anderer Souveräne „einmischen“. Sich so
mit drastischen Forderungen vor aller Welt aufzubauen,
ist das Privileg der Macht.
Damit ist nun allerdings auch des Weiteren klar: Mit so
einer Regierungserklärung ist nicht einfach ein ehrliches
oder geheucheltes Entsetzen über Gemetzel und Massenelend
am Rande der Sahara auf eine höhere Stufe gehoben.
Die Sache selbst, um die es geht, ist damit eine
ganz andere. Eine Regierung, die sich so praktisch für
die Gewaltverhältnisse in einem anderen Staat
interessiert, zettelt damit eine Machtprobe an;
sie testet die Reichweite ihres Einflusses, ob nämlich
der derart angegangene Staat von ihrem Machtwort
hinreichend beeindruckt ist, so dass er a) überhaupt
reagiert und b) sogar mit Respekt. Das ist dann
auch die Sache, um die es geht: ein Stück
zwischenstaatlicher Bevormundung, den
Gewaltgebrauch der fremden Obrigkeit betreffend. Mit dem
wir
der deutschen Ministerin, ihrem werden wir
nicht hinnehmen
; darf nicht aufgehen
; unser
Ziel ist es
usw., befindet man sich in den Sphären
der Macht und des internationalen Machtvergleichs, des
Kräftemessens, der allergrundsätzlichsten Konkurrenz
der Nationen, in der es eben vor allem um die Frage
geht, wer wen wie sehr zu beeinflussen, wie viel Respekt
eine Staatsgewalt sich bei ihresgleichen zu erringen und
zu erzwingen vermag. Was den moralischen Menschen
erschüttern mag, spielt für diese politische
Hauptsache bestenfalls die Rolle eines Anlasses, ist
Material für die eigentliche politische Materie.
Wenn deutsche Regierungsmitglieder hochtönende Erklärungen in Richtung Khartum vom Stapel lassen, dann geht es also erstens um einen weltpolitischen Machtbeweis. Die Opfer vor Ort sind der Stoff, an dem Deutschland in diesem Fall die Reichweite seines Einflusses und seine Fähigkeit erprobt, den Machthabern im Sudan Respekt abzunötigen. Deswegen muss sich die Chefin der deutschen Entwicklungshilfe auch gar nicht erst erkundigen, ob irgendeine Partei vor Ort überhaupt scharf auf die trostlosen Zustände ist, die sie unbedingt wiederherstellen will; deswegen braucht sie sich keine Gedanken darüber zu machen, mit wie vielen Opfern das Unterfangen verbunden wäre, die längst praktizierte „Taktik der verbrannten Erde“ nachträglich scheitern zu lassen: Berlin präsentiert sich als – über alle Konkurrenten würde man sagen: ‚selbst ernannter‘ – Oberaufseher über die Gewaltverhältnisse in anderen Ländern. Das ist so abstrakt, wie es klingt: Solcherart Abstraktion, die Prinzipienreiterei in Sachen Einfluss, ist die erste Materie der Diplomatie.
Deswegen liegt es auch zweitens
überhaupt nicht an den Opfern in Afrika, sondern in der
Kompetenz der Machthaber in Berlin zu entscheiden,
welche Bedeutung den innersudanesischen
Gewalttätigkeiten eigentlich zukommt. Sie wissen bei
jedem Gemetzel fein säuberlich zu unterscheiden und
völker-rechtsmäßig zu kategorisieren – so auch in diesem
Fall: Handelt es sich um ein „humanitäres Problem“, wie
Khartum behauptet, oder um „ethnische Vertreibung“, um
eine „Säu-berung“, um „Genozid“ oder vielleicht um gar
kein Verbrechen, sondern lediglich – wie ein englisches
Blatt meint – um einen „relatively minor subplot“? Die
Antwort hängt nicht von genaueren Ermittlungen ab;
unterschiedliche Einschätzungen liegen nicht daran, dass
die eine Großmacht mehr Tote und vergewaltigte Frauen
entdeckt hätte als die andere und deswegen ein Eingreifen
für dringlicher hielte. Es ist umgekehrt: Weil die
verschiedenen weltpolitisch interessierten und
engagierten Aufsichtsmächte den Konflikt unterschiedlich
wichtig nehmen, gelangen sie zu unterschiedlichen
„Definitionen“ der Lage. Es zeugt von einem besonders
dringlichen Bedürfnis, den eigenen Eingriffswillen
anzumelden, wenn die deutsche Ministerin definiert:
Dies ist mehr als ein Konflikt. Das ist der
organisierte Versuch, eine Volksgruppe auszulöschen.
Wohingegen der amerikanische Außenminister gar nichts
mehr anmelden muss, sondern sowieso maßgeblich
eingemischt ist, dem Sudan noch eine Bewährungschance
geben will und daher die „Tragödie“ „fast“ genauso sieht
wie die deutsche Kollegin, aber eben nur „fast“: Das
ist fast ein Genozid.
Zu welcher Lagedefinition die zuständigen
weltmächtigen Oberaufseher sich entschließen, das hängt
drittens von noch ganz anderen Dingen ab als dem Grad der
Widerspenstigkeit, den die Regierung in Khartum ihrer
Bevormundung entgegensetzt. Der Sudan ist Teil des
islamischen Krisenbogens
(Außenminister Fischer), der von
Nordafrika über den Nahen Osten bis nach Afghanistan
reicht; von dem gehen Gefahren ganz eigener Art aus. Er
bedroht zwar nicht gerade die Flüchtlinge in Darfur,
dafür aber Staaten, die im „Krieg gegen den Terror“
engagiert sind. Von dieser Warte aus betrachtet, muss man
sich fragen, ob man den Sudan nicht in eine
Antiterror-Allianz einbauen sollte, in dem Fall ist
Nachsicht beim Umgang mit dem „verbrecherischen Regime“
geboten. Hat sich der Sudan nicht von einem Herbergsvater
für Bin Laden zu einem Mitstreiter im Kampf gegen Al
Kaida gewandelt? Und wenn Amerikas große
Anti-Terror-Kampagne den Irak als Petroleumquelle bis auf
Weiteres unbrauchbar macht und so wichtige Ölförderländer
wie Saudi-Arabien destabilisiert, wird der Sudan dann
nicht vielleicht zu einem wichtigen Mosaikstein in der zu
schaffenden Stabilitätszone? Zumal sich dort interessante
Ölquellen befinden, die unter dem Gesichtspunkt der
Versorgungssicherheit
als alternative Bezugsquelle
zum Mittleren Osten
für das hohe Gut namens „unsere
Ölversorgung“ dienlich sein können (SZ, 20.2.). Damit sie dienlich werden,
muss man den Sudan vielleicht sogar ein wenig umwerben?
Andererseits ist Rücksichtnahme insoweit ganz
unangebracht, wie konkurrierende Wirtschaftsmächte mit
dem Sudan bereits im Geschäft sind und „unsere“
Geschäftsaussichten ganz ungebührlich einschränken. Ein
kritisches Augenmerk richtet sich hier vor allem auf den
neuen „global player“ China, der mit seinem allzu
erfolgreich aufstrebenden Kapitalismus gar nicht bloß
nützlich, sondern als Konkurrent gefährlich ist, außerdem
„unsern“ Ölmarkt leer kauft und sich angeblich schon die
Öl-Claims im Südwesten des Sudan gesichert hat – ohne
Genehmigung aus Berlin! Das alles will jedenfalls mit
bedacht sein, wenn man die Schlächtereien dort als
„Völkermord“ oder anders einstuft. Und das alles ist auch
mit einkalkuliert, wenn Außenminister Fischer in aller
Öffentlichkeit bedauert, dass die Regierung in Khartum
keine Angst vor Sanktionen
hat, und zugleich
hofft
, dass der riesige Sudan nicht an seinen
Konflikten zerbricht
(Der
Spiegel, 29/04).
Die Nutzenabwägungen eines politischen Engagements sind
also einigermaßen komplex und werden
viertens schon gar nicht einfacher, wenn
man sie ins Verhältnis zum Aufwand setzt, den
„wir uns“ leisten wollen, um die sudanesische Regierung
gegebenenfalls gewaltsam zur Willfährigkeit zu
zwingen. Eigene Soldaten schicken, das wäre
eine hochgefährliche Operation. Wir können das nicht
leisten
(Ch. Schmidt von der
CSU) – gedacht wird an eine solche „Option“ also
durchaus. Aber wenn die Bundeswehr schon mit der
Verteidigung der deutschen Freiheit im Kosovo und am
Hindukusch ausgelastet ist: Kann man nicht vielleicht
intervenieren und zugleich die Lasten der Intervention
billig halten oder gleich auf andere abwälzen? Ist dem
Kontrollanspruch eventuell mit Beobachtern
hinreichend Genüge getan? Falls zu deren Schutz dann doch
Truppen nötig sind: Kann man dafür nicht die Afrikanische
Union mit ihren Soldaten einspannen und so erstens
Personal, zweitens Geld sparen und drittens erreichen,
dass auch diese Staaten auf deutsch-europäisches Kommando
hören? Können „wir“ den dafür nötigen finanziellen
Aufwand nicht gleich der EU aufhalsen und die
afrikanische Friedensfazilität der EU
anzapfen?
Zusammengefasst: „Unser“ Kontrollanspruch soll
respektiert werden – aber möglichst zum Null-Tarif.
Besondere Schwierigkeiten einer „humanitären Mission“
ergeben sich also daraus, dass Deutschland sich mit
anderen Nationen darum streiten muss, wer die Lasten zu
tragen hat und wer federführend in der Angelegenheit ist.
Das führt fünftens direkt zum Verhältnis
zur Führungsmacht USA, die so etwas wie ein Monopol auf
Federführung für sich in Anspruch nimmt. Die
Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul kann daher gar
nicht an die „humanitäre Katastrophe“ in Afrika denken,
ohne zugleich an Amerika zu denken: Die Amerikaner
sind mit den entsetzlichen Folgen ihres Kriegs im Irak
beschäftigt. Sie konzentrieren sich darauf und es darf
nicht wieder passieren, dass alle Augen auf andere
Konflikte gerichtet werden und Afrika vergessen wird.
Natürlich befürchtet man in Berlin überhaupt nicht, dass
die Regierung in Washington Afrika vergessen
könnte; im Gegenteil. Dass Amerika immer und überall
seine Regelungskompetenz geltend macht, schon gleich da,
wo in irgendwie interessanten Weltgegenden in größerem
Stil Gewalt zur Korrektur politischer Verhältnisse
angewandt wird, das ist überhaupt der praktische
Ausgangspunkt aller deutschen Einmischungsinitiativen.
Überall stößt ja der Versuch, eigenen Einfluss zu
entfalten, auf die USA, und an allen Ecken und Enden
stellt sich die Grundsatzfrage, wie man sich zu deren
Ordnungsmacht ins Verhältnis setzen soll: mehr
konkurrierend oder mehr unterstützend; mehr schmarotzend
oder mehr alternativ… Was die deutsche Regierung im Sudan
afrikapolitisch plant, ist von vornherein
durchkalkuliert im Hinblick auf die Rolle, die sie sich
innerhalb und komplementär zu der Weltordnungspolitik der
USA erobern will.
Wie halten „wir“ es sechstens last but
not least mit der UNO? Womöglich ist das Elend im Sudan
ja eine günstige Gelegenheit, sich in eine Führungsrolle
in diesem Verein zu hieven, indem Deutschland – in
wohltuendem Kontrast zu den Amis, die die UNO immer nur
für ihre Anliegen instrumentalisieren wollen – als
Unterstützer eines grandiosen Vorschlags auftritt, den
die UNO, in Gestalt ihres Chefs, selber propagiert: Kofi
Annan kennt seine Vereinten Nationen, weiß, dass Massaker
zur Tagesordnung gehören, will daher der Welt –
anlässlich des 10. Jahrestags des Völkermords in Ruanda –
ein Frühwarnsystem
spendieren und den Sudan zum
ersten Fall für den neuen Sonderbeauftragten zur
Verhinderung von Völkermord
machen. Wenn Deutschland
sich vorbildlich hinter diese Initiative stellt, beweist
dies nicht, dass es in Zukunft in der UNO weiter vorn
stehen muss, also Deutschlands Eignung für einen Sitz
im Sicherheitsrat
(Der Spiegel,
29/04)? So kommen die drangsalierten Sudanesen
schließlich auch noch zu der Ehre, der deutschen
Regierung als Anlass für eine innerimperialistische
Konkurrenzaffäre zu dienen, die auf der höchsten Ebene
der internationalen Diplomatie abgeklärt werden muss:
Staatsministerin Kerstin Müller reist nach New York und
erwirkt nach langen und mühsamen Verhandlungen
im
Sicherheitsrat eine Presidential Declaration, die eine
unverkennbar deutsche Handschrift
trägt.
*
Von wegen also: Es passiert nix!
Das alles
„passiert“. Den Wickerts der Nation macht das jedoch
wenig Eindruck. Denen ist das alles zu wenig: Sie
vermissen Gewalt gegen ‚das Böse‘ in der Welt.
Offenbar ist ihnen die Ideologie zu Kopf gestiegen, mit
der die NATO seit einem Jahrzehnt ihre Kriegspolitik
rechtfertigt und der sie sich, natürlich immer kritisch,
vollinhaltlich angeschlossen haben: Bei der Einmischung
in die Bürgerkriege zur Zerlegung des einstigen
Jugoslawien und speziell im Kampf gegen die Belgrader
Regierung zur Sicherung der Oberhoheit über die
innereuropäischen Machtverhältnisse wäre es um nichts als
internationale Verbrechensbekämpfung und darum gegangen,
Moslems und Kosovaren vor „Gräueltaten“ zu schützen.
Jetzt nehmen die Moralisten des gerechten Kriegs ihre
Politiker beim Wort und verlangen nach der Devise ‚Wer A
sagt, muss auch B sagen‘ die Fortsetzung dieser edlen
Mission im Sudan; andernfalls könnten sie ihnen den
Vorwurf der Pflichtvergessenheit nicht ersparen.
Mit diesem kritischen Blick auf die Sudan-Politik der Regierenden in Berlin und anderswo stellt die nationale Öffentlichkeit sich einerseits entschieden ignorant zur Logik der Berechnungen, denen das Interesse der Berliner Machthaber an den Vertriebenen von Darfur folgt. Äußerst parteilich und durchaus realitätstüchtig stellt sie sich dafür andererseits zum letzten und obersten abstrakten Zweck, den Deutschland tatsächlich mit seiner Einmischung in die sudanesischen Gewaltverhältnisse verfolgt: Die Welt braucht mehr deutschen Imperialismus. Die Moralisten, die dem Imperialismus der Nation vorauseilend sein gutes Gewissen verschaffen, gibt es schon.