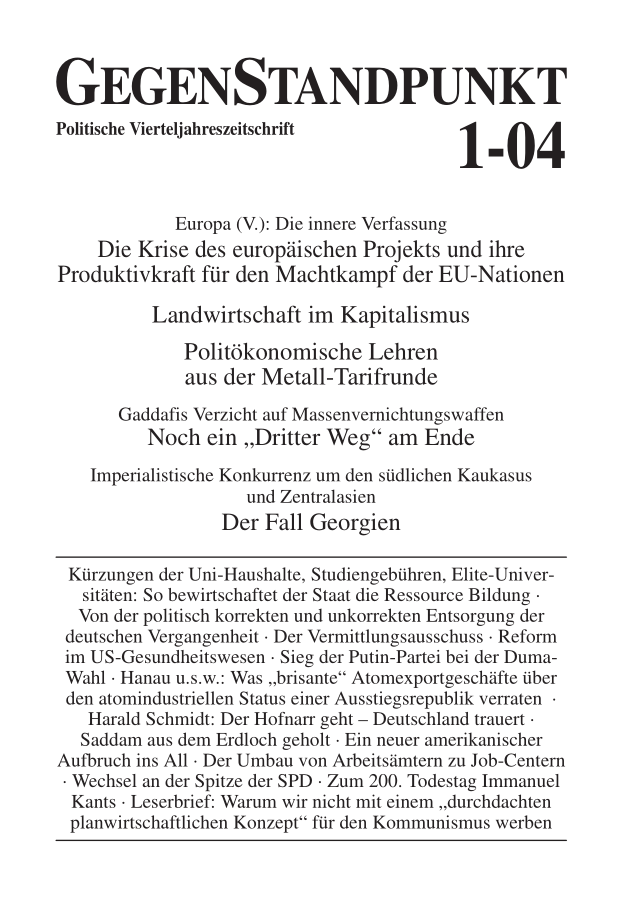Neue Sitten in den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie:
„Ein Schluck aus der Pulle“ – diesmal für die Arbeitgeber
Für die Sanierung ihrer Gewinnrechnungen verlangen die Arbeitgeber unbezahlte Mehrarbeit und die Aufkündigung des Flächentarifs zugunsten betrieblicher Regelungen. Ersteres gesteht ihnen die IG Metall zu, wenn sie auf letzteres verzichten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Die neue Frontstellung: ‚Diesmal sind die Arbeitgeber dran!‘
- 2. Eine politökonomische Richtigstellung zum Kalkül mit dem „Preis der Arbeit“: Unbezahlte Mehrarbeit – das bringt’s!
- 3. Die „Logik“ des kapitalistischen Kampfes gegen den Lohn: Schwaches Geschäft – starke Verhandlungsposition, und je schlimmer die Folgen für die Lohnabhängigen, desto abhängiger
- 4. Wozu „die Konkurrenz“ ihre Veranstalter „zwingt“: Noch ein paar Wahrheiten über das Erfolgsgeheimnis einer modernen Metallwarenproduktion
- 5. Der Abwehrkampf der IG Metall und sein Erfolg: Die Gewerkschaft verwaltet eine Lohngerechtigkeit neuen Typs
Neue Sitten in den
Tarifverhandlungen der Metall- und
Elektroindustrie:
„Ein Schluck aus der Pulle“ – diesmal
für die Arbeitgeber
1. Die neue Frontstellung: ‚Diesmal sind die Arbeitgeber dran!‘
‚Tarifrunden‘ gibt es, bislang hierzulande jährlich wiederkehrend, weil die lohnabhängigen Arbeitnehmer sonst unter die Räder kommen. Ganz ohne den Umstand neuer Vereinbarungen organisieren nämlich die Arbeitgeber fortwährend an den Arbeitsabläufen in ihren Betrieben herum, schaffen gewohnte Tätigkeiten ab und neue Aufgaben an, verfolgen damit, in der Regel höchst erfolgreich, das Ziel, die Leistung ihrer Arbeitskräfte zu steigern, was denen ebenso regelmäßig gar nicht gut bekommt, und kämen von sich aus nie auf die Idee, dafür durch ein erhöhtes Entgelt wenigstens so etwas wie einen Ausgleich zu schaffen. Das jeweils festgelegte Entgelt zeigt im Gegenteil, auch dies ohne dass darüber erst verhandelt und ein Kompromiss geschlossen werden müsste, realiter sinkende Tendenz; in dem Maße nämlich, in dem die Unternehmerschaft der Nation es schafft, mit ihrer Preiskonkurrenz eine in öffentlicher Verantwortung geschaffene Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft so auszunutzen, dass für die verehrten Endverbraucher, also vor allem die Leute mit einem Arbeitslohn als einziger Einkommensquelle, eine allgemeine Teuerung dabei herauskommt. Zu diesem Effekt melden die systemeigenen Gewerkschaften traditionell in größeren Abständen Korrekturwünsche an: Sie beantragen eine Aufstockung der Löhne, nennen dafür eine Prozentzahl, die aus den beiden höflichen Parametern „Anteil am Produktivitätszuwachs“ und „Inflationsausgleich“ zusammengesetzt ist und eine „Umverteilungskomponente“ enthält, die hauptsächlich dazu da ist, in den Tarifverhandlungen gestrichen zu werden. Denn regelmäßig erklärt der Arbeitgeberverband die aufgestellte Forderung für unerträglich und setzt ihr ein Niedrig-Angebot entgegen, das dann die Gewerkschaft für eine Frechheit hält. Man einigt sich am Ende auf eine Zahl in der Nähe des arithmetischen Mittels und schafft damit die Grundlage dafür, dass es alsbald die nächste Korrektur-Runde geben muss; so hat eine Arbeitnehmervertretung, die an der fatalen Abhängigkeit der vertretenen Arbeitnehmer nichts ändern will, dauerhaft zu tun. Zum Dank für ihr systemkonformes Verhalten erntet die Gewerkschaft schlechte Noten: Die Öffentlichkeit nimmt die erste Forderung der Gewerkschaft entweder wider besseres Wissen in voller Höhe ernst und ist über die unheilbare „ökonomische Unvernunft“ der Funktionäre mal wieder entsetzt, oder sie gibt sich angeödet, spricht von einem „Ritual“, das man auch mal sein lassen könnte, und nimmt auf die Art gegen den Antrag der Gewerkschaft auf nachträglichen Lastenausgleich Partei – um dann, wenn genau das herausgekommen, nämlich die Prozentzahl auf ihr wirtschaftsverträgliches Maß reduziert worden ist, perfide den Spieß umzudrehen, die Gewerkschaft zu fragen, warum sie für ein so mageres Ergebnis überhaupt einen solchen Zirkus veranstaltet, und sich die Frage gleich selbst zu beantworten: Mal wieder ein Fall von „Verbandsegoismus“ unter „Betonköpfen“.
Dieses Jahr läuft das alles gründlich anders. Die IG Metall verfährt zwar wie immer, fordert 4% mehr und peilt damit ein Ergebnis um die 2% an; die Öffentlichkeit reagiert auch wie immer, mit dem konditionierten Reflex eines empörten Aufschreis; und was die reine nominelle Geldforderung betrifft, spielt auch die Arbeitgeberseite ihre gewohnte Rolle, bietet erst einmal gar nichts, dann 1,5%. Am Ende steht eine 2 vor dem Komma, und das sogar gleich zweimal: Die Tarifrunde 2005 wird gleich mit erledigt, der nominelle Lohnausgleich auch da auf 2% begrenzt; zusätzliche Promille werden für die Aufhebung des überkommenen Unterschieds zwischen Angestellten-Gehältern und Arbeiterlöhnen verrechnet. Das alles ist diesmal jedoch der erklärtermaßen weniger wichtige, eher unwesentliche Teil der Tarifrunde. Im Jahr 6 der Schröder-Republik legen die Metall-Arbeitgeber einmal eigene Forderungen auf den Tisch. Die öffentlichen Arbeitgeber haben es schließlich vorgemacht, mit gesetzlichen Gehaltseinbußen für Beamte und der tarifvertraglich ausgemachten Streichung von „Sonderzahlungen“ an Arbeiter und Angestellte. In der Metall-Branche geht man gleich gründlich zur Sache: Unter dem Titel „Flexibilisierung“, der seit ein paar Jahren alle möglichen Schweinereien im Umgang mit Arbeitskräften adelt, verlangen die Unternehmer von der Gewerkschaft die vertraglich anerkannte Freiheit, in ihren Betrieben wieder bis zu 40 Stunden arbeiten zu lassen, dafür nicht bloß keine Überstunden-Zuschläge, sondern weniger bis überhaupt nichts zu zahlen und dies ohne störende „Einmischung von außen“, am Tarifvertragspartner vorbei, mit ihren Betriebsräten auszumachen, von deren leichter Erpressbarkeit sie ausgehen und von der jeder weiß. Zur Begründung kopieren die Wortführer von Gesamtmetall die Manier der Gewerkschaften, auf hingenommene Einbußen der letzten Zeit zu verweisen und eine gerechte Kompensation zu beantragen: Sie tun so, als hätten in den letzten Jahren ihre Arbeitnehmer ihnen die Haare vom Kopf gefressen und als müssten ihre stolzen Unternehmen an „Auszehrung“ zu Grunde gehen, wenn nicht endlich mal die Kapitalisten mit ihrem bisschen Profit in der Tarifrunde „an die Reihe kommen“:
„Wir müssen den Auszehrungsprozess stoppen und dürfen deshalb den Verteilungsspielraum nicht vollständig für Einkommenserhöhungen ausschöpfen.“ (Pressemitteilung Gesamtmetall, 12.12.03)
Eine gewisse interessierte Einseitigkeit ist da schwer zu übersehen, auch wenn Gesamtmetall-Chef Kannegiesser so vornehm daherredet, als müssten sich die Aktionäre und Unternehmensvorstände mit ihren, im Unterschied zum arbeitenden Fußvolk tatsächlich eingetretenen „Einkommenserhöhungen“ gleich mit betroffen fühlen. In ihrer Dreistigkeit hat die Forderung aber auch ein Gutes: Ein gewisser Aufklärungswert ist ihr nicht abzusprechen.
2. Eine politökonomische Richtigstellung zum Kalkül mit dem „Preis der Arbeit“: Unbezahlte Mehrarbeit – das bringt’s!
„‚Wenn Sie mir erlauben‘, sagte mir ein sehr respektabler Fabrikherr, ‚täglich nur 10 Minuten Überzeit arbeiten zu lassen, stecken Sie jährlich 1000 Pf. St. in meine Tasche‘.“ (Englischer Fabrikinspektor 1856, zit. in: Karl Marx, Das Kapital, Bd. I. S.257)
Wenn der so verständnisheischend beschworene
„Auszehrungsprozess“ in den Unternehmensbilanzen
der Metall-Industrie durch bis zu fünf zusätzliche, am
besten gar nicht bezahlte Arbeitsstunden pro Woche
umgekehrt werden soll und kann, dann zehren
diese
Bilanzen offenbar davon, dass ein kapitalistisches
Unternehmen überhaupt nicht die Arbeit bezahlt,
die es einsetzt, nämlich den Arbeitern den Wert auszahlt,
den sie schaffen. Die Differenz macht die
Unternehmer reich: der Unterschied zwischen dem Geld, das
die Arbeit als „Kostenfaktor“ kostet, und der Summe, die
sie als „Produktionsfaktor“ erzeugt. Dabei ist es
freilich gar nicht so, dass kapitalistische Arbeitgeber
bis zu irgendeiner soundsovielten Arbeitsstunde alles
bezahlen und anschließend den Ertrag sich selber in die
Tasche stecken würden; so als wäre der Profit, um den es
ihnen geht, bloß die Summe, die sie ihren Arbeitskräften
eigentlich zahlen müssten, aber dann doch systematisch
vorenthalten. Mit ihrer Forderung, ihre Bilanzen dadurch
wieder ins Lot zu bringen, dass sie sich die Früchte der
36. bis 40. Wochenarbeitsstunde unentgeltlich aneignen
dürfen, tun die Gesamtmetaller zwar so, als bestünde ihr
Profit tatsächlich darin, dass sie etliche Stunden extra
arbeiten lassen, ohne dafür zu zahlen – im Vergleich zu
dem im Motto zitierten Knallkopf haben sie anscheinend
nur eins dazugelernt: den eigenen unverschämten
Bereicherungswillen als schiere Notlage vorzutragen. In
diesem Sinne fordern sie unbezahlte Mehrarbeit wie eine
Art Nothilfe ein, die die Arbeitnehmer nur ausnahmsweise
leisten sollten; als Ausnahme nämlich von der Regel, dass
im Prinzip natürlich jedes Quantum Arbeit ganz korrekt
mit dem Betrag entlohnt würde, den das Unternehmen damit
erwirtschaftet. Doch wäre das die Wahrheit, dann wäre
wirklich nicht ersichtlich, wovon ein Unternehmen sich
normalerweise ernährt, wenn ihm seine Belegschaft gerade
mal nicht mit einem Sonderopfer unter die Arme greift,
sondern alle Arbeitsstunden ordentlich bezahlt werden.
Umgekehrt ist jedem mitdenkenden Menschen natürlich völlig klar, dass die unbezahlten Extra-Arbeitsstunden, die Gesamtmetall jetzt genehmigt haben will, keine womöglich bloß zeitweilige Ausnahme bleiben. Sie sollen und werden in den normalen und alltäglichen Geschäftsbetrieb der Metall-Unternehmen eingehen und zu deren Vorteil das Verhältnis korrigieren, das überhaupt den kapitalistischen Reichtum begründet und mehrt. Insofern gibt die Forderung von Gesamtmetall in ihrer unverschämten Direktheit einen bemerkenswert deutlichen Hinweis auf die politökonomische Regel: Kapitalistische Unternehmen bereichern sich grundsätzlich und im Allgemeinen nicht durch die eine oder andere unbezahlte Extra-Arbeitsstunde; sie „zehren“ davon, dass sie überhaupt nicht die Arbeit „entgelten“, die sie verrichten lassen, sondern mit dem Lohn einem Menschen die Verfügung über seine Arbeitskraft abkaufen und über die dann selber zweckmäßig verfügen. An ihren Produktionsmitteln, nach ihren Vorgaben, was die Art der Arbeit, die Leistungsdichte, das Tempo der Produktion und alle anderen Bedingungen betrifft, und am liebsten immer genau so lange, wie es ihrem aktuellen Bedarf entspricht, lassen sie das Personal, das sie bezahlen, Waren schaffen, die ihnen gehören und in Gestalt des Geldes, das „am Markt“ damit zu verdienen ist, ihren Reichtum mehren. Der weggezahlte Lohn gehört zu den Unkosten, die sie für diesen schönen Effekt aufwenden müssen; seine Höhe hat mit dem Erlös aus der produzierten Ware nur insofern etwas zu tun, als sie sich daneben – nach Abzug aller sonstigen Unkosten – lächerlich geringfügig ausnehmen muss, weil sonst das Unternehmen sofort unter „Auszehrung“ leidet. Ansonsten ist die Lohnhöhe, ebenso wie die Zeitschranke des damit erkauften Verfügungsrechts über fremde Arbeitskraft, Verhandlungssache: in der BRD heute das Resultat von Jahrzehnten „sozialpartnerschaftlicher Tarifpolitik“, auch in dieser höflichen Form aber nichts anderes als das Ergebnis eines erpresserischen Kräftemessens zwischen frei kalkulierenden Unternehmern und ihren Lohnabhängigen.
Wenn beides dann mal fixiert ist, Lohnhöhe und Arbeitszeit, dann rechnen die kaufmännisch versierten Manager des Unternehmens den weggezahlten Lohn freilich anteilig aufs Produkt herunter und beziehen die Lohnstückkosten als wichtige Bestimmungsgröße in ihre Kalkulation eines „kostendeckenden“, also möglichst viel Profit bringenden Verkaufspreises ein. Das heißt aber eben noch lange nicht, dass der Lohn dann auch nichts anderes wäre als der Betrag, den die Arbeitskraft in Gestalt ihrer Lohnstückkosten zum Verkaufswert der Ware beisteuern würde: Auch in dieser verwandelten Gestalt bleibt das Arbeitsentgelt der Hebel, um mit dem produzierten Gut und dessen durchkalkuliertem Preis das Unternehmen reicher zu machen. Die Stückkostenrechnung nimmt davon nichts weg, sondern schreibt im Gegenteil genau dieses Verhältnis – Lohn als möglichst verschwindende Größe neben dem erwirtschafteten Erlös und als Hebel für die Erwirtschaftung von Überschuss – für jede Arbeitsstunde und in modernen Betrieben bis auf die einzelne Arbeitssekunde herunter fest; die Berechnung und Auszahlung des Lohns nach Stunden oder Leistung stellt sicher, dass die Arbeitskraft auch wirklich konsequent und ausschließlich nur fürs Arbeiten bezahlt wird und nicht für eine Minute Müßiggang.
In der Tarifrunde dieses Jahres geht es den
Metall-Arbeitgebern nun also um eine durchgreifende
„Korrektur“ eben dieses Verhältnisses zwischen
Lohnaufwand und Arbeitsertrag zu ihren Gunsten: Schlicht
mehr von dem, was Marx als kapitalistische
Ausbeutung
auf den Begriff gebracht hat, wollen
sie sich von den Gewerkschaften genehmigen lassen. Dafür
gehen sie in die Offensive.
3. Die „Logik“ des kapitalistischen Kampfes gegen den Lohn: Schwaches Geschäft – starke Verhandlungsposition, und je schlimmer die Folgen für die Lohnabhängigen, desto abhängiger
Ganz offensichtlich fühlen die Metall-Arbeitgeber sich
enorm stark. Das tun sie aus einem denkbar
perversen Grund: Sie geben sich ganz furchtbar
schwach. Sie bejammern die Ertragsschwäche ihrer
Betriebe – Auszehrungsprozess
! –; in
vorauseilendem Selbstmitleid malen sie drohende Pleiten,
ersatzweise den Gang ins Exil jenseits der Grenzen des
Tarifvertragsgebiets an die Wand. Dem Gejammer fügen sie
eine harte Selbstbezichtigung hinzu: Lauthals erinnern
sie selber an Hunderttausende, die sie um ihrer
Unternehmensbilanzen willen entlassen – „abgebaut“ –
haben; sie stellen weitere hunderttausend Entlassungen in
Aussicht, wenn man ihnen nicht zu gründlich verbesserten
Gewinn-Bilanzen verhilft. Sie geben also offen zu, dass
sie mit ihrer Art, arbeiten zu lassen, ihre Arbeitskräfte
schädigen – so oder so, durch völligen Einkommensverlust
oder mit verschärfter Inanspruchnahme bei abgesenktem
Lohn; sie bestehen in aller Öffentlichkeit darauf, dass
der Nutzen, den sie aus ihren Arbeitskräften herausholen,
mit einem allgemeinen Wohlstand unverträglich ist und die
Gesellschaft insgesamt ’reinreißt, wenn er mal nicht groß
genug für ihre hohen Ansprüche ausfällt. Und siehe da:
Schlagartig wird aus der behaupteten Schwäche ihrer
Geschäftemacherei und deren verheerenden Folgen eine
unschlagbare Stärke im Kräftemessen mit der IG Metall.
Niemand macht den Arbeitgebern zum Vorwurf, dass ihre
Profit-Produktion ein Desaster für die Leute ist, die
darauf angewiesen sind, sich in ihren Fabriken zu plagen,
und erst recht für die, die sich dort noch nicht einmal
mehr abplagen dürfen. Niemand kommt auf den nahe
liegenden Gedanken, dass es ein katastrophaler Fehler
ist, wenn eine Gesellschaft die Existenzsicherheit der
großen Masse ihrer Mitglieder vom Kalkül und der
Geschäftspraxis einer freien Unternehmerschaft abhängig
macht. Nicht bloß der parteiliche Sachverstand der
Unternehmer und ihrer Profit-Manager zieht den
entgegengesetzten Schluss: Alle Welt, die Weisen und
Gelehrten im Lande und die politische Führung der Nation
an der Spitze, aber auch das geschädigte Fußvolk selbst,
sieht in den verheerenden Folgen des kapitalistischen
Geschäftsgangs ein unwiderlegliches Argument dafür, um so
mehr auf eben diesen Geschäftsgang zu setzen, ihn zu
pflegen und zu fördern, den Ansprüchen seiner
Veranstalter in allen Punkten zu Diensten zu sein. Je
mehr sich die Abhängigkeit des ganzen Ladens vom Wachstum
des kapitalistischen Vermögens und der Zufriedenheit
seiner Besitzer als Schadensfall für die Mehrheit
erweist, um so weniger ist an eine Kündigung dieser
Abhängigkeit „von unten“ zu denken, vielmehr eine extra
beflissene, am besten vorauseilende Unterwürfigkeit
geboten. Wer als lohnabhängige Arbeitskraft unterwegs
ist, mit seinem Lebensunterhalt zum stets zu teuren
„Kostenfaktor“ degradiert und mit seiner Physis und
seiner Lebenszeit als „Produktionsfaktor“ ausgenutzt, der
wird geradezu darauf hingewiesen, wie schlecht er in
dieser Eigenschaft derzeit bedient ist; denn daran soll
er ablesen und sich zu Herzen nehmen, wie schlecht sich
erst seine Dienstherren durch ihn bedient finden, und
dass es höchste Zeit für ihn wird, auf Zeit oder Geld
oder am besten auf beides zu verzichten, um
denen besser zu taugen. In diesem Sinne geht
Gesamtmetall in der Tarifrunde 2004 auf die Gewerkschaft
los: 40-Stunden-Woche, „Lohnausgleich“ im Ermessen des
Betriebs, keine „Einmischung von außen“!
4. Wozu „die Konkurrenz“ ihre Veranstalter „zwingt“: Noch ein paar Wahrheiten über das Erfolgsgeheimnis einer modernen Metallwarenproduktion
Für ihren dreisten Übergang von den Folgen ihrer freien Marktwirtschaft, die sie voll auf ihre lohnabhängigen Arbeitskräfte abwälzen, zu um so härteren Ansprüchen führen die Gesamtmetall-Funktionäre – dasselbe noch einmal in umgekehrter Richtung – ihre Ohnmacht ins Feld. Die schlechte Konjunktur, die hart umkämpften Märkte, die Konkurrenz aus der restlichen Welt – nicht zuletzt die, die sie unter Ausnutzung von Standortvorteilen in der nächsten Nachbarschaft sich selber am heimischen Standort machen: das alles lässt ihnen keine Wahl, ist vielmehr ein unumstößlicher Sachzwang, mehr Arbeit fürs Geld zu verlangen. Sieht man einmal ab von der albernen Attitüde ausgewachsener Firmenchefs, sich als arme Opfer der Konkurrenz hinzustellen, die sie selber machen, dann sind diesem Gejammer doch auch ein paar sachdienliche Hinweise auf die politökonomische Natur der Mittel zu entnehmen, die im Konkurrenzkampf kapitalistischer Firmen zum Einsatz gelangen, und einige Auskünfte über die Eigenarten des Reichtums, dessen Vermehrung tatkräftige Unternehmer sich wechselseitig so schwer machen.
Dass es um Reichtum in dem schlichten Sinn eines wohltuenden Überflusses an nützlichen, mit möglichst geringem Aufwand hergestellten Gütern nicht geht, ist sowieso klar: Als Reichtum zählt nur der Gelderlös, der sich damit „am Markt“ erzielen lässt. Dafür langt es aber nicht – den „Sachzwang“ setzen die Unternehmer mit ihrer Konkurrenz tatsächlich in Kraft –, überhaupt brauchbare Ware feilzuhalten. Was aus der Produktion herauskommt, muss einen Preisvergleich bestehen; es muss sich als ökonomische Waffe in einem Konkurrenzkampf ums Geld der Kundschaft bewähren, bei dem es in letzter Instanz auf erfolgreiches Unterbieten ankommt. Um mehr Geld zu verdienen, wenden kapitalistische Unternehmen das paradoxe Mittel an, fürs einzelne Produkt – vergleichsweise – weniger Geld zu verlangen. Damit dieses widersprüchliche Kalkül aufgeht, werfen sie sich alle auf das Kampfmittel, über das sie „hausintern“ frei verfügen. Sie stürzen sich auf den Produktionsprozess und scheuen keinen Aufwand, um die Arbeit, die sie ihre Belegschaft verrichten lassen, so einzurichten, dass die Ergebnisse für ihren Preiskampf taugen. Das entscheidende Mittel hierfür ist die Steigerung der Produktivität der eingesetzten Arbeit: Wenn pro Stück immer weniger Arbeit verausgabt wird, aus jeder Arbeitsstunde mehr verkäufliches Produkt herauskommt, dann lässt sich die einzelne Ware billiger verkaufen, ohne dass der Gelderlös sinkt; er steigt sogar ganz erheblich, wenn die Firma auf die Art zusätzliche Marktanteile erobert und von der effektiver gemachten Arbeit größere Mengen einsetzen kann.
Dieses Ergebnis verdient mehr Beachtung, als der marktwirtschaftlich verdorbene „gesunde Menschenverstand“ ihm zu schenken pflegt. Es ist nämlich so paradox wie das Marktproblem, das für den erfolgreichen Konkurrenten damit gelöst wird, an dem dafür die weniger erfolgreichen scheitern: Je schneller und leichter eine Ware produziert wird, um so weniger ist sie wert, um so weniger Reichtum in seiner gesellschaftlich gültigen Form des damit zu erlösenden Geldes stellt sie dar. Mit jedem produktionstechnischen Fortschritt wird die Sache immer absurder, das Ergebnis jedoch immer unerbittlicher festgehalten: Die Arbeit kürzt sich tendenziell aus dem Produktionsprozess heraus; aber was an Arbeit gespart wird, soll den Warenwert senken, zwecks Stärkung der Konkurrenzposition des Produzenten, und senkt insoweit auch wirklich den Zuwachs an Reichtum, der mit dem Verkauf der einzelnen Ware in Geldform in die Unternehmensbilanzen eingeht. Der Reichtum, auf den es den kapitalistischen Warenproduzenten ankommt, hat sein Maß in der Arbeitsmenge, die für seine Produktion draufgeht – und die gleichzeitig fortwährend verringert wird, nur damit die konkurrierende Firma mehr von diesem Reichtum für sich ergattern kann. Insgesamt zählt die Ersparnis an Arbeitsmühe nicht als Zuwachs, sondern als Minderung des Wohlstands der Gesellschaft.
Den Nachteil dieses absurden Effekts haben selbstverständlich nicht die kapitalistischen Unternehmer zu tragen, die sich auf diese Weise ja bereichern – und auch nicht die unterlegenen Konkurrenten, die ihre Firma aufkaufen lassen oder rechtzeitig in Konkurs gehen. Die Verteilung des Schadens, der aus dieser Sorte produktionstechnischen Fortschritts folgt, regelt sich wie von selbst zu Lasten derjenigen, auf die die verbleibende Mühsal des Arbeitens entfällt. Nämlich dadurch, dass der konkurrenztüchtige Unternehmer vom verringerten Gelderlös pro Ware einen um so größeren Teil für sich behält, einen um so geringeren Anteil an Lohn wegzahlt; was sich ganz automatisch daraus ergibt, dass für seine Kalkulation die Menge Arbeit, an der er spart, indem er sie produktiver macht, vollständig zusammenfällt mit der Lohnsumme, die er dafür zahlen muss. Auf die wird geschaut, wenn der Produktionsprozess reorganisiert und mit neuen kostspieligen Arbeitsmitteln bestückt wird: Die Arbeitsproduktivität hat ihr kapitalistisches Maß in den Lohnstückkosten; deren Senkung ist das selbstverständliche Kriterium jedes technischen Fortschritts, den ein konkurrenztüchtiges Firmen-Management in seinen Betrieb einführt. So kommt es, wie es kommen soll: Das Unternehmen verdient an der verbilligten Ware besser; dafür kürzt sich, wie die Arbeit aus dem Produktionsprozess, der Kostenfaktor Arbeit, also der Lebensunterhalt der Arbeitskräfte aus der Firmenbilanz tendenziell heraus. Denen, deren Arbeit noch benötigt wird, bleibt die Mühsal voll erhalten oder steigt sogar, ohne dass sie sich dafür mehr kaufen könnten; diejenigen, die nichts mehr zu tun haben, verlieren ihr Einkommen und damit jeden Anteil am produzierten Warenberg.
So funktioniert also das Erfolgsgeheimnis kapitalistischer Unternehmungen; und damit erklären sich einige Absurditäten, die den in den marktwirtschaftlichen Verhältnissen befangenen Menschenverstand immer wieder vor Rätsel stellen. Zum Beispiel die, dass Arbeitsplätze in der Tarifrunde dieses Jahres mal wieder eine so widersprüchliche Rolle spielen, nämlich von allen Seiten gefordert und versprochen, von den Arbeitgebern aber, die das Monopol darauf haben und auch unbedingt behalten sollen, in ziemlich großer Stückzahl „abgebaut“ werden: Ein Arbeitsplatz in der kapitalistischen Produktion ist ein widersprüchliches Ding, weil die Arbeit selbst widersprüchlich bestimmt ist. Sie ist Quelle und Maß des kapitalistischen Reichtums; und aus genau diesem Grund ist zugleich die Minderung des für einen Produktionsprozess notwendigen Arbeitsquantums die entscheidende Waffe in der Konkurrenz um die Aneignung von Gelderlösen. Von ihr kann also gleichzeitig gar nicht genug eingespart – und von der dann doch notwendigen gar nicht genug verausgabt werden. Den Widersinn kriegen die Arbeitskräfte in der Form zu spüren, dass sie einen Arbeitsplatz noch viel nötiger brauchen als ihr Arbeitgeber, weil ihr Lebensunterhalt vollständig davon abhängt, ohne dass sie darüber etwas zu bestimmen hätten, weder über die Art der zu erbringenden Leistung noch über den Bedarf an ihrem Arbeitseinsatz überhaupt; sie müssen unbedingt daran interessiert sein, die Arbeitsmühe zu übernehmen, die ihren Arbeitgeber reich macht, und zwar nach der perfiden Logik des Stunden- bzw. Leistungslohns möglichst viel davon; und sie sind damit konfrontiert, dass ihnen in jedem Job das Schicksal blüht, überflüssig gemacht zu werden. Dabei sind sie umzingelt von lauter ideellen und praktizierenden Anwälten der Arbeitersache, die sich für nichts anderes als dieses aufgenötigte verkehrte Interesse an Arbeit stark machen – also im Namen der Opfer dieser Verrücktheit das Prinzip verteidigen, dass die Reduzierung der notwendigen Arbeitsmühen die benötigten Arbeitskräfte auspowert und die anderen verelendet.
Über die „Verteilungsspielräume“, die der Sprecher von Gesamtmetall für „Einkommenssteigerungen“ verplempert sieht, wo sie doch den Unternehmen als Kraftnahrung gegen Auszehrung helfen sollten, und über das Elend der Ertragsschwäche, das die Metall-Unternehmer so beredt bejammern, dass man ihnen fast eine sozialistische Revolution als Ausweg empfehlen möchte, ist damit auch schon alles gesagt. Wenn Kannegiesser das Geld meint, das konkurrenztüchtige Unternehmen mit produktiver gemachter Arbeit, also mit billiger gemachter Ware zusätzlich verdienen, dann ist über dessen „Verteilung“ bereits entschieden, noch bevor die Ware überhaupt am Markt ist. Denn der Verbilligung geht eine „Rationalisierung“ voraus: eine Effektivierung der Arbeit, die den Preis senkt, der für die noch erforderliche Arbeit zu zahlen ist; eine Effektivierung also, die voll zu Lasten der Arbeitskräfte geht, die bestenfalls für gleich bleibenden Lohn mehr schaffen, im schlechteren Fall die eingesparten Arbeitsstunden verkörpern, also ins Arbeitslosenelend abwandern. Wenn jemand diese Erfolgsrechnung durchkreuzt, dann ist es – jedenfalls in einem so ordentlichen Land wie der Bundesrepublik des Jahres 2004 – nie und nimmer die unersättliche Belegschaft, sondern die Konkurrenz, die womöglich noch erfolgreicher ihre hausinterne Ausbeutungsrate gesteigert hat und mit entsprechend überlegenen Waffen den Preiskampf bestreitet. Und wenn tatsächlich die ganze Branche unter einer „ausgezehrten“ Rendite leidet und eine „Krise“ durchmacht, dann darf sie getrost auch diesen – allemal höchst relativen – Nachteil der Art und Weise zuschreiben, wie sie ihren Vorteil sucht und findet: An einer Tendenz zur Ertragsschwäche, soweit die sich wirklich bemerkbar macht, registrieren auch mal die Konkurrenzgewinner gewisse Auswirkungen des Widersinns, dass sie mit den aufwändigen Methoden ihres Kampfes um die Aneignung des Geldes, das es „am Markt“ zu verdienen gibt, die Quelle dessen reduzieren, was in ihrer kapitalistischen Gesellschaft überhaupt als Reichtum zählt.
Doch wie man sieht, wissen die Metall-Arbeitgeber selbst auf diese Lage eine passende Antwort, auch wenn sie den wirklichen Grund dieser Lage ganz sicher nicht wissen, sondern nur über den bedingten Reflex verfügen, auf den Reiz „zu wenig Geld verdient“ mit der Forderung „mehr Arbeit für weniger Lohn“ zu reagieren; für ein astreines kapitalistisches Erfolgs-Management langt das allemal. Nicht als ob sie es leid wären, mit perfektioniertem Produktionsgerät Arbeitskosten wegzurationalisieren und sich an der Größe zu bereichern, die Marx seinerzeit als „relativen Mehrwert“ bestimmt hat. Aber wenn ihnen das – derzeit oder sowieso – immer noch nicht langt, dann können sie sich zusätzlich auch für die andere Methode begeistern, ganz einfach länger arbeiten zu lassen, ohne mehr dafür zu bezahlen; dafür brauchen sie schon gar nicht die Anmerkungen ihres alten Kritikers zum „absoluten Mehrwert“ zu studieren. In diesem Sinne drehen sie in der Tarifrunde 2004 den Spieß einmal um, stellen den kompensatorischen Sinn und Zweck dieses Verhandlungs-„Rituals“ auf den Kopf und konfrontieren zur Abwechslung mal die Gewerkschaft mit der Forderung nach Zugeständnissen in Sachen Lohn und Arbeitszeit.
5. Der Abwehrkampf der IG Metall und sein Erfolg: Die Gewerkschaft verwaltet eine Lohngerechtigkeit neuen Typs
Mit ihrem Ansinnen stoßen die Metall-Arbeitgeber auf den erbitterten Widerstand der Gewerkschaft. Die sieht sich gleich mehrfach herausgefordert – was ja auch die Absicht von Gesamtmetall ist: Die Lizenz für die Unternehmer, mit ihren Betriebsräten freihändig bis zu 40 Stunden pro Arbeitswoche mit oder ohne „Lohnausgleich“ auszuhandeln, wäre gleichbedeutend mit der Preisgabe ihrer Verhandlungsmacht, der Anfang vom Ende ihrer Position als Tarifvertragspartei; die 40-Stunden-Woche selbst und der Verzicht auf ein entsprechendes Entgelt wären a) eine „Rolle rückwärts“ in die Zeiten vor dem großen Kampf um die „35“, b) ein Verstoß gegen den heiligen Grundsatz der gerechten Entlohnung – „gutes Geld für gute Arbeit“ oder so ähnlich –, c) alles andere als ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, im Gegenteil eine Gefahr für den Fortbestand von – nach gewerkschaftlicher Rechnung – 400.000 Arbeitsplätzen. Die Auseinandersetzung wird hart geführt; mit Streikdrohungen und Warnstreiks, die die besorgte Nation wieder einmal um sich als Kapitalstandort fürchten lassen. Am Ende steht eine „überraschend schnell“ zu Stande gekommene Vereinbarung, mit der die IG Metall ihre Tarifhoheit wahrt und dafür den Arbeitgebern in allen anderen Fragen, bei deren materiellen Ansprüchen, gerne entgegenkommt.
So besteht die Gewerkschaft in der Frage der Arbeitsplätze nicht stur auf ihrer Vorstellung von einem großen Topf, aus dem das Lebensmittel Arbeit an alle Bedürftigen gerecht ausgeteilt werden sollte. Den Schwindel, dass die Einrichtung von Arbeitsplätzen sich irgendwie an den Interessen der Lohnabhängigen zu orientieren hätte, vertritt sie gegenüber ihren Leuten, die sich auch nach noch so vielen entgegengesetzten Erfahrungen nichts anderes denken, als dass ihre Lohnabhängigkeit, wenn es schon ihre einzige Einkommensquelle ist, dann auch eine einigermaßen taugliche sein müsste, und bestärkt sie in diesem Fehler. Im Umgang mit den Arbeitgebern dagegen legt sie mehr von dem an den Tag, was in einer perfekten Marktwirtschaft „ökonomische Vernunft“ heißt, erkennt die Kriterien der Gegenseite vorbehaltlos an und trifft mit der eine „Vereinbarung“ mit dem erklärten
„Ziel…, am Standort Deutschland bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dies verlangt den Erhalt und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen. Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zu diesen Zielen und zu ihrer Aufgabe, den Rahmen für mehr Beschäftigung in Deutschland zu gestalten.“
Diese ‚Rahmengestaltung‘ sieht im Groben folgendermaßen aus – Näheres regeln zwei „Anlagen“ zu der „Vereinbarung“ –:
„Ist es unter Abwägung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen erforderlich, durch abweichende Tarifregelung eine nachhaltige Verbesserung der Beschäftigungsentwicklung zu sichern, so werden die Tarifvertragsparteien nach gemeinsamer Prüfung mit den Betriebsparteien ergänzende Tarifregelungen vereinbaren oder es wird einvernehmlich befristet von tariflichen Mindeststandards abgewichen (z.B. Kürzung von Sonderzahlungen, Stundung von Ansprüchen, Erhöhung oder Absenkung der Arbeitszeit mit oder ohne vollen Lohnausgleich…).“
Arbeitsplätze sind für die Gewerkschaft ein höchstes Gut; dafür, dass vielleicht welche nicht abgeschafft werden, müssen da schon ein paar überkommene Vorstellungen von Lohngerechtigkeit geopfert werden. Die Lüge, mit dem Arbeitsentgelt würden der Arbeitskraft ihre Leistung ganz gerecht und jede Arbeitsstunde Stück für Stück entgolten, so dass auf ihrer Seite im Prinzip keine Ansprüche mehr offen bleiben – dieser Schwindel, an dem die Gewerkschaften seit jeher ihre Lohnkämpfe ausrichten, muss auch mal zurückstehen, wenn die ganze Republik sich einig ist, dass „die Lage auf dem Arbeitsmarkt“ es schlicht verbietet, bei einer Arbeit überhaupt danach zu fragen, wie lange sie dauern und was dafür bezahlt werden soll. Es langt, wenn die Arbeitgeber nicht bloß ihren Betriebsrat vorher informieren, sondern auch ihren Tarifvertragspartner vorher fragen, wenn sie von „tariflichen Mindeststandards“ abzuweichen gedenken:
„Die Betriebsparteien prüfen, ob die Maßnahmen im Rahmen der geltenden Bestimmungen ausgeschöpft sind, um Beschäftigung zu sichern und zu fördern. Die Tarifvertragsparteien beraten auf deren Wunsch die Betriebsparteien, welche Möglichkeiten hierzu im Rahmen der Tarifverträge bestehen.“
Dass im Prinzip von ihr aus immer alle Möglichkeiten bestehen, Arbeiter länger arbeiten zu lassen und schlechter zu bezahlen als im Tarifvertrag vorgesehen, das wird die IG Metall nicht müde zu betonen und mit Verweis auf unzählige Ausnahmeregelungen, für die sie sich noch allemal hergegeben hat, zu beglaubigen. Das einzige, worauf sie unerbittlich besteht, ist ihre Verhandlungsvollmacht – und sogar da findet sie sich bereit,
„nach 3 Jahren … die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit zwischen den Tarifparteien und den Betriebsparteien auszuwerten“ und gemeinsam mit den Arbeitgebern „darüber zu entscheiden, ob die Balance zwischen den Entscheidungsmöglichkeiten der Tarif/Betriebsparteien in Richtung mehr Entscheidungskompetenz der betrieblichen Ebene zu verändern ist.“
Ohne die IG Metall geht einstweilen aber nichts; und das kommt für den BDA-Präsidenten Hundt schon einer schweren Niederlage gleich:
„Die von Wirtschaft und Politik angestrebte neue Balance zwischen Flächentarifverträgen und betrieblichen Regelungen sei nicht erreicht worden. Das ist ‚zu wenig und nicht mit den von uns vorgeschlagenen Instrumenten‘, rügte Hundt.“ (FAZ, 14.2.)
Dafür geht mit der IG Metall alles; das hat die Gewerkschaft zugesagt, und das versprechen die Arbeitgeber auch voll auszureizen:
„Hundt sprach gleichwohl von einem ‚bemerkenswerten Ansatz‘, da eine Erhöhung oder Senkung der Wochenarbeitszeit mit oder ohne vollen Lohnausgleich künftig nicht nur in Härtefällen, sondern auch zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Investitionsbedingungen“ – im Klartext also: immer – „ermöglicht werden soll. ‚Das war nicht unser Vorschlag für rein betriebliche Regelungen, aber wir werden die IG Metall jetzt beim unterzeichneten Wort nehmen, und es muß sich erweisen, inwieweit diese Zielsetzung in den Betrieben umgesetzt wird.‘“ (ebd.)
Am Ende werden die Arbeitgeber total unzufrieden sein; das steht jetzt schon fest. Das schmälert aber nicht die Leistung, mit der die IG Metall sich in der Tarifrunde dieses Jahres um den reformerischen Fortschritt der Schröder-Republik und ihres Berliner Kapitalismus verdient gemacht hat. Faktisch räumt sie den Unternehmern die Freiheit ein, nach Bedarf des Hauses und ohne Zwang zu entsprechender Bezahlung die Arbeitszeiten ihrer Belegschaft zu verlängern; unter dem Titel „Flexibilisierung“ gibt sie ihnen in Sachen „absoluter Mehrwert“ fast genauso freie Hand, wie sie das bei der Erwirtschaftung des „relativen Mehrwerts“, der permanenten „Rationalisierung“ des Produktionsprozesses, schon immer getan hat. Dabei lässt sie auf ihr Vertretungsmonopol für Arbeitnehmerinteressen im Allgemeinen nichts kommen – und genau so leistet sie ihren wesentlichen Dienst am bundesdeutschen Gemeinwesen: Auf oberster Ebene und allgemeinverbindlich für ihre Klientel organisiert sie, was auf unterer Ebene und „vor Ort“ den Betriebsräten überlassen bleibt, nämlich die Ohnmacht der Lohnabhängigen, deren alternativlose Abhängigkeit von allen kapitalistischen Rechnungen. Sie vermittelt den Druck, den die Arbeitslosigkeit ja keineswegs ganz von selbst auf die Löhne und die Lebensbedingungen der Arbeitnehmerschaft ausübt, macht ihn überhaupt erst praktisch wirksam, indem sie ihn als Leitfaden für ihre tariflichen Vereinbarungen anerkennt. Dass sie dabei formell immer noch als Widerpart der Arbeitgeber agiert und ihre Zugeständnisse wie Beschränkungen der unternehmerischen Freiheit daherkommen, ist für die Vereinsleitung einerseits ihrer Basis gegenüber schon ihre ganze Legitimation als unersetzliche Interessenvertretung und auch schon ihre ganze Überzeugungsarbeit; andererseits ist es ein ewiger Stachel, sich der nationalen Öffentlichkeit, die das gewerkschaftliche Treiben genau deswegen skeptisch bis feindselig beäugt, um so nachdrücklicher als unentbehrlicher Garant des ökonomisch Vernünftigen zu empfehlen. Und das muss man ihr lassen: Die Lüge vom kapitalistischen Arbeit-Geben als einzigem Heilmittel für alle sozialen Übel, die daraus folgen, im Namen der Opfer zu beglaubigen und zu bekräftigen – das bringt wirklich niemand so gut wie sie.