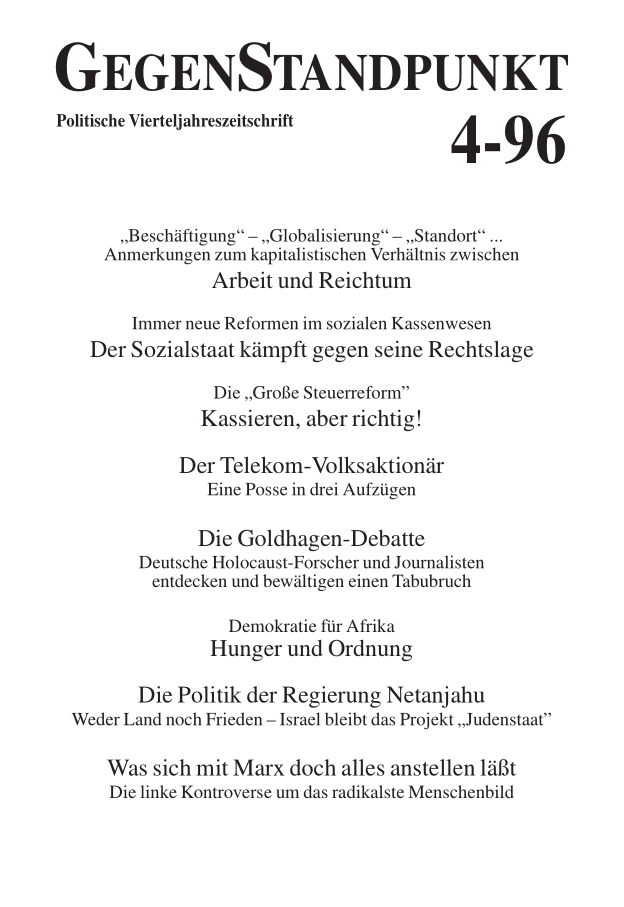Eine Posse in drei Aufzügen
Der Telekom-Volksaktionär
Zur Verwandlung einer staatlich bereitgestellten Dienstleistung in ein privates Geschäft wird der Spargroschen des lohnabhängigen Bürgers eingesammelt. Zum wirklichen Spekulieren fehlt dem Volksaktionär das Geld, sein Spargroschen ist die Basis für die Spekulation anderer, die dann auch den Ertrag der Kleinbeträge bzw. den Verlust definiert.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Vorspiel:Der Staat gründet die Telekom AG
- 1. Aufzug: „Let’s go public!“ – Die Entdeckung der Aktie als alternatives Volkssparmodell
- 2. Aufzug: „Eine breite Streuung des Aktienkapitals“ – Die notwendige Pflege und Hege wildgewordener Schnäppchenjäger am Aktienmarkt
- 3. Aufzug: Hokus, Pokus, Fidibus – „28,50!“
Eine Posse in drei Aufzügen
Der Telekom-Volksaktionär
Mitwirkende:
Staat: Geschäftsgründer, ursprünglicher und auf Dauer unverzichtbarer Vertrauensstifter bei der Umstellung einer Gebühreneinzugszentrale auf Gewinnerwirtschaftung.
Telekom: AG, zieht Telefongebühren ein, lebt nach dem Willen ihres Gründungsvaters vom Gleichheitszeichen zwischen Schulden und Kapital, braucht daher immer mehr Vertrauen.
Volk: Einzeln betrachtet ewige Habenichtse, die hohe Telefongebühren zahlen, zusammengenommen aber überraschend vermögend sind; dazu noch ahnungslos, also für Vertrauenswerbung wie geschaffen.
Ferner helfen bei der Vertrauensbildung mit: Banken, Schauspieler und Gaukler aus allen öffentlich-rechtlichen Abteilungen.
Vorspiel:Der Staat gründet die Telekom AG
Der Staat und nicht das Vertrauen ist der Anfang von allem. Mit der Privatisierung
einer seiner Funktionen – Bereitstellung und Unterhalt eines flächendeckenden Telefonwesens – schafft er das Rechtssubjekt einer AG. Die soll wie eines der unter dieser Bezeichnung bekannten industriellen Großunternehmen nach allen Regeln der Wirtschaftlichkeit operieren, also ihre Dienstleistungen mit Gewinn verkaufen. Damit sie dies vermag, verwandelt der Gründer Staat seinen sachlichen Besitz und die Gelder, die er beim Betrieb seines Postwesens ausgibt und einnimmt, in Aktiv- und Passiv-Posten einer Bilanz und setzt eine Unternehmensführung mit dem furchtbar komplizierten Auftrag ins Amt, übers Jahr gesehen möglichst mehr einzunehmen als auszugeben. Wie in jedem kapitalistischen Betrieb rechnen sich über die Einstellung in diese Rechnung alles sachliche Vermögen, alle Lohn- und Gehaltszahlungen und alle sonstigen Einnahmen und Ausgaben zu Größen eines Kapitalwerts und zu Faktoren von dessen Wachstum zusammen – wobei es bei einer AG nur überhaupt nicht darauf ankommt, daß es ihr Kapital ist, das sie geschäftsmäßig zu mehren sucht. Das Bestechende an dieser Unternehmensform ist gerade umgekehrt die Trennung zwischen dem Eigentum und der Funktion seiner Mehrung, die mit ihr institutionalisiert ist: Das Kapital, mit dem sie wirtschaftet, sind regelmäßig Schulden, die sie von Geldbesitzern mit dem Versprechen der Möglichkeit einsammelt, anteilig an einem möglichen Geschäftserfolg teilzuhaben.
Dieses aus der produktiv tätigen Abteilung der kapitalistischen Gesellschaft bekannte Verfahren, zur Mehrung von Wucht und Schlagkraft gegen die Konkurrenz das eigene Kapital durch die Mobilisierung von Kredit zu vergrößern, hat auch für einen Staat, der sich verschuldet, um einen unproduktiven Dienstleistungsbetrieb zu unterhalten, offenbar seine Reize. Es gestattet ihm nämlich, einen Teil der Schulden, die er gegenüber seiner Gesellschaft hat, zu privatisieren
. Er gründet eine AG, um mit ihr die Geldmittel, die er zur Finanzierung seines alten Post- und Fernmeldewesens von den Geldbesitzern seiner Gesellschaft als Postanleihen
u. dergl. ausgeliehen hatte, in einen Posten einer unternehmerischen Kapitalbilanz zu verwandeln, und legt darüber den wirtschaftlichen Generalzweck dieses Unternehmens darauf fest, seine Schulden zu bedienen: Ein ansehnlicher Teil von dessen Geschäftserfolgen ist für ihn, nunmehr Gläubiger der AG, reserviert.
Daß die Proportion, in der sich bei der von ihm gegründeten AG die wie immer eingesammelten Telefongebühren zur Summe von Schulden, Schuldendiensten und fälligen Neuverschuldungen des Betriebs verhalten, einigermaßen kurios ausfällt; daß darüber die gewohnten Maßstäbe, die an eine seriöse
Geschäftsgründung angelegt werden, ein wenig ad absurdum geführt werden; daß der Staat mit seiner Finanzkraft nicht nur beim Akt der Gründung, sondern auch bei jeder Geschäftstätigkeit der Firma als Dauerbetreuer von seinem privatwirtschaftlichen Geschöpf gar nicht wegzudenken ist – das alles tut dem Erfolg dieser Privatisierung
keinen Abbruch. Wo der Staat, der politische Schöpfer und Herr des gesamten Kreditwesens, Gläubiger ist, genießt das wirtschaftliche Wesen, das er in die Konkurrenz entläßt, einen ganz besonderen Vertrauensschutz und ist einer Prüfung entlang der gestrengen Kriterien von Solidität
gründlich enthoben, die ansonsten für seinesgleichen gelten. Es macht daher nichts, daß hier eine AG das Licht der Welt erblickt, die in einem Umfang verschuldet ist, wie man es sonst nur von Staaten selbst kennt: In letzter Instanz ist ja als Garantie dieser Schulden – und damit des Schuldners selbst – hier nicht wie sonst maßgeblich, ob erwirtschaftete Erlöse die Lasten eines Schuldendienstes tragen, sondern der Staat selbst ist diese Garantie und ersetzt mit ihr alle Nachfragen in Sachen Wirtschaftlichkeit.
*
So färbt das solide Vertrauen, das der deutsche Staat in Kreditfragen genießt, auch auf das ab, was seiner AG schon bei ihrer Gründung als Perspektive ihrer wirtschaftlichen Zukunft gleich mit auf den Weg gegeben wird. Daß das Mittel, mit dem die AG als global player
die Konkurrenz um die weltweit mit Telefonen, Funk- und Kabelnetzen zu verdienenden Gelder für sich entscheiden soll, schon wieder Schulden sein werden, die sie sich in zwei großen Börsengängen
von der Gesellschaft einzusammeln hat, stimmt niemanden groß bedenklich. Auch da scheint das Vertrauen, das der Staat genießt, ganz von selbst den Kredit zu stiften, den sein Unternehmen braucht.
1. Aufzug: „Let’s go public!“ – Die Entdeckung der Aktie als alternatives Volkssparmodell
So selbstverständlich der Staat bei seinem Geschöpf davon ausgeht, daß die Beschaffung von mehr Kredit der Hebel ist, sich von seinen Schulden zu entlasten – der Erfolg bei dem ehrenwerten Bemühen, sich für ein wirtschaftliches Unternehmen bei Besitzern von Geldvermögen diesen Kredit zu verschaffen, ist an eine kleine, aber entscheidende Bedingung geknüpft. Wer soviel Geld hat, daß er es verleihen kann, tut dies nur, wenn die Geldsumme, die er verleiht, vergrößert zu ihm zurückfließt. Wie und wodurch genau sie vergrößert wird, ist für ihn ganz und gar unwichtig, weil sein Interesse sich rein auf den Witz des Kapitalismus, die Vergrößerung einer Geldsumme, kapriziert. So hat sich jeder, der sich Geld leihen will, vertragsgemäß dazu zu verpflichten, den Anspruch zu bedienen, den der Besitzer der Leihsumme auf deren Vergrößerung hat, und die Beschaffung von Kredit ist daher für gewöhnlich das Geschäft zwischen denen, die vom Verleihen ihres Geldvermögens leben, auf der einen und denen, die gleichfalls Eigentum haben, aber zu dessen Mehrung mehr Geld brauchen, auf der anderen Seite.
Anders bei der Kreditbeschaffung der Telekom. Das Publikum
, an das sie sich in der Eigenschaft eines potentiellen Kreditgebers wendet, ist diesmal nicht auf den erlauchten Kreis der Geldkapitalisten der diversen Finanzmärkte
begrenzt. Man will sich nicht allein den Finanzkapitalisten der Börsen zu einem für sie lohnenden Angebot der Kreditvergabe machen, das Gelingen der Kreditbeschaffung nicht allein dem Umstand überantworten, exklusiv für die Klientel der professionellen Geldverschieber ein für lohnend befundenes Angebot zu sein. Die ausschließliche Abhängigkeit von deren Zuspruch wollen die Kreditstrategen der Telekom ein wenig relativieren, das Risiko eines Fehlschlags der Kreditbeschaffung wollen sie reduzieren – indem sie es streuen
und sich mit ihrem Angebot dem sog. breiten Publikum
zuwenden: Der Erfolg bei den Laien im Volk soll dann für alle weltweit verstreuten Spezialisten des Kreditgewerbes wie ein Signal
dafür wirken, daß das Kreditieren sich auch für sie lohnt.
So stellt sich die Telekom den normalen Bürgern
, wie sie gehen und stehen, einmal ganz anders als gewohnt vor: Nicht mehr als der widerliche Monopolist von neulich, der an Gebühren absahnt, was geht, sondern als ein Unternehmen, dem man – so die nicht unabsichtlich geweckte Vorstellung – sein Geld borgen soll, natürlich, um damit ein wenig zu verdienen. Allen Ernstes wird den Kreaturen, die das Leihen von Geld nur als letzten Weg zur vorübergehenden Linderung ihrer praktischen Notlagen kennen und im übrigen so ihre gewissen Ressentiments gegenüber Couponschneidern
und Geldgeiern
hegen, eine Karriere zum Einstieg in die Welt des Finanzkapitals angetragen. Aktien sollen sie kaufen, und damit sie das tun, macht man ihnen den Kauf derselben als eine Abwandlung des Umgangs mit Geld schmackhaft, den sie aus ihren Lebensumständen kennen: Den Kauf einer Aktie sollen sie für ungefähr dasselbe halten wie einen Sparbrief, nur daß eine Aktie eben besser ist, weil viel rentabler und sicher obendrein …[1]
Nun ist eine Aktie keine Sparsumme, die Zinsen heckt. Das Geld, das für sie hinzulegen ist, wird ein für allemal an das Unternehmen weggezahlt; dafür erwirbt der Käufer einen Rechtstitel auf anteilige Teilhabe am Ertrag, der sich aus der produktiven Nutzung des von ihm und anderen eingezahlten Stammkapitals
einfindet – oder nicht, so daß der Ertrag der Firma schon Gegenstand der Spekulation ist; auch bei Erfolg dieser Spekulation begründet der Rechtstitel nicht das Recht auf einen Anteil am Gewinn, der Dividende, so daß auch auf diese spekuliert wird. Der Rechtstitel selbst ist verkäuflich, wobei sich sein Preis aus der spekulativen Hochrechnung der – wirklich gezahlten oder spekulierten, es ist egal – Dividendenerträge auf Basis der durchschnittlichen Verzinsung von Geld ergibt; und zuguterletzt setzen die Subjekte dieses Spekulierens, die auf diese Art und Weise Nennwerte
zu beachtlichen Kurswerten
vervielfachen – kapitalisieren
heißt das im Jargon der Profis –, Richtwerte ihrer zukünftigen Spekulation in die Welt, an deren Überzeugungskraft und Haltbarkeit sie manchmal schon bei Börsenschluß nicht mehr glauben mögen: Im fruchtbaren Zusammenwirken mit allen anderen Daten
, über die sie fürs Spekulieren sonst noch verfügen – von der Geldwertstabilität
bis zur Gesundheit des Präsidenten
reicht da bekanntlich die Palette –, passiert es dann schon, daß Aktien ganz schnell überhaupt nichts mehr wert sind, weil die maßgeblichen Subjekte einfach dem weiteren Vertrauen auf die Haltbarkeit ihrer Spekulationen mißtrauen. …
An einer diesbezüglichen Aufklärung kann einem Unternehmen freilich nicht so recht gelegen sein, das ein Volk dazu stimulieren will, seine Spargroschen herzugeben, um Aktionär des eigenen Ladens zu werden. Dem präsentiert man sich besser mittels einer kunstvollen Vertauschung der Prädikate, die den Erwerb eines bloßen Rechtstitels auf einen möglichen Anteil an einem möglichen Geschäftserfolg als solide Methode in Sachen eigener Geldvermehrung vorstellig macht: Am Geschäftserfolg der Telekom kann kein Zweifel bestehen, weil dort, wo sie geschäftlich wirkt, eine Zukunftsbranche mit hohem Wachstumspotential
vorliegt – das Wachstum in Geldform, das sie gegen ihre Konkurrenz erst erkämpfen muß, hat sie also schon ganz sicher erkämpft, so daß auch das Mitverdienen eines jeden Aktionärs ganz außer Frage steht. Überhaupt ist es bei ihr so, daß alles Geld, das sie den Bürgern abnimmt, umgehend in Wachstum
verwandelt wird, weil sie nämlich ganz dessen bekannt hohen Anforderungen an Innovationsfähigkeit und Finanzierungskraft
gehorcht. Was letztere betrifft, wird sie sich auf einen ruinösen Preiskampf mit ihren Konkurrenten auf keinen Fall einlassen, wobei sie nicht verschweigt, daß sie sich hierzu ganz auf den weiteren staatlichen Schutzdienst an ihrer Monopolstellung verläßt – auch das kommt als wirtschaftliche Erfolgsgarantie des Unternehmens daher, Dividende inklusive. Der Sache nach teilt sie ihren Kunden zwar nur mit, daß die mit ihren reichlichen Gebührenzahlungen wie bisher den Umsatz der Firma positiv saldieren sollen; eröffnet werden aber soll ihnen die bestechende Perspektive, selbst ein wenig am Reibach teilzuhaben, den die Telekom mit ihnen macht – die Aktie, die sie kaufen können und sollen, macht’s möglich. Auch ihren untragbar hohen Personalstand
wird die Telekom unmittelbar in Wachstum
verwandeln. Er wird um ein Viertel reduziert, damit der verbleibende Rest ein höher gestecktes Wachstumsziel
erreicht – was in Sachen Innovationsfähigkeit
, die bekanntlich die Dividenden sichert, keine Wünsche mehr offen läßt. Zwar gehören die derart Umworbenen just selbst zu denen, die hier als Quelle des Wachstums auch der Telekom namhaft gemacht werden – wenn weniger von ihnen mehr Wachstum schaffen sollen, dann schaffen eben sie das Wachstum. Es sind auch dieselben, die die einschlägigen Maßnahmen zur Pflege des Personalstands ausschließlich als Betroffene kennen, als Verlust ihres Arbeitsplatzes und damit ihrer einzigen Verdienstquelle; aber als Aktionär heißt es da eben umzudenken und der Rationalisierung
, die das Wachstum voranbringt, gutes Gelingen zu wünschen: Die Aktie fürs Volk macht’s möglich, daß die von Rationalisierung
Betroffenen glatt noch an dem Geschäftserfolg partizipieren, der sich über ihre Außerdienststellung vermehrt einfindet…
*
Offenbar nicht wenige Volksgenossen, die von den höheren Geldangelegenheiten in aller Regel nur peinlich berührt werden, weil sie Kredit wegen ihrer Not brauchen und dafür Zinsen zahlen müssen, hören – schlau, wie sie sind – genau heraus, was sie hören sollen. Ihr für allfällige Notlagen Zusammengespartes in Aktien zu verwandeln, ist ziemlich einfach, eine sichere Sache und zahlt sich aus. Da macht man irgendwann der Bank eine Überweisung, und schon ist man hineingegangen
, in die Aktien; das bißchen Gebühren für die netten Banker spürt man kaum. Pünktlich zum Ende des Geschäftsjahres kommen die Dividenden aufs Konto; wenn der Kurs
günstig ist oder wenn man überhaupt schnell mal Bares braucht, geht man schon vorher wieder hinaus
, aus den Aktien, und landet prompt mit einem dicken Plus im alten Portfolio; falls man ausreichend eingekauft hat, weil sonst die Bankgebühren den Kursgewinn
doch merklich schmälern. Günstig, günstig, genau betrachtet geradezu ein Schnäppchen; ein kleines Risiko mag es geben, aber wenn er schlau ist, der Analyst
, sich nichts vormachen läßt, kann einfach nichts groß passieren…
2. Aufzug: „Eine breite Streuung des Aktienkapitals“ – Die notwendige Pflege und Hege wildgewordener Schnäppchenjäger am Aktienmarkt
Der Telekom AG ist diese Erwartungshaltung, die sich im Volk regt und im Anwachsen der Bestellziffer ihrer Zettel niederschlägt, nur recht. Die sog. institutionellen Anleger
kann sie im wesentlichen ihren eigenen Spekulationen überlassen, und das tut sie auch, wobei sie zu Recht – so sind die eben – davon ausgeht, daß eine erfolgreiche Vermassung der Spekulation auch noch so ein Datum ist, auf das die Profis des Spekulierens ihrerseits bereits spekulieren…
Allerdings erfordert die börsenungewohnte Klientel, deren Spargroschen man zur Aufstockung des eigenen Kapitals in Beschlag nehmen will, einigen separaten Aufwand. Die geweckte Überzeugung, im Spekulieren mit Aktien als Verfahren zur Mehrung der spärlichen eigenen Mittel goldrichtig zu liegen, ist an sich ja schon gut. Aber daß spekulierende Bürger die Spekulation als Vehikel auffassen, mal eben so einen Schnitt zu machen, kommt überhaupt nicht in Frage – womöglich kaufen die sich in ihrer primitiven Geldgier heute nur in Aktien ein, um gleich danach, am besten schon morgen, den Kursgewinn
zu verjuxen, und wohin fällt dann der Kurs?! Was sagt die Börse zu so einer Massenbasis
ihrer Spekulation?! Und wohin fällt dann erst recht der Kurs?!
Man muß also das Volk auf jeden Fall richtig an die Hand nehmen, und dazu wird zunächst das Angebot, die Aktien, die es kaufen soll, mit einigen Zusätzen ausgestattet, die von den sonstigen Gepflogenheiten ein wenig abweichen. Zinsgarantien sind zwar nach geltendem Aktienrecht verboten, garantierte Dividenden für die ersten beiden Jahre aber offenbar nicht, womit die Verwechslung der Aktie mit einem Sparbuch schon mal einen griffigen Anhaltspunkt hat. Daß die versprochene Dividende nur bekommt, wer die Aktien während der in Frage kommenden Geschäftsjahre nicht verkauft, versteht sich von selbst und leuchtet als Argument, das Depot zu halten
, von selbst ein, vermutlich genauso wie der Umstand, daß man nach gutem Börsenbrauch die ausbezahlte Dividende auch in Gestalt eines Wertverlustes der eigenen Zettel – und zwar in gleicher Höhe – verbuchen darf. Das macht relativ wenig, weil, wenn niemand verkauft, der Kurs danach gleich wieder steigen kann, und überhaupt ist der Zuwachs des Vermögens nicht zu vergessen, der nach drei Jahren in Gestalt von Prämien-Aktien
für alle die winkt, die ihre ersten treu in Besitz gehalten haben. Wieviel und ob überhaupt etwas der stolze Besitz dann noch wert ist, kann freilich keiner sagen, aber was ist schon sicher; jedenfalls spricht einfach alles dafür, ewig der Kleinaktionär der Telekom zu bleiben, der man werden soll.
Überhaupt gibt es ja so viele Argumente, zuversichtlich auf sprudelnden Reichtum zu warten, und den zur Verbreitung dieser Zuversicht fälligen Part, die flächendeckende Volksverarschung zum Wohl von Telekom und für den Finanzplatz Deutschland
überhaupt, erledigt dann vollends die Werbung für das Angebot. Ganz viele von den guten Onkels, die vertrauenserweckend Werther-Bonbons lutschen oder bierernst den letzten Hit aus der Technologie der Zahnbürste vorstellen, sitzen in Chefsesseln, werfen vor laufender Kamera prüfende Blicke in ein Glanzpapier und vermelden dem Publikum, daß die Bilanzen der Telekom einfach in Ordnung sind
. Unausstehliche Frohnaturen unter dreißig sind diesbezüglich mindestens ebenso bedingungslos glaubwürdig. Mit den Händen ein „T“ formend, hüpfen sie durchs Bild, sind immer nur locker und gut drauf – die Zukunft der Telekom ist einfach rosig. Und wenn sie eine Telefonzelle sehen, lachen sie ungezwungen – einfach kraß, diese Aktien, ultrageil, echt. Usw., Tag für Tag. Den Vogel aber schießt eine gesamtdeutsche Nervensäge ab, die sich schon mit dem Rüberbringen
der anheimelnd-menschlichen Aspekte von Rechtsanwälten und Polizisten ihre Meriten verdient hat, im übrigen auch persönlich sehr glaubwürdig ist in den Fragen einer lohnenden Treue zur Nation. Der Mann ist das fleischgewordene nationale Vertrauen für die Telekom überhaupt. Der seift bei Bockwurst und Bier mit Unschuldsmiene und Hemdsärmeln sein Publikum mit den ewiggleichen Sentenzen über die Wahnsinnsgelegenheit eines so einfach anzuzapfenden Goldesels ein, die man sich nur ja nicht durch die Lappen gehen lassen soll. Nebenbei hat er immer auch gleich den fälligen mahnenden Hinweis parat – den man ihm, so ist er einfach, als wertvollen Tip von Spekulant zu Spekulant abnehmen muß –, den Einstieg ins Spekulieren bloß nicht mit einer schnellen Mark zu verwechseln, und so inszeniert er grandios das Ideal des deutschen „T“-Volksaktionärs: Einerseits doofer Schnäppchenjäger, andererseits total schlau und in Treue fest zur deutschen Telekom. …
*
Im Volk wird so allmählich ganz begriffen, daß hier ein Angebot vorliegt, das für die Bedürfnisse von Xaver Löhner einfach wie geschaffen ist. Viele kratzen schon mal einen Teil dessen zusammen, was sie sich angespart haben, manche auch mehr, und lassen sich als potentielle Aktienerwerber vormerken, Kleinanleger haben Vorzugsbedingungen. In den Banken ist man ihnen gegenüber – „trotz des Ansturms“ – ausnehmend zuvorkommend, gerne erteilt man Auskunft, was so alles an Gebühren anfällt. Nur wie teuer genau einen das Sparen mit Aktien kommt, den Preis der heißen Zettel, den man einlegen muß, den weiß man dort auch nicht. Macht nichts, Angebot und Nachfrage, so hört man, regeln das schon, und endlich sind die Kunden König. Sogar die Tendenz der Preisentwicklung
haben sie hier in der Hand. Je emsiger sie spekulieren, desto mehr steigt der Druck nach oben
.
3. Aufzug: Hokus, Pokus, Fidibus – „28,50!“
Es stellt sich also heraus, daß dank der kundigen Anleitung die Deutschen überhaupt kein Volk von Aktienmuffeln
sind, sondern sogar viel mehr von diesen Zetteln haben wollen, auf denen 5,- steht, als angeboten werden. Sie wissen auch schon, daß das, was auf den Zetteln steht, auf keinen Fall der Preis ist, den sie für sie hinblättern müssen. Aber insofern dessen Bestimmung sie nichts angeht, können sie die Kosten des Sparens getrost auf sich zukommen lassen und ganz dem Verstand von Spezialisten vertrauen. Die machen sich an dem schwierigen Problem zu schaffen, das betragsmäßige Ergebnis einer Spekulation möglichst so genial vorweg zu erraten, daß die Spekulation, die mit ihrer festgesetzten Preisziffer losgehen soll, sich tatsächlich auf diese so bezieht, als wäre sie ihr eigenes Werk.
Zur Lösung dieses interessanten Problems, die genau richtige Mitte zwischen Zuviel und Zuwenig zu treffen, gibt es allerdings ein paar trockene Anhaltspunkte, die die Sache vereinfachen: Mit dem Nennbetrag der Aktien und der Anzahl, die plaziert
werden soll, steht die Höhe fest, um die das Stammkapital aufgestockt werden soll, ebenso läßt sich der Gesamtbetrag der Dividende als der an die Einleger
insgesamt auszuzahlende Anteil des Unternehmensgewinns errechnen, der aus dieser Kapitalvermehrung erwachsen soll. Nun sind diese Einleger
, wie eingangs schon gesagt, eben bloß das, was ihr Name bedeutet, Geldbesitzer, die sich ein Anrecht auf möglichen Gewinn kaufen, und in dieser Berechnung werden sie bedient. Es ist ihnen gleichgültig und geht sie auch nichts an, mit welchen produktiven Machenschaften, wie und mit wieviel Kapital das Unternehmen, an dem sie sich mittels ihrer Kreditgewährung bereichern wollen, den Überschuß erwirtschaftet
, an dem sie als Aktionäre dann anteilig partizipieren. Die Hauptsache ist für sie, daß sie den Überschuß erzielen, der in der Gestalt des Zinses dem Besitz von Geldvermögen von selbst zu entwachsen scheint, und diese Hauptsache bestimmt den Preis, den sie für ihre Methode der Bereicherung zu zahlen haben. Ihr Anrechtsschein auf Dividende ist soviel wert, wie es bei herrschendem Marktzins an vorgestelltem, fiktivem Geldvermögen bräuchte, um den Betrag der Dividende als Zinseinkommen einzustreichen, und diese Rechnung, die Kapitalisierung
des Gesamtbetrags der Dividende zu Marktzinsen dividiert durch die Anzahl der Aktien, ergibt im Fall der Telekom dann jenen Korridor
zwischen zwanzig und dreißig Mark pro Aktie im Nennwert von fünf Mark. Aus dem aber gilt es dann mit ganz viel Fingerspitzengefühl den genau richtigen Preis noch zu ermitteln. Diese Sensibilität ist nötig, weil sich da ein paar der Interessen überkreuzen, von deren insgesamt harmonisch geregelter Befriedigung das Gesamtprojekt abhängig ist:
- Je höher der Preis der Aktie festgelegt wird, desto größer ist auch der Gründungsgewinn der AG, der ihr aus dem Verkauf ihrer Aktien zufließt. Ihr unmittelbarer Erlös umfaßt die Summe des fiktiven Geldkapitals, die aus der Kapitalisierung der Dividenden zu Marktzinsen resultiert und die den aktuellen Wert der Aktien darstellt – soviel kosten die Anrechtstitel auf einen Teil des Unternehmensgewinns auf dem Markt der Geldbesitzer. Die Kosten der AG fallen demgegenüber wesentlich kleiner aus. Ein Teil des über den Verkauf der Aktien erhöhten „Stammkapitals“, also die Summe der Aktien zu ihren „Nennwerten“, steht als die rechnerische Bezugsgröße der Dividendenansprüche in der Bilanz des Unternehmens und figuriert als der „Preis“, den seine Kreditierung für es kostet. So nutzt das Unternehmen aus, daß auf seinen zukünftigen Erfolg spekuliert wird, diese Spekulation den Verkaufspreis der Anteilsscheine auf mögliche Teilhabe an diesem Erfolg in die Höhe treibt – und ihm erst darüber die Mittel zufließen, aus und mit denen es seinen Erfolg zu erwirtschaften gedenkt. Daher sucht das Unternehmen seine Aktien so hoch wie möglich zu verkaufen sucht. Unterstützt wird es in diesem Ansinnen von den Konsortialbanken, die den Verkauf der Aktien in ihre bewährten Hände nehmen und sich ihre bescheidenen Dienste stets durch einen Anteil am Gründungsgewinn entgelten lassen.
- Zu hoch darf andererseits der Preis der Aktie auf keinen Fall sein, denn das möchte der Spekulation der Fachleute, die dann auf den „Märkten“ erst losgeht, womöglich den Anreiz geben, nicht mit den Aktien der AG, sondern gegen sie zu spekulieren. Die zusammenaddierten Aktienwerte der AG mögen fiktiv sein, wie sie wollen; sie mögen noch so wenig zu tun haben mit der Masse des Kapitals, die produktiv im Unternehmen zugange ist und dessen Profit erzielt; und selbst dann, wenn überhaupt kein Profit mehr erzielt wird oder die ganze Gründung ohnehin nur Schwindel war: Vom Standpunkt der Besitzer von Geldvermögen aus ist in den Aktienwerten der Wert fixiert, den die betreffende AG für sie und ihr spekulatives Interesse hat. Also hängt das Gelingen der AG-Gründung, der positive Ausgang des Projekts, Schulden als Kapital fungieren zu lassen, ganz davon ab, daß die Geldbesitzer den von ihnen zu entrichtenden Preis für ihren Anteil am Unternehmensgewinn praktisch akzeptieren, sich einleuchten lassen, mit ihm bei ihrer Rechnung auf ihre Kosten zu kommen. Um den Gründungsgewinn einzufahren, ist also dessen vorsorgliche Begrenzung vonnöten und der Preis der Aktie so zu bemessen, daß sie als Angebot in der Konkurrenz um das Geldkapital reüssiert, die konkurrierenden Angebote – Staatsanleihen, andere Aktien anderer AGs mit anderen Dividenden, auf die spekuliert wird, und womit man sonst noch auf Finanzmärkten aus Geld mehr Geld macht – aussticht. Für jenen spekulativen Augenblick zumindest, in dem die Börse mit den neuen Titeln eröffnet wird, aber im Prinzip natürlich auch auf lange Sicht hin. Denn mit einer Entwertung seines fiktiven Aktienkapitals verliert auch das Unternehmen selbst – jene Wertschätzung nämlich, die seine Kreditwürdigkeit betrifft, und dieser Verlust führt dann gegebenenfalls auch zur Entwertung wirklichen Kapitals.
Aber die schlauen Ingenieure von Telekom und dreißig Bankinstituten schaffen es tatsächlich. Sie riskieren angesichts der unglaublich erfolgreichen Nachfrage
sogar noch eine ungeplante Zusatzausgabe von Aktien – und ziehen an einem Sonntag dann den genau richtigen Preis der Aktie aus dem Hut. Zwar ist er etwas höher als manche ihn sich zusammenspekuliert haben. Vielleicht ist er auch zu hoch, wie andere mit festem Blick auf seine mögliche Weiterentwicklung
meinen. Aber in jedem Fall ist er der richtige, was er dadurch unter Beweis stellt, daß er pünktlich zur Börseneröffnung steigt. So genial geht Kapitalismus, auch wenn der Preis gleich danach wieder fällt.
*
Die vielen neuen deutschen Volksaktionäre haben also auch alles richtig gemacht. Zwar haben sie den Übergang zum Geldkapitalisten, der mit Spekulieren und sonst nichts seinen Lebensunterhalt bestreitet, nicht ganz geschafft. Aber wann verdienen sie schon über Nacht bzw. womöglich über 1995 Nächte ihrem Vermögen von tausend Mark vielleicht 150 weitere hinzu?! Zwar haben sie in ihrer bescheidenen Rolle eines Privatanlegers
oder Kleinaktionärs
weder Mittel noch Gelegenheit, die Freiheiten der Spekulation so richtig zu genießen. Aber während sie zur Arbeit gehen, kümmern sich an ihrer Stelle schon die netten Banken um die Kurspflege
ihrer Aktien, und vermutlich noch lange werden sie von ihrer Öffentlichkeit mit der täglichen Nachricht unterhalten werden, wieviel ihr Vermögen gerade wert ist.
Wegen der innigen Beziehung, die sie als deutsche Aktionäre zur nationalen Telefongesellschaft unterhalten, die ja nunmehr ein ganz klitzekleines bißchen die Ihre ist, werden sie der auch gegen die Konkurrenz der ausländischen Billiganbieter beistehen und einfach markentreu weitertelefonieren. Es wird sie da auch freuen, daß der ziemlich ansehnliche Preis, den sie und alle anderen im Vertrauen auf die Zukunft der deutschen Telekom für ihre Titel an ihr gezahlt haben, auch tatsächlich – wie bei der Gründung der AG vorgesehen – als Schuldendienst der Firma an ihren Gründer Staat zurückfließt. Erstens mögen sie nämlich Schulden überhaupt nicht, und daß in einem Haushalt entsprechend aufgeräumt gehört, versteht sich jetzt, wo er ihnen gehört, zweitens schon gleich von selbst.
[1] Das weicht schon ein wenig ab von der Werbung, mit der die frühe „soziale Marktwirtschaft“ bei ihren „Privatisierungen“ die Masse der Eigentumslosen betören und zum Aktienerwerb stimulieren wollte. „Vermögensbildung in privater Hand“ u.ä. hieß damals die Propaganda, mit der Kapital und Kredit als die im Vergleich zum Sozialismus und seiner Planwirtschaft weit überzeugenderen Einrichtungen zur Mehrung des Volkswohls verwechselt werden sollten.