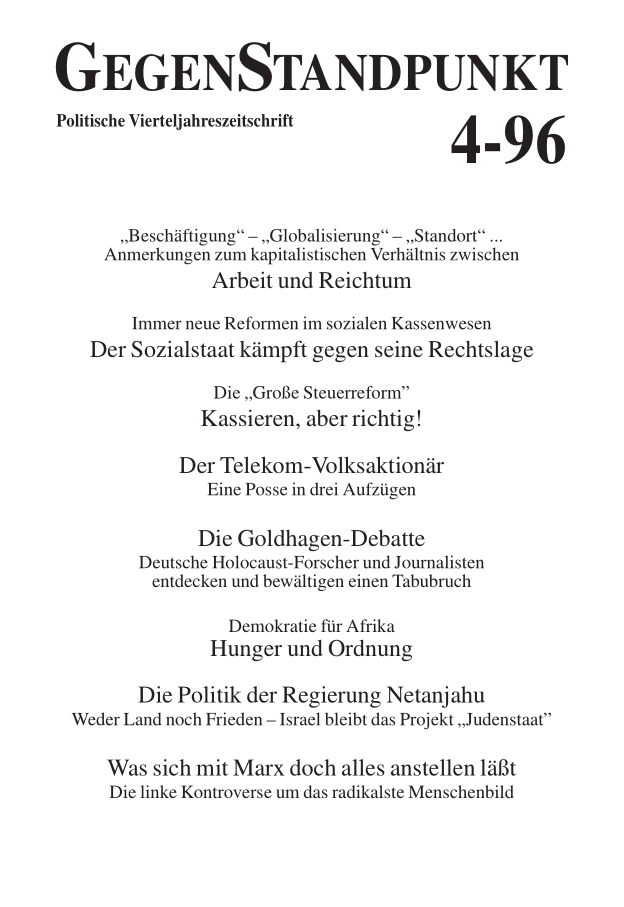Die „Große Steuerreform“
Kassieren, aber richtig!
Zur Finanzierung seiner staatsnotwendigen Aufgaben nimmt der Staat seinen Bürgern Geld weg. Dabei berücksichtigt er die Unterschiede der Steuerquellen: Einkommen für Lebensunterhalt bedarf weniger Schonung als zur Vermögensbildung taugliches Einkommen. Mit periodisch auftretenden Steuerreformen huldigt der Staat dem Ideal, durch die Art des Einkommensabzugs (an seinem Geldbedarf ändert sich ja nichts)das Wachstum zu fördern.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die „Große Steuerreform“
Kassieren, aber richtig!
Im Vorfeld der für 1999 geplanten „Großen Steuerreform“ haben die Regierungsparteien eine „Neuorientierung“ in der Steuerpolitik angekündigt. Durch eine Senkung der Einkommenssteuersätze und die Abschaffung zahlreicher Ausnahmetatbestände soll vor allem die Lohn-und Einkommenssteuer „einfacher, gerechter und leistungsfreundlicher“ (Schäuble) werden. Wegen der „angespannten Haushaltslage“ müsse ein Teil der durch die Senkung der Steuersätze ausfallenden Steuern durch die Besteuerung bisher steuerfreier Einkommensbestandteile ausgeglichen werden. Insgesamt werde den Bürgern aber eine Steuerentlastung von „netto ca. 30 Milliarden DM“ (Waigel u.a.) zugute kommen. Mit dieser Reform werde ein schwerwiegender Standortnachteil Deutschlands – die im internationalen Vergleich viel zu hohen Steuersätze – beseitigt. Sie werde deshalb endlich „Kräfte für ein dynamisches Wachstum freisetzen.“ (Schäuble)
Die lebhafte öffentliche Debatte zum Thema hat das Vorhaben als überfällig begrüßt. Kritik wurde laut an einzelnen seiner Regelungen, und Fragen wurden gestellt nach der „sozialen Ausgewogenheit“ der Pläne und ihrer „ökologischen Komponente“; ob die Vereinfachung des Systems wirklich so radikal wie nötig ausfallen werde; ob die „Entlastung der Bürger“ weit genug gehe; ob sich der Staat das angesichts seiner „dramatischen Finanzprobleme“ überhaupt leisten könne; wie stark wohl der „konjunkturelle Impuls“ der Reform ausfallen werde. Daß dies alles, unbeschadet der „Problematik“ ihrer Durchführung im einzelnen, eine Reform des Steuerwesens grundsätzlich leisten könne, wurde von niemandem bezweifelt.
Dabei gehen all diese Erwartungen völlig an der ökonomischen Natur der Steuern vorbei.
I. Vom Charakter der Steuern und den Eigenarten des Staatshaushalts
Der Staat ist zwar der Garant des in seinem Machtbereich gültigen Geldes; aber er verdient keins, muß es sich also hoheitlich bei seiner Gesellschaft besorgen, soweit er Geld als Kaufmittel für seine Zwecke benötigt. Er finanziert die Kosten seiner Bedürfnisse und politischen Vorhaben durch Abgaben auf die Einkommen, den Besitz, die Vermögen und Vermögenserträge etc. seiner Bürger, entzieht ihnen damit nach verbindlichen Regeln einen Teil des privaten Reichtums, dessen Schutz und Vermehrung sonst sein ganzes politisches Trachten gilt, und fällt ihnen als Kost zur Last. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit dieser Kosten für den Unterhalt der Gewalt, ohne die die kapitalistische Gesellschaft nicht bestehen könnte, ändert nichts daran, daß sie vom Standpunkt des gesellschaftlichen Reichtums faux frais, also für die Einkommensbezieher und Vermögensbesitzer Abzug von ihrem privaten Eigentum darstellen.
Die Höhe der Steuern richtet sich einerseits nach den ziemlich umfassenden Erfordernissen der Gewalt; das sorgt für hoheitliche Rücksichtslosigkeit. Andererseits nimmt der Staat aus dem Interesse am Erhalt seiner Steuerquellen heraus zugleich Rücksicht; er will sich ja dauerhaft am Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums bedienen. In unterschiedlichen Steuerarten und -sätzen organisiert er, daß mit vermehrten Einkünften seiner Bürger auch automatisch die seinen wachsen; andererseits trägt er dabei dem von ihm gewollten und betreuten gegensätzlichen Charakter der Geldposten auf den verschiedenen Konten Rechnung. Die in seiner Gesellschaft vorgefundenen ökonomischen Unterschiede gebieten dem Steuerstaat nämlich ein verschiedenes Maß von Rücksichtslosigkeit und Rücksicht.
Von abhängig Beschäftigten
zieht er Lohn- und
Einkommenssteuer an der Quelle ab, wohl wissend, daß das
Eintreiben bei der üblichen Knappheit von „Lohn und
Einkommen“ in diesen Kreisen sonst schwierig wäre, nimmt
also durch deren Vorauszahlungen Kredit bis zum
„Jahresausgleich“; er richtet ein bescheidenes System von
Freibeträgen und Abzugsmöglichkeiten ein, durch die die
Kosten für Nachzucht, Ausbildung, Anwendung,
Instandhaltung und nachberuflichen Unterhalt der
Arbeitskraft je nach politischer Konjunktur
„steuerrechtliche Berücksichtigung“ finden, und behält
zusätzlich Beiträge für die diversen Sozialkassen ein,
die nicht als Steuer gelten, aber genauso zum ziemlich
gravierenden Unterschied von nominellem „Bruttolohn“ und
„Nettoeinkommen“ beitragen, über das der arbeitende
Normalbürger wirklich verfügt. Zusammen mit den
„indirekten“ Steuern, die sich in den Preisen
niederschlagen, die die Massen als Konsumenten bezahlen
müssen, bringt das ca 75% des gesamten Steueraufkommens
ein. So macht der Staat das beschränkte Einkommen seiner
Mehrheit steuerlich zu seiner Reichtumsquelle.
Von den Besserverdienenden
, „Selbständigen“ und
„juristischen Personen“ wird ebenfalls Einkommenssteuer
bzw. Körperschaftssteuer erhoben; ihr Einkommen
qualifiziert sie für die Zahlung der berüchtigten
„Spitzensteuersätze“, allerdings auch für lauter
steuerabzugsfähige Posten. „Gewerbetreibende“ und Firmen
sind mit „Gewerbekapital“ und „Gewerbeertrag“
steuerpflichtig, dessen abgabenwirksame Größe mit dem
fungierenden Kapital und seinem Ertrag keineswegs
zusammenfällt. Wo Bilanzen erstellt werden, herrscht
Vertrauen und Entgegenkommen: über die Tolerierung von
„stillen Reserven“ können Körperschaften die Höhe des
ausgewiesenen Gewinns und die Körperschaftssteuer darauf
gleich selbst bestimmen, usw. usw. Bei dieser Klientel
gibt umgekehrt der Staat Kredit bis zum endgültigen
Steuerbescheid. So respektiert der Staat bei der
Befriedigung seines Finanzbedürfnisses die Vermögen und
Einkommen, die aus geschäftlicher Nutzung von Eigentum
resultieren und wieder als Reichtumsquelle fungieren
sollen.
Auf Grundlage dieser Regelungen ist der Staat mit seinen Einkünften abhängig vom Reichtum seiner Gesellschaft. Schließlich kann er nur, wenn der Reichtum seiner Gesellschaft ständig wächst, auch seine Einkünfte dauerhaft steigern. Allerdings macht er sich mit seinen kostspieligen Aufgaben und Vorhaben, die vom Straßenbau bis zur militärischen Sicherung und Beaufsichtigung ganzer Weltgegenden reichen, nicht abhängig vom begrenzten Inhalt der Steuerkasse. Moderne Souveräne pflegen ihre staatlichen Projekte nicht an den Staatseinnahmen auszurichten; sie machen sich den Reichtum ihrer Gesellschaften durch Verschuldung verfügbar. Als politische Schöpfer und Garanten des in ihrem Machtbereich gültigen Geldes legen sie nach eigenem Gutdünken Staatsanleihen auf, bedienen also ihre Finanzbedürfnisse, indem sie Geldanlegern neue Geschäftsgelegenheiten eröffnen, für deren Bedienung sie mit ihrer Finanzhoheit einstehen. Auf diese Weise setzen sie laufend zusätzliche Kreditmittel in die Welt.
Das Steueraufkommen ist also in kapitalistischen Staaten nur ein Teil des gesamten Reichtums, den die öffentliche Hand für ihre Vorhaben bewegt; es tritt als Staatseinnahmen ins Verhältnis zu den jährlich sich mehrenden Staatsschulden. Das verleiht den Staatseinnahmen einen ganz neuen Sinn. Sie sind die Basis für die ausgiebig genutzte Freiheit des Staates, seine Schulden zu vermehren.
„Da die Staatsschuld ihren Rückhalt in den Staatseinkünften hat, die die jährlichen Zins- usw. Zahlungen decken müssen, so wurde das moderne Steuersystem notwendige Ergänzung des Systems der Nationalanleihen.“ (Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1, S. 784)
Ihren „Rückhalt“ hat die Staatsschuld in der Steuer einerseits insofern, als mit ihr und mit neuen Schulden die anfallenden Zinsen bezahlt werden. Andererseits – und vor allem – insofern, als durch die steuerliche Teilhabe am wachsenden Reichtum der Gesellschaft der vom Staat aufgehäufte und ebenfalls alljährlich wachsende Berg von Verbindlichkeiten „gedeckt“ sein soll, was natürlich nie mehr heißen kann, daß die aufgelaufenen Verbindlichkeiten aus Steuern bezahlt werden könnten. Vielmehr gelten die „echten“ Einnahmen als Ausweis, daß der Staat über ein „gesundes Wirtschaftswachstum“ unter seiner Hoheit und in seinem nationalen Geld gebietet, so daß Aussicht auf künftig wachsende Einnahmen besteht; sie sind Indikator für die Qualität der Schulden, ob und wieweit der zusätzliche Kredit lohnende Geschäfte in Gang gebracht hat, also als Geschäftsmittel brauchbar ist und von den Finanzplätzen nachgefragt wird. Die Höhe der Einnahmen, ihre Wachstumsrate bzw. die des „Bruttosozialprodukts“ im Verhältnis zu Stand und Wachstum der Staatsverschuldung stiftet das Vertrauen, daß die staatlichen Schuldscheine wertbeständige Zahlungsversprechen, „solider“ Nationalkredit sind – und sorgt auf diesem Weg dafür, daß sie international anerkannt und genommen werden.
Die stets wachsenden Schulden verlangen also gebieterisch nach stets wachsenden Einnahmen – und umgekehrt:
„Die Anleihen befähigen die Regierung, außerordentliche Ausgaben zu bestreiten, ohne daß der Steuerzahler es sofort fühlt, aber sie erfordern doch für die Folge erhöhte Steuern. Andererseits zwingt die durch Aufhäufung nacheinander kontrahierter Schulden verursachte Steuererhöhung die Regierung, bei neuen außerordentlichen Ausgaben stets neue Anleihen aufzunehmen.“ (ebd.)
Das Steuersystem bildet daher als „notwendige Ergänzung“ der Staatsschuld die zweite Seite des Betreuungsverhältnisses, dessen Gegenstand der Kredit der Nation ist. Allerdings bleibt dessen Solidität stets prekär, weil das Wachstum der Schulden gewiß ist, ihre wachstumsdienliche Verwendung, also die Akkumulation des gesellschaftlichen und damit des staatlichen Reichtums sich aber staatlicher Order entzieht.
Gerade Deutschland hat sich seit dem Anschluß des Ostens einiges an „außerordentlichen Ausgaben“ geleistet, ohne daß dem auch nur annähernd ein Wachstum seiner Einnahmen entsprochen hätte. Das hat die Finanzpolitiker aus zwei Gründen sorgenvoll gestimmt. Erstens – wie gesagt – weil Politik und Finanzwelt in einem solchen Fall immer und überall die „Stabilität“ des nationalen Geldes gefährdet sehen. In den von ihnen selbst aufgestellten Kriterien einer „gesunden Haushaltsentwicklung“, eines „soliden Staatshaushalts“ fassen sich ja alle Sorgen um die Effizienz des nationalen Geldes zusammen. Die gebieten insofern eine gewissenhafte Betreuung ihres Haushalts. Zweitens haben die EU-Länder im Zuge der Gründungsvorbereitungen für das neue Euro-Geld eine ungünstige Entwicklung des Verhältnisses von Einnahmen und Schulden offiziell als stabilitätsgefährdend definiert und, Deutschland allen voran, die Bewirtschaftung der Schulden und Einnahmen nach festen Maßzahlen in den Rang einer Bündnisverpflichtung erhoben. Also war die „Konsolidierung des Haushalts“ nach Maßgabe der Kriterien geboten, um das Projekt eines Euro-Geldes und den deutschen Führungsanspruch dabei glaubwürdig zu erhalten. Deswegen gilt heute mehr denn je die Devise, mit der sich die Haushaltspolitiker schon immer an ihre Gesellschaft gewandt haben, egal ob es Schulden für einen Krieg oder eine neue Eisenbahn zu finanzieren galt: Geld her!
II. Die Steuerpolitik – eine praktizierte Ideologie
Diese Darstellung würde jeder Finanzminister als verfehlt, zumindest als polemische Verkürzung zurückweisen. Deren Vorstellung geht eher dahin, durch geschickte Modifikationen des Steuersystems, wären die Abgaben so zu arrangieren, daß sie anregend und fördernd auf das nationale Wachstum einwirken und so den steigenden Bedarf an Staatseinkünften befriedigen. Dieses Interesse läßt die obersten Steuereintreiber den Unterschied zwischen (steuerlichen) Bedingungen des Kapitalwachstums im Lande und dessen (ökonomischen) Gründen vernachlässigen. Sie glauben allen Ernstes an die Umdrehung des tatsächlichen Zusammenhangs von Steuern und Wachstum: Ihrer Auffassung nach geht es darum und kann es gelingen, die fiskalische Enteignung der Bürger so einzurichten, daß der Abzug von Reichtum durch und für die öffentliche Gewalt dessen Vermehrung bei den Privaten hervorbringt. Daß der Staat faux frais darstellt, die Steuer Abzug bleibt, kann zwar kein noch so ausgeklügelter Tarif beheben; ihre Senkung ändert nichts daran, daß sie als – dann eben geringerer – Kostenfaktor in die Berechnungen des kapitalistischen Geschäftes eingeht; und erst recht unerfindlich ist, wie das durchgesetzte staatliche Bedürfnis nach mehr Einnahmen zwecks „Konsolidierung seines Haushalts“ – zumal wenn es mit staatlichen Ausgabenkürzungen einhergeht – die Steuer zu einem entscheidenden „Wachstumsfaktor“ machen soll. Aber bei ihrem steuerlichen Zugriff arbeiten sich die Finanzpolitiker an dieser Unmöglichkeit ab, mit dem festen Willen, sie wahrzumachen. Sie verwechseln Steuern mit Steuerung und treiben in diesem Geist Steuerpolitik.
Mit der Ausgestaltung des Steuerwesens bemühen
sich die Finanzpolitiker darum, die Beschränkungen der
privaten Reichtumsvermehrung, die mit dem Abzug von
Steuern verbunden sind, nicht nur ungeschehen zu machen,
sondern in „Hebel“ des Privatreichtums und damit
vermehrten Staatseinkommens zu verwandeln. Sie
organisieren diesen Widerspruch, indem sie von Staats
wegen unterscheiden, wo und wieweit das Geld der
Bürger für nicht wachstumstauglich gilt und deswegen ohne
Schaden für die Wirtschaft vom Staat vereinnahmt werden
kann, und wo sich der Fiskus besser zurückhält, weil nach
seiner Auffassung dort das Geld zur Vermehrung taugt. Und
sie organisieren diesen Widerspruch periodisch
um, immer dann nämlich, wenn der Stand von Schulden
und Staatseinnahmen Anlaß zur Unzufriedenheit gibt und
Einnahmeerhöhung politisch dringlich wird. Genauso wie
die politischen Macher das allgemein florierende Geschäft
mit seinen heilsamen Wirkungen auf den Staatshaushalt
nicht zuletzt für ein gelungenes Werk ihrer Steuerpolitik
halten, entdecken sie den Grund für ausbleibendes
Wachstum, Standortprobleme, Konjunkturschwäche in einem
falschen Steuerwesen. Also steht eine Große
Steuerreform
an, die mehr Belastungen an der einen
Stelle mit Entlastungen an der anderen kombiniert.
Die Freiheit der Gestaltung läßt manche Korrektur beim Durchforsten des Steuer„dickichts“ ziemlich absurd ausfallen, weil alle möglichen alten Regelungen als Grund für den mangelnden Wachstumserfolg dingfest gemacht werden – wenn mit hohen Steuersätzen bei hohen Abschreibungs- und Steuersenkungsmöglichkeiten zu wenig Steuer erzielt wurde, muß der Erfolg eben in der Gegenrichtung gesucht werden: niedrigere Steuersätze mit weniger Abschreibungsmöglichkeiten… Um die kapitalistische Bestimmung der verschiedenen Geldsummen kümmern sie sich ja nur so und soweit, wie sie ihnen vom Standpunkt staatlicher Finanznot in den Blick gerät, bilden sich also alle möglichen positiven Wirkungen und Schadensvermeidungen ein, wenn sie statt „Kapitaleinkünften“ mehr „Massenkaufkraft“ verstaatlichen, wie wenn die Lohneinkommen nicht zur Realisierung von Kapital bestimmt wären, etc.[1] Aber die große Richtung geht bei diesem instrumentellen Verfahren nicht verloren, behalten doch die Reformer, wenn sie zwischen „wachstumsschädlichem“ und „wachstumsförderlichem“ Besteuern unterscheiden, ganz von selbst die zwei entscheidenden Gesichtspunkte im Blick, um die es wirklich geht: Erstens mehr Steuereinnahmen, zweitens so, daß dabei die entscheidenden Unterschiede der Steuerquellen gebührend berücksichtigt werden. Auf die radikalere Sortierung zwischen verstärkt besteuerbarem Masseneinkommen und zu entlastender „Wirtschaft“ laufen die steuerpolitischen „Weichenstellungen für Jahrzehnte“ allemal hinaus. So auch die aktuellen Reformbeschlüsse der Bundesregierung, die unter dem Firmenschild „Netto-Entlastung von mindestens 30 Milliarden“ und „Gegenfinanzierung durch eine Verbreiterung der Steuerbasis“ laufen. Das Vorhaben, die Steuerreform über die Konsolidierung der Einnahme-Schulden-Verhältnisse im Haushalt zu einem Beweisverfahren in Sachen nationaler Kreditwürdigkeit zu machen, gebiert einigen Radikalismus in den neuen Regelungen und schlägt sich darin nieder, daß der Gesichtspunkt der Erhaltung der Revenuequelle gegenüber dem der Haushalts- und damit Kreditkonsolidierung zurücktritt – jedenfalls bei den neuen Regeln für die Besteuerung der Lohneinkommen, der Lohnersatzleistungen und des Konsums. Es mag ökonomischer Unsinn sein, daß die staatliche Belastung der Revenue von Lohnarbeitern den Aufschwung fördert; in einem Sinn tut sie ihre Dienste: Sie bedient den Staat, ohne die Kapitalisten zu belasten – jedenfalls soweit die Betroffenen die Sache zwischen sich und dem Staat belassen und sich das vom Staat Genommene nicht beim Lohn zurückholen. Das ist also das offene Geheimnis einer erfolgreichen „wachstumsfördernden“ Steuerpolitik: Der Staat vermehrt seine Einkünfte soweit wie möglich durch hoheitliche Lohnsenkung und rechnet dabei auf die Lohnzurückhaltung der arbeitenden Massen.
III. Die Steuerdebatte – verlogen, aber demokratisch wirksam
Es mag ziemlich daneben liegen, daß die Besteuerung von Überstundenzuschlägen den Aufschwung beflügelt, daß die Senkung des Höchststeuersatzes bei der Einkommensteuer und für thesaurierte Gewinne lauter anlagefreudige Privatvermögen stiftet; daß die Besteuerung von Renten, Arbeitslosen- und Krankengeld Wachstum freisetzt; daß die Erhöhung der Mehrwert- und der Mineralölsteuer die Konjunktur voranbringt oder abwürgt. Viel entscheidender ist, daß das seinen Grundprinzipien nach so einfache Steuer„system“ und seine hoheitliche Ausgestaltung vom Volk in diesem Sinne und noch ganz anders verstanden wird. Denn mit seinen Steuern setzt sich der Staat nun einmal zu seinen Bürgern in Gegensatz, gibt also mit jeder Steuerreform seinem Volk von Steuerzahlern eine harte Nuß zu knacken. Erstens weil jeder als Privatsubjekt mit seinem im gesellschaftlichen Getriebe wohlverdienten Geld betroffen, vom Staat unweigerlich geschädigt wird; insofern muß jeder nachrechnen, was künftig an Abgaben auf ihn zukommt. Zweitens weil jeder als Staatsbürger die prinzipielle Notwendigkeit der Steuer einsieht, soweit es die Gemeinschaft an und für sich und nicht ihn selbst betrifft. Als gehorsamer, aber selbstbewußter Untertan verwechselt er Steuern mit einem wechselseitigen Leistungs- und Pflichtenverhältnis, das der Staat mit ihm eingeht, merkt unweigerlich, daß es sich um einseitige hoheitliche Akte handelt, hegt von daher den unausrottbaren Verdacht, daß er zuviel geschröpft, jeder andere zu sehr verschont wird, und fragt nach den einsichtigen Gründen der neugeregelten Abgaben, die er sowieso zahlen muß, so als hingen die noch von seinem Einsehen ab.
Also liefert die Obrigkeit dem Volk entsprechende Gründe, bevor sie die einschlägigen Gesetze erläßt: Politiker und Öffentlichkeit führen eine Steuerdebatte, in der die Menschheit mit vorgeblichen Zwecksetzungen und Leistungen des Steuereintreibens der disparatesten und absurdesten Art bedient wird. Mit jedem Steuerposten will und soll der zum Zahlen verpflichtete Mensch etwas verbinden können – und zwar garantiert etwas anderes als die schlichte Tatsache, daß der Staat seinen Geldbedarf neu regelt, streng im Interesse und nach Gesichtspunkten der Verwaltung und Nutznießerschaft einer kapitalistischen Gesellschaft. Im demokratischen Streit, den Regierung, Opposition und Kommentatoren über jeden Reformposten im einzelnen und das Werk insgesamt führen, wird die Steuer zu lauter sachfremden Gesichtspunkten ins Verhältnis gesetzt, die dem Volk den geglaubten und praktizierten Idealismus der Steuerpolitik verdolmetschen und um einige, nur in diesem Dialog zwischen Staat und Staatsbürgern wichtige Ideologien ergänzt. Dabei macht gerade die Tatsache, daß der Staat beim Zugriff keinen ausläßt und umgekehrt seine Steuern irgendwie allen Staatsleistungen zugrundeliegen, die Debatte so produktiv. Sie läßt sich zu allem, was den Staat und damit seine Bürger angeht, in Beziehung setzen.
Daß die Steuer die heilsamsten oder verheerendsten Wirkungen hat – auf das Kinderkriegen, die Investitionsentscheidungen, die generelle Leistungsmotivation, das allgemeine Kaufverhalten, überhaupt die Stimmung im Land, nicht zu vergessen das Gerechtigkeitsempfinden… – und daß es beim Abkassieren letztlich nur um diese Wirkungen geht, daß es sich also um einen einzigen Dienst am Bürger und seiner Allgemeinheit handelt, wenn der Staat sich bedient, das ist die von allen geteilte Grundlüge der Steuerdebatte, die je nach politischem Lager positiv oder negativ gewendet wird. Zumal wenn die Politik eine Umgestaltung des Steuerautomatismus insgesamt im Auge hat, ist daher eine heiße Debatte über die Grundprinzipien einer Steuerreform, die „ihren Namen verdient“, und ihre rechte Ausgestaltung im einzelnen unausweichlich – über so hehre Prinzipien wie „Haushaltssolidität“, (Leistungs-)„Gerechtigkeit“, „Einfachheit“ und „Durchsichtigkeit“ der Steuern.
So auch bei dem anstehenden bundesdeutschen „Reformwerk“.
Mit den Belastungen, die künftig gelten sollen, wird das
deutsche Volk unter dem Stichwort der Entlastung
vertraut gemacht, die der Staat seiner Gesellschaft
beschert. Daraus ergibt sich zwanglos – wenn man den
Staatshaushalt wie ein ordentliches
Einnahmen-Ausgaben-Wesen versteht, das dem
schuldenmachenden Staat Disziplin aufherrscht – der
Bedarf nach Gegenfinanzierung
, der eine vermehrte
Bedienung des Staates unausweichlich macht. Die
Opposition und – ausgerechnet – die Gewerkschaft können
hier ihre generellen Bedenken nicht verhehlen, ob sich
der Staat den Verzicht
auf Besteuerung in
Abteilungen, wo durchaus schadlos Geld von höheren
Einkommen, Beamten… zu holen wäre, überhaupt leisten
kann. Die Regierung hält dagegen, wo sie bisher in der
Abteilung Lohn- und Konsumbesteuerung fälschlicherweise
„Verzicht“ geübt habe. Damit ist allem die Funktion als
potentielle Steuerquelle für einen notleidenden
Staatshaushalt zugewiesen und die Debatte darüber
eröffnet, aus welchen unwiderleglichen Gründen wer wie
zur Kasse gebeten, wer entlastet werden muß.
Mit dem Hinweis, daß nur durch die geplanten Änderungen
verhindert werden kann, daß sich Deutschland in ein
Industriemuseum mit Freizeitweltmeistern
verwandelt, ist sowohl die Schicksalsschwere der
Entscheidungen wie die Ursache der deutschen Misere
benannt, die steuerlich aufgehalten werden muß: die
mangelnde Leistungsbereitschaft der Deutschen auf der
einen, die Leistungsfeindlichkeit der deutschen Steuern
auf der anderen Seite. Daß dies auf mehr Steuerleistungen
in den unteren Etagen, in denen Steuern eben nie
demotivierend und leistungsfeindlich
(Schäuble)
wirken können, hinausläuft und auf Entlastung in den
oberen, wo ständig Leistung „bestraft“ wird, versteht
sich zwar von selbst, muß aber unbedingt noch einmal
gesagt werden: 35% statt 35-Stunden-Woche!
(Waigel)
Die mehr am Schaden für den Bürger orientierte
Steuerideologie – daß es, wenn der Staat die finanzielle
Belastung seiner Gesellschaft organisiert, eigentlich
darum ginge, die Lasten möglichst erträglich und gerecht
auf die Gemeinschaft der Bürger zu verteilen, also der
Gerechtigkeit Genüge zu tun – kommt also durchaus zu
ihrem Recht. Allerdings vor allem in der Weise, daß die
Anträge auf gerechte Aufteilung der unvermeidlichen
Belastungen und die paar matten Beschwerden über die
einseitige Belastung der niederen
Einkommensbezieher
mit den kundigen Hinweisen auf die
Standort-Notwendigkeiten und volkswirtschaftlichen
Effekte einer sachgerecht organisierten Reform erschlagen
werden. Sie kommen sowieso gleich in der Form daher, daß
die Einseitigkeit letztlich am allermeisten dem
Staatshaushalt selbst schade. Gegen die Karte
Sozialneid
(Waigel) setzt die Regierung ihre Lesart
von Gerechtigkeit: Daß bisher gewisse Lohnteile und
Sozialzahlungen aus der Steuer ausgenommen waren, ist
ungerecht; außerdem fällt es unter die verhängnisvolle
staatliche Subventionsmentalität
, die das
bisherige System so undurchsichtig gemacht hat. Der
Hinweis, daß das „Steuersystem“ radikal vereinfacht
und gerecht
(Schäuble) wird, gewinnt durch die
generelle Besteuerung sämtlicher Lohn- und
Sozialzahlungen enorm an Glaubwürdigkeit.
Mindestens ebenso belebt wird die Debatte durch die
andere Seite aller Steuerideologien, durch den
behaupteten Stellenwert jeder Abgabe für Fortgang und
Fortbestand des großen Ganzen. Die Opposition ist sich da
z.B. Zweifel an der heilsamen Wirkung der Steuerreform
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen
sowie
Vorschläge für ein garantiert arbeitsplatzwirksames
Abgabenwesen schuldig und handelt sich prompt die
Zurückweisung ein: Sozialneid schafft keine
Arbeitsplätze
– sondern nur das Steuerkunstwerk der
Regierung. So pflegen beide Seiten, die sich
wechselseitig der Lüge bezichtigen, die Lüge, es ginge
beim Besteuern um eine Leistung, um die es weder dem
Kapital noch dem Staat – ausgerechnet beim
Steuereintreiben – zu tun ist. Viel mehr als über die
steuerlichen Maßnahmen – da sind sich Regierung,
Opposition und auch Gewerkschaft weitgehend einig
geworden über den vermehrten Finanzbedarf und die
wesentlichen Modalitäten seiner Erfüllung –, streitet man
sich öffentlich über die überzeugenden Titel, unter denen
das Jahrhundertwerk veranstaltet und unwiderleglich gut
begründet sein soll. Die allerhöchsten Ehrentitel guten
Regierens sind da gerade recht: der Standort Deutschland,
Deutschlands wirtschaftliche Zukunft – oder auch die
Umwelt. So werfen Grüne und SPD der Regierung vor, die
große Chance einer ökologischen Ausrichtung des
Steuersystems
verpaßt zu haben. Müßig, darauf
hinzuweisen, daß teurere Benzinpreise genauso wenig der
Gesundheit dienen wie die staatliche Bedienung am Tabak-
und Alkoholkonsum – die Steuer verhindert ja
nicht, sie rechnet mit den Verhaltensweisen, die
sie angeblich korrigieren soll. Waigel weiß das so gut
wie Lafontaine. Aber statt daran zu rühren und damit ihre
eigene Steuerlüge offenzulegen, bezweifeln sie lieber
Ernst und Wirksamkeit der von der Gegenseite
vorgeschlagenen Alternativen. Wenn Waigel im Gegenzug
verspricht, die Benzinsteuer zu erhöhen, was er sowieso
im Programm hat, eben unter seinem Firmenschild, dann ist
die umweltbewußte Opposition noch lange nicht zufrieden
oder gibt sich geschlagen. Sie bemüht in kritischer
Absicht die Fiktion, die den abstrakten Kern aller
Steuerideologien ausmacht: die Fiktion, das hoheitliche
Sich-Finanzieren sei ein höchst kompliziertes,
wohlabgestimmtes, alle Lasten und Notwendigkeiten
berücksichtigendes und darin aufs nächste Jahrhundert
berechnetes Gesamtkunstwerk: Zweifel, ob die Reform
überhaupt aus einem Guß
ist, ob diese
Flickschusterei
die nächsten fünf Jahre
überdauert
etc., sind immer geboten – und wegen ihres
Charakters so wenig zu widerlegen wie zu beweisen.
Marx hat in jungen Jahren die Auffassung vertreten, die Steuer sei das Steckenpferd des radikalen Bourgeois. Er hat dabei eines übersehen: daß sie mindestens genauso das Betätigungsfeld des radikalen Citoyen ist – jedenfalls in einer ordentlichen Demokratie, wo Steuern öffentlich verhandelt und parlamentarisch beschlossen werden.
[1] Das weiterführende Ideal der Besteuerung geht darauf, überhaupt nur mehr indirekte Konsumsteuern zu erheben, wofür aber nach Auffassung der CDU-Projektemacher die Zeit noch nicht reif sei. Dann wäre – in den Augen der Steuerpolitiker, die sich über die Rolle der kleinen Zirkulation im Kreislauf des Kapitals keine Gedanken machen – der Idealzustand erreicht, in dem man sich einfach beim Konsum die Steuern holen könnte, die man braucht, ohne störende Bezugnahmen auf schwankende und – soweit es sich dabei um Gewinne handelt – gegen „Belastungen“ sehr sensible Einkommen. „Des Kanzlers Partei bekennt sich zu einem Umbau des Steuersystems von den direkten Steuern zu den indirekten hin und folgt so erneut den Gelehrten… Es komme darauf an, so argumentieren die Fachleute, weniger die Einkommensentstehung, also den Unternehmensgewinn, als vielmehr die Einkommensverwendung, also den Konsum, einschließlich des Autofahrens, zu besteuern, denn die Gewinnsteuern schmälerten die Fähigkeit zur Investition in Arbeitsplätze.“ (SZ 19./20.10.96) „Des Kanzlers Partei“ und ihre „Gelehrten“ greifen damit eine altehrwürdige Tradition aus der Frühzeit des Kapitalismus und der „modernen Fiskalität“ (Marx) auf. Im „Kapital“ (S.784) berichtet Marx von dem „großen Patrioten de Witt“, der das System der „Steuern auf die notwendigsten Lebensmittel (also deren Verteuerung)“ und der tendenziellen „Überbesteuerung“ wegen des steigenden Finanzbedarfs des Staates „als das beste System“ gefeiert hatte. Dieses Lob hatte sich die frühe Form der Mehrwertsteuer allerdings damals nicht wegen des Erhalts der „Fähigkeit“ der Betriebe „zur Investition in Arbeitsplätze“ verdient, sondern weil es de Witt als „das beste System“ erschien, „den Lohnarbeiter unterwürfig, frugal, fleißig und … mit Arbeit überladen zu machen“.