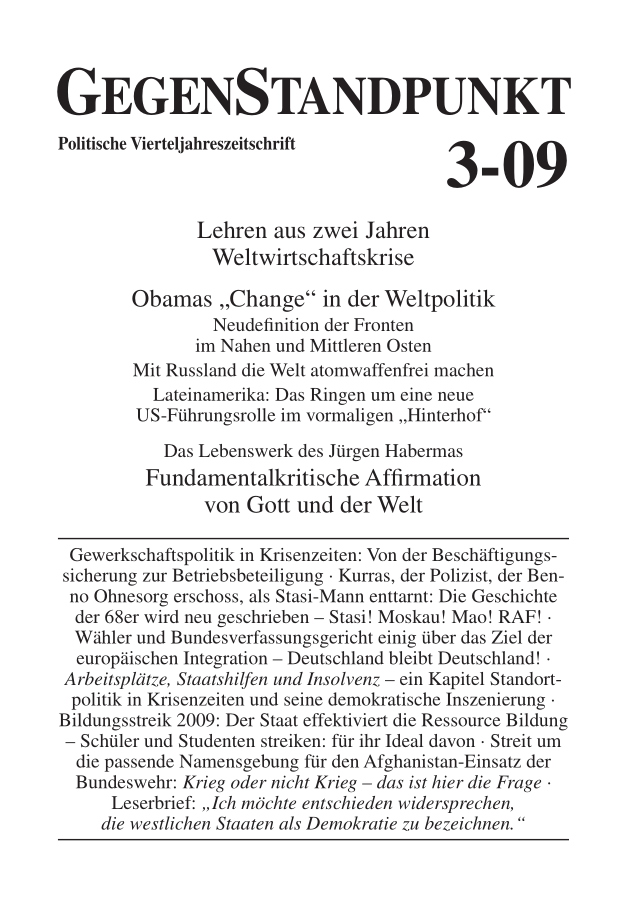Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Arbeitsplätze, Staatshilfen und Insolvenz – Ein Kapitel Standortpolitik in Krisenzeiten und seine demokratische Inszenierung
Die Alternative „Insolvenz oder Staatshilfen“ wird unter dem Titel „Rettung von Arbeitsplätzen“ debattiert. Schließlich sind Wahlkampfzeiten und das demokratische Leben hält Einzug in die Krisenpolitik: Politiker empfehlen sich dem Volk als die richtigen Krisenmanager und inszenieren ihre Standortoffensive für die Perspektive und im Namen der betroffenen Krisenopfer.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Arbeitsplätze, Staatshilfen und Insolvenz – ein Kapitel Standortpolitik in Krisenzeiten und seine demokratische Inszenierung
1.
Insolvenz ist, wenn ein Kapital in Industrie oder Handel kein Geld mehr hat. Die festgestellte Zahlungsunfähigkeit ist das klare Eingeständnis, dass die Konkurrenzbemühungen ums Geldverdienen gescheitert sind: Die Einrichtung einer Produktion – Gebäude, Rohstoffe, Maschinen und die gesamte für die Produktion der Waren aufgewendete Arbeit – haben sich als vollständig untauglich erwiesen. Nicht in dem Sinne, dass untaugliche Gebrauchsgüter herausgekommen wären, sondern untauglich in dem Sinne, dass der gesamte Aufwand für die Herstellung von Produkten am Markt nicht genügend Geld eingespielt hat, um alle geldwerten Ansprüche von Lieferanten, Eigentümern, Investoren oder Gläubigern zu befriedigen. Der Produktionsbetrieb hat als Geldvermehrungsmaschine versagt, und über alle konkreten Voraussetzungen und Ergebnisse der Produktion wird das verächtliche Urteil gefällt: nach kapitalistischen Maßstäben war aller Aufwand verschwendet, nutzlos, eigentlich sogar schädlich, weil mit der Produktion von konkreten Waren abstrakter Reichtum, Geld, vernichtet worden ist. Aus diesem Urteil über den konkreten Reichtum wird die entsprechende Konsequenz gezogen: Wie nützlich und tauglich alle Produktionseinrichtungen und Waren noch sein mögen, mit ihnen wird entsprechend dem Urteil des Geldregimes – Untauglich! Zu groß für lohnende Verwertung! – verfahren: Die Konkursmasse wird, soweit möglich, zu Geld gemacht, ansonsten verschrottet oder sie verrottet. Der Betrieb verschwindet vom Markt; sein lebendes Inventar ist damit ebenfalls überflüssig und dementsprechend wird es behandelt.
Auf diesen Fall privatwirtschaftlicher Verschwendung sachlichen Reichtums und sozialer Verelendung bezieht sich die Staatsgewalt üblicherweise höchst affirmativ: Sie gibt ihm vollumfänglich Recht, in doppeltem Sinne: Sie bestätigt ihn und regelt ihn durch einschlägige Bestimmungen des Insolvenzrechts. Schließlich liegt mit der Insolvenz die Schädigung von Eigentumsrechten vor, deretwegen der staatliche bestellte Verwalter überparteilich die Verteilung der Vermögensschäden abwickelt: Er beendet den ‚Wettlauf der Gläubiger‘ und sortiert und hierarchisiert nach der Seite hin die Rechte der durch den Zahlungsausfall Geschädigten, und er organisiert das rechtlich verbindlich gemachte Wegschmeißen von Reichtum und Arbeitskraft, um möglichst viel von dem zu befriedigen, was in der Marktwirtschaft alleine zählt: Eigentumsansprüche. Die können auch bedient werden durch Sanierung – einen der rechtlich fixierten Wege, die Insolvenzmasse für die Gläubiger in der weiteren Zukunft zu verwerten. Das unter Gläubigerschutz stehende Kapital wird durchgemustert auf die Aussicht auf einen Neustart. Und das heißt zuvörderst, dass ‚frisches‘ Kapital, ein Investor angelockt werden muss, für den die Konkursmasse attraktiv gemacht wird: Mittels der einschlägigen Techniken der kapitalistischen Konkurrenz wird das Unternehmen zugerichtet, auf dass es in Zukunft wieder eine Quelle für Profit und Kredit wird: Betriebsteile werden brachgelegt oder verkauft, Konkurrenten aufgekauft, Arbeitskräfte stillgelegt, die verbleibenden effektiver, also billiger eingesetzt, usw. usf..
*
Krise ist, wenn ein nationaler Kapitalstandort insgesamt schrumpft, wenn das Kapital in großem Stil abwrackt, die betrieblichen Pleiten auf ein ungewöhnliches Maß ansteigen, noch viel mehr Betriebe unrentabel wirtschaften und in Zahlungsnöte geraten. Dann sind Insolvenzen nicht nur Gegenstand routinierter staatlicher Regelung, dann sehen sich die obersten Hüter des Standorts herausgefordert. Dass Größe und Wucht des deutschen Standorts gerade kleiner werden, nehmen die Kanzlerin und ihr Außenminister zum wiederholten Male zum Anlass, dem Rest der Welt eine Konkurrenzoffensive anzusagen:
„Die Karten werden auf der Welt im Augenblick neu gemischt, und ich möchte, dass Deutschland daraus gestärkt hervorgeht. Die Bundesregierung wird deshalb darauf achten, dass zweifellos erforderliche Marktbereinigungen nicht nur in Deutschland stattfinden. In den nächsten zwei Jahren entscheidet sich, welchen Platz Deutschland nach der Krise in der Welt wieder einnimmt. Wir fordern ein Bekenntnis zur klassischen Industrie und zum Modell des Exportlandes D, das Exportweltmeister bleiben will. Dazu, dass wir eine exportstarke Nation sind, gibt es keine Alternative.“ (Merkel und Steinmeier vor dem BDI am 15.6.09)
Eine klare Ansage – Merkel und Steinmeier rechnen
felsenfest damit, dass im Zuge der Krise
Marktbereinigungen zweifellos erforderlich
sind,
die Vernichtung von Reichtum und Kapital ansteht. Aber
dies soll nicht nur
in Deutschland stattfinden,
und gemeint ist natürlich: nur nicht in
Deutschland, denn wie anders sollte sich ihre Nation
stärken
, als dadurch, anderen Standorten von
Kapital die Schäden der Krise aufzuhalsen? Dort
soll stillgelegt werden, dort soll nationaler
Kapitalreichtum entwertet werden, jedenfalls relativ mehr
als am deutschen Standort, und die deutsche Regierung
verspricht den Vertretern der deutschen Wirtschaft, für
die staatliche Korrektur des Krisenverlaufs einiges zu
tun. Sie richtet diverse „Wirtschaftsfonds Deutschland“
ein und stattet sie per politischen Beschluss mit Geld
und Rechten aus, um zahlungsunfähigen Unternehmen den
Kredit zu gewähren, den sie privat nicht mehr haben, aber
brauchen, um die Konkurrenz in der Krise zu überleben. An
die Gewährung der „Staatshilfen“ sind die Interessen der
Standorthüter geknüpft, und die bedeuten etwas mehr als
die bloße Erhaltung privaten Kapitals: Fabriken,
Technologie und alles, was daran hängt, also die
materielle Substanz des Industriestandorts
Deutschland
(Merkel) soll
ebenso gesichert bleiben wie der exklusiv-nationale
Zugriff Deutschlands auf diese
Wachstumspotenzen. Deswegen gilt es, deren Transfer in
konkurrierende Nationen möglichst zu verhindern, insofern
spielt die nationale Herkunft der Investoren eine Rolle,
deren Bereitschaft, selber Kapital aufzubringen, usw.
usf. Jedenfalls wollen Merkel und Co.
Reichtumsquellen gegen andere Staaten sichern.
Und diese Grundlagen ihrer Macht sollen sich in der
Zukunft wieder als rentable private Unternehmen bewähren.
Dafür blähen sie Haushalt und Staatsschulden für
Subventionen auf.
Damit stehen die in den Ministerien eingerichteten Prüf-
und Lenkungsausschüsse in der Umsetzung dieses
politischen Anspruchs vor der spekulativen Drangsal zu
entscheiden, welchem der zahlungsunfähigen
Antragsteller aus Industrie und Handel sie zutrauen, dass
er nach der Krise wieder Geld verdient und so den
deutschen Kapitalstandort stärkt.
Prominentes
Beispiel Opel, ein Stück insolventer deutscher
Schlüsselindustrie, das die Regierung auf Biegen und
Brechen erhalten will: Alte Eigentümer, neue Investoren
und Standortpolitiker rechten um ihre jeweiligen
Interessen, und sollten sie sich in ihren Ansprüchen an
Opels Zukunft
einig werden, gibt es ‚frisches‘
privates Kapital und staatliche
Kreditbürgschaften für Opels Zurichtung als wieder
profitablen Beitrag zur Substanz des
Industriestandorts D
– schon wieder mit allen
Techniken der kapitalistischen Konkurrenz: Betriebsteile
brachlegen oder verkaufen … usw. usf.
Sollte in dem munteren Streit zwischen privatem Bereicherungs- und staatlichem Standortinteresse um die Bedingungen für die Subventionsvergabe keine Einigung erzielt werden, steht an dessen Ende dann doch die Abwicklung des Konkurrenzergebnisses ‚Zahlungsunfähigkeit‘. Der Betrieb geht in die „geordnete Insolvenz.“
2.
Die Alternative Insolvenz oder Staatshilfen
wird
unter dem Titel Rettung von Arbeitsplätzen
debattiert. Schließlich sind Wahlkampfzeiten und das
demokratische Leben hält Einzug in die Krisenpolitik:
Politiker empfehlen sich dem Volk als die richtigen
Krisenmanager und inszenieren ihre Standortoffensive für
die Perspektive und im Namen der betroffenen Krisenopfer.
Natürlich wissen wählende Arbeitnehmer, denen
bange ist vor den Konsequenzen der Krise, dass die Sache,
die heutzutage in dem Sprachdenkmal ‚Arbeitsplatz‘
gefasst ist, nicht einfach ihretwegen, wegen
ihrer chronischen Geldnot gerettet
wird.
Dass sie Arbeit nur dann haben, wenn damit
Gewinne gemacht werden, ist ihnen klar. Ebenso ist ihnen
bekannt, dass beim Retten
von Arbeitsplätzen
etliche davon der Sanierung zum Opfer fallen. Und erst
recht sagt ihnen ihre Lebenserfahrung, was sie an diesen
‚Plätzen‘ erwartet, solange und sobald sie daran
arbeiten: Leistungsanforderungen bis zur Erschöpfung und
Ruinierung, ein Lohn, der vielleicht eben hinreicht, um
tagtäglich als Arbeitskraft antreten zu können, dazu
Über- oder Kurzarbeit, Lohnverzicht, über allem die
ständige Drohung, ob das alles morgen überhaupt noch als
„Angebot“ zum Geldverdienen da ist – all das, was eben
den Arbeitsplatz als Instrument einer kapitalistischen
Profitrechnung ausmacht. Nur: Wer sich auf diesen
bezahlten Arbeitsdienst am fremden Eigentum als seine
Lebensperspektive hat festnageln lassen, der will dann
auch daran glauben, dass diese Arbeitsplätze, zu denen er
keine Alternative hat, irgendwie und letztlich doch auch
für ihn eingerichtet sind. Er will es so sehen, dass sein
Lebensunterhalt und die Rentabilität der Arbeit im
Prinzip ganz gut zusammenpassen, wenn nur alle
Beteiligten das Richtige machen. Spätestens dann, wenn
„die Wirtschaft“ aber Arbeitsplätze abbaut, zahllose
Leute überflüssig macht und in die noch größere
Not der Erwerbslosigkeit stürzt, dann sind
sich moderne Arbeitnehmer ganz sicher, dass hier weder
systemgemäßer Fortschritt des Kapitals im Umgang mit
Arbeit noch dessen systemnotwendige Konsequenz vorliegen.
Es muss vielmehr irgendetwas in diesem Laden ganz
falsch gelaufen sein. Sie registrieren
Versagen, zumeist oben im Management, und wenden
sich als Staatsbürger vertrauensvoll an die
politischen Verwalter dieses gesellschaftlichen
Zusammenhangs: Die sollen es richten für sie und
besser regieren, damit künftig so wenig
Arbeitsplätze wie möglich verloren gehen.
Wenn es so am Ende ein Glück und nicht ein Pech sein
soll, einen Arbeitsplatz zu haben oder zu behalten, wenn
also dieses Arrangement beinharter Rentabilitätskriterien
namens ‚Arbeitsplatz‘ die schöne Karriere zum fraglos
hohen Gut der Nation (nicht nur) in Krisenzeiten
hingelegt hat, dann kann eine wechselnde Front
von Ministerpräsidenten, Parteivorsitzenden und Ministern
nicht nur der SPD zum großen, edlen Rettungswerk antreten
und mit dem Slogan Arbeit statt Abbruch!
für sich
werben: Müntefering, Seehofer und Steinmeier kämpfen
so um jeden Arbeitsplatz
, wenn sie sich für
Staatshilfen bei Opel, Karstadt und Schaeffler einsetzen.
Und die nationale Öffentlichkeit der Arbeitnehmer,
angeführt von Bild, begleitet sorgenvoll das
verantwortungsvolle Wirken der Politik: Klappt morgen
die Opel-Rettung?
Karstadt – 56 000 Arbeitsplätze
in Gefahr!
und: Immer mehr Unternehmen rufen nach
Regierungshilfe – Kann der Staat mit Steuer-Milliarden
Firmen retten?
So kämpfen volksfreundliche Politiker
mit Staatskredit an Stelle der Arbeitnehmer um
die Lebensperspektive von Hunderttausenden in
Deutschland
(Steinmeier):
das Geschacher der Regierung mit mächtigen Investoren,
die Verfügung über Zeit und Geld von Arbeitskräften, der
Handel mit Entlassungen, das Ringen um nationalen
Einfluss über Schlüsselindustrien – das ist dann nichts
als die pure Solidarität führender Demokraten mit den
Interessen der abhängig Beschäftigten. Ein ebenso
altbewährter wie verlogener Perspektivenwechsel,
mit dem letztere für die Standortpflege mächtiger
Industriestaaten und für die Wahl demokratischer
Führer vereinnahmt werden: Wenn wir mit Staatshilfen um
erfolgreiche private Profitquellen kämpfen, uns also um
eure Arbeitsplätze kümmern, dann dürfen wir Politiker
doch wohl auch von euch eure Stimmen erwarten!, lautet
der demokratisch-freche Anspruch von Politikern, die
Staatskredit mobilisieren im Namen des Volkes, dem in
Teilen der Lebensunterhalt verloren geht.
*
So rettet man Arbeitsplätze nicht!, heißt es
kritisch aus dem Wirtschaftsministerium. Milliarden für
marode
Betriebe – das schadet der
Wirtschaft und dem öffentlichen Allgemeinwohl!
Wenn heute schon jeder ABC-Schütze aufsagen kann, dass in
der Wirtschaft mit Arbeit Geld verdient werden
muss, kann man seriös Arbeitsplätze nur
retten
, indem man zu für die Grundsätze
des
Wirtschaftens Partei ergreift, die gerade einmal wieder
den Leuten das Überleben schwer machen:
„Für mich ist die Krise Anlass, die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft nun erst wirken zu lassen ... Die Breite der Bevölkerung will auch keine Rettung um der Rettung willen. Die Menschen durchschauen die wahltaktischen Erwägungen, die hinter solchen Rettungen stehen, viel klarer, als manche glauben ... Ich kämpfe um die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft.“ (Guttenberg, Spiegel Nr. 24)
Wenn die breite Bevölkerung
schon Arbeit
braucht und will, dann braucht sie entsprechend den
Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft
jemanden,
der an ihr verdient. Dafür zu sorgen, für die
rentablen Bedingungen der Arbeit, ist insofern
das beste Versprechen, das ein Politiker in Krisenzeiten
Arbeitnehmern machen kann. Dafür zu sorgen, dass
erfolgreiche Profitmacherei baldmöglichst wieder losgeht,
ist das ordnungspolitisch
großartige Angebot, das
Guttenberg als ehrlicher Realist in der Politik
den Menschen macht. Es ist einfach wirklichkeitsfremd,
systemwidrig und unverantwortlich, als Politiker so zu
tun, als könnte man mit den Mitteln der Politik
alle Arbeitsplätze retten:
„Ich möchte mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufräumen: Das Eingreifen des Staates in ein Unternehmen schützt NICHT vor Arbeitsplatzabbau.“ (Guttenberg im Bild-Interview)
Zumal Staaten wie Deutschland und ihre politischen Führer
wie Guttenberg sowieso ohnmächtig sind gegenüber
den Krisenfolgen. Sie gebieten zwar über gigantische
Kapitalstandorte und eine gewaltige Kreditmacht,
gegenüber manchen Prozessen
aber schätzen sie ihre
Mittel als ausgesprochen bescheiden ein:
„Wir müssen aufpassen, dass sich der Staat nicht überschätzt – und den Menschen das Gefühl gibt, er könne allen helfen. Das ist unmöglich. In dieser wie jeder anderen Krise zuvor werden Unternehmen in die Insolvenz gehen oder vom Markt verschwinden. Solche Prozesse kann der Staat nicht aufhalten.“ (ders.)
Aber: Was der Staat nicht aufhalten
kann, das kann
er zumindest mit der guten deutschen
Insolvenzordnung
begleiten und zugleich für deren
guten Ruf beim Wähler sorgen:
„Wir müssen die Stigmatisierung des Begriffs Insolvenz beenden. Insolvenz bedeutet nicht Abgrund und Pleite. Die deutsche Insolvenzordnung ist zu einem Instrument für erfolgreichen Neuanfang nach einer Umstrukturierung geworden.“ (ders.)
Das macht Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber vor dem
Zumachen steht, Mut: Man muss die guten von den
schlechten Pleiten als Chance der Belegschaft
unterscheiden lernen. Arbeitsplätze, die nach
einer guten Insolvenz nämlich noch übrig bleiben, sind
dann echt gerettet, und dann darf man als
Politiker auch mal öffentlich dafür werben, dass ein
maroder
Betrieb weggeschmissen und nicht mit
Steuergeld gepäppelt gehört. Letzteres wäre nichts
anderes als eine Gefährdung des Allgemeinwohls:
„Alle Optionen für ein Unternehmen sind genau abzuwägen und durchzurechnen und auch die Konsequenzen für Unternehmen und Steuerzahler genau zu benennen. Danach haben wir zu entscheiden, ob sich der Einsatz der Steuergelder rechtfertigen lässt oder nicht.“ (ders.)
Guttenberg weiß schon, wie er sein
Millionenpublikum ansprechen muss: Staatshilfen für
Karstadt und Co. sind letztlich und irgendwie
Steuergelder
, also Gelder, die die breite
Bevölkerung
bezahlt hat, und die deswegen von
verantwortungsvollen Politikern vor falschem
Einsatz
bewahrt werden müssen. An das stete
Ärgernis, dass ihm der Staat Geld wegnimmt, denkt nämlich
noch jeder Bürger, wenn er Steuergelder
hört. An
dieses Ärgernis erinnert der Wirtschaftsminister im
Zusammenhang mit Staatshilfen, weil er die mit
ihrem Geldhaushalt unzufriedenen Steuerzahler
auf den Standpunkt einer ideellen Verantwortung für
solide Staatsfinanzen verpflichten will. Die
Unzufriedenheit von Steuerzahlern nimmt der Minister als
Auftrag, mit dem Steuergeld, gut zu regieren.
Und für diesen Auftrag empfiehlt er sich als soliden
Treuhänder mit seiner grundlegenden Skepsis gegenüber
Staatshilfen: Für uns Steuerzahler
will er
genau durchrechnen
, ob sich für das staatliche
Allgemeinwohl die Rettung von Einkommensquellen wirklich
rechtfertigt
. Damit will er vor allem denen unter
seinen Adressaten, die noch Arbeit haben, nahelegen, ihre
werten Mitbürger, deren Lebensunterhalt von Insolvenz und
Krise bedroht ist, also ihresgleichen, als
mögliche Kostgänger „ihrer“ eigenen Steuergelder
höchst kritisch zu betrachten.
*
Es ist schon interessant, welche Töne im Krisenwahljahr
in der nationalen Debatte um die Rettung von
Arbeitsplätzen
durch Staatshilfen Oberwasser
gewinnen, jenseits davon, dass in den Ministerien
Hunderte Anträge auf Subventionen positiv beschieden
werden. Die Kanzlerin stellt am prominentesten Fall Opel
klar, dass die Gewährung von Subventionen eine Ausnahme
ist:
„Was macht den Fall Opel einzigartig: Es gibt keinen Eigentümer – mit Ausnahme des Pleitekandidaten GM, kein Konto, keine Gläubigerbank. Zudem die Verquickung von GM und US-Finanzministerium, die aus Opel einen Spielball amerikanischer Interessen zu machen droht. Die einzige Instanz, die dem Traditionsunternehmen in einer solch schwierigen Gemengelage noch zur Seite springen kann, ist die Bundesregierung.“ (Merkel)
Die unverblümte Vereinnahmung von Wählern als Nationalisten, das geht immer. Vier deutsche Opel-Fabriken ohne Eigentümer im Strudel der GM-Pleite, klar, dass hier wehrlose deutsche Arbeitsplätze amerikanischen Ausländern entrissen werden mussten. Und wenn solche deutschen Interessen auf dem Spiel stehen, erledigen sich alle möglichen Einwände gegen staatliche Subventionen von selbst.
Die nationale Öffentlichkeit selbst schließt sich
insgesamt ziemlich einmütig dem Befund Guttenbergs an:
Arbeitsplätze retten, indem der Staat sie bezahlt,
Beschäftigte vor den Wirkungen der krisenhaften
Entwertung der Kapitale schützen – das geht eigentlich
nicht, wie immer man es auch hin- und herwendet. Verlangt
ist stattdessen die umstandslose Parteinahme für das
Allgemeinwohl, also die Grundsätze
der
Privatwirtschaft und die Solidität der staatlichen
Finanzen, gerade da, wo sie sich gegen die Interessen von
Krisenopfern richten – Krise ist keine Zeit für soziale
Taten der Politik! Und gerade so, als wollten die
Kommentatoren und Experten diese ihre Parteinahme noch
einmal untermauern, machen sie ihr Publikum darauf
aufmerksam, wer eigentlich und letztlich die notorischen
Nutznießer der Subventionen sind. Um zu unterstreichen,
dass der staatliche Geldsegen unbedingt verhindert werden
muss, greifen sie glatt zu einem Stück Wahrheit über die
Verhältnisse und erinnern ihre Leser ganz nebenbei daran,
dass die Milliarden, ob private oder öffentliche, sowieso
immer irgendwelche umstrittenen
Middelhoffs,
Schaefflers oder Schickedanzens einsacken:
„Die pflichtvergessenen Eigentümer – die Familie Schickedanz und die Privatbank Sal. Oppenheim – haben die Aktiengesellschaft zu Unrecht als ihr persönliches Eigentum behandelt. Dabei haben sie Arcandor, ehemals Karstadt-Quelle, ausgehöhlt. Sie haben verkauft, was nicht niet- und nagelfest war … Der vielleicht umstrittenste dieser Manager, Thomas Middelhoff, kassierte bis zum Frühjahr Millionen.“ (Ulrich Schäfer, Eigentum vernichtet, SZ, 10./11.6.)
Dass einzelne Eigentümer milliardenschwere Konzerne, an
deren Schicksal der Lebensunterhalt Zehntausender hängt,
als ihr persönliches Eigentum
behandeln und
dementsprechend damit verfahren, ist wohl wahr. Etwas
befremdlich allerdings der Zusatz, dabei handele es sich
um Unrecht
und Pflichtvergessenheit
gegenüber den Konzernen, gerade so, als ob deren Wachstum
eine Art moralischer Pflichtdienst für Innenstädte,
Regionen oder Arbeitnehmer wäre. Diese verwegene
Scheidung von Arbeitsplatz spendenden,
gemeinwohldienlichen Unternehmen und
pflichtvergessenen
Eigentümern, die „unser“ Geld
nicht verdient haben, kann man dem einfachen Volk aber
auch etwas geradliniger vorsagen:
„Diese Milliardärin will an unser Steuergeld! Weil die reiche Frau Schaeffler sich bei der Conti-Übernahme verrechnet hat, ruft sie den Staat um Hilfe.“ (Bild.de)
Als Sprachrohr des Volkes, das Arbeit braucht, hat das
Massenblatt einen Tag zuvor dessen berechtigte Sorge um
die Rettung unserer Arbeitsplätze
beim Arbeitgeber
Schaeffler bedient. Als Anwalt aller arbeitenden
Steuerzahler bedient Bild jetzt das Ressentiment gegen
schmarotzende Reiche, indem sie die Milliardärin
Schaeffler im Pelzmantel vorführt, weil sie dasselbe
Publikum für solide Finanzen unseres Gemeinwesens
und gegen Subventionen vereinnahmen will: In dem Fall
retten
staatliche Milliarden nicht Arbeitsplätze,
sondern machen reiche Milliardäre einfach reicher.
Sozialneid – auch eine Art, seinem Publikum mitzuteilen,
dass Arbeitsplatzsubventionen nicht in die Zeit passen.
3.
Niemandem ist klarer als den Profis der demokratischen
Öffentlichkeit selbst, dass Politiker da
Wahlkampf betreiben, also ihr Profil für ihren
politischen Erfolg inszenieren, wenn sie öffentlich um
Staatshilfen ringen und rechten. Dass sich dabei das
nationale Führungspersonal wechselseitig die guten
Absichten abspricht und die übelsten Motive unterstellt,
um sich selbst jeweils als besonders vertrauenswürdig zu
empfehlen, verbucht eine abgebrühte Öffentlichkeit als
Normalfall: Wenn der Wirtschaftsminister als Minister
der Insolvenzen
schlechtgemacht werden soll, der
Konkurs zum Volkssport erklärt
, wenn umgekehrt
Guttenberg locker den SPD-Rettern unterstellt, dass
sie mit dem Schicksal der Betroffenen spielen, wenn sie
sich jetzt mit einem nicht plausiblen Konzept zufrieden
geben, zynisch kalkulierend, ob es über die anstehenden
Wahlen reicht
, dann gehört das offenbar zum
notwendigen Repertoire erfolgreicher Machtfiguren, die
ihre Klientel betören wollen, und insofern quasi zum
guten Ton einer lebendigen Demokratie: Dass alle werten
Kandidaten für die hohen politischen Ämter danach
trachten, die Betroffenheit des Volkes von materieller
Not in Krisenzeiten in ihren politischen Erfolg
umzumünzen, damit rechnen sie ganz selbstverständlich.
Zynische Kalkulationen der demokratischen Konkurrenz
dieser Art empören Spiegel, SZ und FAZ nicht, sie gehen
davon aus und zeichnen liebevoll die durchschauten
Strategien der Wahlkämpfer nach:
„Merkel verfolgt eine Doppelstrategie: Guttenberg soll die reine Lehre vertreten, um Stammwähler zu binden. Die Kanzlerin gibt die pragmatische Regierungschefin, die auch für die Wähler der linken Mitte attraktiv bleiben soll.“ (Der Spiegel Nr. 24)
*
Was die Kenner der Verhältnisse aber überhaupt nicht
leiden können, das sind demokratische Populisten, die
ihren Wahlkampf mit volksfreundlichen Versprechen
bestreiten. Schon damit erregen die Wahlkämpfer den
Verdacht, bei ihrem opportunistischen Blick auf den
Wähler die Grundsätze
der sozialen Marktwirtschaft
aufzugeben:
„Parteipolitiker wie Müntefering aber brauchen keine Prüfungs-, Lenkungs- oder sonstige Ausschüsse um festzustellen, dass eine Bürgschaft notwendig und zukunftsträchtig erscheint. Ihnen genügt der Blick auf den Kalender, auf dem für nächsten Sonntag die Europa-Wahl vermerkt ist – und für den 27. September die Bundestagswahl … Das klingt sozial, hat mit sozialer Marktwirtschaft aber nichts zu tun. Es ist das Paradies. Das Wahlkampf-Paradies.“ (Nico Fried, SZ, 2.6.)
Und wenn die politischen Experten den Eindruck gewinnen, dass die Wahlkämpfer am Ende auch noch die Politik machen, die sie versprechen, nimmt sich die real existierende Demokratie für sie wie eine Katastrophe aus. Mit ihrer Volksverbundenheit sind die Politiker nicht nur drauf und dran, Marktwirtschaft und Staatsfinanzen kaputtzuregieren:
„Wenn kränkelnde Unternehmen in Kooperation mit ihrerseits sterbenskranken ausländischen Konzernen gedrängt werden, und zwar vom Staat, dann ist das eigentlich ein Fall für den Staatsanwalt. Ist das nicht Untreue zu Lasten des Gemeinwesens?“ (Reinhard Müller, Insolvent, FAZ, 12.6.)
Sie versauen mit ihren unhaltbaren Versprechungen auch
noch die Gesinnung in ihrem Volk. Anstatt es zur rechten
Krisenhaltung zu erziehen, sind die demokratischen
Populisten Getriebene ihrer falschen Vorstellungen
darüber, was das Volk von ihnen verlangen würde. Als
windelweiche Stimmungspolitiker
glauben sie, sich
das Volk mittels ihres Milliardenweitwurfs
in
Krisenzeiten gewogen halten zu müssen. Das plumpe
Festhalten an der alten Mär vom Schutzheiligen der
Arbeitnehmer
(SZ) ist
aber ein unverzeihlicher Fehler. In Wirklichkeit nämlich
– das ist spätestens mit der Niederlage der SPD bei den
Europa-Wahlen den Demokratiekennern klar – ist das
deutsche Volk viel besser als sein schlechter Ruf, den es
bei Parteipolitikern wie Müntefering und Seehofer hat:
„Wähler lieben Wahrheit – Etwas Unerwartetes und für viele Polit-Profis Unvorstellbares ist diese Woche geschehen: Im ZDF-Politbarometer schoss Wirtschaftsminister Guttenberg (CSU), der erst seit vier Monaten im Amt ist, an Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier (SPD) vorbei, der bisher immer der beliebteste Minister war. Guttenberg, der Opel nicht um jeden Preis retten wollte. Guttenberg, der nicht mit Staatshilfen wuchert. Guttenberg, der keine Arbeitsplatzgarantien gibt und den Leuten nicht nach dem Mund redet – Guttenberg, den die SPD als den ‚schwarzen Baron aus Bayern‘ verspottet und zum kalten Herzen der Union machen wollte. Der Unpopuläre, der Unbequeme steigt in der Wählergunst, die Vielversprecher sacken ab. Das ist die Lehre der Umfragen. Die Bürger haben Gutenbergs Mut zur Wahrheit belohnt ... die Bürger spüren seinen Respekt vor ihnen. Spüren, dass er ihre Steuergelder nicht aufs Spiel setzt, um bei Wahlen zu punkten ... Mehr als das gute Abschneiden Guttenbergs freut mich dieser Denkzettel für den Populismus. Liebe Politiker, merkt euch: Es ist eine große Sünde, die Wähler zu unterschätzen!“ (Kommentar, Bild.de, Juni 2009)
Letztlich funktioniert Demokratie also doch, die Nation
kann aufatmen. Erstens gibt es noch Politiker im Lande,
die ihr Volk nicht unterschätzen
, die bei ihm
nicht den dringlichen Wunsch nach Verschonung von Armut
mutmaßen. Fähige Krisenmanager wissen, was sie an ihrem
Volk in schweren Zeiten haben: Ein Kollektiv, das sich
demokratische Führer wünscht, die umstandslos die Räson
von Eigentum und Staat durchsetzen und ihm in aller
Klarheit ansagen, dass es deswegen von staatlicher Seite
keine Unterstützung zur Abwendung der katastrophalen
Krisenfolgen erwarten darf. Und zweitens, vielleicht noch
erfreulicher: Das deutsche Volk honoriert dieses
Kompliment, dass es in unverwüstlicher Treue zur
politischen Führung steht und bereit ist, das
heraufziehende Elend tapfer durchzustehen: Im Juli
rangiert Karl-Theodor zu Guttenberg auf Platz 1 im
Barometer der beliebtesten Politiker Deutschlands.