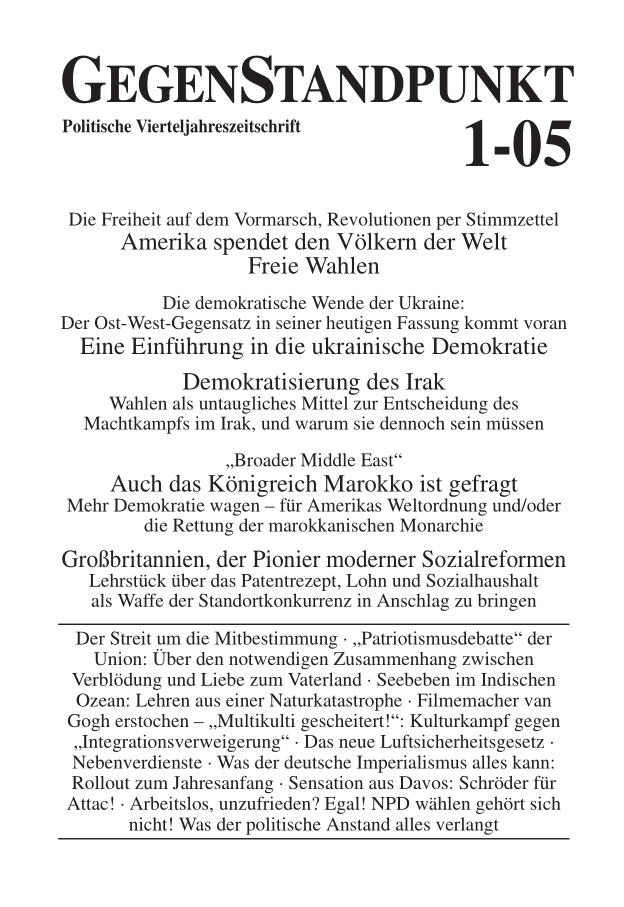Großbritannien, der Pionier moderner Sozialreformen
Lehrstück über das Patentrezept, Lohn und Sozialhaushalt als Waffe der Standortkonkurrenz in Anschlag zu bringen
Großbritannien hat sich sogar der äußerst bescheidenen europäischen Sozialcharta verweigert und besteht darauf, sich in seiner nationalen Selbstbehauptung durch keinerlei europäische Pflichten in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Arbeiterrechte behindern zu lassen. Genauso entschieden wie damals die „europaskeptische“ Thatcher verteidigt heute ein „proeuropäischer“ Blair das britische „opt-out“ gegen Brüssel. Auch er betrachtet die rücksichtslose Behandlung des Arbeitsvolks als einen nationalen Vorteil und Vorsprung, den er sich nicht nehmen lässt. Und er sieht sich durch die Entwicklung bestätigt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Der „Thatcherismus“: Eine gewaltige Reform zur Aufrüstung der imperialistischen Basis der Nation
- Die elementare Voraussetzung: Brechung der Gewerkschaftsmacht
- Der Arbeitsmarkt
- Die nationale Errungenschaft einer „deregulierten“ und „flexiblen“ Arbeiterklasse
- Die sozialpolitische Absicherung dieser Errungenschaft durch New Labour: „welfare to work“ und gesetzlicher Mindestlohn für die „working poor“
- Der staatliche Kampf um die Billigkeit des Volks in Zeiten des Wirtschaftsbooms
- Die Wohnungsfrage
- Das Rentensystem
- Das Gesundheitswesen
Großbritannien, der Pionier moderner
Sozialreformen
Lehrstück über das Patentrezept,
Lohn und Sozialhaushalt als Waffe der Standortkonkurrenz
in Anschlag zu bringen
Auf dem einheitlichen Binnenmarkt sind Zölle und Handelshemmnisse abgeschafft, damit das Kapital der europäischen Staaten seine Konkurrenz unter gleichen Bedingungen ausficht. Die Behandlung der Arbeitskraft gehört nicht dazu. Beim Umgang mit der Arbeiterklasse behalten sich die Mitgliedstaaten Sondertouren vor, um alle Elemente des proletarischen Lebensstandards als Mittel der innereuropäischen Konkurrenz zu nutzen. Großbritannien hat sich sogar der äußerst bescheidenen europäischen Sozialcharta verweigert und besteht darauf, sich in seiner nationalen Selbstbehauptung durch keinerlei europäische Pflichten in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Arbeiterrechte behindern zu lassen. Genauso entschieden wie damals die „europaskeptische“ Thatcher verteidigt heute ein „proeuropäischer“ Blair das britische „opt-out“ gegen Brüssel. Auch er betrachtet die rücksichtslose Behandlung des Arbeitsvolks als einen nationalen Vorteil und Vorsprung, den er sich nicht nehmen lässt. Und er sieht sich durch die Entwicklung bestätigt.
Kaum ein Tag, an dem nicht der erste Minister ihrer
Majestät seinen Stolz auf den wirtschaftlichen Zustand
des Vereinigten Königreichs vermeldet: Britannien hat
allen Grund zur Zufriedenheit. Schon wieder haben 2
Millionen mehr Menschen einen Arbeitsplatz. Allein das
Vereinigte Königreich hat ein durchgängiges Wachstum in
jedem einzelnen Quartal während der gesamten letzten 7
Jahre – eine Bilanz, die kein anderes Land der G8
aufweisen kann. Britannien funktioniert.
[1] Vorbei sind die
unrühmlichen Zeiten des wirtschaftlichen Abstiegs,
spätestens seit Mitte der 90er Jahre hat man das Etikett
des „kranken Mannes in Europa“ an Deutschland
weitergereicht. Und die gesamte Nation ist sich einig,
was der Grund für die erfolgreiche
wirtschaftliche Genesung ist: Großbritannien hat schon
vor 20 Jahren die Sozialreformen unternommen,
welche die Staaten auf dem Kontinent, allen voran
Deutschland, heute machen müssen. Früher als andere hat
man auf der Insel den Standpunkt eingenommen, dass der
überkommene Lebensstandard der Arbeiterklasse ein
national schädlicher Luxus ist und dessen Absenkung der
entscheidende Hebel, um den nationalen Niedergang zu
stoppen und umzukehren. Mit diesem Rezept hat
Großbritannien einen so beispiellosen Aufschwung
hingelegt, dass das europäische Ausland diesem
unbestrittenen Vorbild für die eigenen längst
überfälligen Reformen jeden Respekt zollt:
„Ein Jahrzehnt des Aufschwungs – Reformen und niedrigere Ansprüche der Bevölkerung ebnen den Weg“ titelt die FAZ in ihrem Länderbericht vom 1.11.2004 und fährt fort: „Großbritannien steht gut da. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosenquote ist niedrig. Das Land profitiert noch immer von den Reformen der Thatcher-Ära. Die von ihr eingeleitete Liberalisierung des Wirtschaftssystems hat zu großer Prosperität geführt.“
Da kann auch der deutsche Kanzler nur zustimmen, indem er den Kollegen Blair erkennbar um seine erzkonservative Amtsvorgängerin beneidet:
„Frage SZ: Die Labour-Party steht besser da als die SPD, und wird, was bei Ihnen zweifelhaft ist, die Wahlen wieder gewinnen – trotz des Zorns über Blairs Beteiligung am Irak-Krieg. Warum steht Labour besser da? Antwort Schröder: In Großbritannien war die Reform der sozialen Sicherungssysteme schon vor Tony Blair, nämlich in der Ära Thatcher, abgeschlossen; und Tony Blair hatte die Chance, die Fehler, die in der Thatcher-Ära gemacht worden sind, in Ordnung zu bringen. Es ist einfacher, Korrekturen an der Reform zu machen als die Reform selbst.“ (SZ, 2.10.04)
‚Einfacher‘ oder nicht – jedenfalls sind die Nachfolger der ‚Eisernen Lady‘ heute schon mit gewissen Reformen der Reform befasst, an der sich andere ein Vorbild nehmen. Im Vereinigen Königreich lassen sich nicht nur die ruinösen Wirkungen studieren, die die gezielte Verbilligung des Kostenfaktors Arbeit auf die Arbeiter selbst hat, sondern auch gewisse kontraproduktive Wirkungen auf den Zweck, für den die Reform veranstaltet wird: Solidität und Prosperität der britischen Ökonomie. Deutlich wird aber auch, dass eine Staatsführung, die den Weg solcher Reformen einmal eingeschlagen hat, auch angesichts unerwünschter Nebenwirkungen nie mehr an eine grundsätzliche Korrektur denkt, sondern ihre Anstrengungen auf die Perfektionierung dieses Kurses richtet.
Der „Thatcherismus“: Eine gewaltige Reform zur Aufrüstung der imperialistischen Basis der Nation
Thatcher beginnt ihre Amtszeit 1979 mit einer vernichtenden Bilanz zur Lage der Nation: „Britain is a nation in retreat (eine Nation auf dem Rückzug)!“ Der anhaltende Niedergang der Wirtschaft lässt nicht nur die britischen Erträge aus dem globalen Geschäft zunehmend geringer ausfallen, auch die von einer imperialistischen Macht wie Großbritannien beanspruchte Kompetenz zur weltweiten Ordnungsstiftung leidet darunter. Dabei geht Thatcher wie selbstverständlich davon aus, dass ihr Vereinigtes Königreich in der globalen Welt von Geschäft und Gewalt nach wie vor viel zu erledigen hat: den Ausbau einer privilegierten Partnerschaft mit der Supermacht USA im Kalten Krieg, den Beweis der militärischen Fähigkeiten zur eigenständigen Ordnungsstiftung in einem Falkland-Krieg und nicht zuletzt die Etablierung als Mit-Führungsmacht in der Europa-Konkurrenz. Die Diagnose, in der internationalen Konkurrenz eine Niederlage nach der anderen zu kassieren, ist der Auftakt zu einer gewaltigen Reformanstrengung. Die „Eiserne Lady“ macht sich daran, das gesamte Innenleben des britischen Wirtschaftsstandorts umzukrempeln, auf dass er den hohen imperialistischen Ansprüchen der Nation wieder zu genügen vermag.
Die in staatlichem Besitz befindliche oder vom Staat subventionierte überkommene Industriebasis ist das erste Reformobjekt. Zwar leben ganze Regionen in Mittel- und Nordengland, Wales und Schottland von der Kohle-, Stahl- und Werftenindustrie und ein Gutteil der britischen Arbeiterklasse verdient hier ihren Lebensunterhalt. Die Energie- und Rohstoffbasis des britischen Kapitalismus ist aber selbst keine Profitquelle, sondern wie in vielen Ländern ein wachsender Posten unter den Ausgaben des Staatshaushalts. Was keine Gewinne erwirtschaftet, hat kein Existenzrecht in der Marktwirtschaft – lautet die Maxime der „Eisernen Lady“, mit der sie die radikale Abwicklung ganzer Industriebranchen samt der darin beschäftigten Lohnarbeiter in Angriff nimmt. Statt auf die „veraltete“ Schwerindustrie zu setzen, soll die Nation ihr kapitalistisches Wachstum auf das Nordseeöl, den erreichten Status als Weltfinanzzentrum und „Zukunftstechnologien“ wie die Bio- und Pharmaindustrie gründen, und sich als attraktiver Standort für ausländische Kapitalinvestitionen herrichten. Gewinner der globalen Konkurrenz, Multis aus aller Herren Länder, amerikanische Computerkapitale ebenso wie japanische Autoproduzenten oder deutsche Elektronikkonzerne sollen sich im Land anlegen. Für die notwendige Attraktivität des Standorts Großbritannien will Thatcher durch die radikale Senkung des nationalen Lohnniveaus sorgen. Last but not least ist der „Thatcherismus“ Auftakt für ein gigantisches Privatisierungsprogramm: Die bislang vom Staat betriebenen und aus dem Steueraufkommen mitfinanzierten öffentlichen Dienstleistungen, von Post und Telekommunikation über die Wasser- und Stromversorgung bis hin zum Transportwesen auf Schienen und in der Luft, werden kapitalkräftigen Investoren zum Kauf angeboten; zuvor allerdings werden die öffentlichen Dienste von überkommenen Besitzständen der Bediensteten gereinigt, damit dann private Kapitale aus weniger und billigeren ehemals staatlichen Arbeitskräften auch einen ordentlichen Profit erwirtschaften können.
Das zweite große Projekt, um Großbritannien wieder den ihm gebührenden Platz in der Konkurrenz der Nationen zu erobern, ist die „Reform der sozialen Sicherungssysteme“. An den steigenden Haushaltsaufwendungen für die staatliche Betreuung der kapitalistischen Armut entdeckt Lady Thatcher nur unproduktive Kosten. Für die Maßnahmen früherer Labour-, aber auch Tory-Regierungen, im System des Sozialstaates die Inanspruchnahme von Leistungen zu beschränken und darüber den Staatshaushalt zu sanieren, hat sie bloß Verachtung übrig. Solche Korrekturen hält sie für „halbherzig“. „Wets“ (Weichlinge) sind für sie alle, die noch immer der veralteten Auffassung anhängen, die einmal bei der Gründung des Sozialstaates Pate stand: dass nämlich angesichts der zerstörerischen Wirkungen der kapitalistischen Reichtumsproduktion auf die unmittelbaren Produzenten staatliche Eingriffe für die Wiederherstellung einer für das Kapital brauchbaren Arbeiterklasse und für den Erhalt des sozialen Friedens notwendig sind. Der Lady zufolge gilt die Umkehrung: Rücksichten auf die Lebenslage der Arbeiterklasse haben Britannien arm gemacht; nur mehr proletarische Armut, der fundamentale Abbau des Sozialstaates, verspricht einen Wiederaufstieg der britischen Ökonomie. Entsprechend radikal geht sie zur Sache bei der Absenkung von sozialstaatlichen Leistungen und der Reduzierung der Anspruchsberechtigten nach der Maxime, wer sich nicht um Arbeit für jeden Preis bemüht, gehört nicht zu den „deserving poor“ und hat den Anspruch auf „welfare“ verwirkt.
Die elementare Voraussetzung: Brechung der Gewerkschaftsmacht
Die Regierungschefin ist sich von vorneherein sicher,
dass es mit einem regierungsamtlichen Beschluss, die
kapitalistischen Reichtumsquellen der Nation zum Sprudeln
zu bringen, dafür die britische Wirtschaft
gesundzuschrumpfen und die staatlichen Dienste zu
privatisieren, allein nicht getan ist, solange der
Regierung ein erklärter Feind ihrer Modernisierung im Weg
steht: die Trade Unions. Und dass der Weg zur den von ihr
beabsichtigten radikalen Sozialreformen nur über die
Ausschaltung der Gewerkschaft führt, davon geht sie schon
gleich aus. Mit den Trade Unions verfügen die betroffenen
Arbeiter nämlich über eine durchaus machtvolle, ebenso
kampferprobte wie kampfbereite Gewerkschaftsorganisation,
die sich gegen das staatliche Oktroi von Lohnsenkung und
Entlassung zur Wehr setzen und entschiedene Gegner des
angesagten sozialstaatlichen Paradigmenwechsels sind, der
die Vorsorge für die Notlagen des kapitalistischen
Arbeitslebens zu einer „eigenverantwortlichen Aufgabe“
derjenigen erklärt, die sie sich nicht leisten können.
Für die Premierministerin steht daher fest, dass die
Senkung des nationalen Lohnniveaus, die Liquidierung
unrentabler Wirtschaftsbranchen und die Privatisierung
überkommener staatlicher Infrastrukturaufgaben eine
einzige Gewaltfrage ist, also die Brechung der
Gewerkschaftsmacht erfordert. Das Mantra der „Eisernen
Lady“ – Die Lösung des Gewerkschaftsproblems ist der
Schlüssel für die Wiederherstellung Großbritanniens.
– proklamiert den Klassenkampf von oben gegen die Trade
Unions als erste Tat des nationalen Reformprojektes. Die
Entmachtung der Gewerkschaften ist die alles
entscheidende Bedingung, um das Programm mit all seinen
Härten erfolgreich zu vollstrecken. Denn die britischen
Trade Unions hatten die nötige demokratische Reife
vermissen lassen, die politische Lizenz zum Ausgleich der
überlegenen Kapitalmacht zu einer unverantwortlichen
Missachtung ihres Auftrags ausgenutzt und sich als
kämpferische und bisweilen kompromisslose Lohnmaschine
für ihre Mitglieder aufgeführt – anstatt wie ihre
deutschen Pendants als „Tarifpartner“ Verantwortung zu
tragen und sich zugunsten von Gewinnen und
Wirtschaftswachstum sozialfriedlich zu bescheiden.
Entsprechend militant macht sich die „Eiserne Lady“ an die „Lösung des Gewerkschaftsproblems“, die Brechung der gewerkschaftlichen Macht und die Enteignung überkommener proletarischer Besitzstände in den ihrem direkten Zugriff unterstellten staatlichen Wirtschaftssektoren. Gleichzeitig stachelt sie ihre Kapitalistenklasse zu entsprechender Radikalität im Klassenkampf an. Das lassen die sich nicht zweimal sagen, kündigen den Gewerkschaften die bisherige Anerkennung auf und machen sich daran, die Verankerung der Gewerkschaft im Betrieb zu brechen und die Ausbeutungskonditionen in ihren Betrieben entscheidend zu ihren Gunsten zu verändern. Der Staat betätigt sich dabei als machtvoller Agent der Freiheit des Kapitals. Die „Eiserne Lady“ sorgt durch den Einsatz der rechtlichen und polizeilichen, wenn nötig auch militärischen Gewaltmittel dafür, die Auseinandersetzung zugunsten der Kapitalseite zu entscheiden.[2] Das letzte große Gefecht gegen den „enemy within“ (inneren Feind) endet mit der vernichtenden Niederlage der Bergarbeitergewerkschaft NUM im großen Streik von 1984/85.[3]
Damit ist der Weg frei für das angestrebte gewaltige Aufrüstungsprogramm an der imperialistischen Basis der Nation, hinter dessen Errungenschaften keiner mehr zurück will. Das von Margaret Thatcher in Anschlag gebrachte Patentrezept moderner Sozialreformen – die Gewerkschaftsmacht politisch brechen, den Lohn als entscheidendes Konkurrenzmittel handhaben, den Sozialhaushalt als Mittel der Standortkonkurrenz gestalten – hat nicht nur die politische Konkurrenz auf der Insel überzeugt und eine ganze Strömung bürgerlicher Politik, die klassische Sozialdemokratie, auf den Misthaufen der Geschichte befördert.[4] Es hat mittlerweile überall in Europa Schule gemacht.
Der Arbeitsmarkt
Die nationale Errungenschaft einer „deregulierten“ und „flexiblen“ Arbeiterklasse
„Länger arbeiten für weniger Geld“ – ist in Großbritannien schon lange Realität. Die politischen Verwalter der Insel regieren seit der Thatcher-Ära über einen „deregulierten“ Arbeitsmarkt und sehr „flexible“ Arbeitskräfte. Vorbei sind die Zeiten des „Heizers auf der E-Lok“, der 5-Uhr-Teepause am Fließband und der meisten Streiktage in Europa. Heute arbeitet der britische Arbeitnehmer ganz ohne überkommene Besitzstände und „Tarifkorsett“ nach dem Lohn- und Zeitdiktat seines Arbeitgebers, so dass die Löhne zu den vergleichsweise niedrigen und die Arbeitszeiten zu den definitiv längsten in der Europäischen Union gehören.[5] Seit Thatcher zählt die britische Nation zu ihrem wertvollsten Kapital eine Arbeiterklasse, die auf Kommando Voll- oder Teilzeit arbeitet, ob billiger Mann oder noch billigere Frau,[6] und dann auch wieder mehr als die von der EU erlaubten wöchentlichen 48 Stunden in Fabrik oder Büro verbringt, wenn es das Kapital so will. Das Ausland schaut denn auch nicht mehr mit spöttischer Verachtung, sondern neidvoller Anerkennung auf die „englischen Verhältnisse“:
„Es ist unverkennbar: Die Blair-Administration hat bei ihrem Amtsantritt einen anderen Arbeitsmarkt vorgefunden, als er im Ernstfall auf Schröder in Deutschland wartet. Achtzehn Jahre konservativer Regierung haben in Großbritannien die Löhne gesenkt, den Arbeitsschutz zusammengestrichen, die Gewerkschaften geschwächt – und im Gegenzug ein umstrittenes ‚Jobwunder‘ gebracht. Gestützt durch die starke Konjunktur sank die registrierte Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren kräftig. Viele Jobs ernähren freilich kaum ihren Mann“ (Fachkundiger deutscher Kommentar vor dem Wahlsieg von Schröder in: Die Zeit, Nr.10/1998)
In einer entscheidenden Hinsicht ist die britische Arbeitswelt je schon „dereguliert“: Das „free collective bargaining“[7] sorgt dafür, dass die Aushandlung von Lohn und Leistung eine Frage der unmittelbaren Kräfteverhältnisse im Betrieb ist, wobei die Belegschaft den angedrohten wie durchgeführten Streik als ebenso selbstverständliches Kampfmittel handhabt wie das Management die Aussperrung. Kein Gesetz schreibt in Großbritannien den Arbeitskampf-Parteien den Zwang zur Einigung als Tarifpartner vor, erlaubt den Streik bestenfalls als allerletztes Mittel und versieht den erreichten Tarifabschluss mit einer Friedenspflicht, wie man das aus dem deutschen Tarifvertragsrecht kennt. Genau diese „Regulierungen“ nicht zu haben, galt einmal als der schwerwiegendste Nachteil des britischen Standorts, der ihn viele Millionen durch Streik verlorene Arbeitstage koste und es den britischen Gewerkschaften erlaube, proletarische Besitzstände zu erkämpfen und zu verteidigen, die mit dem kapitalistischen Fortschritt der Nation einfach unverträglich sind. Seitdem allerdings die „Eiserne Lady“ die Macht der Gewerkschaften zerstört und dadurch die Arbeitsbeziehungen „liberalisiert“ hat, entdeckt man nur Vorzüge in dem typisch britischen System der „freien“ Lohnfindung: die Kapitalseite kann ganz einseitig gemäß den Notwendigkeiten des Profits vor Ort Lohn und Leistung, Arbeitszeit und Urlaub für ihre Arbeitskräfte diktieren – weder beschränkt durch branchenweite Abmachungen eines Flächentarifvertrags, noch durch von sozialstaatlichen Gesichtspunkten geleitete Gesetze zu Arbeitszeit und Kündigung, noch durch Mitbestimmungsrechte. Die lohnsenkenden Potenzen des „deregulierten“ Arbeitsmarkts schätzen die Standortverwalter nicht nur wegen der Geschäftsbilanzen der heimischen Kapitalisten, sondern auch ob seiner Attraktionskraft auf ausländisches Kapital, das sich die im internationalen Vergleich billigen Löhne und attraktiven Arbeitsbedingungen nicht entgehen lässt und auf der Insel investiert.[8]
Ihren Nachfolgern übergibt Thatcher einen Arbeitsmarkt, der eine stets anschwellende Armee von Lohnarbeitern hervorbringt, die vom Lohn für ihre Arbeit schlechterdings nicht mehr leben können und „working poor“ genannt werden. Davon bevölkern inzwischen rund 2 Millionen den Arbeitsmarkt, neben den rund 1,5 Millionen registrierten Arbeitslosen der aktiven Reservearmee und dem toten Gewicht von 4 Millionen Briten, die ganz aus dem Arbeitsmarkt fallen und auf Sozialhilfe (income support) angewiesenen sind.
Die sozialpolitische Absicherung dieser Errungenschaft durch New Labour: „welfare to work“ und gesetzlicher Mindestlohn für die „working poor“
Das „Erbe des Thatcherismus“ – Millionen freigesetzter
Arbeitskräfte als Produkt der erfolgreichen Erneuerung
des Standorts und als Garant für weitere Lohndrückerei –
nimmt New Labour dankend an. Allerdings findet Blair,
dass über 5 Millionen Briten mit Anspruch auf
Arbeitslosenunterstützung oder Sozialhilfe eine
untragbare Belastung für den Sozialhaushalt sind; zwar
hat seine Vorgängerin die Leistungen für Arbeitslose und
Sozialhilfeempfänger immer wieder zusammengekürzt, aber
deren anschwellende Zahl hat noch jeden Sparerfolg ihrer
„Austeritätspolitik“ zunichte gemacht. Statt
„Arbeitslosigkeit zu finanzieren“, soll der Staat
„Beschäftigung fördern und fordern“, so die
sozialpolitische Generalleitlinie von New Labour, mit der
die Partei eine Art Urheberrecht für moderne
Sozialpolitik in Europa beansprucht.[9] „Welfare to work“ heißt
schlicht: Der Staat streicht die staatliche Unterstützung
und zwingt Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zur
Arbeit, für die es dann, aber auch nur dann, staatliche
Unterstützung gibt. Dass unter dem Strich mehr an Stütze
eingespart wird, als die zusätzlichen Maßnahmen zur
Arbeitsförderung kosten, ist von der Labour-Regierung
zwar bezweckt, aber entscheidender ist, dass sie damit
das Millionenheer von Arbeitslosen und
Sozialhilfeempfängern in ein riesiges Reservoir von
Billigstarbeitskräften zwangsverwandelt – für
ausbeuterische Sonderbeschäftigungsverhältnisse, die von
vorneherein nicht mit Lohnarbeitsverhältnissen zu
verwechseln sind, die ihren Mann oder ihre Frau ernähren.
Der beste Weg aus Armut und gesellschaftlichem
Ausschluss ist Beschäftigung
(Tony Blair) – auch und gerade dann, wenn
dieser Weg in die Arbeit schnurstracks wieder in die
Armut zurückführt und Millionen working poor
produziert.
Für die hat New Labour dann eine weitere sozialpolitische Errungenschaft bereit, den „National Minimum Wage“.[10]
Über zwei Jahrzehnte erfolgreicher Senkung des nationalen Lohnniveaus haben nämlich dazu geführt, dass ganze Abteilungen der auf den unteren Stufen der Arbeitsmarkthierarchie Beschäftigten von ihrem Einkommen ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie einfach nicht mehr bestreiten können. Der gezahlte Lohn gewährleistet nicht mehr die gesellschaftsdienlichen Leistungen, die eine politische Gewalt von ihm erwartet: Wohnungselend, aktuelle Kinder- und zukünftige Altersarmut, Verwahrlosung und Kriminalität sind die Folgen des freien Falls, in den Regierung und Unternehmer die Löhne versetzt haben. Die Einführung eines staatlichen Mindestlohns zieht eine Untergrenze für die Absenkung des nationalen Lohnniveaus, ist damit aber zugleich eine Einladung an jeden Arbeitgeber, die Löhne auf dieses Niveau zu drücken. Nicht zuletzt stellt New Labour mit dem „National Minimum Wage“ klar, wo in Großbritannien bestenfalls „Ausbeutung“ und „Armut“ anfängt – bei unter 4,85 £ die Stunde für einen erwachsenen Arbeitnehmer.
Kaum ist der Mindestlohn eingeführt, entsteht der nächste „Korrekturbedarf“: Die damit beglückten „working poor“ können von ihrem staatlich garantierten Einkommen nämlich nicht einmal die elementarsten Lebensnotwendigkeiten bestreiten. Einfach die Mindestlöhne zu erhöhen, ist dem Profit der Unternehmer selbstverständlich nicht zuzumuten; stattdessen entdeckt New Labour den Widerspruch, dass der Staat durch Besteuerung von Niedriglöhnen einiges zur Verarmung von Millionen Familien beiträgt, die so erzielten Staatseinnahmen dann aber doch bloß wieder als Sozialhilfe für die verarmte Bevölkerung ausgeben muss. Damit die 2 Millionen im Billiglohnsektor Beschäftigten ihren gesellschaftlichen Pflichten zum Unterhalt einer Familie und zur verantwortlichen Aufzucht des Nachwuchs nachkommen können, legt New Labour mit einem Programm gegen die Armut arbeitender Familien nach: Der 1999 eingeführte „Working Family Tax Credit“ ist ein Steuernachlass, der über den Arbeitgeber erfolgt und den ausgezahlten Lohn erhöht, nachdem eine Bedürftigkeitsprüfung der Einkommensverhältnisse die Armut zweifelsfrei bestätigt hat; er soll dafür sorgen, dass arbeitende Familien wöchentlich 24 £ (ca. 36 Euro) mehr in der Tasche haben, und ein Mindesteinkommen von 180 £ pro Woche garantieren. Gleichzeitig beseitigt die Regierung damit die „Armutsfalle“, womit sie den für den Staat ärgerlichen Zustand bezeichnet, dass sich insbesondere Alleinerziehende, die von Sozialhilfe leben, nicht besser stellen, wenn sie einen Billigjob annehmen, und es folgerichtig lassen. 24 £ die Woche mehr für Billiglohnarbeit sind ab sofort ein Angebot, das die Betroffenen nicht ablehnen können, weil ihnen sonst die staatliche Stütze gekürzt oder gestrichen wird – so billig ist die Bekämpfung der „social exclusion“, die sich New Labour auf ihre Fahnen geschrieben hat.
Der staatliche Kampf um die Billigkeit des Volks in Zeiten des Wirtschaftsbooms
So steigt mitten im längsten Wirtschaftsaufschwung der britischen Geschichte die Zahl der „working poor“. Dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, spricht selbstverständlich nicht gegen das Patentrezept, den Lohn und Staatshaushalt als die Waffe der Standortkonkurrenz zu handhaben, sondern für es: „Britannien funktioniert!“ (Tony Blair mit der ihm eigenen Prägnanz). Offensiv dementiert der oberste Standortverwalter die Vorstellung, mit der Senkung des nationalen Lohnniveaus könnte es auch einmal vorbei sein, wenn die Wirtschaft, von der alles abhängt, so schön wächst. Dem Eigenlob, „Vollbeschäftigung“ (die per definitionem im Vereinigten Königreich dann erzielt ist, wenn die Zahl der Arbeitslosen unter 1,5 Millionen und die Arbeitslosenquote unter 5 Prozent fällt) herbeiregiert zu haben, folgt die Klage über die „Arbeitskräfteknappheit“, die Anlass zur Befürchtung gibt, mit der steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften könnten auch die Löhne und Gehälter steigen. Das ist für die Labour-Regierung kein Anlass zur Freude über die sonst bei jeder Gelegenheit gepriesenen „market forces“ mit ihrem „freien Spiel von Angebot und Nachfrage“, sondern ein ernstes Problem. Beim Preis der Arbeit darf nicht sein, was sonst bei Preisen gilt! Die Niedrigkeit des Lohns ist eben nicht nur das Instrument des „Thatcherismus“, den nationalen Kapitalismus aus der Krise zu führen, welches nach erfolgreicher Grundsanierung der Nation wieder im Arsenal eines „herzlosen“ Kapitalismus abgelegt werden kann, sondern ein unverzichtbarer Dauerhebel jeder Regierung für alle Phasen des kapitalistischen Wirtschaftszyklus. Gerade auch im Boom hat der Staat mit aller Macht darauf zu achten, dass der Fortschritt des Kapitals nicht zur materiellen Besserstellung der Arbeiterklasse führt und die erreichten Vorteile in der internationalen Konkurrenz gefährdet. Die Gefahr, dass der Wirtschaftsboom mit der sinkenden Zahl der Arbeitslosen den Druck der industriellen Reservearmee auf die Löhne mindern könnte, ist eine einzige Herausforderung für die Regierung, mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln einem steigenden nationalen Einkommensniveau entgegenzuwirken.
Dort, wo der Staat noch selbst Arbeitgeber ist, geht die Labour-Regierung ihrer Kapitalistenklasse mit gutem Beispiel voran, das sich hinter der Härte einer „Eisernen Lady“ nicht verstecken muss. Die Lohnforderung der Feuerwehrleute von 40 Prozent kommt ihr da gerade recht, um an der Fire Brigades Union ein Exempel zu statuieren: Den Streik erstickt der frühere Gewerkschafter und jetzige Vizepremier John Prescott mit dem streikbrechenden Einsatz des Militärs. Dort, wo der Staat Organisator der gesellschaftlichen Ausbeutungsbedingungen ist, konzentriert er sich auf die Aufgabe, dem „Arbeitskräftemangel“ entgegenzuwirken, über den seine Unternehmer neuerdings immer lauter klagen. Die jüngste Erweiterungsrunde der Europäischen Union nutzt er, um dem englischen Arbeitsmarkt die konkurrenzlos billige osteuropäische Arbeitswilligkeit zu erschließen. Im Gegensatz zu Deutschland und den meisten anderen alten EU-Staaten, die mit Übergangsfristen von bis zu 7 Jahren die Freizügigkeit Arbeit suchender Bürger aus den neuen Mitgliedsländern beschränken, lässt Tony Blair Arbeitsimmigranten aus den osteuropäischen Mitgliedsstaaten ohne Beschränkung einreisen.[11] Seit Mai 2004 bereichern schon rund 100.000 osteuropäische Arbeitskräfte den britischen Niedriglohnsektor, verdingen sich als Reinigungskräfte in Hotels und Krankenhäusern oder als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft. So sorgt der britische Staat mit dem Import von ausländischen Billigarbeitskräften dafür, dass die fällige Erhöhung des staatlichen Mindestlohns bestenfalls die Inflation ausgleicht.
Die Wohnungsfrage
Hauseigentum und „mortgage“ – eine britische Besonderheit in den Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft
Der eigentumslose Proletarier ist in Großbritannien stolzer Hauseigentümer. Während in Deutschland knapp ein Drittel der Haushalte in der eigenen Wohnung leben, besitzen auf der Insel über 70 Prozent der Haushalte ein eigenes Haus.[12] Zwar reicht auch in der Nation, die den Kapitalismus erfunden hat, der vom Unternehmer gezahlte Lohn nicht hin, das elementare Lebensbedürfnis nach einem Dach über dem Kopf zu befriedigen – er muss aber dafür reichen. Ein umfangreicher Geschäftszweig von Bausparkassen (building societies), Banken und Versicherungsunternehmen bietet sich an, der arbeitenden Bevölkerung hilfreich zur Seite zu stehen. In der proletarischen Wohnungsnot sehen sie eine solide Basis ihres Geldgeschäfts: Mit einem Hypothekenkredit ermöglichen sie den Vermögenslosen den Erwerb eines Hauses – um den Preis, dass ein beträchtlicher Teil des verfügbaren Arbeitnehmereinkommens direkt in die Bedienung der „mortgage“[13] genannten Hypothek zum Wohle der Bankbilanz fließt. Wie viel von seinem monatlichen Einkommen der Brite direkt an die Bank überweist und nicht mehr für seine sonstigen Lebensbedürfnisse zur Verfügung hat, ändert sich beständig in Abhängigkeit von dem nationalen Zinsniveau – Immobilien sind im Regelfall mit variabel verzinsten Darlehen finanziert. Die wechselnde Höhe der „mortgage“ bestimmt unmittelbar die verfügbare Kaufkraft der Haushalte, somit den nationalen Lebensstandard. Niedrige und sinkende Kreditzinsen sind da aus der Sicht des verschuldeten Hauseigentümers genau so gut wie eine Lohnerhöhung, während steigende Zinsen noch jede Steigerung des Lohns auffressen. So kommt es, dass das vorhandene Einkommen, aus dem ein britischer Arbeitnehmer seine Existenz zu bestreiten gezwungen ist, nicht nur die abhängige Variable der profitlichen Kalkulation seines Arbeitgebers, sondern gleich auch noch die ebenso abhängige Variable der Geschäftskalkulation der Immobilienbanken ist.
Die gleiche Wirkung auf Einkommen und Lebensstandard geht von der Entwicklung der Immobilienpreise aus:[14] Steigende Hauspreise bei niedrigen Zinsen – wie in den vergangenen 10 Jahren des britischen „property booms“ – verringern nicht nur die monatlichen Hypothekenzahlungen, sie erlauben es den Hausbesitzern auch, mit der Sicherheit einer im Wert gestiegenen Immobilie im Rücken sich in noch größerem Umfang bei der Bank zu verschulden, um immer wieder hinausgeschobene Konsumausgaben vorzuziehen. Darüber haben es die britischen Haushalte bis heute zu beeindruckenden 1000 Milliarden £ (2004) privater Verschuldung gebracht – eine volkswirtschaftliche Größe, deren Bedeutung als steigende Kaufkraft, sprich Binnennachfrage, heimische Wirtschaftsexperten enorm schätzen – mit periodisch fatalen Folgen für eben diese Haushalte.[15] Ein Crash der Hauspreise hinterlässt nämlich nicht nur überschuldete Hauseigentümer mit den Verbindlichkeiten einer „mortgage“, die den aktuellen Immobilienwert weit übertrifft – „negative equity“ heißt diese persönliche Notsituation in der nüchternen Bankersprache. Er endet oft genug im Zwangsverkauf an die Bank (repossession), der nichtsdestotrotz den ehemaligen Hausbesitzer auf einem weiter zu bedienenden Schuldenberg sitzen lässt. Eine Zinserhöhung der Bank of England, die gewöhnlich den Zusammenbruch der Hauspreise einleitet, entscheidet da über Sein oder Nichtsein des britischen Arbeitnehmers und Hausbesitzers, ob er nämlich das für seine Reproduktion notwendige Häuschen halten kann, oder ob er mit dem Verlust seines Dachs über dem Kopf auch seine Reproduktionsfähigkeit überhaupt einbüßt.[16] So prekär wird eine Arbeiterexistenz, wenn aus Proletariern stolze Hauseigentümer geworden sind!
Die britische Lösung der Wohnungsfrage
Dass im 21. Jahrhundert der weit überwiegende Teil der Arbeiterklasse auf der Insel sich zur respektablen Schicht der Hauseigentümer zählen darf, liegt nicht an einem besonders ausgeprägten Zug des britischen Nationalcharakters, dem „My home is my castle!“ über alles geht. Vielmehr bezeichnet dies den Endpunkt der Wohnungspolitik in einem doppelten Sinne, dem nämlich, dass der Staat ein halbes Jahrhundert sozialen Wohnungsbau betrieben hat, und dem, dass er damit aufgehört hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat eine Labour-Regierung an, das notorische Wohnungselend der englischen Arbeiterklasse durch den Bau von Sozialwohnungen zu mildern. Bis dahin blieb der arbeitenden Bevölkerung gar nichts anderes übrig, als einen Großteil ihres Lohns an kapitalistische Grundeigentümer und profitliche Wohnungsgesellschaften wegzuzahlen, um in den tristen, oftmals feuchten und immer viel zu kleinen Unterkünften der englischen Arbeiterviertel leben zu dürfen. Die Kommunen sorgten mit dem Bau von „council houses“ und subventionierten Mieten für eine preiswerte Alternative zu Diktat und Rechnungsweise der privaten Landlords, die umso mehr Miete verlangten, je größer die Wohnungsnot und je slum-mäßiger die Behausung war. Die Programme zum „social housing“ führten dazu, dass Ende der 70er-Jahre fast ein Drittel der britischen Bevölkerung in „council houses“ und nur noch 10 Prozent privat zur Miete wohnten. Die staatlichen Subventionen für soziales Wohnen zu reduzieren und die in der Zwischenzeit ebenfalls gestiegene Anzahl der Haushalte mit eigener Wohnung weiter zu erhöhen, sind die erklärten Ziele der konservativen Regierung unter Lady Thatcher, die sie mit einer Mischung von Angebot und Zwang realisiert: Der „Housing Act“ von 1980 gibt den Mietern das Recht, ihr gemietetes „council house“ zu kaufen, während drastische Mieterhöhungen für „social housing“ dafür sorgen, dass sich die Mieter der neuen Perspektive eines Hauseigentümers und Schuldners mit entsprechender „mortgage“ nicht weiter verschließen können.[17]
An der von den Konservativen vorangetriebenen Verwandlung von Sozialmietern in ein Volk von verschuldeten Hauseigentümern will New Labour nicht rütteln,[18] weil auch diese Partei den Dienst schätzt, den Millionen von Hauseigentümern für einen florierenden Häusermarkt und die von ihm profitierenden Branchen des Finanzkapitals, der Bauwirtschaft und des Maklerwesens leisten. Und wenn dann dieselben Hauseigentümer den mittlerweile 10 Jahre andauernden Anstieg der Hauspreise zum Anlass nehmen, sich im Vertrauen auf diesen Trend immer weiter und höher zu verschulden und mit ihrer krediterweiterten Zahlungsfähigkeit für die „robuste“ inländische Kaufkraft zum Wohle des britischen Kapitalstandorts zu sorgen, dann ist die soziale Wohnungsfrage endgültig zur Zufriedenheit der Regierenden gelöst, weil wachstumsfördernd erledigt – jedenfalls fast.
Die aktuelle Neuauflage der Wohnungsfrage
Einen gewissen neuerlichen Korrektur- und Handlungsbedarf in Wohnungsangelegenheiten betrachtet auch New Labour als unvermeidlich. Der ergibt sich aus der zunächst einmal erfreulichen Tatsache des boomenden Häusermarkts, um dessen Herstellung und Fortschritt sich Konservative und Labour gleichermaßen verdient gemacht haben. Die durchschnittliche Vervierfachung der Hauspreise innerhalb der vergangenen 10 Jahre ermöglicht zwar den Hauseigentümern, sich zunehmend reicher zu rechnen, verunmöglicht aber gleichzeitig dem wohnungssuchenden Einsteiger den Erwerb. So steigt die Wohnungsnot insbesondere junger Arbeitnehmer und Familien, deren Einkommen einfach nicht mehr hinreicht für die zum Kauf erforderliche „mortgage“. Die gewohnte Karriere, mit einem kleinen und entsprechend billigen Reihenhäuschen anzufangen, um dann mit steigendem Einkommen sukzessive ein größeres, besseres und günstiger gelegenes Haus zu kaufen („climbing up the property ladder“ nennt das der Brite), geht einfach nicht mehr auf. Billiges „council housing“ steht dank erfolgreicher Privatisierung kaum noch zur Verfügung; und die Alternative, von einem privaten Landlord zu mieten, verbietet sich für die Mehrzahl der Wohnungssuchenden, wenn monatliche Mietbeträge von 3000 £ für ein kleines Reihenhaus in England der Normalfall sind – bei gewöhnlich sechsmonatiger Vertragsdauer. Seitdem sich mitten im längsten Boom der britischen Geschichte selbst gut verdienende junge Menschen keine Wohnung mehr leisten können – für die steigende Anzahl der im florierenden Billiglohnsektor beschäftigten Arbeitskräfte ist der Erwerb von Wohnungseigentum ohnehin illusionär –, sieht sich New Labour herausgefordert, hier korrigierend einzugreifen.[19] Eine Rückkehr der Öffentlichen Hand zu den Zeiten des „council housing“ schließt die Partei entschieden aus, stattdessen favorisiert sie den Bau von auch für „low income families“ erschwinglichen Häusern durch sogenannte „PPPs“ (public private partnerships) – schon wieder so ein wegweisendes Konzept moderner Sozialpolitik, das neuerdings auch die deutsche rot-grüne Regierung ins Schwärmen bringt! Der Staat stellt hierbei öffentlichen Grund und Boden zur Verfügung, auf dem dann private Wohnungsbaukapitale Billighäuser bauen, die sie für projektierte 60.000 £ auf den Markt werfen. Vor allem im boomenden Südosten Englands mit seinem steigenden Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften will die Regierung damit die ärgste Wohnungsknappheit mindern, die sich zu einem ernsthaften Mobilitätshindernis für die ansonsten so gelungen flexibilisierte britische Arbeiterschaft auswächst.
Die Regierung kennt aber Probleme noch an einer ganz anderen Ecke des Häusermarktes: Sie sieht die Gefahr, dass sich der langjährige „property boom“ wieder einmal als „Blase“ herausstellt, die früher oder später platzt. Ihre Sorge gilt dabei weniger den absehbaren ruinösen sozialen Folgen für die ehrbare Klasse der „home owner“: dann droht schließlich den Millionen überschuldeter Hausbesitzer endgültig der Offenbarungseid und massenhaft Zwangsverkäufe stehen auf der Tagesordnung. Die eigentliche Sorge gilt den Rückwirkungen eines solchen Crashs auf das nationale Wachstum insgesamt. Allen voran sieht der britische Finanz- und Wirtschaftsminister Gordon Brown gerade in der britischen Lösung der Wohnungsfrage, der Verwandlung der Wohnungsnot in einen florierenden und flexiblen Immobilienmarkt, die Ursache für die beklagte Labilität des Wirtschaftswachstums auf der Insel – den berühmt-berüchtigten Zyklus von „boom and bust“. Den zu durchbrechen nimmt sich die Regierung vor: Mit den Mitteln der Finanz- und Zinspolitik will sie den Anstieg der Hauspreise bremsen und die „Volatilität“ des Häusermarktes durch Anreize zur Umstellung der variabel verzinsten Immobilienkredite auf langjährig fixierte Zinsen bekämpfen.[20] So erfährt die Frage, ob der arbeitende Mensch „a decent home at a decent price“ bekommt, ihre systemgemäße Antwort: Die Wohnungsfrage entscheidet sich gerade nicht an einer anständigen Qualität und einem erschwinglichem Preis für das Dach über dem Kopf, sondern daran, ob der Häusermarkt seinen möglichst gesicherten Beitrag leistet zum gedeihlichen Florieren des Kredits im Land, jener ersten Ressource des Kapitalwachstums. „Sozial“ ist, was als Hebel des Wirtschaftswachstums und der Bereicherung des Kapitals dient – eine andere Definition des Sozialen lässt auch eine Labour-Regierung nicht mehr gelten.
Das Rentensystem
Die Errungenschaft einer staatlichen Grundrente im Dienste des Wirtschaftsstandorts
Die Renten drastisch absenken und die arbeitende Bevölkerung zur privaten Altersvorsorge zwingen – auch dieses Rezept hat Lady Thatcher als erste erfolgreich praktiziert. Schon seit weit über zwanzig Jahren herrschen unter Großbritanniens Rentnern die vorbildlichen sozialpolitischen Verhältnisse, welche die rot-grüne Bundesregierung hierzulande gerade herbei reformiert. Auf der Insel kann man die flächendeckende Altersarmut studieren, vor der deutsche Gewerkschaften und Sozialverbände die Bundesregierung noch warnen, weil sie sich nicht vorstellen wollen, dass eine Regierung solche Lebensverhältnisse für ihre Rentner ernsthaft einplanen kann. Die Leistungen des britischen Rentensystems setzen sich aus einer vom früheren Einkommen unabhängigen Grundrente plus einer einkommensbezogenen Zusatzrente zusammen und betragen durchschnittlich 37 Prozent des früheren Lohns. Am Ende eines gewöhnlichen Arbeitslebens liegt die staatliche „pension“ vielfach unter dem anerkannten Existenzminimum und wird durch Sozialhilfe so aufgebessert, dass sie am Ende zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig ist.[21] Ohne nennenswertes Eigentum und zusätzliches privates Einkommen im Alter gehört der Brite nach seiner Pensionierung schnell zu dem Heer der 3 Millionen Rentner, die unterhalb der amtlichen Armutsgrenze vegetieren und mit wöchentlich 112 £ (ca. 170 Euro) auskommen müssen. Für den Rest der ausrangierten Arbeiterklasse sieht der Lebensabend nicht viel üppiger aus – abgesehen von der kleinen, aber feinen Minderheit jener 2 Millionen der insgesamt 11 Millionen Rentner, denen ihre Klassenlage erlaubt hat, privat vorzusorgen, und die jetzt ein jährliches Alterseinkommen von durchschnittlich 45.000 £ konsumieren.
Schon lange hat der britische Staat den Standpunkt hinter sich gelassen, mit seinem Rentensystem dafür zu sorgen, dass seine Bürger auch nach Ende ihres aktiven Arbeitslebens über die Runden kommen. Wieder einmal war die „Eiserne Lady“ die erste, die den parteienübergreifenden Nachkriegskonsens, ein sozialstaatliches Rentenwesen brauche es zur Betreuung, teilweise auch Linderung der kapitalistischen Armut, gleichsam gegen den Strich gebürstet und diese soziale Einrichtung als ein wohlfeiles Instrument des Kapitalwachstums entdeckt hat. Auf die Erfahrung, dass mit dem Niedergang der britischen Industrie die in das „National Insurance System“ eingesammelten Arbeitnehmerbeiträge[22] sinken, antwortet ihre Regierung mit einer rücksichtslosen Kürzung der Renten; die Alternative, die Einnahmen der Kasse zu erhöhen und Arbeitnehmer oder Steuerzahler mit höheren Rentenbeiträgen zu belasten, verbietet sich von vorneherein für eine Regierung, die gerade antritt, das nationale Lohnniveau zu senken.[23]
Mit der drastischen Absenkung der staatlichen „pension“ leitet sie die Geburt einer neuen Altersversicherung ein, der Privat-Rente. Damit zwingt sie nicht nur ihre arbeitende Bevölkerung, sich von dem knappen Lohn auf Kosten des jetzigen Lebensunterhalts beträchtliche Gelder für das Überleben im Alter abzusparen; sie eröffnet damit zugleich dem Finanzkapital, das sie als eine der Stärken der britischen Ökonomie wertschätzt, ein wachsendes Geschäft mit der privaten Altersvorsorge. Der „ideelle Gesamtkapitalist“ führt den realen Finanzkapitalisten beträchtliche Teile der nationalen Lohnsumme zu und sorgt mit seiner politischen Garantie stetiger Zuflüsse in Lebensversicherungen und Pensionsfonds für die Akkumulation eines Kapitalstocks von 700 Milliarden £, dem weltweit zweitgrößten seiner Art nach den USA. Die moderne Methode, aus der Armut eine Kapitalanlage zu machen, schlägt also zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie senkt die staatlichen Aufwendungen zur Betreuung der Altersarmut und verschafft London einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsvorteil in der internationalen Konkurrenz der Finanzplätze.
New Labours Bewältigung der „pension crisis“
Dass Millionen Rentner es zu keinen privaten Ersparnissen bringen und in absoluter Armut leben, dieses „Erbe des Thatcherismus“ ist für New Labour kein „Fehler“ und Anlass zu „sozialpolitischen Korrekturen“ – schließlich wissen die heute armen Pensionäre schon seit 25 Jahren, dass sie auf die Sozial-Rente nicht mehr bauen können, und haben es dennoch an der nötigen „eigenverantwortlichen“ Altersvorsorge fehlen lassen. Jetzt droht aber auch den besser verdienenden Abteilungen der nationalen Arbeiterklasse, die ihrer Pflicht zur privaten Vorsorge ordnungsgemäß nachgekommen sind, dasselbe Schicksal. Der Crash an den internationalen Finanzmärkten hat das zur Altersvorsorge angelegte Aktienvermögen – seien es die Fonds der Betriebsrentenkassen oder die Depots der privaten Kleinanleger – in großem Stil vernichtet. Firmenpleiten lösen nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die betriebliche Alterssicherung der Belegschaften in Luft auf, und von den vielen Bankrotten der Lebensversicherer ist der des weltältesten Versicherungsunternehmens Equitable Life nur der spektakulärste, weil größte mit 1 Million betroffenen Versicherten, die eine deutliche Kürzung ihrer Policen hinnehmen müssen. Das kommt heraus, wenn eine Regierung die Vorsorge ihrer im Prinzip armen Bevölkerungsmehrheit auf Spekulationsgewinne von Finanzjongleuren baut: Weil die verstaatlichten Lohnbestandteile immer weniger reichen, um das Leben im Alter zu sichern, sollen die „hohen Renditen“ risikoreicher Kapitalanlagen die Lücke füllen – mit dem Ergebnis, dass nicht nur aus den hohen Zuwächsen nichts wird, sondern auch noch die von Anfang an zu kleine Stammsumme verspielt wird.
Natürlich denkt die Regierung gar nicht daran, die glorreiche Rentenreform wieder rückgängig zu machen. Aber Schadensbegrenzung und Fortentwicklung stehen angesichts der „pension crisis“ schon an. Zunächst einmal an der Front der Betriebsrentenkassen. In denen klafft eine Finanzierungslücke von 54 Milliarden £ als Folge der Kapitalvernichtung an den Börsen, aber auch wegen der „contributional holidays“ genannten Auszeit, die sich die Unternehmer in den Jahren des Börsenbooms genehmigt haben. Angesichts der Aufblähung des Werts der betrieblichen Rentenfonds haben die Arbeitgeber schlichtweg ihren Anteil an den Einzahlungen reduziert, während die Arbeitnehmer nach wie vor ihren vollen Zwangsbeitragssatz vom Bruttolohn abgebucht bekamen. Das Defizit in den betrieblichen Rentenkassen nehmen die Unternehmen nun zum Anlass, die Versicherungsbeiträge der Arbeitnehmer, nicht aber die späteren Auszahlungen zu fixieren, sowie neueingestellte Arbeiter von den „occupational pension schemes“ auszusperren, was dazu führt, dass mittlerweile schon 60 Prozent dieser Rentenkassen „in Auflösung“ begriffen sind. Darüber hinaus haben seit 1997 über 100.000 Arbeitnehmer durch Firmenbankrott ihre Rentenansprüche weitgehend verloren. Nicht mehr für diese, aber für die zukünftigen Opfer der absehbaren Pleiten verabschiedet die Regierung Blair daher ein Gesetz, das die Unternehmerschaft verpflichtet, in einen Rücklagenfonds einzuzahlen, der den Beschäftigten von zahlungsunfähigen Betrieben von 2005 an 90 Prozent ihrer betrieblichen Rentenansprüche garantieren soll. Wenn zukünftig Betroffene schon heute die drohende Minderung ihrer Betriebsrenten einkalkulieren können, statt wie bisher mit einem Totalverlust rechnen zu müssen, dann ist für die Regierung die Krise der Betriebsrentenkassen zur Zufriedenheit gelöst.
Auch bei der Krise der privaten Altersvorsorge steht für New Labour fest, dass sie nur mit noch mehr Privatisierung zu bekämpfen ist. Wenn Aktien- und Rentenfonds wenig „soziale Sicherheit“ bringen und immer weniger Rendite abwerfen, dann muss sich die Bevölkerung eben noch mehr von ihrem Lohn für das Alter absparen. Die Labour-Regierung kann sie bestenfalls dabei wieder mit Steuervergünstigungen unterstützen, die sie vor kurzem noch mit dem Verweis auf boomende Aktienmärkte gestrichen hat.[24] Darüber hinaus beauftragt die Regierung eine von ihr eingesetzte „Independent Pension Commission“, die Rentenkrise zu analysieren und Lösungsvorschläge zu machen. Sie kommt zu dem ebenso realistischen wie vielversprechenden Ergebnis, dass
„die Rentenprobleme während der letzten 20 Jahre noch durch die Baby-Boom-Generation verdeckt wurden, aber de facto schlimmer geworden sind, insbesondere durch die zu gering eingeschätzte Verlängerung der Lebensdauer der Rentner und durch die irrationalen Übertreibungen der Finanzmärkte in den 80er und 90er Jahren“. Die Regierung schlägt die folgenden „options“ zur Bewältigung der „pension crisis“ vor: „Entweder werden die Rentner im Verhältnis zum Rest der Gesellschaft ärmer, oder die Steuern bzw. Beiträge zur Nationalen Versicherung werden erhöht, oder die Ersparnisse steigen, oder das Renteneintrittsalter wird erhöht.“ Die Kommission hält die Option ärmerer Rentner für die „am wenigsten attraktive“ und plädiert für einen Mix von „höheren Steuern/Beiträgen zur Nationalen Versicherung, höheren Ersparnissen und/oder höherem Rentenalter“. (Independent Pensions Commission: First Report, 12.10.2004)
Das Gesundheitswesen
Der National Health Service
In der Betreuung der Volksgesundheit ist das Vereinigte Königreich von Anfang an eigene Wege gegangen. Dass die gesellschaftliche Lohnsumme für Erhalt und Wiederherstellung der Gesundheit der Arbeiterklasse nicht hinreicht, aber hinreichen muss, diesen Widerspruch organisiert der britische Staat im Unterschied zu seinen europäischen Nachbarn nicht als Kassenwesen mit – der Form nach paritätischem – Beitragsabzug vom Bruttolohn der Arbeitnehmer, sondern er finanziert das Gesundheitswesen per Staatsausgaben, für die das ganze Volk in seiner Eigenschaft als „tax payer“ zur Kasse gebeten wird. Die Kosten für den National Health Service (NHS) werden zu über 80 Prozent aus dem Staatshaushalt bestritten. Die Inanspruchnahme seiner Leistungen steht jedem Bürger grundsätzlich offen; medizinische Behandlung, Operationen und Therapie sind heute noch wie zu Zeiten der Gründung 1948 kostenlos – abgesehen von den Kosten, die seit geraumer Zeit als Zuzahlungen bei Arzneimitteln, Brillen und Zahnersatz von den Patienten zu tragen sind.
Im internationalen Vergleich kommt das Gesundheitswesen die britische Nation dabei billig:[25] ihre Unternehmern sowieso, bei denen der sozialstaatliche Dienst an der Gesundheit des von ihnen be- und vernutzten Ausbeutungsmaterials nicht wie andernorts als Erhöhung ihrer Lohn(neben)kosten auf das Personalkonto schlägt; aber auch den Staat selbst, dem bei seinem Bemühen, Erhalt und Wiederherstellung der Volksgesundheit möglichst kostengünstig zu bewerkstelligen, die Monopolstellung des NHS in dreifacher Weise zugute kommt. Erstens unterliegt die Definition, was zur Volksgesundheit an medizinischen Leistungen (nicht) dazugehört, unmittelbar seiner politischen Direktive – im Unterschied zu einem deutschen Gesundheitswesen, wo sich der Umfang der Leistungen und die Höhe der Kosten im Konkurrenz- und Dreiecksverhältnis von Krankenversicherung, Ärzteschaft bzw. Krankenhäusern und Pharmakonzernen erst her- und herausstellt. Zweitens ist der NHS im Prinzip der einzige Arbeitgeber für sämtliche Ärzte im Lande, die sich mit einem gewöhnlichen Angestelltenstatus im öffentlichen Dienst und entsprechenden Gehältern begnügen müssen, welche meilenweit entfernt sind von den Salären, die Mediziner in Deutschland oder den USA verdienen;[26] das restliche Personal, von Krankenschwestern über Hebammen bis zu Physiotherapeuten, darf seinen Dienst an der Volksgesundheit sowieso zu deutlich unter dem nationalen Durchschnitt liegenden Löhnen leisten. Drittens tritt der NHS auch einer ganzen Wirtschaftsbranche – der Pharmaindustrie – gegenüber als Monopolist auf und sorgt für ein im internationalen Vergleich niedriges Preisniveau beim Medikamentenverbrauch; er untersagt den Pharmaunternehmen, sich bei der im nationalen Gesundheitswesen versammelten Zahlungsfähigkeit frei zu bedienen und wie andernorts mit entsprechend hohen Preisen für ihre Arzneimittel Extraprofite einzustreichen.[27] Als national orientierter Großabnehmer sorgt der NHS bei zwar relativ niedrigen Arzneimittelpreisen gleichwohl für eine sichere Heimatbasis des weltweiten Geschäfts. Das hat britischen Pharmakapitalen wie Astra-Zeneca oder Glaxo-Smith-Kline zur nötigen Kapitalgröße verholfen, um sich und ihre Nation als „global player“ auf dem Weltmarkt zu bereichern.
Labours nachholendes Bemühen um mehr „Effizienz“: die Verordnung von „mehr Markt“
Das Gesundheitswesen ist der einzige Bereich des britischen Sozialstaates, den die Regierung Thatcher nicht radikal reformiert hat. Die ursprüngliche Idee, den gesamten NHS zu privatisieren, ließ sie fallen – nicht weil die Eiserne Lady sich vor dem Zorn des britischen Volkes fürchtete, das trotz aller Kritik an langen OP-Wartelisten und maroden Krankenhäusern den kostenlosen Gesundheitsdienst als „Symbol des Wohlfahrtsstaates“ schätzt, sondern weil die entschiedene Vorkämpferin für die Privatisierung öffentlicher Dienste nach reiflicher Abwägung zu der Entscheidung gelangte, dass der staatliche NHS die Nation unzweifelhaft billiger kommt als ein privat organisiertes Gesundheitswesen.[28] Statt dessen verordnet sie dem NHS einen „inneren Markt“, um ihn „effizienter“ zu machen. Gemäß dem Credo des Thatcherismus, dass es nur dort effektiv zugeht, wo der Zwang des Geldes und der Konkurrenz herrscht, implantiert sie marktwirtschaftliche Verhältnisse von „Anbietern“ und „Nachfragern“ der „Ware“ Gesundheit in den NHS. Die Krankenhäuser avancieren zu Anbietern und die lokalen Gesundheitsbehörden sowie die im Rahmen des NHS niedergelassene Ärzteschaft zu Nachfragern von zu bezahlenden Gesundheitsdienstleistungen, während die Patienten in dem Konstrukt des „inneren Marktes“ von der Rolle als „Nachfrager“ ausgenommen sind, weil für sie Gesundheit hauptseitig nach wie vor nicht als mit einem Preis versehene Ware, sondern als kostenlose Sozialleistung vorgesehen ist. So konkurrieren zu sogenannten „NHS-Trusts“ mit begrenzter Selbstverwaltung und Budgetautonomie beförderte Krankenhäuser als „Dienstleister“ um die Zahlungsfähigkeit ihrer „Kunden“, die mit einem immer zu knappen staatlichen Gesundheitsbudget ausgestatteten lokalen Gesundheitsbehörden.[29]
Den NHS mit seinem „internal market“ hätte New Labour mit seiner Vorliebe für „market values“ glatt erfinden müssen, hätte die Partei ihn nicht schon fix und fertig bei Regierungsantritt vorgefunden. So aber muss sich Tony Blair nur mit den unvermeidlichen Wirkungen herumschlagen, die eintreten, wenn man die jahrzehntelange „Unterfinanzierung“ des Gesundheitswesens durch den Zwang zur Konkurrenz zu heilen verspricht und die etablierte zentrale Planung im NHS durch einen internen Markt ersetzt.[30] Die klassische Mängelliste – marode Krankenhäuser, monatelange Wartezeiten für Operationen, kein Serum für Grippeimpfungen – ist keineswegs kürzer geworden, dafür aber um neue Posten bereichert, die mit der Zerschlagung der bisherigen staatlichen Planung eintreten, wie die verschwenderische Doppelung von Behandlungskapazitäten bei gleichzeitigen Versorgungslücken. Da sich New Labour ein Zurück zu mehr zentraler Planung verbietet, sieht die Regierung sich nun gezwungen, das zu tun, was ihr wirklich gegen den ideologischen Strich geht: staatliche Haushaltsmittel vermehrt in den NHS zu pumpen. Finanzminister Gordon Brown erhöht die Budgetmittel für den NHS von 42,4 Milliarden £ (2001) auf 56,7 Milliarden £ (2004) mit dem erklärten Ziel, die berühmt-berüchtigten Wartelisten zu verkürzen, aber auch die notorisch niedrigen Gehälter aufzubessern und damit die Abwanderung qualifizierten medizinischen Personals ins Ausland zu bekämpfen, und last but not least das britische Gesundheitswesen auf den in der Europäischen Union üblichen Leistungsstandard zu bringen. Dass die konservativen Vorgängerregierungen den NHS über Jahrzehnte „kaputtgespart“ haben, sieht New Labour als Teil und Erblast der ökonomischen Krise der Nation; heute, nach Überwindung der Krise, ist sich das wiedererstandene Britannien ein Niveau von Volksgesundheit schuldig, das dem Vergleich mit seinen Konkurrenz-Nationen standhält. Das zählt selbst zum Erfolg der Nation.
Während der Chancellor die dafür nötigen Haushaltsmittel bereitstellt, macht sich Tony Blair an das „Fine-tuning“ des in Richtung auf „mehr Markt“ reformierten Nationalen Gesundheitsdienstes. Die Autonomie der NHS-Trusts bleibt, die finanzielle und operationale Selbständigkeit wird sogar durch die umstrittene Gründung sogenannter „foundation hospitals“ mit dem Recht zur Kreditaufnahme am freien Kapitalmarkt erweitert; zugleich sollen mit den Krankenhäusern vertraglich fixierte Qualitätsstandards sicherstellen, dass der NHS „value for money“ liefert. So fließt dann ein nicht unbeträchtlicher Teil des „money“ in Verwaltung, Controlling und Qualitätsmanagement des „internal market“, während der Patient weiterhin den „value“ eines hinteren Platzes auf der „waiting list“ für die nächste Operation genießen darf. Wer schneller dran sein will und es sich finanziell leisten kann, für den gibt es dann auch bei der Gesundheit, wie schon bei der Rente, die Option einer privaten Krankenversicherung. Darüber kommt die Scheidung von Reich und Arm auch im Gesundheitswesen voran.
Das wiederum gefällt der aufmerksamen deutschen Öffentlichkeit, die ihren Bürgern am liebsten nicht nur eine dem britischen Gesundheitssystem vergleichbar sparsame Medizin, sondern auch gleich noch die entsprechende vorbildliche Staatsbürgermoral verpassen möchte, die sie beim britischen Vorbild ausgemacht hat:
„Das Gesundheitswesen ist sparsamer als in Deutschland. Wer nicht riskieren will, für eine Operation auf Wartelisten gesetzt zu werden, versichert sich privat… Die Briten akzeptieren dieses System weitgehend, denn der Leidensdruck in den wirtschaftlich miserablen Jahren vor der Thatcher-Regierung war für die Bevölkerung so groß, dass Thatcher Reformen durchdrücken konnte, die heute noch in Deutschland undenkbar erscheinen, die aber das britische Wirtschaftssystem reformierten und befreiten. Im Gegensatz zu den Deutschen wurde den Briten in den siebziger und achtziger Jahren allerdings auch nicht eingeredet, dass jeder die gleichen hohen Ansprüche auf soziale Absicherung habe. Daher fehlt in Großbritannien der in Deutschland so lähmende und reformfeindliche Sozialneid.“ (FAZ, 1.11.04)
Wenn die Opfer der Sozialreformen all deren Härten schlucken und das ‚Notwendige‘ auch noch für gerecht halten, dann ist die Nation vollends in Ordnung!
[1] Rede von Tony Blair am 15.11.04. Politiker und Öffentlichkeit in Großbritannien verweisen bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf den mittlerweile zehnjährigen Aufschwung der britischen Wirtschaft mit im Vergleich zu Deutschland durchschnittlich doppelt so hohen Wachstumszahlen, auf den langjährigen Überschuss im Staatshaushalt (bis 2001) und eine im europäischen Vergleich niedrige Arbeitslosenquote von unter 5 Prozent, und sie rechnen die britische Volkswirtschaft inzwischen auf die zweitgrößte der EU zusammen, mit ¾ des BIP der wirtschaftlichen Vormacht Deutschland (2004).
[2] Die von Thatcher
erlassenen Anti-Gewerkschaftsgesetze zielen auf die
Erschwerung bzw. Verunmöglichung von Streiks, die
Kriminalisierung von Streikaktionen inklusive der
Enteignung von Gewerkschaftsvermögen: Waren die
Gewerkschaften durch das Parlamentsgesetz von 1906 vor
dem Zugriff der nach dem Gewohnheitsrecht urteilenden
Richter durch Immunität (vor Schadensersatzforderungen
der Unternehmer aus Streikfolgen) geschützt worden, so
hob die Regierung Thatcher diese Abriegelung in
wesentlichen Teilen auf… Sie verloren die Immunität,
wenn sie nicht bestimmte Regeln vor Ausrufung eines
Streiks beachteten: Urabstimmungen wurden gesetzlich
vorgeschrieben, Sympathie- und Unterstützungsstreiks
wurden verboten. Das Vermögen der Gewerkschaften kann
erstmals seit 1906 durch Gerichte beschlagnahmt werden…
Gewerkschaften wurden für Handlungen ihrer Mitglieder
bei ungesetzlichen Streiks haftbar gemacht.
(Politische Reformen von Thatcher bis Blair, in: Aus
Politik und Zeitgeschichte, Nr. 18/1997, S. 13). Die
„Eiserne Lady“ verwandelt Betriebe in
gewerkschaftsfreie Zonen – indem sie per Gesetz die
Zulassung von Gewerkschaften in Betrieben an
gesetzliche Bedingungen knüpft, die immer öfter nicht
zu erfüllen sind: mehr als 50 Prozent der Beschäftigten
müssen Gewerkschaftsmitglieder sein, und die
Belegschaft muss mit Mehrheit bei einer Urabstimmung
für die gewerkschaftliche Interessenvertretung
votieren.
[3] Die Bilanz des erfolgreichen Klassenkampfs von oben: 1979 betrug der gewerkschaftliche Organisationsgrad noch 54 Prozent und die britischen Gewerkschaften hatten 13,3 Millionen Mitglieder; bis 1991 verloren sie rund ein Drittel ihrer Mitglieder und der Organisationsgrad sank in den 90er-Jahren unter 30 Prozent. Die Zahl gewerkschaftsfreier Betriebe stieg von 1984 bis 1990 von 27 auf 36 Prozent. Betriebe, in denen Gewerkschaftsmitgliedschaft Einstellungsvoraussetzung ist, sogenannte „closed shops“, gibt es praktisch nicht mehr. Arbeitskämpfe und Ausfalltage durch Streiks gehen drastisch zurück – auf das im europäischen Durchschnitt übliche Maß. Schon 1990 werden nur noch 10 Prozent der Arbeitnehmer auf Basis von mit den Gewerkschaften ausgehandelten Branchen- oder regionalen Tarifverträgen entlohnt, 40 Prozent aufgrund von mit „shop stewards“ ausgehandelten Firmenvereinbarungen und 50 Prozent ganz ohne Tarif- oder Firmenvereinbarung allein gemäß Diktat des Managements, Tendenz steigend.
[4] Der Sieg der
vereinten Staats- und Kapitalseite über die
Gewerkschaftsbewegung fiel so eindeutig und überzeugend
aus, dass Labour sich noch in der Opposition in „New“
Labour umfirmiert und gravierenden Korrekturbedarf an
seiner engen Bindung an die Gewerkschaften entdeckt.
Schließlich hatten die einst Labour als ihre Partei
gegründet, um dem im Trade Unionism organisierten
Proletariat zu politischem Einfluss auf die Schalthebel
der staatlichen Macht zu verhelfen; und sie finanzieren
noch heute weitgehend die Partei, um sich im Gegenzug
dafür maßgeblichen Einfluss in ihren
Entscheidungsgremien zu sichern. All das ein einziges
Ärgernis für die Partei, die auf dem langen Weg zurück
zur Macht nichts so sehr fürchtet wie den Ruch, immer
noch keine moderne Volks-, sondern eine verstaubte
Klassenpartei zu sein. Labour komplettiert die von der
konservativen Regierung erfolgreich durchgezogene
Brechung der Gewerkschaftsmacht in den Betrieben um die
Degradierung des gewerkschaftlichen Einflusses in der
eigenen Partei. Programmatisch erklärt Tony Blair noch
in der Opposition gegenüber den Gewerkschaften: Ich
will ganz offen über die moderne Beziehung zwischen der
heutigen Labour-Partei und den Gewerkschaften zu euch
sein. Es war einmal eine Zeit, als mächtige
Gewerkschaften eine Politik beschlossen haben und dann
davon ausgehen konnten, dass Labour dem auf dem Fuße
folgen würde. Forderungen wurden aufgestellt. Labour
reagierte und verhandelte. Diese Zeiten sind vorbei.
Sie kommen nicht wieder zurück.
(Rede auf dem Gewerkschaftstag der Transport
und General Workers Union, 1995) In diesem Sinne
beschließt die Partei, das Blockstimmenrecht der
Gewerkschaften zu beseitigen (mit dem die
Gewerkschaften die Stimmen ihrer Mitglieder bündeln,
vergleichbar dem Stimmrecht deutscher Bankenvertreter
für ihre Kleinaktionäre; von den 6,8 Millionen
Mitgliedern im Trade Union Congress sind 5 Millionen
zugleich in der Labour Partei), den festen
Stimmenanteil, den die Gewerkschaften noch auf dem
Parteitag ausüben, auf 50 Prozent zu beschneiden und
den berühmten Artikel 4, der Verstaatlichungen fordert,
aus der Satzung der Partei zu streichen. Für den
Abschied von den sozialistischen und
sozialdemokratischen Werten erfindet New Labour sein
neues Markenzeichen vom „Dritten Weg“ jenseits von
Sozialismus und Kapitalismus.
[5] Im Durchschnitt
arbeiten die Briten laut Statistik auf ihrem
‚deregulierten, flexiblen‘ Arbeitsmarkt gut 43 Stunden
die Woche. Jeder sechste schuftet sogar mehr als 48
Stunden – jenseits der von Brüssel erlaubten maximalen
wöchentlichen Arbeitszeit… Von den gut 4 Millionen
Briten, die wöchentlich mehr als 48 Stunden arbeiten,
erhält nur etwa jeder dritte Überstundenzuschläge.
Indes kämpft Tony Blair seit dem Frühjahr in Brüssel
dafür, dass sein Land sich weiterhin nicht an das
wöchentliche Limit von 48 Stunden halten muss. Diese
Ausnahmeregelung wurde der Insel seit 1998
zugestanden.
(Frankfurter
Rundschau, 14.07.04)
[6] Der erste weibliche
britische Premier hat sich auch um die Verwirklichung
der Gleichberechtigung im Arbeitsleben verdient gemacht
und den Britinnen zu dem ihnen gebührenden gerechten
Anteil an den nationalen Billiglöhnen verholfen:
1991 waren rund zwei Fünftel aller britischen
Erwerbstätigen Frauen. Im Jahr 1971 lag der
Frauenanteil noch bei ungefähr einem Drittel aller
Beschäftigten. Nur 14 Prozent aller Beschäftigten
arbeiteten 1971 auf Teilzeitbasis. Dieser Anteil ist
auf ca. 25 Prozent im Jahr 1991 gestiegen. Die meisten
der zwischen 1981 und 1991 neu geschaffenen 1,2
Millionen Arbeitsplätze waren überwiegend
Teilzeitstellen. 1991 war jeder achte britische
Erwerbstätige selbständig; 1981 war es nur jeder
zwölfte.
(Länderbericht
Großbritannien…, S.102)
[7] Dieser Begriff
lässt sich nur unvollkommen mit ‚Tarifautonomie‘
übersetzen… ‚Deutsche Beobachter‘ hatten denn auch
immer Probleme damit, dass es im ‚free collective
bargaining‘ keine rechtliche Verbindlichkeit von
Tarifvereinbarungen gab, keine ‚Friedenspflicht‘
während der Laufzeit von Tarifverträgen, keine
zivilrechtliche Haftung bei nicht eingehaltenen
Verträgen und keine Betriebsverfassung, die den
Belegschaften bestimmte Rechte einräumt, aber auch auf
einen ‚Betriebsfrieden‘ verpflichtet.
(Länderbericht Großbritannien, Schriftenreihe
der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1994,
S.283f)
[8] Großbritannien ist in den 90er-Jahren die europäische Nation mit dem größten Zufluss an ausländischem Kapital. So ist das Vereinigte Königreich beispielsweise trotz des fast vollständigen Niedergangs der „nationalen“ Automobilindustrie der nach Deutschland größte europäische Produktionsstandort von Kraftfahrzeugen mit Fertigungsstätten von General Motors, Ford, Nissan, Toyota und Honda. Ausländische Direktinvestitionen gehen insbesondere in die Finanzdienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnik, Pharmaindustrie- und Biotechnologie sowie die privatisierten Bereiche des Verkehrswesens und der Infrastruktur wie Strom-, Wasser- und Gasversorgung.
[9] Labour kam 1997
an die Regierung mit dem expliziten Ziel, die Menschen
aus staatlicher Unterstützung heraus und in Arbeit
hinein zu bringen. Dies war in Übereinstimmung mit dem
übergreifenden Ziel, die öffentlichen Ausgaben zu
beschränken, aber es war auch in Übereinstimmung mit
dem zweiten Ziel, das Problem des sozialen Ausschlusses
anzugehen. Entsprechend der Überzeugung, dass
Beschäftigung der beste Weg aus Armut und Ausschluss
ist, richtete sich die Sozialreform auf die Erreichung
dieser Ziele durch arbeitsbezogene Maßnahmen, ergänzt
durch Verbesserung der finanziellen Anreize, um aus
staatlicher Unterstützung in Arbeit zu wechseln und um
das Armutsrisiko von Leuten, die einen Arbeitsplatz
haben, zu reduzieren.
(Governing as New Labour, Basingstoke 2004,
S.151)
[10] Die Einführung
des „National Minimum Wage“ war Gewerkschaftsforderung
und Wahlversprechen von Labour 1997 und ist seit 1999
Gesetz. Die „Low Pay Commission“, in der Vertreter von
Regierung, Gewerkschaften und Unternehmern sitzen, legt
den Mindestlohn fest und überprüft seine Höhe jährlich.
„Der nationale Mindestlohn ist ein wichtiger Eckpfeiler
der Regierungspolitik, die darauf zielt, den
Arbeitnehmern angemessene (decent) und faire
Mindeststandards am Arbeitsplatz zu garantieren. Er
gilt für fast alle Arbeitnehmer und fixiert
Stundenlöhne, unter die die Bezahlung nicht fallen
darf. Er hilft den Unternehmen, weil er ihnen
ermöglicht, auf Basis von Qualität ihrer Güter und
Dienstleistungen zu konkurrieren und nicht auf
Grundlage von niedrigen Preisen vorwiegend durch
niedrige Löhne. Die Höhe des Mindestlohns wird von der
unabhängigen Low Pay Commission
festgelegt.“
(www.dti.org.uk) Regelungen
laut Department of Trade and Industry (DTI): ab 22
Jahre (main adult rate): 4,50 £ (1999), erhöht auf 4,85
£ (1.10.2004); 18-21 Jahre: 3,80 £ (1999), erhöht auf
4,10 £ (1.10.2004); 16-17 Jahre: 3,00 £ (1.10.2004, neu
eingeführt). Zum Vergleich: 1 Bier kostet 2,20 £.
[11] Um die
Unternehmen mit billigen Arbeitskräften zu versorgen,
lässt Tony Blair die Arbeitssuchenden aus den neuen
EU-Beitrittsländern seit dem 1. Mai ohne jegliche
Übergangszeit ins Land strömen. ‚Von diesen wird
zwangsläufig weiterer Druck auf unsere Niedriglöhner
und rund um die Uhr arbeitenden Armen ausgehen‘,
kritisiert die Zeitung The Guardian.
(Frankfurter Rundschau, 14.7.04)
[12] 20 Prozent der Briten leben in Sozialwohnungen (von der Gemeinde finanzierte und vermietete „council houses“) und nur 10 Prozent zur privaten Miete (zumeist Studenten, Gelegenheits- und Wanderarbeiter, junge Arbeitnehmer, die sich noch keine eigene Wohnung leisten können; oder aber gutverdienende Singles, für die Job-Mobilität zur Qualifikation gehört).
[13] „Mortgage“ bezeichnet sowohl die Natur des Kredits, bei dem die Immobilie bis zur Abzahlung des Hauskredits Eigentum der Bank bleibt, als auch die Schuld selbst und ihre Bedienung. Im 14. Jahrhundert aus dem Französischen übernommen setzt sich der Begriff aus „mort“=Tod sowie „gage“=Versprechen zusammen und bezeichnet die Verpflichtung, die der Schuldner mit seinem Hauserwerb eingeht, der dem Gläubiger zwar nicht mehr sein Leben, aber immerhin sein Eigentum und Einkommen verpfändet.
[14] Als die Immobilienpreise nach dem letzten Zusammenbruch des „property markets“ 1992 ihren Tiefstand erreichten, musste der britische Hausbesitzer im Durchschnitt ein Fünftel seines Netto-Wochenlohns für die Bedienung der „mortgage“ ausgeben. Seit damals haben sich die Hauspreise in vielen Regionen, insbesondere im Südosten, Süden und Südwesten des Vereinigten Königreichs, verdrei- bis versechsfacht, und wenn auch die Zinsen seitdem historisch niedrig sind, fließt heute locker ein Drittel des Gehalts direkt auf die Konten der Hypothekenbank.
[15] Während der
neunziger Jahre führte jede Leitzinssenkung der Bank of
England um ein halbes Prozent zu einer Reduzierung der
Belastung der Hypothekennehmer um 0,2 bis 0,25 Prozent.
Hinzu kommt: Wegen des Booms am Immobilienmarkt wurde
jedes Haus bei einer Neuverhandlung des Vertrags auch
noch höher bewertet. Wer sein eigenes Haus besaß,
verdiente sein Geld sozusagen im Schlaf. Allerdings
steckten die Briten dieses Geld nicht in die
Rückzahlung ihrer Hypothekenverträge, sondern in
Fernsehgeräte oder Fernreisen. Sie wurden die
konsumfreudigste Nation Europas. Und während sich
deutsche Konsumenten mehr und mehr aus den Läden
zurückzogen und schließlich das Kaufen praktisch
einstellten, trugen die Briten mit ihrer ungehemmten
Konsumlust die Inselwirtschaft durch das Jammertal der
vergangenen Jahre – wenn auch auf Pump.
–
kommentiert die deutsche „Zeit“ Nr. 32/2004 in einer
Mischung von neidvoller Bewunderung und abgeklärter
Besserwisserei, dass Wachstum auf Pump auf Dauer nicht
gut gehen könne: Die Schulden liegen mittlerweile
bei 135 Prozent des Gesamteinkommens aller
Privathaushalte. Immer mehr Haushalte brechen nun unter
diesem Joch zusammen. Die Leitzinsen sind im
vergangenen halben Jahr um 1,5 Prozentpunkte auf 4,5
Prozent gestiegen und 39 Prozent aller
Hypothekenschuldner dürften mit der Bedienung einer
ihrer Schuldentöpfe ins Hintertreffen geraten, wenn die
Leitzinsen nur um einen weiteren Prozentpunkt
ansteigen.
[16] „Leute, die auf
dem Gipfel der Hauspreise gekauft haben, besaßen
Grundeigentum mit einem Wert unter dem Kaufpreis und
folglich Schulden über dem Wert des Grundeigentums.
Statistiken der Bank von England zeigen, dass 1993 über
1,3 Millionen Hausbesitzer sich in dieser als
negative equity
bezeichneten Situation befanden…
In den 80er und 90er Jahren stiegen die
Zwangsrückverkäufe an Bausparkassen wegen
ausgebliebener Hypothekenzahlungen drastisch an. 1997
mussten 32 770 Hauseigentümer zwangsverkaufen, und 236
900 Personen waren mehr als drei Monate mit ihren
Hypothekenschulden in Verzug und standen vor dem
drohenden Zwangsverkauf.“ (Pat
Young, Social Welfare, Basingstoke 2000, S.131)
Beim letzten Crash des Häusermarktes Ende der achtziger
Jahre stieg die Zahl der Familien ohne Wohnung von
56.000 im Jahr 1979 auf 128.000 im Jahr 1989. Nach
offiziellen Angaben waren zu diesem Zeitpunkt 370.000
Menschen obdachlos. Gegen 200.000 Menschen erhob die
Regierung Thatcher Anklage wegen Vagabundierens.
[17] Der Housing
Act von 1980 eröffnete das ‚Recht auf Erwerb‘. Unter
dieser Klausel können Mieter ihre Gemeindehäuser mit
einem Abschlag von 33 Prozent kaufen, wenn sie drei
Jahre zur Miete gewohnt haben, und von 50 Prozent nach
dreißig Mietjahren… Personen, die von dieser Option
Gebrauch machen, sind zu einer Hypothek berechtigt, die
100 Prozent des Hauspreises und der rechtsanwaltlichen
Kosten deckt… Die Politik der Konservativen zielte
darauf, die Mieter in zweierlei Weise zum Kauf zu
bringen: erstens durch den Preisabschlag, und zweitens
durch Mieterhöhungen. In der Periode 1979-80 wurden die
Mieten um 117 Prozent erhöht… Zwischen April 1979 und
Ende 1991 wurden in Großbritannien 1,8 Millionen
Gemeindehäuser verkauft.
(Pat
Young, Social Welfare, S.127)
[18] In den 90er
Jahren näherten sich die Positionen von Konservativen
und Labour in der Wohnungsfrage einander an, als Labour
seine Verpflichtung zum sozialen Wohnungsbau (public
housing) aufgab… Mit staatlichen Haushaltsgeldern
wurden Wohnungsbaugesellschaften und Steuerermäßigungen
für Wohnungseigentum (private housing) subventioniert.
1990/91 betrugen die Belastungen des Staatshaushalts
für Steuerermäßigungen auf Darlehenszahlungen 8,3
Milliarden £.
(Pat Young,
Social Welfare, S.129)
[19] Der
stellvertretender Premierminister John Prescott
beschreibt die Wohnungslage auf dem Labour-Parteitag
2004: Die Zahl derjenigen, die sich ein Haus nicht
mehr leisten können, steigt auf ein unakzeptierbares
Niveau. Wenn du ein Haus besitzt, dann ist die Kost für
die Hypothek auf dem niedrigsten Stand seit einer
Generation. Aber wenn du keines hast, dann sind die
Kosten für einen Hauskauf auf Rekordhöhe. Mehr und mehr
Leute wollen Hauseigentum erwerben, aber können es sich
einfach nicht leisten. Letztes Jahr fiel die Zahl der
Erstkäufer um rekordverdächtige 27 Prozent, während der
durchschnittliche Preis für den ersten Hauskauf in
London bei 218.000 £ lag – eine Verdreifachung seit
1997.
(The Guardian,
27.9.2004)
[20] Finanzminister
Brown kündigt eine „Reform-Agenda“ an, die ein Programm
zur „Stabilisierung“ des Häusermarktes mit dem Ziel
vorsieht, Angebot und Nachfrage „zu balancieren“ (in
der vergangenen Dekade stiegen die Hauspreise um
jährlich über 20%) und die Hypothekenfinanzierung
umzustellen (die Zinsen für Hypothekenkredite sind
gewöhnlich nicht langfristig fixiert, sondern variieren
entsprechend dem aktuellen Zinssatz). Darin glaubt die
britische Regierung, die maßgebliche Krisenursache der
Vergangenheit ausgemacht zu haben: In Britannien hat
die Kombination von Hauspreis-Inflation und Volatilität
– und die Wirkung von beidem auf den Konsum – generell
Zinsraten bewirkt, die höher sind als in anderen
Ländern. In der Tat sind die meisten Wachstumsprobleme
(stop-go problems), die Britannien in den letzten 50
Jahren erlitten hat, durch den Häusermarkt
hervorgerufen oder beeinflusst worden.
(Bericht von Finanzminister Gordon Brown zur
Euro-Tauglichkeit des Vereinigten Königreichs im House
of Commons am 9.6.2003)
[21] Kein Wunder, dass in Großbritannien jeden Winter zwischen 20.000 und 45.000 ältere Menschen mehr sterben als in den wärmeren Jahreszeiten – für viele reicht das Geld schlicht nicht zum Heizen der Wohnung. Das Königreich hat laut der Hilfsorganisation „Help the Aged“ den „höchsten Anteil derartiger Todesfälle in der Europäischen Union“.
[22] Die Rentenversicherung ist der einzige Bereich des nationalen Versicherungssystems, der nicht rein steuerfinanziert ist, sondern als Lohnumlageverfahren mit Zwangsbeiträgen der Arbeitnehmer in Höhe von rund 9 bzw. 13 Prozent des Bruttolohns organisiert ist. Auf den Schein einer paritätischen Finanzierung der Sozialversicherungen durch einen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil, auf den man in der deutschen sozialen Marktwirtschaft einmal soviel Wert gelegt hat, verzichtet der britische Staat von vorneherein. Damit erspart er sich die Klage seiner Kapitalistenklasse über zu hohe Lohnnebenkosten, mit der deutsche Kapitalisten ihren Politikern seit Jahren in den Ohren liegen – die Herren Unternehmer rechnen ihm vielmehr seine Sparsamkeit bei den Renten und die im internationalen Vergleich niedrigen Lohn(neben)kosten als begrüßenswerten Standort- und Wettbewerbsvorteil Britanniens hoch an.
[23] Bis 1982
stiegen die Renten im Allgemeinen zumindest den
Einkommen entsprechend. Seither sind sie an die
Preisentwicklung gekoppelt. Real waren sie 1993 fast
140 Prozent mehr wert als 1948. Im Verhältnis zum
durchschnittlich verfügbaren Einkommen erreichten sie
jedoch bereits 1983 ihren Höhepunkt mit 46,5 Prozent,
lagen 1991 sogar unter den Werten von 1948… Mehr als
die Hälfte der Pensionäre wird in Zukunft betriebliche
oder private Renten erhalten – mehr als ein Drittel
aber überhaupt keine… Bürger mit lediglich einem
geringen Lebensarbeitseinkommen oder auch Selbständige,
die wenig Rentenbeiträge eingezahlt haben, werden nur
unbedeutende Summen erhalten.
(Länderbericht Großbritannien…, S.427)
Auch unter New Labour werden die Renten entsprechend
den Preisen erhöht; das spart der Labour-Regierung
Ausgaben für Grundrente und einkommensabhängige
Zusatzrente, und die Pensionisten verlernen nicht die
Tugend, den Penny zu ehren: Die Regierung Blair
weigert sich, die Maßnahme der Thatcher-Regierung
zurückzunehmen und die Renten wieder an die
Einkommensentwicklung zu binden, obwohl der
Labour-Parteitag im Jahr 2000 abstimmte, die
einkommensbezogene Rentenangleichung wieder
einzuführen. Labour wurde heftig für seine mageren
Erhöhungen der pauschalen Grundrente kritisiert – 2001
wurde sie entsprechend der Inflation um 75 Pence
erhöht, und 2002 um 5 £ für Alleinstehende und 8 £ für
Verheiratete.
(Governing as
New Labour…, S.155) Und das bei
Lebenshaltungskosten, die durchschnittlich um rund 50
Prozent über denjenigen in Deutschland liegen!
[24] Die Versuche
der Regierung, Anreize für eine freiwillige Erhöhung
der Sparrate zu schaffen, schlugen bislang fehl; vor
Zwangsmaßnahmen aber schreckt man zurück. Die
sogenannten Stakeholder-Pensions, eine besonders
einfache und günstige Altersversicherung, die alle
Unternehmen ihren Beschäftigten anbieten müssen, wurden
von den Geringverdienenden nicht angenommen, für die
sie gedacht waren, sondern von den bessergestellten
Haushalten. Außerdem hat die Labour-Regierung schon zu
Beginn ihrer Regierungszeit den Pensionsfonds
beträchtliche Steuervergünstigungen gestrichen.
(FAZ, 4.7.2004)
[25] Wie
OECD-Zahlen zeigen, ist das britische Gesundheitswesen
im internationalen Vergleich erstaunlich günstig (zumal
angesichts des relativ hohen Anteils der älteren
Bevölkerung). 1990 machten die Ausgaben für das
Gesundheitswesen nur 5,2 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zu den
durchschnittlichen 5,6 Prozent der OECD aus, und sie
lagen weit unter dem westeuropäischen Niveau. (1999:
OECD-Durchschnitt 8,2 Prozent vom BIP, UK 6,7 Prozent)
Die USA geben den gleichen Anteil ihres
Bruttoinlandsprodukts für ihr sehr begrenztes
öffentliches Gesundheitswesen aus wie Großbritannien
für den NHS – und dann noch einmal soviel privat.
(Länderbericht Großbritannien…,
S.429)
[26] Das Einkommen der formell selbständigen, aber im Rahmen des NHS vertraglich niedergelassenen praktischen Ärzte (general practitioners) liegt noch deutlich unter dem der festangestellten Krankenhausärzte, was seit Jahrzehnten zu der chronischen Knappheit an Allgemeinärzten in Großbritannien führt.
[27] Während der
NHS eine staatlich verwaltete und staatlich finanzierte
Organisation ist, ist er für seinen Bedarf an
Arzneimitteln, Ausrüstung und einigen Dienstleistungen
auf profitorientierte Unternehmen angewiesen. Die
multinationalen Pharmakonzerne zählen zu den
profitabelsten Unternehmen weltweit. Die von
Allgemeinärzten in England und Wales verschriebenen
Arzneimittel kosteten 3,6 Milliarden £ (1992-93). Das
sind 10 Prozent des NHS-Budgets… 1999 schloss die
Regierung ein Abkommen mit den Pharmakonzernen zur
Begrenzung der Profitmargen bei neuen Medikamenten.
Schätzungen zufolge erspart der Vertrag dem NHS 200
Millionen £ im Jahr.
(Pat
Young, Social Welfare, S.335f)
[28] Ich war der
Überzeugung, dass wir auf den NHS entschieden stolz
sein können. Er lieferte Pflege auf hohem Niveau –
besonders bei akuter Krankheit – und zu ziemlich
günstigen Stückkosten, zumindest im Vergleich mit den
meisten anderen auf dem Versicherungsprinzip beruhenden
Gesundheitssystemen… Dementsprechend zögerte ich,
fundamentale Reformen ins Auge zu fassen… Auch wenn ich
gerne einen blühenden privaten Gesundheitssektor neben
dem NHS sehen wollte, habe ich immer den NHS als unser
grundlegendes Prinzip und als Fixpunkt unserer Politik
gesehen
(Margaret Thatcher,
The Downing Street Years, S.606)
[29] Die Regierung
entschied sich, den NHS auf dem bestehenden
Kostenniveau zu effektivieren, indem sie die interne
Organisation veränderte. Sie schuf ‚interne‘ oder
‚Quasi‘-Märkte, auf denen unabhängig gewordene Anbieter
– z.B. Krankenhaustrusts – sich um Aufträge von
zweierlei Kunden bewerben: der Gesundheitsbehörde des
Distrikts und der niedergelassenen Allgemeinmediziner,
die ihre Patienten im Rahmen eines ihnen zugewiesenen
Jahresbudgets betreuen. Im März 1993 boten bereits über
130 NHS-Trusts ein Drittel der NHS-Leistungen in
England an, weitere 133 folgten 1994. Über 1000
praktische Ärzte, die ein Viertel der Bevölkerung
versorgen, arbeiten heute mit einem Jahresbudget (New
Labour hat 1999 dieses eigene Budget wieder
abgeschafft.).
(Länderbericht
Großbritannien…, S.429)
[30] Unter der
Überschrift „A New Start“ bilanziert New Labour die
konservative Reform des NHS: Erhalten und fortgeführt
(nach dem Motto: „keeping what works“) wird der Zwang
zu mehr Markt und Konkurrenz, was man auch so
ausdrücken kann: Die Regierung erkennt die
intrinsische Stärke einer dezentralisierten
Verantwortlichkeit für das operative Management an.
Abgeschafft wird, was nicht funktioniert („discarding
what has failed“): Der innere Markt hat die
Verantwortlichkeiten für Planung, Finanzierung und
Bereitstellung von Gesundheit zwischen 100
Gesundheitsbehörden, rund 3500 praktischen Ärzten und
über 400 NHS-Trusts aufgesplittert. Da gab es dann
wenig Koordination, auf Kosten der Patienten…
Die
praktische Konsequenz daraus: New Labour belässt den
„inneren Markt“ mit seiner „Fragmentierung“, schafft
hierfür einen neuen Mechanismus, um die
verselbständigten Bestandteile des NHS neu zu
koordinieren: Um diese Fragmentierung zu überwinden,
werden in dem neuen NHS all diejenigen für Planung und
Bereitstellung von Gesundheits- und Pflegediensten
Zuständigen in Entsprechung mit einem gemeinsam
vereinbarten ‚Health Improvement Programme‘
arbeiten.
(The New NHS,
Regierungsdokument) So kompliziert wird es, wenn
man „mehr Markt“ einführt, um alles kostengünstiger,
sprich „effizienter“ zu machen!