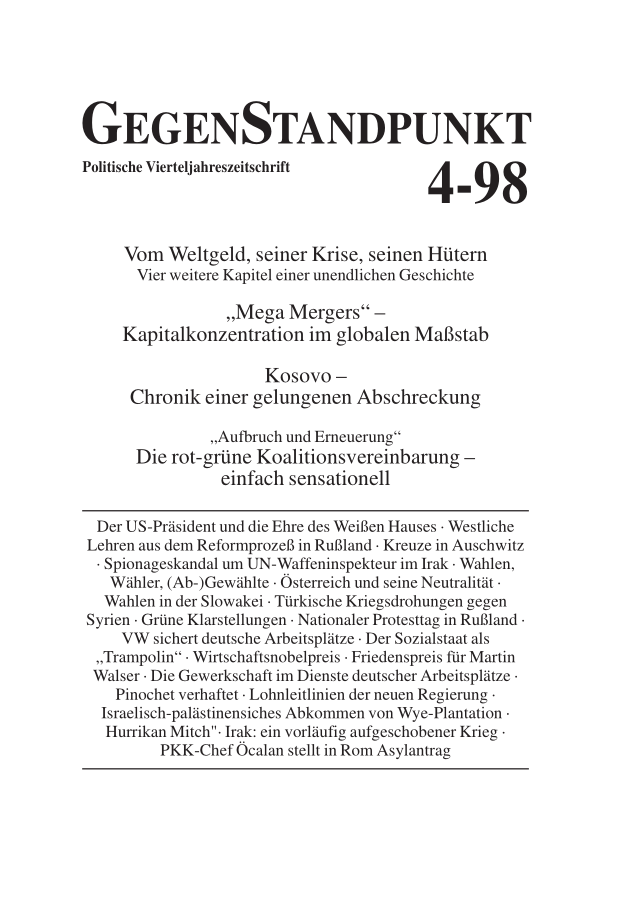Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Eine demokratische Haupt- und Staatsaktion:
Der Präsident, der Sonderermittler, Monica, die Zigarre und die Ehre des Weißen Hauses
In der Demokratie ist die persönliche „Integrität“ ihrer Führer – also auch deren „Privatleben“ inkl. außerehelichen Affären – so wichtig, weil der Inhalt der Politik nicht zur Debatte steht. Wegen des Meineids des Präsidenten wird aus der moralischen Begutachtung ein Fall von Justiz und Parlamenten, unter heftiger Anteilnahme der Öffentlichkeit. Was dann doch stört; die Inszenierung von Führungsstärke leidet unter dem Gezerre um die Person.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Eine demokratische Haupt- und
Staatsaktion:
Der Präsident, der Sonderermittler, Monica,
die Zigarre und die Ehre des Weißen Hauses
1. Ein Ermittler schafft sich seinen Fall
So verbittert Clintons innenpolitische Rivalen seine ‚Demontage‘ betreiben, so wenig haben sie gegen seine Politik etwas einzuwenden; da gibt es gelegentlich – wie bei den Vergeltungsschlägen gegen die Bin Laden Gruppe – sogar heftigen Applaus aus den republikanischen Reihen. Und doch: Die Person Clintons halten sie für untragbar. Abgesehen davon, daß für einen anständigen Republikaner die Welt sowieso nur in Ordnung ist, wenn ein strammer Vertreter der Grand Old Party die Weltführungsmacht kommandiert, erschien diesen Gemütern Bill Clinton immer schon als eine besondere Zumutung. Wie soll einer, der in seiner Biographie so etwas wie ‚unamerikanische Umtriebe‘ stehen hat, der sich vor dem Kriegsdienst in Vietnam und damit vor seinen vaterländischen Pflichten gedrückt und sich stattdessen dem verdächtigen Vergnügen des Marihuana-Rauchens hingegeben hat, heute die moralische Kraft aufbringen, als Präsident und leuchtendes Vorbild der Nation die Supermacht zu regieren?
Also nutzen die Republikaner ihre Kongreß-Mehrheit und
nehmen irgendwelche gerichtsanhängig gewordene
Grundstücksgeschäfte, an denen auch die Clinton-Family
irgendwie beteiligt war, zum Anlaß, um einen
Sonderermittler auf den Präsidenten zu hetzen – mit dem
durchaus nicht unbestimmten Auftrag, Tatbestände für ein
förmliches Amtsenthebungsverfahren beizuschaffen. In
Kenneth Starr finden sie dafür den richtigen Mann: Der
bibelfeste Jurist
läßt sich weder davon beirren,
daß seine Ermittlungen von Anfang an unter dem
Verdacht exzessiver Parteilichkeit standen
, noch
davon, daß von den ursprünglichen Vorwürfen gegen den
Präsidenten in Sachen Whitewater, Filegate oder
Travelgate kein substantieller Vorwurf übriggeblieben
ist.
(SZ 4.9.98) Der felsensichere Glaube, daß dieser
Präsident einfach nichts taugen kann, scheint ihm die
Kraft zu geben, nicht locker zu lassen und immer weiter
und weiter zu ermitteln, auch wenn ein Angriff nach dem
anderen ins Leere geht. So ist in Amerika seit über vier
Jahren das etwas groteske Phänomen zum festen Bestandteil
des politischen Alltags geworden, daß der mächtigste Mann
der Welt dauernd von einem gegen ihn ermittelnden
oppositionellen Juristen drangsaliert wird.
Das unentwegte Herumstochern in Clintons Privatleben
erzeugt schließlich selbst das gewünschte
Delikt: Starr ermittelt eine „unstatthafte Beziehung“,
die der auf seinen guten Ruf bedachte Präsident – wie es
sich gehört – öffentlich und unter Eid abstreitet. Und
schon hat der Ermittler seinen Fall: der Präsident hat
unter Eid und vor laufenden Kameras die ganze Nation
belogen! So emanzipiert sich die Daueraffäre um
Clinton von nur agitatorisch ausschlachtbaren
sittlichen Verfehlungen
und gerät zum gewünschten,
juristisch verwertbaren Rechtsfall: Clinton ist
ernsthaft in Bedrängnis
(SZ)
2. Ein Fall von demokratischer Vertrauenswirtschaft
Daß die kleinen Schweinereien des amerikanischen Präsidenten und seine dazu gehörigen ‚Notlügen‘ überhaupt den Status eines Herrenwitzes verlassen und zum hochoffiziellen Politikum werden, liegt daran, daß sie ein Gut tangieren, das nirgends so wertvoll ist wie in einer Demokratie: das Vertrauen des Volkes in seine Herrschaft. Im demokratischen Gemeinwesen verhält es sich nämlich bekanntermaßen so, daß das Tun und Lassen der politisch Verantwortlichen dauernd bekanntgemacht und erläutert, umgekehrt öffentlich erörtert und kritisch begutachtet wird – und zwar im Dienste einer eindeutigen Fragestellung: Sind die Richtigen an der Macht? Demokratie ist lebendig, wenn diese Frage die Gemüter bewegt; so intensiv, daß die wahlberechtigte Bürgerschaft sich glatt zu einem Ja oder Nein durchringt und das auch noch in einem freien, gleichen und geheimen Wahlzettel mit dem Kreuz für einen der konkurrierenden Kandidaten verbindlich notiert. Also dann, wenn niemand sich daran stört, daß mit der Art der Frage die entscheidende Antwort schon gegeben ist: Die Macht selbst, warum und wozu es sie braucht, und daß immer irgendeiner sie hat und damit dem freien demokratischen Volk seine Lebensbedingungen diktiert – das alles steht gar nicht erst zur Debatte. Der gute Demokrat wirft sich mit seinem aktiven Wahlrecht ganz auf die Entscheidung, wem er die Macht über sich anvertraut – und nimmt dafür in Kauf, daß er in jedem Fall als Manövriermasse staatlicher Gewalt fungiert. Umgekehrt unterwirft sich die demokratische Machtelite dem freien Urteil der Regierten – und bekommt dafür die Gewißheit, daß das auch das einzige Urteil über die Macht ist, das der freie Bürger sich herausnimmt. Oder noch einmal anders: Die Demokratie hat es zur festen Einrichtung gemacht, das Geschäft des Regierens insgesamt und ohne Vorbehalte gut zu heißen, den Staat mit seiner „Räson“ und seiner Gewalt umfassend und pauschal zu billigen – um den Preis, daß das Personal der Herrschaft einer Überprüfung von unten unterzogen wird. Unter dem Gesichtspunkt eben, bei welcher Alternativmannschaft der regierte Bürger die so oder so über ihn ausgeübte Regierungsgewalt besser aufgehoben glaubt. Gerade weil sie sich dieser Gewalt ohne kritischen Vorbehalt unterwerfen, müssen die Regierten darauf vertrauen dürfen, daß sie bei den Regierenden in guten Händen ist. Anders herum schuldet das regierende Personal seinem Volk nicht mehr und nicht weniger als Vertrauenswürdigkeit: Mit seiner Ermächtigung, frei und unbehindert nach eigenem souveränen Ermessen zu regieren, unterwirft es sich der Verpflichtung, das Zutrauen des Volkes nicht zu enttäuschen, sondern zu verdienen – mit der unablässigen Klarstellung eben, wie gut die Staatsmacht bei ihnen aufgehoben ist. Eine komplette demokratische Opposition paßt darauf auf, daß die Regierung dieser Pflicht genügt und das Volk zu seinem Recht kommt, indem sie dem amtierenden Personal fortwährend seine Vertrauenswürdigkeit bestreitet.
Daß hierbei die sittliche Persönlichkeit der Herrschaftselite ins Spiel kommt, ist unvermeidbar. Die ganze demokratische Fragestellung, das gesamte öffentliche Interesse, der Meinungsstreit der Parteien geht ja aufs Persönliche, auf die Eignung der Politiker für das verantwortungsvolle Geschäft des Verantwortung-Tragens; auf ihre sittliche Reife also, auf ihren guten Willen, ihre Hingabe an die Sache der Nation, ihren Respekt vor höheren Werten – die Glaubwürdigkeit ihrer Vertrauenswerbung eben. Es geht folglich zwischen Regierenden und Regierten um das moralische Bild, das die Machtinhaber von sich entwerfen, das ihre politischen Widersacher zu zerstören versuchen – und das das Wahlvolk akzeptieren oder ablehnen soll. Alle Regierungstätigkeit gerät so in der öffentlichen Besprechung ganz von selbst zu einer Indizienkette, die die Berufung des Personals zur Herrschaft rechtfertigt oder nicht – und vermischt sich dabei notwendigerweise mit dem Charakterbild, um deren zweckmäßige Konstruktion sich demokratische Politiker kümmern müssen. Denn ihre gewinnende Persönlichkeit ist noch allemal ihr wichtigstes Beweisstück für ihre Zuverlässigkeit beim Regieren, die Intaktheit ihres Familienlebens der überzeugendste Beleg für ihre Integrität beim Gebrauch der Macht, ihre Charakterfestigkeit das entscheidende Argument dafür, daß ihre Herrschaft durch anständige Beweggründe motiviert ist – und darum geht es schließlich in der Demokratie. Eben deswegen streitet die Opposition immerzu gegen falschen Schein, entlarvt Heuchelei und kann keinesfalls da Halt machen, wo nach bürgerlicher Auffassung das Privatleben und die Intimssphäre anfangen: Als Anwälte des Rechts der Wähler auf vertrauenswürdige Regenten ist sie zu Intransigenz und Rücksichtslosigkeit geradezu verpflichtet.
Der Blick durchs Schlüsselloch der Herrschaft ist der demokratischen Kultur somit nicht unangemessen, wie manche aufgescheuchten Verteidiger der Intimsphäre des Präsidenten glauben, sondern immanent. Die Absurdität, daß die lächerlichsten privaten Nebensächlichkeiten als Indizien für die immerwährende Meinungsbildung betreffs der Glaubwürdigkeit des politischen Personals eine so überragende Bedeutung gewinnen, wird damit zum demokratischen Alltag. Die disparatesten Gesichtspunkte – vom militärischen Einsatzbefehl eines Präsidenten bis zu seinem Oralverkehr – werden über die allgegenwärtige Personalfrage kompatibel. Das macht die kleinen privaten Sünden des Bill Clinton zur Staatsaffäre.
3. Von der Vertrauensfrage zum Rechtsfall und zurück
Daß Heuchelei ein wesentlicher Teil politischer Selbstdarstellung wird, ist mit dem Bedürfnis der ‚Vertrauensbeschaffung‘ genauso gegeben wie die Notwendigkeit, alles, was nicht ‚ins Bild paßt‘, konsequent abzustreiten. Insofern gehören Clintons Bemühungen, alle Meldungen über ‚unstatthafte Beziehungen‘ zum Personal des Weißen Hauses zu leugnen, zu seinem Auftrag, mit seinem Image der Achtung und Respekt gebietenden Würde seines Amtes zu entsprechen; Pech nur, daß man ihm das Gegenteil und damit auch noch Meineid, Zeugenbeeinflussung, Behinderung der Justiz usw. beweisen kann. Die jahrelangen Bemühungen der Republikaner, den Präsidenten in Fragen seiner Vertrauenswürdigkeit bei den Amerikanern so in Mißkredit zu bringen, daß der nächste Urnengang wieder einen anständigen Republikaner ins Weiße Haus bringt, haben mit den damit provozierten juristisch verwertbaren Delikten des Präsidenten eine dramatische Verschärfung erfahren: Dem höchsten Repräsentanten von Recht und Gesetz werden nicht mehr nur sittliche Fehltritte, sondern darüberhinaus einige handfeste Rechtsbrüche vorgeworfen.
Diese Aussichten überführen die Affäre allerdings nicht
in die nüchternen Sphären der Rechtspflege, sondern
verschärfen den öffentlichen Streit um die Ehre des
Präsidenten. So einfach auf dem Rechtsweg kriegt man
nämlich den obersten Mann der USA nicht los: Ein
Impeachment kann zwar mit der einfachen Mehrheit der
Republikaner im Repräsentantenhaus eingeleitet, aber nur
mit einer Zweidrittelmehrheit im Senat, also nur mit
Zustimmung eines Teils der Demokraten erfolgreich zu Ende
gebracht werden; was als Rechtsbruch behandelt wird,
entscheidet hier die Mehrheit der Senatoren. Die
entscheidende Frage bleibt damit, ob die Republikaner das
Vertrauen der Nation in ihren Präsidenten erfolgreich
torpedieren können. Das reizt die Opinion-Leader zu
manipulatorischen Höchstleistungen, so daß die
Schlacht um die öffentliche Meinung
inzwischen so
rücksichtslos geführt wird, daß in Washington
allenthalben von Hexenjagd
und Blutstimmung
die Rede ist.
Daß mit der Kompromittierung des Präsidenten das Präsidentenamt, als dessen Inkarnation Clinton ja unterwegs ist, Schaden nehmen könnte, ist den Republikanern dabei offenbar kein sonderliches Problem. Was sonst zu den ungeschriebenen Gesetzen der Politik gehört, die innenpolitische Parteienkonkurrenz mit ihren alltäglichen Ehrabschneidungen wegen der internationalen Reputation der Nation nicht nach außen zu tragen, spielt im Selbstbewußtsein der Supermacht keine Rolle. In aller Ungeniertheit wird das Thema nicht bloß in der amerikanischen Öffentlichkeit mit einer alles andere weit in den Schatten stellenden Wichtigkeit behandelt, sondern auch noch alles ermittelte „Material“ per Internet jener weltweiten Gemeinde meinungsstarker Individuen zum Fraß vorgeworfen, die das ‚www‘ längst zum Marktplatz hemmungslosen Meinens und darüber zu einem Denkmal des politisierten bürgerlichen Verstandes gemacht hat. Derweil läuft die Weltpolitik unbeanstandet und routinemäßig weiter, einschließlich der vom inkriminierten Präsidenten für fällig erachteten militärischen Schläge gegen Afghanistan und Sudan, so als wäre das die schönste Nebensache der Welt.
4. Die Retourkutsche der Demokraten
verfolgt die Doppelstrategie, den Schwarzen Peter in der
Vertrauensfrage an die Republikaner zurückzureichen und
gleichzeitig das Vertrauenskontingent Clintons neu
aufzubauen. Die moralische Urteilskraft des
amerikanischen Volkes wird zuerst auf die niederen Motive
gelenkt, die die republikanischen Saubermänner zu ihrem
unnachgiebigen Vorgehen und ihren
puritanisch-pornographischen
Ermittler zu so
grundloser öffentlicher Demütigung des Präsidenten
beflügeln: Pure Machtgier sei da am Werk und nichts als
Heuchelei, wenn die gegnerische Partei sich auf ihre
Verantwortung für die Würde des Amtes, die Ehre des
Weißen Hauses sowie das verfassungsmäßige Recht des
Volkes auf freie und vollständige Information über die
Umtriebe seiner Obrigkeit beruft. Ohne die Sorge, nach
eben dieser Entlarvungslogik selber als genauso großer
Heuchler dazustehen, vielmehr in der Sicherheit, daß das
Vertrauen der Amerikaner sowieso nur bei einer der beiden
Konkurrenzparteien landen kann, ein Schaden bei den
anderen folglich automatisch zum eigenen Frommen
ausfällt, zeigen die Demokraten darüberhinaus, wie gut
auch sie sich auf Rufmordkampagnen verstehen: Selbst
dreißig Jahre zurückliegende Seitensprünge ergrauter
Republikanergrößen werden aus dem Giftschrank geholt, um
den moralischen Feldzug gegen den Präsidenten moralisch
zu diskreditieren.
Eine zweite Chance zur Gegenoffensive bietet den
Demokraten der Umstand, daß die ‚Verfehlungen‘, an denen
die republikanische Opposition sich so erbittert
festbeißt, dann doch so vollständig im Bereich des
Allerprivatesten liegen. Denn bei allem Respekt vor den
‚family values‘, und ohne die Wichtigkeit der
Privatsphäre des Politikers für die Konstruktion der
demokratischen Herrschaftstugend der Vertrauenswürdigkeit
zu relativieren, läßt sich da doch ganz gut die Meinung
lancieren, andere, mehr amtsbezogene, insofern
‚politischere‘ Einwände gegen den Präsidenten hätten
dessen Gegner also offenbar nicht zu bieten –
ein in seinem Amt guter und, wie seine Wiederwahl
bewiesen hat, erfolgreicher Präsident, solle folglich mit
‚sachfremden‘ Anklagen aus dem Amt gehebelt werden.
Anklang findet dieser schöne Gedanke, weil er
andererseits keineswegs bis zu der Forderung übertrieben
wird, den Affären des obersten Amerikaners überhaupt
keine Aufmerksamkeit zu schenken: Die soll sich darauf
richten, mit wieviel Anstand der gute Mann vor den Augen
der nationalen Öffentlichkeit und nach den Maßstäben der
amerikanischen Bigotterie seine ‚letztlich‘ doch ganz
‚private‘ Affäre privat bereinigt. Da läßt
Clinton es nämlich an nichts fehlen: Die
Selbstdarstellung als Staatsmann, der ‚seine Sache‘
unbestreitbar gut macht, wird durch zerknirschte
Schuldbekenntnisse und demonstratives Beten & Beichten
mit zwei frisch angeheuerten Pfaffen im
Tele-Beichtstuhl der Nation
ergänzt.
„Slick Willy hat sich einige Tricks ausgedacht. Er macht jetzt in öffentlicher Reue und will sich wöchentlich mit zwei Pastoren zum Gebet treffen.“ (SZ)
Daß solche Übungen mindestens so unübersehbar scheinheilig sind wie sein demonstratives Händchenhalten mit der First Lady nimmt dieser Vertrauensoffensive keineswegs ihre Wirkung: auch eine gnadenlos geheuchelte Reue signalisiert, daß sich der Präsident auch in seinem Intimleben fortan der Würde seines Amtes und den moralischen Ansprüchen seines Volkes beugen will. Und Ehefrau Hilary liefert mit ihrer Treue zum treulosen Gatten der politischen Öffentlichkeit den Beweis, daß der Präsident auch als Mensch die Verzeihung verdient, von der seine scheinheiligen Gegner nichts wissen wollen.
5. Der moralische Volksgerichtshof
funktioniert denn auch keineswegs auf Anhieb so, wie sich das die Republikaner vorgestellt hatten. Ihr Kalkül, mit der Veröffentlichung der Videobänder ein großes ‚Igitt‘ durchs Land gehen zu lassen, das sich eindeutig und machtvoll gegen den Präsidenten richten würde, hat sich als glatter Rohrkrepierer erwiesen. Was den Präsidenten der Lächerlichkeit preisgeben sollte, hat ihm sprunghaft gestiegene Sympathiewerte beschert.
Eine satte Mehrheit wahlberechtigter US-Bürger treibt
damit die Auffassung der Staatsmacht und ihrer Ausübung
als Vertrauensfrage in der Form auf die Spitze, daß sie
sich im moralischen Glaubwürdigkeitsstreit zwischen
republikanischen Eiferern und amtierendem Chef der Nation
gegen den radikalen Saubermann, für den Präsidenten mit
seiner nachvollziehbaren ‚menschlichen Schwäche‘
entscheidet, den vom Sonderermittler so intensiv
beackerten Intimbereich verständnisvoll aus der
politischen Vertrauensfrage ausklammert, jedenfalls für
dieses Mal, und nach Hilarys Vorbild dem Mann im Weißen
Haus ‚verzeiht‘ – als hätte der dem amerikanischen Wähler
in den Schritt gegriffen. So wie Clintons Gegner dessen
gesamte Präsidentschaft praktisch unter das eine Urteil
zu subsumieren suchen, daß der oberste nationale
Rechtshüter und Repräsentant der nationalen Moral unter
Eid gelogen hat, so wollen die Sympathisanten von
Clintons Amtsführung – einschließlich aller Fortschritte
des US-Kapitalismus, der abschreckenden US-Weltordnung
usw. – nichts weiter wissen und wahrhaben als den einen
Punkt: daß er ihr Zutrauen mit seiner Sex-Affäre
und den anschließenden Notlügen jedenfalls nicht
enttäuscht hat. Folglich ist man gern bereit, ihm –
ideell – die Lizenz zum Regieren zu verlängern. Manche
greifen gar zur tätigen Hilfe für den mächtigsten
Präsidenten der Welt, malen Plakate wie Save the
presidency, jail Kenneth Porno-Starr
und ziehen damit
bei Wind und Wetter vors Weiße Haus, bestehen also
engagiert und nachdrücklich darauf, daß ihr ‚Schützling‘
im Amt bleibt – was auch immer der ihnen an
Lebensbedingungen verpaßt und der restlichen Welt auf
ihre politische Tagesordnung setzt.
Dennoch: die von den Republikanern beabsichtigte Wirkung.
6. Die Schwächung des Präsidenten
bleibt nicht aus. Zwar läßt der Staatschef die Macht Amerikas wirklich keinen Moment lang ungenutzt; erst recht läßt er sie kein bißchen verkommen. Aber was immer er tut und entscheidet: Alles steht unter dem Vorbehalt seiner drohenden rechtsförmlichen Entmachtung; und zwar nicht der turnusmäßigen durch demokratische Neuwahlen: ganz außerplanmäßig droht die Trennung des Amtsinhabers von der Macht, die ihm sein Amt verleiht. Und selbst wenn die Absetzung nicht unmittelbar bevorsteht: der Präsident muß um seine Macht kämpfen, statt sie souverän zu exekutieren – er muß z.B. um die Unterstützung seines demokratischen Fußvolks im Kongreß werben, statt es in der demokratisch gebotenen Eindeutigkeit auf seine Linie zu bringen und so die nötige Führerschaft zu exekutieren. Die Macht seines Amtes, geschweige denn die seiner Nation, leidet darunter zwar überhaupt nicht; doch für Clinton als Amtsinhaber bedeutet der Zwang zu derartigen Berechnungen bereits eine Schwächung der rücksichtslosen Souveränität, die sich die Demokratie von ihrem vertrauensvoll ermächtigten Häuptling erwartet. Das wirkt sich auch auf das demokratisch organisierte Vertrauensverhältnis zwischen Volk und Führung selber aus: statt mit der Zustimmung zu seiner Person die unbedingte Billigung der Staatsmacht und ihres Gebrauchs sicherzustellen, unterliegt Clintons Amtsführung dem nicht auszuräumenden Verdacht, seine politischen Entscheidungen wären vom Kampf um Zustimmung zu seiner Person bestimmt, also durch persönliche Machtinteressen motiviert – und folglich die Belange der Nation bei ihm nicht mehr besonders gut aufgehoben. So anspruchsvoll ist eben das Kriterium der politischen Vertrauenswürdigkeit: man möchte der Person glauben können, daß sie überhaupt nichts als die pure Staatsmacht repräsentiert und exekutiert – nur dann und nur so finden sich demokratische Untertanen mit der über sie ausgeübten Herrschaft gut bedient.
Allein durch den Machtkampf, in den die republikanische Opposition den Präsidenten verstrickt, wird der also zu einer schwachen Figur; das beeinträchtigt dann das Vertrauen der Wähler in den Mann ihrer Wahl, auch wenn sie die republikanischen Anklagen selber nicht billigen; und natürlich wirkt das wieder auf den Kampf zurück, den Clinton um seinen Verbleib im Amt zu führen hat: die ‚Beschädigung‘ des Präsidenten nimmt ihren demokratisch vorgezeichneten Verlauf.
7. Der Rest der Welt
ist davon wenig begeistert: Dort ist man überwiegend eher der Meinung, daß die Amerikaner es mit der Subsumtion der Politik unter die Intimssphäre ihres obersten Machers entschieden zu weit treiben, wenn sie die zur Demokratie gehörige ‚Schlammschlacht‘ nicht mehr auf den Wahlkampf beschränken, in dem sie ihre vertrauensbildende Funktion und ihr Recht hat, sondern mitten zwischen den Wahlen den Präsidenten demontieren. Es langt ja, daß man sich im Turnus der Wahlperioden auf neue Repräsentanten und Inhaber der amerikanischen Weltmacht einstellen muß; der turnusmäßige Wechsel soll dann aber auch stabile Verhältnisse verbürgen.
Und das schon gleich, wenn die Stabilität der Verhältnisse sowieso schon viel zu wünschen übrig läßt: Die ‚deregulierten Finanzmärkte‘ warten gebieterisch auf klare ‚politische Vorgaben‘ in der Frage, wieviel Kredit sich die großen Weltwirtschaftsmächte ein funktionierendes Weltfinanzsystem kosten lassen wollen; die NATO-Partner brauchen klare Vorgaben aus Washington für ihre Entscheidung, wie weit sie in ihrer Kriegsbereitschaft gegen Restjugoslawien gehen sollen; im Nahen Osten hängt der ‚Friedensprozeß‘ von Amerikas Entscheidung über das Ausmaß palästinenserfreien Naturschutzzonen im palästinensi-schen Selbstverwaltungsgebiet ab. Kein Wunder, daß ein so erfahrener Demokrat wie Kanzler Kohl, der selber mit Konterfeis einer ‚Weltklasse‘-Persönlichkeit um das Vertrauen des Wählers konkurriert, die Methoden des außerturnusmäßigen Machtkampfes in den USA „zum Kotzen“ findet, die sozialdemokratische Konkurrenz sich gleich anschließt und die Kollegen aus aller Welt die Sache ähnlich sehen. Mit ‚Männerfreundschaft‘ hat das jedenfalls nichts zu tun – bzw. insofern sehr viel, als diese menschliche Vokabel für gar nichts anderes steht als für die Selbstverständlichkeit, mit der politische Chefs als gültige Inkarnation der Macht ihres Staatswesens auftreten und einander als solche behandeln und folglich auch an der Dauerhaftigkeit der amtierenden Charaktermasken die Stabilität der so charaktervoll maskierten politische Verhältnisse ablesen.
Wo schon den obersten politischen Machern der unpassende
Machtkampf in Washington soviel Verdruß bereitet, da
fällt es gut erzogenen Wahlvölkern selbstredend leicht,
das Vorgehen der Republikaner unpassend, den Eifer ihres
Sonderermittlers übertrieben – und überhaupt die
demokratische Kultur Amerikas ziemlich unzivilisiert zu
finden. Experten aus dem abendländischen Überbau finden
sich dann auch, die nicht bloß Präsident Clinton
angegriffen sehen, sondern gleich sämtliche Grundfesten
und Werte der Demokratie – Toleranz, Rechtsstaatlichkeit,
Persönlichkeitsschutz, Menschenrechte . … –, deren
Beschlagnahmung durch den großen NATO-Bruder den
kongenialen europäischen Patrioten noch nie geschmeckt
hat. So ereifern sich Europas antiimperialistische
Intellektuelle und Künstler, angeführt und in einem
Offenen Brief vereinigt durch Frankreichs ehemaliges
Kulturministergenie Jack Lang, über einen fanatischen,
inquisitorischen Staatsanwalt
, der Bill Clinton
nicht in Ruhe regieren läßt – und merken
vielleicht noch nicht einmal, was für ein vorbehaltloses
Bekenntnis zu Amerikas Rolle in der Welt sie damit
ablegen.