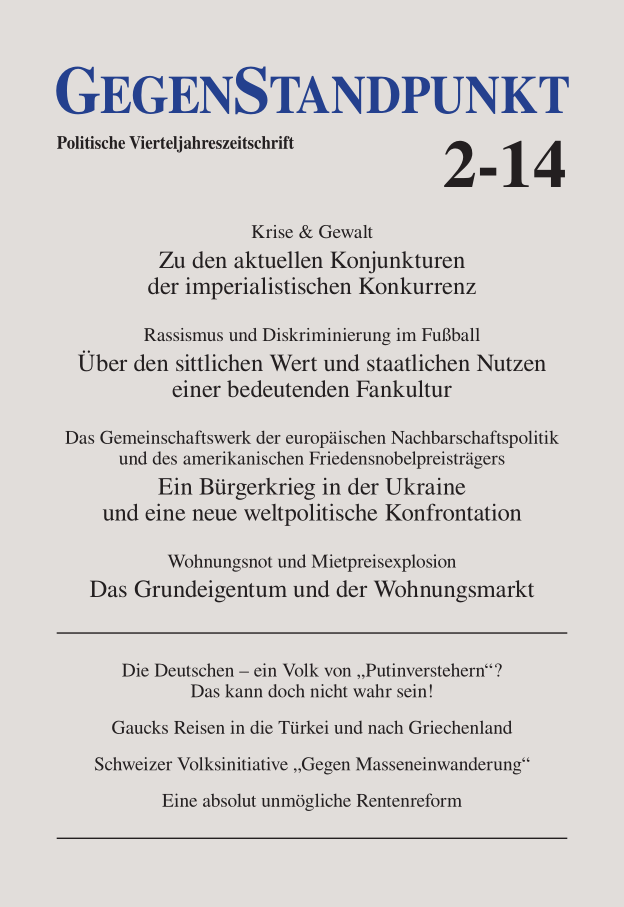Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Schweizer Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“
Der Schweizer Volkssouverän hat sich daneben benommen – wobei?
Die Schweizerische Volkspartei (SVP), stimmenstärkste Partei in der Schweiz, hat unter Federführung ihres Vizepräsidenten Christoph Blocher eine Eidgenössische Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ veranlasst und die Volksabstimmung am 9. Februar 2014 mit 50,3 % der abgegebenen Stimmen knapp gewonnen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Schweizer Volksinitiative „Gegen
Masseneinwanderung“
Der
Schweizer Volkssouverän hat sich daneben benommen –
wobei?
Die Schweizerische Volkspartei (SVP), stimmenstärkste Partei in der Schweiz, hat unter Federführung ihres Vizepräsidenten Christoph Blocher eine Eidgenössische Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ veranlasst und die Volksabstimmung am 9. Februar 2014 mit 50,3 % der abgegebenen Stimmen knapp gewonnen.
Die Empörung ist groß. Unmittelbar nach Bekanntgabe des
Ergebnisses gehen Demonstranten in mehreren Schweizer
Städten auf die Straße und protestieren gegen Rassismus
und Ausländerfeindlichkeit in der Schweiz. Vertreter der
Schweizer Wirtschaft fürchten um die Zukunft ihrer
grenzüberschreitenden Geschäfte, nicht nur in der
Tourismusindustrie, die nach offizieller Auskunft der
dort engagierten Unternehmer ohne die besonders billigen
und willigen ausländischen Arbeitskräfte nicht leben
kann. Von den europäischen Nachbarstaaten – mit
Deutschland an vorderster Front – gehen die schärfsten
und handfestesten Verurteilungen aus; sie sehen in der
Entscheidung des Schweizer Volks nämlich höhere Güter
verletzt: Weil europäische Zuwanderer in der Schweiz
künftig so zu behandeln sind wie gewöhnliche Ausländer,
wird darin ein Verstoß gegen den heiligen Grundsatz
der Personenfreizügigkeit
(EU-Kommissionssprecherin) moniert, laut
EU-Chef Barroso ein fester Bestandteil des
EU-Binnenmarkts
, näher der Bilateralen I
von
1999. Ausnahmen gibt es nicht, schließlich ist der EU
Binnenmarkt kein Schweizer Käse
(EU-Kommissarin Viviane Reding);
Rosinenpickerei
kommt nicht in Frage. Wenn man das
Paket aufschnürt
, dann greift die
Guillotine-Klausel
, die einen denkbar tiefen
Schnitt in allen möglichen zwischenstaatlichen Verträgen
hinterlassen würde. Kurz darauf werden Gespräche über den
grenzüberschreitenden Stromhandel ausgesetzt und die
Schweiz wird aus den EU-Förderprogrammen Erasmus und
Horizon 2020 ausgeschlossen.
Die einen sehen also die Weltoffenheit, oder vielleicht
nur das weltoffene Image ihres Landes geschädigt, die
anderen ihre Geschäfte, die dritten die gelungene
Einbindung und Unterwerfung der Schweiz unter europäische
Regeln für den zwischenstaatlichen Verkehr… Aus den
denkbar disparatesten Gründen kommen die Gegner der
Entscheidung in einem Punkt überein: Die Schweizer haben
auf die ihnen vorgelegte Frage auf jeden Fall verkehrt
geantwortet. Das lässt sogar Bundespräsidenten Gauck,
Freiheitsguru und im Nebenberuf Schweiz-Versteher
(FAZ) – Warum schwärme ich
für die Schweiz? Es sind die Partizipationsmöglichkeiten
ihrer Bürger!
– daran zweifeln, ob überhaupt
Volksentscheide sich für schwierige Sachfragen
eigneten.
Er frage sich, ob sie von allen
Abstimmenden wirklich verstanden werden.
(FAZ, 1.4.2014) Oder etwas weniger
vorsichtig formuliert: Die spinnen die Schweizer!
(Stegner, SPD) Wenn die
Schweizer mehrheitlich daneben langen, also zur
Überraschung der einschlägigen Experten den für sie
vorgesehenen Konsens diesmal nicht bestätigen, ist das
Volk dort womöglich nicht reif für die direkt
demokratische
Entscheidungsmacht, die sein Staat ihm
anvertraut?
Von wegen.
*
Bei der Abstimmung über die Volksinitiative „Gegen
Masseneinwanderung“ nimmt die
Partizipationsmöglichkeit
der Eidgenossen ihren
Ausgangspunkt in dem Kalkül einer rechten
Regierungspartei: Die sieht in den derzeitigen
diplomatischen und Vertragsbeziehungen zu der EU, ganz
prominent in der europäischen Personenfreizügigkeit, die
die Schweizer Regierung vor anderthalb Jahrzehnten
unterschrieben hat, einen einzigen Angriff auf die
Souveränität der Schweiz: Die EU tut, als würden wir
zu ihr gehören!
(Blocher,
Interview, 10.2.14, www.20min.ch) Kein
EU-Beitritt auf Samtpfoten!
(Blocher, Albisgüetli-Rede, 17.01.2014).
Die Schweiz schließt keine Kolonialverträge ab, auch
nicht mit der EU… Kleine Länder straft man ab wie kleine
Buben. Das darf sich die Schweiz nicht gefallen
lassen.
(Blocher im
Spiegel-Interview, 17.2.14) An der Durchsetzung
dieser alternativen, anti-europäischen
Regierungslinie dürfen sich die Schweizer Bürger selber
beteiligen, indem sie sich – wie es sich für eine
Demokratie gehört – als Stimmvieh in Anspruch nehmen
lassen. Denn auch in der Schweiz besteht die
demokratische Teilnahme der Bürger an der Herrschaft
darin, zu einem von oben festgelegten Zeitpunkt zwischen
von oben präsentierten Alternativen staatlicher
Gewaltausübung zu wählen. Das tun sie aber nicht nur –
dies der kleine Unterschied, zu dem die Schweizer sich
gratulieren –, indem sie Politiker per Wahl
ermächtigen, die dann nur ihrem Gewissen verpflichtet,
also frei beschließen, was die Souveränität der Schweiz
gebietet und welche Imperative das für die Bürger
bedeutet. Das tun sie manchmal eben auch direkt
:
Den Politikern, die sie bei anderer Gelegenheit ins Amt
hieven, können und sollen sie ihrerseits – punktuell und
unter allerlei Bedingungen – Imperative erteilen, in
diesem Fall die folgenden vier:
(1) Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländern
und Ausländerinnen eigenständig.
Die Bedingungen für
die Begrenzung der Einwanderung zum Nutzen der Schweiz
lauten: (2) Die Zahl der Bewilligungen für den
Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der
Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente
begrenzt...
Für Erwerbsfähige sind diese (3) ...
auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz
unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen
und Schweizer auszurichten.
Qualitative Kriterien für
die Auswahl der ausländischen Erwerbswilligen werden
gleich mitgeliefert: Nur gut ausgebildete, für die
Arbeitgeber besonders gut geeignete Dienstleister und
Finanzkräftige sollen rein dürfen: Kriterien für die
Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind das Gesuch
des Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine
ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage.
Und
schließlich: (4) Es dürfen keine völkerrechtlichen
Vereinbarungen abgeschlossen werden, die gegen diesen
Artikel verstoßen.
(zitiert aus:
„Eidgenössische Volksinitiative „Gegen
Masseneinwanderung“. Änderungsvorschlag des Art. 121 der
Bundesverfassung).
Es ist nicht gerade wenig, was den Eidgenossen abverlangt
wird, wenn sie zur Entscheidung aufgefordert werden, ob
die Schweiz
selber, und zwar definitiv
eigenständig
die Zuwanderung von Ausländern
steuern
sollte. Da wird nämlich
erstens mit der größten
Selbstverständlichkeit unterstellt, dass die zum
Urnengang aufgeforderten Kantonisten mit der Beschwörung
dieses eigenständig steuernden Subjekts namens Schweiz
sich angesprochen fühlen, als Mitglieder einer
Gemeinschaft, die viel mehr als einen gemeinsamen Pass,
nämlich eine nationale Sache teilen. Die mögen
sich über alles Mögliche in der Schweiz uneinig
sein, und auch wenn sie sonst nichts teilen – als
Schweizer Eidgenossen teilen sie ein fortdauerndes
Gemeinschaftsanliegen, das ihnen Treue abverlangt, vom
Rütlischwur bis zu den heutigen gesamtwirtschaftlichen
Interessen der Schweiz
: Die Sache der Nation muss
gelingen, das Beste fürs Land muss herauskommen.
Gerade diese moderne, marktwirtschaftliche Fassung des
national Besten – das gemeinsame Anliegen
Gesamtwirtschaft
– steht in auffälligem Kontrast
zu dem Bild, das diese Gemeinschaft im Zuge der Debatte
über die Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ von
sich abgibt: Die Befürworter der Initiative verweisen auf
einen Verdrängungskampf auf dem Arbeitsmarkt
,
hauptsächlich wegen der Schmutzkonkurrenz
von
Außen, nämlich von ausländischen Lohnabhängigen, die über
die Grenzen schwappen und mit ihrer außerordentlichen
Billigkeit und Willigkeit für Lohndruck
sorgen.
Die Opponenten halten dagegen, dass ein Ja
zum
Referendum den Zugriff auf genau die Billigstarbeiter
gefährden würde, der für die Bereicherung von ganz vielen
Schweizer Unternehmen einfach unentbehrlich ist – ein
Anschlag auf genau die gesamtwirtschaftlichen
Interessen
, die die Initiative bewahrt sehen will.
Diese Interessen werden nämlich in dem Maße besser
bedient, wie deren unternehmerische Agenten die
Konkurrenz der Arbeiter für ihre Bilanzen ausnutzen und
den Lohndruck
durchführen können, den sie – und
zwar nicht nur sie – dann den konkurrierenden
Arbeitskräften zuschreiben. Die Ja-Fraktion beklagt
explodierende Mieten und Bodenpreise
, bei den
Nein-Sagern herrscht Freude über die glänzenden
Immobiliengeschäfte, die sich genau damit machen lassen –
auch ein Beitrag zur Gesamtwirtschaft
. Eine
steigende Belastung der Sozialkassen durch Ausländer wird
kritisch ins Feld geführt; die wird mit der Sorge um
mangelnde Fachkräfte – und zwar billige – für die
elementarsten medizinischen Leistungen gekontert. Usf. Es
ist also nicht zu übersehen, dass auch das Leben unter
den Eidgenossen von einer flächendeckenden
Konkurrenz, von handfesten Gegensätzen
in ziemlich zentralen Angelegenheiten geprägt ist. Die
Lohnabhängigen unter ihnen kriegen es in der Debatte bunt
ausgemalt und im Referendum schwarz auf weiß: Sie müssen
um Arbeitsplätze buhlen, von denen es sowieso nicht genug
für alle gibt, und an denen ihre unternehmerischen
Eidgenossen sich umso besser bereichern, je weniger deren
„Besitzer“ davon haben. Alle zusammen konkurrieren sie um
den Wohnraum, der in dem Maße die Herzen der Vermieter
höher schlagen lässt, wie er für die anderen das Konto
strapaziert. Sie werden als Beitragszahler und -empfänger
gegeneinander aufgestellt, müssen sich auf der einen
Seite um teure Beiträge, auf der anderen Seite um
schlechtere Leistungen sorgen...
Das alles steht auch in der direkten Demokratie nicht zur
Abstimmung und soll von der SVP auch gar nicht in Frage
gestellt werden. Dafür werden gerade die Figuren, die
sich in dieser Konkurrenz unter allerlei widrigen
Bedingungen bewähren müssen,
zweitens zu einem ganz dicken
quid pro quo eingeladen, indem sie in ihrer eigenen
Notlage eine ihrer politischen Herrschaft sehen. Die
eigenen Interessen an einem Lebensunterhalt, an
erschwinglichen Wohnungen und medizinischer Versorgung,
die nicht so recht zum Zuge kommen; die Sorgen um die
eigene Existenz, die sich deswegen einstellen: Die müssen
die Schweizer Stimmbürger nicht beiseite legen, sondern
neu fassen – sie müssen sie national denken, als
lauter Anzeichen eines unerfüllten Bedürfnisses nach
einer nach Außen und nach Innen souveränen,
unwidersprechlichen Gewalt, die eigenständig
diktiert, was sich in und für die Schweiz gehört. Und sie
müssen es nicht dabei belassen, dieses unerfüllte
Bedürfnis zu bedauern und hinzunehmen, sondern dürfen die
ihnen zugestandene direkt demokratische Kompetenz dazu
benutzen, praktisch eine Lanze für die Souveränität ihres
Staates zu brechen. Ausgerechnet die Leute, deren Leben
im Wesentlichen darin besteht, sich von den
gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz
,
also von den Ansprüchen ihrer ökonomischen und
politischen Subjekten bestimmen zu lassen,
bekommen damit das Angebot, sich als die Herren im Haus
aufzuführen, also dort aufräumen zu lassen. Und zwar
indem sie sich ideell vor die Haustür stellen und darauf
bestehen, dass nur der Schweizer Staat entscheidet,
wer rein darf – und wenn ja, wie viele.
Die Frage betrifft zwar nur ein Moment der Verhältnisse im Land, i.e. den staatlichen Umgang mit den Ausländern, doch sie lässt das gesamte Leben in der Schweiz zugleich in einem vollkommen anderen, denkbar verfärbten Licht erscheinen: Alle dazugehörigen Notwendigkeiten und Schwierigkeiten – die Konkurrenz um einen Arbeitsplatz, von dem man leben kann, um erschwinglichen Wohnraum, sogar um Plätze in Zügen und Straßenbahnen – werden angesprochen, und zwar mit einer einzigen, sehr eindeutigen Absicht: Es geht nämlich drittens darum, unter den Betroffenen eine Gesinnung wach zu kitzeln und zu mobilisieren, die das alles in lauter Privilegien verwandelt, die nur Schweizer genießen. So dass sich nur eine Frage stellt: Wem stehen sie sonst zu bzw. nicht zu? Wenn sie sich beim Konkurrieren schwer tun, dann spricht das nicht gegen die Konkurrenz, sondern dafür, sie für Schweizer Konkurrenten zu reservieren. Kurz: Sie werden dazu aufgerufen, sich in genau der Weise zu äußern, wie es sich für ein Volk gehört, das sein Recht einklagt – mit einem Ruf nach dem Ausschluss der Anderen. Wovon die Fremden da ausgeschlossen werden sollen, was man damit für sich exklusiv reserviert – das wird in der Frage nicht einmal für bedeutungslos erklärt, das wird vielmehr heilig gesprochen.
*
Das Schweizer Volk, so viel steht fest, lässt sich die
Frage stellen. Es macht sämtliche darin enthaltenen
Prämissen mit und akzeptiert gern die Rolle des
Türstehers vor seinem Ländchen. Dass sie zu einem
Wir
dazu gehören und in den Schweizer Lebens-,
Arbeits- und sonstigen Verhältnissen ihre
gemeinsamen Verhältnisse haben, mag es darin noch so
gegensätzlich zugehen, ist für die Eidgenossen offenbar
eine Selbstverständlichkeit. Und diesmal haben sie in
ihrer knappen Mehrheit genau die völkische Antwort
gegeben, die die SVP von ihnen erwartet. Sie lassen sich
ohne Weiteres darauf ansprechen, dass die auf allen
Kanälen breitgetretenen Unannehmlichkeiten eines
Zurechtkommens in der Schweiz nichts als einen
Dichtestress
darstellen, der in dem Moment
unerträglich wird, in dem sich Nicht-Schweizer
hinzugesellen. Wie auch immer es in der Schweiz zugeht,
womit auch immer man da zurechtzukommen hat: Das alles
soll auf jeden Fall den Schweizern vorbehalten
sein.
Keine Frage, da hat sich ein sehr reifes, nämlich patriotisch verdorbenes Volk zu Wort gemeldet. Dass das wiederum keine Schweizer Besonderheit ist; dass ein Volk, wenn es schon dazu eingeladen wird, auf seinem Recht und auf der heiligen Eigenständigkeit seiner nationalen Herrschaft auch besteht, und zwar gelegentlich im Widerspruch zum aktuellen Konsens der herrschenden Instanzen: Das haben die Parteien der europäischen Nachbarstaaten, die regierenden wie die oppositionellen, nach dem Schweizer Referendum und vor der „Europawahl“ deutlich genug gemacht. Die Herrschaften werden ihre Basis schon gut kennen.