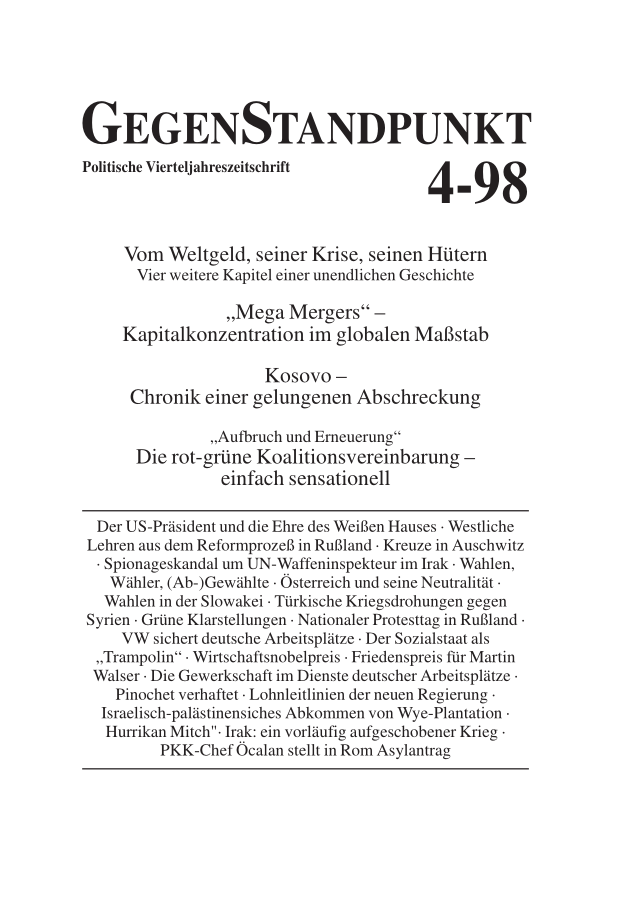„Aufbruch und Erneuerung“
Die rot-grüne Koalitionsvereinbarung – einfach sensationell
Der Koalitionsvertrag der frisch gewählten rot-grünen Regierung liefert einen Überblick über moderne Regierungstätigkeit in Demokratie und Kapitalismus. Als da wären: Öko-Steuer gegenfinanzierte Verbilligung der Arbeit durch Senkung der Lohnnebenkosten, Steuerreform zur Stärkung der Konjunktur unter Schonung der Staatskasse, „Förderung“ von Arbeit statt Arbeitslosigkeit, „Sicherung“ der Renten durch Kürzung und „Privatisierung“, Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie wegen drohender „unabsehbarer Schäden“ unter Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Energiekonzerne, Kriminalitätsbekämpfung, „Integration“ von Ausländern sowie, nicht zuletzt, Kontinuität der Außenpolitik im deutschen Interesse.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- „eine Politik zu gestalten, die den neuen Herausforderungen gerecht wird“
- „Kassensturz“
- „Mit der ökologischen Steuerreform senken wir die Lohnnebenkosten und belohnen umweltfreundliches Verhalten“
- „eine sinnvolle Kombination von Angebots- und Nachfragepolitik“
- „eine gerechte Verteilung von Leistungen und Lasten“
- „Der Grundsatz unserer aktiven Arbeitsmarktpolitik lautet: Arbeit statt Arbeitslosigkeit“
- „Die Veränderung im Altersaufbau der Bevölkerung erfordert ein Umdenken in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“
- „den Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft entschädigungsfrei regeln“
- „entschlossen gegen Kriminalität und entschlossen gegen ihre Ursachen“
- „Integration der auf Dauer bei uns lebenden Zuwanderer“
- „außenpolitische Verläßlichkeit“
- „Die Koalitionspartner verpflichten sich, diese Vereinbarung in Regierungshandeln umzusetzen“
„Aufbruch und Erneuerung“
Die rot-grüne Koalitionsvereinbarung –
einfach sensationell
In der öffentlichen Diskussion über den Koalitionsvertrag dreht sich alles um die Frage: Was macht die neue Regierung anders? Die einen sehen durch das, was sie von ihr mitgeteilt bekommen, ihre Befürchtungen bestätigt, daß sich zuviel ändert; andere sind enttäuscht darüber, wie wenig sich ändert; der mainstream kommt nüchtern realistisch zu dem Urteil, daß eine rot-grüne Koalition es auch nicht anders macht. Diese Diskussion hat einen entscheidenden Nachteil: In ihr kommt einfach nicht zur Sprache, was die Sache ist, die die Regierung macht. Die ist einfach unterstellt, wo sich aus der Perspektive der Betroffenheit – der eigenen oder stellvertretend der anderer oder einer bloß vorgestellten – Leute zu Wort melden, die dem Koalitionspapier Erkenntnisse darüber ablauschen wollen, was sich nun für Lieschen Müller, für die Unternehmer, für den Steuerzahler, für die Natur etc. ändert oder ob alles beim alten bleibt. Und solange sie weiter nichts interessiert, wird man ihnen nur empfehlen können abzuwarten: Das wird ihnen schon noch rechtzeitig mitgeteilt.
So selbstverständlich ist freilich die Wahl dieser Perspektive gar nicht. Daß sie von Mann und Frau, arm und reich, Hauptschulabgängern und Intellektuellen eingenommen und von einem Heer von Fernseh- und Zeitungsleuten nach Kräften bedient wird, zeugt immerhin selbst schon von der ziemlich ungeheuerlichen Selbstverständlichkeit, daß der Bürger seine materiellen Lebensumstände diktiert bekommt und – mürrisch oder erleichtert, meist unzufrieden, aber grundsätzlich fügsam – entgegennimmt. (Nur die anerkanntermaßen mächtigsten Privatpersonen im Land, diejenigen, die den Reichtum der Nation verkörpern, machen da eine Ausnahme und mischen sich ein in die Festlegung dessen, was auf sie zukommt; aber die haben ja auch erstens sowieso Recht und zweitens die Mittel dazu.) Umgekehrt: Was die Herren Schröder und Fischer, Lafontaine und Trittin samt ihren Quotenfrauen sagen, das gilt nun für alle. Bei ihren Wortmeldungen handelt sich ab sofort nicht mehr um bloße Meinungsäußerungen oder Parteistandpunkte, sondern um verbindliche Auskünfte darüber, wonach sich jeder in der Nation unabhängig von seiner unmaßgeblichen Meinung und Interessenlage zu richten hat.
Und so stellen sich die mit der Regierungsverantwortung betrauten Damen und Herren von der sozialdemokratischen und grünen Partei auch sogleich dem Publikum vor: als die neue Herrschaft im Lande. Es ist zwar bloß eine Floskel; aber auch eine solche Floskel darf ruhig einmal beim Wort genommen werden; denn daß niemand ihr eine größere Bedeutung beimißt, bezeugt nur die fatale Selbstverständlichkeit der Herrschaftsattitüde, die sich darin immerhin äußert: Gleich in der Präambel ihres Koalitionsabkommens bekunden die Vertragsparteien ihren Willen,
„eine Politik zu gestalten, die den neuen Herausforderungen gerecht wird“
Man hört es sofort: Da machen sich Leute ans Werk, die
ihre dank der weisen Entscheidung des Wählers nun endlich
ihnen zukommende Freiheit des Regierens
sichtlich genießen und es als reizvolle
Gestaltungsaufgabe begreifen, dem Rest der Nation die
Notwendigkeiten zu verordnen, mit denen der dann
zurechtkommen muß. Das, was sie ihm verordnen, begründen
sie mit Verweisen auf die Handlungsbedingungen
nationaler Politik
: Nicht näher bestimmte
„tiefgreifende ökonomische, ökologische und soziale
Veränderungen“ im Inneren sowie gewisse internationale
Entwicklungen – eine „zunehmende Verflechtung der
Weltwirtschaft“, die „Internationalisierung der
Finanzmärkte“, die „fortschreitende Integration Europas“
und „weltweite Krisentendenzen“ – sind es, die ihrer
Auskunft zufolge „nach einer entschlossenen Reformpolitik
verlangen“. So sieht die Welt aus der Perspektive
derjenigen aus, die die Macht ausüben: Die inneren und
äußeren Verhältnisse der Nation bestehen für sie aus dem
staatlichen Handlungsbedarf, den sie aus ihnen
ableiten. Diesen machen sie als die ihrer Politik
vorausgesetzte Lage vorstellig, aus der sich jeweils
die aktuellen Anforderungen ergeben, die sie an die
Gesellschaft, an die staatliche Ordnung sowie ans Ausland
stellen. Dabei machen sie nicht viel Aufhebens davon, daß
ihre Freiheit zu bestimmen, wo und wann der Staat als
Gesetzgeber bzw. als außenpolitisches Subjekt
herausgefordert ist, auf einer bereits flächendeckend
funktionierenden rechtsstaatlichen Herrschaft sowie auf
dem ökonomischen, politischen und militärischen Status
ihrer Nation beruht. Deswegen brauchen sie ihrem Volk
auch nicht umständlich zu erklären, daß sie es für einen
erfolgreichen Kapitalismus und die Bedürfnisse seiner
Staatsmacht einspannen. Mit dem Hinweis auf die
Sachzwänge der Politik einerseits, auf die
Ziele staatlichen Handelns andererseits, sowie
auf ihre Entschlossenheit, ihre Führungsaufgaben im
Unterschied zur alten Regierung tatkräftig anzupacken,
ist es bestens bedient und darf es sich seinen Reim auf
die Verteilung von Freiheit und Notwendigkeit machen –
wobei die Definition der Ziele, mit denen sie ihre
Politik rechtfertigen und an denen sie sie allein messen
lassen, selbstverständlich ebenfalls ihnen obliegt:
„Die von den Koalitionsparteien vereinbarte Regierungspolitik steht für wirtschaftliche Stabilität, soziale Gerechtigkeit, ökologische Modernisierung, außenpolitische Verläßlichkeit, innere Sicherheit, Stärkung der Bürgerrechte und die Gleichberechtigung der Frau.“
Bei diesen Zielen handelt es sich samt und sonders um Ideale gelungener Herrschaft: um Varianten der Lüge von der Volksdienlichkeit des Regierens, in deren Namen Staatsführungen ihre Berechtigung zur Ausübung der Herrschaft zu reklamieren pflegen. Da die Werte guten Regierens, welche die neue Mannschaft verkündet, im wesentlichen dieselben sind wie die der Regierung Kohl, wird es ihr wohl in erster Linie auf ein deutliches Bekenntnis zur Kontinuität angekommen sein – was die in den Zeitungen abgedruckten Analysen, in denen sich die geballte Urteilskraft der Nation äußert, ja auch prompt herausfinden, ohne dabei der Hauptsache sonderlich Beachtung zu schenken: daß die Kontinuität, zu der sich die neue Regierung da bekennt, schon auch einen eindeutigen Inhalt hat. Die Kontinuität betrifft die Herrschaft, deren Bestand, Fortschritt und Gelingen auch die rot-grüne Mannschaft all ihre Bemühungen zu widmen verspricht.
Gewisse Akzentsetzungen – Frau ersetzt Familie; und ein noch penetranteres Herumreiten auf Ökologie und Arbeitslosigkeit, als Generalrechtfertigungen für jede Aktivität der Regierung – waren bei der Abfassung des Wertekanons zwecks Erkennbarkeit der Handschrift der Koalitionspartner dennoch unvermeidlich. Daß sich aus ihnen keine neuartigen Ansprüche an den Staat ableiten lassen, stellt der Koalitionsvertrag jedoch sogleich klar; und zwar – sehr konsequent, wenn man an der Hauptsache fortdenkt –, indem er auf das Herrschaftsmittel zu sprechen kommt.
Ihre Arbeit will die neue Regierung entschlossen mit einem
„Kassensturz“
aufnehmen:
„Erst die Bilanzierung der Finanzpolitik der alten Regierung im Rahmen eines umfassenden Kassensturzes nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung kann endgültig Klarheit über die tatsächliche Lage der Staatsfinanzen erbringen“ –
wobei für sie bereits vor dem alles entscheidenden Blick in die Kasse feststeht, daß ihr die Vorgänger-Regierung „eine schwere finanzpolitische Erblast“ hinterläßt, welche „die finanziellen Handlungsmöglichkeiten des Staates enorm einschränkt“. Sie versteht sich also nicht nur vom ersten Tage an perfekt darauf, mit dem Verweis auf die beschränkten Mittel, die ihr zur Verfügung stehen, deutlich zu machen, daß man ihr die menschenfreundlichsten Absichten zwar gerne unterstellen darf, die aber nicht das Regierungshandeln bestimmen können. Der rot-grünen Mannschaft ist es sichtlich ein besonderes Bedürfnis klarzustellen, daß bei ihr der Verdacht völlig abwegig ist, sie könnte womöglich, bloß weil sie irgendwie alles sozial gerecht und ökologisch zu machen verspricht, für eine sauberere Umwelt oder ein erträglicheres Arbeitslosendasein die Staatsfinanzen einspannen. Durch die regelrechte Inszenierung eines vorbildhaften haushälterischen Gebarens als erster Amtshandlung und die präventive Zurückweisung sozial oder ökologisch begründeter Forderungen an sie – „Nicht alles, was wünschbar wäre, ist gegenwärtig auch finanzierbar.“ – stellt sie ausdrücklich klar, daß sie einen mindestens ebenso verantwortlichen Umgang mit den Haushaltsmitteln pflegen wird wie Theo Waigel.
Von dem erbt sie nämlich nicht nur einen Haufen Staatsschulden, der sie zur Ohnmacht verurteilt. Seine Nachfolge tritt sie darin an, daß sie es sich zur „Hauptaufgabe“ macht, „die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates durch Sanierung der öffentlichen Finanzen zurückzugewinnen“. Die Macht, tatkräftig die Unterordnung ihres Gemeinwesens unter die Finanzlage des Staates zu betreiben, hat sie ja nun immerhin; und diese Macht ist sie entschlossen auszuüben. Damit freilich stellt sie klar, daß die Staatsfinanzen nicht – nur gerade leider nicht zur Verfügung stehende – Mittel für irgendwelche wohltätigen Zwecke sind, sondern das Kriterium des Erfolgs, an dem sich auch für sie die gesellschaftlichen Interessen einigermaßen übersichtlich in solche sortieren, deren Förderung dem Wirtschaftswachstum und darüber der Staatskasse zugute zu kommen verspricht, die deswegen entsprechende Staatsausgaben rechtfertigen und vom Fiskus zu schonen sind, und solche, die dieses Argument nicht auf ihrer Seite haben und deswegen auch rot-grünen Finanzverwaltern des Staates Gelegenheit bieten, die Tugend einer „sparsamen Haushaltspolitik“ unter Beweis zu stellen. Z.B. durch den finanzpolitische Kompetenz ausstrahlenden Gebrauch einer von ihren Vorgängern in Umlauf gebrachten Wortschöpfung:
„Finanzwirksame Vorhaben des Koalitionsvertrages müssen entweder unmittelbar gegenfinanziert oder unter Finanzierungsvorbehalt gestellt werden.“
In Bezug auf die gesellschaftlichen Interessen, für die ihnen das gute Geld des Staates einfach zu schade ist, schreiben sie die Lüge fort, der Staat finanziere seine Gesellschaft, um aus dem damit an die Wand gemalten, unhaltbaren Zustand das wirkliche, nämlich umgekehrte Verhältnis als Gebot einer ordentlichen Haushaltsführung abzuleiten. Wobei sie kurz mal unter den Tisch fallen lassen, daß da, wo es ihnen auf die Förderung eines Interesses ankommt, auch sie sich von einer fehlenden „Gegenfinanzierung“ durch Steuereinnahmen selbstverständlich nicht die Hände binden lassen, sondern sich rechtzeitig auf das Mittel der Staatsverschuldung besinnen.
Im Hinblick auf die „Gegenfinanzierung“ vorbildlich ist der große Schlager der Koalitionsvereinbarung:
„Mit der ökologischen Steuerreform senken wir die Lohnnebenkosten und belohnen umweltfreundliches Verhalten“
Der weithin für genial gehaltene Einfall: Mit einer Steuer auf Benzin, Heizöl, Gas und Strom, die Anreiz zum Energiesparen schafft, wird eine Senkung der Lohnnebenkosten finanziert, die Anreiz zur Einstellung von Arbeitskräften schafft. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und einer ruinierten Umwelt ist den zur Regierungsmacht aufgestiegenen Vertretern des sozialen und des ökologischen Denkens der Befund klar: In ihrem Gemeinwesen ist die Arbeit zu teuer, die Energie zu billig. Die falschen Preise diagnostizieren sie im Hinblick auf den Konsum dieser so unterschiedlichen „Güter“: Von dem einen wird für ihren Geschmack viel zuwenig Gebrauch gemacht, bei dem anderen wäre ein sparsamerer Umgang angesagt.
Was die Arbeit betrifft, ist freilich klar, daß für sie nur ein sehr exklusiver Kreis von Konsumenten in Frage kommt. Daß umgekehrt die große Masse der Regierten mit ihrem Lebensunterhalt in dieser Rechnung als Ware vorkommt, über deren Gebrauch jener auserlesene Konsumentenkreis befindet, muß jedoch niemanden grämen. Denn nun gibt es ja eine neue Koalition, die sich dem unausbleiblichen Folgeproblem widmet, daß immer wieder einiges und derzeit so besonders viel von dieser Ware unverkäuflich liegenbleibt. Sie packt das Problem tatkräftig an, und zwar nach der Maxime: Wenn die Leute billiger werden, dann werden die Unternehmer sie doch wohl wieder mehr benutzen können.
Den Vorwurf des Zynismus brauchen Rote und Grüne an dieser Stelle nicht zu fürchten. Sie zitieren ja gewissermaßen bloß die gesellschaftliche Praxis, und zwar im Licht der herrschenden Interessenlage. Und die sieht nun einmal so aus, daß Löhne bezahlt werden – „Arbeit gekauft wird“, wie der ökonomische Sachverstand es ausdrückt –, damit der Einsatz der Arbeitskräfte sich für den Arbeitgeber lohnt, also damit für ihn durch möglichst wenig Lohn möglichst viel Ertrag zustandekommt. Man braucht diese Zweckbestimmung nur eine Spur sozialfriedlicher, nämlich als Bedingungsverhältnis zu betrachten, etwa so: Arbeitgeber können sich den Kauf von Arbeit nur leisten, wenn mit ihrer Anwendung Profit zu erwirtschaften ist – dann hat man noch immer nichts so richtig Falsches behauptet und ist doch schon auf der richtigen Seite gelandet. Denn so gesehen ist alles, was Unternehmer für ihr Interesse unternehmen – und das ist nicht wenig: Löhne drücken, Leistung steigern, über die gesteigerte Leistung wieder die Löhne drücken, also mit einem Wort: rationalisieren –, nichts als ein gemeinnütziges Engagement für das Ziel, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen Lohnzahlungen überhaupt erst möglich werden, also mit einem Wort: Arbeitsplätze zu schaffen; und darin verdienen sie ja wohl eindeutig jede Unterstützung. Sogar die beliebte und in den zurückliegenden Jahren ausgiebig praktizierte unternehmerische Technik, die Folgen eingesparter Lohnkosten, nämlich immer mehr Arbeitslose, zum wirksamen „Argument“ gegen die Lohnhöhe und für mehr Leistung zu machen, gibt, so mit dem richtigen parteilichen Blick gesehen, den zwar absurden, aber völlig systemgemäßen Umkehr-„Schluß“ her, daß es dann wohl weniger Arbeitslose gäbe, hätte „man“ durch rechtzeitige Verbilligung der Arbeitslöhne mehr Lohnkosten gespart als die Unternehmer durch Rationalisierungen mit nachfolgender Entlassung der überflüssig gewordenen Arbeitskräfte. Woraus sich ganz einwandfrei die oben zitierte Handlungsmaxime ergibt; schon gleich für Rote und Grüne, die aus der Gesellschaft keinen anderen Ruf vernehmen als den sehnsüchtigen nach „Arbeit, Arbeit, Arbeit!“ Die Konsequenzen des tatkräftig verwirklichten Unternehmerinteresses an immer rentablerer Arbeit sind für die Koalitionäre eine einzige Herausforderung, die Arbeiter von Staats wegen um soviel billiger zu machen, daß sich allein deswegen schon wieder mehr von ihnen ertragreich anwenden lassen müßten.
Wo sie da eingreifen können, das erklären die privateigentümlichen Veranstalter des kapitalistischen Erwerbslebens dessen politischen Managern schon seit Jahren in Form zunehmend verärgerter Beschwerden über die sogenannten Lohn-Nebenkosten: jenen Teil der für Arbeit verausgabten Geldsumme, der gleich in der Hand des Staates landet und von diesem „sozial“ verwandt wird, nämlich für den Unterhalt der vom Kapital nicht bzw. nicht mehr gebrauchten und deswegen einkommenslosen Angehörigen seiner auf Lohneinkommen angewiesenen Mannschaft. Richtig, nämlich mit Unternehmeraugen betrachtet, liegt da überhaupt kein genuiner Lohnbestandteil vor – unter reinen Lohngesichtspunkten hat ein Leben ohne lohnenden Dienst für einen Arbeitgeber jeden Anspruch auf Unterhalt verloren –, sondern ein von der Staatsgewalt verfügter Zuschlag zum eigentlichen Preis der Arbeit, quasi eine sozialpolitische Steuer auf Arbeitsplätze – und insofern ein enormes Einsparpotential. Und das sehen die rotgrünen Wirtschaftssachverständigen ganz genauso: Den sozialstaatlich beschlagnahmten Teil des Lohns begreifen sie als Chance, die unzumutbar hohen „Faktorkosten“ für Arbeit von Staats wegen zu senken, und beschließen – zwecks „Abbau der Arbeitslosigkeit“ – eine Entlastung der Unternehmer; wenigstens schon einmal von einem Teil des Aufwands für den Lebensunterhalt der Klasse, die ihnen doch zur Vermehrung ihres Vermögens zur Verfügung steht und nicht, um unnütz zu kosten.
Dabei kommt für die neue Koalition eines von vornherein nicht in Frage: mit den Kosten der Armutsverwaltung, die sie den Unternehmern ersparen will, den Staatshaushalt zu belasten. Deshalb findet eine seit Jahrzehnten propagierte grüne Forderung endlich Aufnahme in das Regierungsprogramm: Energie wird verteuert; mit den Mehreinnahmen werden die Lohn-Nebenkosten gesenkt. Das ist insofern eine ungemein sinnvolle Maßnahme, als der Kreis derer, die dieses Gut konsumieren, erheblich größer ist als der kleine Zirkel der Konsumenten von Lohnarbeit. Strom und Benzin verbraucht irgendwie jeder – eine prima Gelegenheit also, dem Staat eine ergiebige Steuerquelle zu erschließen, aus der die Gelder fließen, mit denen er die Unternehmer entlastet. Letztere gehören allerdings auch und zwar zu den größten Energieverbrauchern. Und da es nicht zu deren Entlastung beiträgt, wenn sie das, was sie beim Kostenfaktor Arbeit sparen, beim Kostenfaktor Energie zusätzlich zahlen müssen, hat die weitsichtige rot-grüne Staatsführung gleich die passenden Ausnahmen mitbeschlossen: Durch die Ökosteuer soll „die energieintensive Wirtschaft bei Heizöl, Gas und Strom nicht belastet“ werden; die energieintensivste Wirtschaft, die Energieindustrie mit ihren Dreckschleudern wird dann noch einmal extra in der Weise „erfaßt“, daß nicht sie, sondern ihre Kundschaft die neue Steuer zahlen soll: „In der Stromerzeugung eingesetzte Energieträger werden ausschließlich über die Besteuerung des Stroms erfaßt.“ Mit diesen Ausnahmen gewährt die neue Regierung ihrem freien Unternehmertum weiterhin das Recht auf einen kostengünstigen Zugang zu den Energieträgern und damit auf den kapitalistisch einzig sachgerechten Umgang mit der Natur. Da für das Kapital jede Rücksichtnahme auf seine Umwelt, von der es verschwenderisch Gebrauch macht, Unkosten darstellt, will sie ihm die gar nicht erst aufbürden. Sie setzt da mehr auf das „Instrument der freiwilligen Selbstkontrolle“, womit freilich auch alles über den ökologischen Nutzen gesagt ist, den sie ihrer Energiesteuer zuspricht. Aber was soll’s auch: Die ist jedenfalls, Ökologie hin oder her, eine ideale neue Steuerquelle: Die Massen zahlen und ersetzen mit dem, was sie zahlen, Sozialbeiträge der Unternehmer; die Nutznießer, die Unternehmer, sind von Zahlungen ausgeschlossen. Besser kann man wirklich nicht mit einem Schlag Um- und Arbeitswelt gleichzeitig sanieren.
Im rotgrünen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ist die ökologische Steuerreform, die volkswirtschaftlich betrachtet wohl unter die Rubrik ‚angebotsorientierte Wirtschaftspolitik‘ fällt, aber bei weitem nicht das einzige, was die neue Regierung zu bieten hat. Volkswirtschaftlich gebildete Leute, die aus der eindeutigen Zweckbestimmung der Arbeit in der Marktwirtschaft – es muß sie geben, damit sie mehr bringt als kostet – den konstruktiven Standpunkt verfertigen, daß Arbeit billiger werden muß, damit es welche gibt, solche Sachverständige können sich immerhin einen Gesichtspunkt vorstellen, unter dem ein Geld in den Händen der von Lohnarbeit lebenden Massen doch auch einen Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leisten könnte, nämlich im Sinne einer beachtlichen Randbedingung fürs kapitalistische Geschäft: Als Massenkaufkraft ist sogar der Lohn letztlich ein Bestandteil jener Nachfrage, ohne die das beste und billigste Angebot bloß ein Angebot bleibt. Wenn die Rot-Grünen im Zeichen dieser tiefen und humanen Einsicht
„eine sinnvolle Kombination von Angebots- und Nachfragepolitik“
versprechen, so bedeutet das freilich nicht, daß sie sich zu dem Mißgriff versteigen, bei privaten oder gar bei sich selbst als öffentlichen Arbeitgebern ein gutes Wort für höhere Löhne einzulegen – wie sollte sich so etwas auch „sinnvoll“ mit einer guten „Angebotspolitik“ vertragen. Unter dem Stichwort „Nachfragepolitik“ kündigen sie vielmehr eine „Reform der Einkommens- und Unternehmensbesteuerung“ an und bekennen sich damit zu dem ebenso absurden wie traditionsreichen Ideal, der Staat könnte und sollte mit seinen Steuern noch ganz andere Sachen bewerkstelligen als bloß sich an dem Geld bedienen, das in seiner Gesellschaft verdient wird; insbesondere müßte er die private Nachfrage durch eine geschickte Art ihrer steuerlichen Beschränkung stärken und dadurch der Wirtschaft zu einer immerwährenden Binnenkonjunktur verhelfen. In diesem Sinne stellt die Koalition „den Bürgern und Bürgerinnen sowie den Unternehmern“ Steuerentlastungen in Aussicht; nicht ohne dazu, schon um der Glaubwürdigkeit ihrer Entlastungsabsicht willen, gleich ein ausgetüfteltes Finanzierungskonzept zu präsentieren. So stellt sie erstens ihren konstruktiven Reformwillen unter Beweis – und zweitens die Banalität, daß auch unter rot-grünen Vorzeichen der Staat seine ökonomische Natur als faux frais nicht los wird: Er will von seiner Gesellschaft unterhalten sein. Darum bemühen sich die mit diesem aufregenden Auftrag neu Betrauten nach Kräften, wenn sie an Bemessungsgrundlagen und Steuerprozenten herumdoktern; wobei sie es u.a. für angezeigt halten, durch die „Beseitigung überflüssiger Steuersubventionen“ auch Unternehmer und Selbständige wieder einmal in die Nähe von Steuerforderungen zu bringen. Stinknormale Steuerpolitik also.
Immerhin: Ein neues Stichwort – ‚nachfrageorientiert‘ –, unter dem Steuer-, Finanz- und Wirtschaftspolitik gemacht werden kann, ist eingeführt. Und das ist ja auch was! Irgendwo soll der neue Wind ja dann doch zu spüren sein, der mit der neuen Regierung ins Land kommt. Und daß sie dieses Stichwort wählt, zeigt, auf welchem Feld sie sich als die bessere Führung hervortun, ihre Kompetenzen unter Beweis stellen und sich messen lassen will: In Fragen der staatlichen Förderung des Kapitalwachstums will sie sich von den neoliberalen Versagern auf den Oppositionsbänken auf keinen Fall den Rang ablaufen lassen.
Und der neue Wind wird auch wahrgenommen. Allein damit, daß die Koalition das jahrelang eingemottete volkswirtschaftliche Dogma von der Massenkaufkraft, die dem Wirtschaftswachstum dient, wieder einmal in Erinnerung bringt, löst sie helle Aufregung aus – bei den Vertretern der Wirtschaft, die ihr unteilbares Recht auf Kontinuität in Sachen Senkung des nationalen Lohnniveaus in Gefahr sehen und eine Besteuerung von Unternehmereinkommen für schlichtweg unverschämt halten: Vom Staat, der ihr Eigentum schützt, werden sie ja wohl noch verlangen können, daß er es auch selber unangetastet läßt und seinen Unterhalt gefälligst aus dem Einkommen derer bestreitet, die es vermehren! Der neuen Regierung tut der Unternehmerstand damit den Gefallen, daß er den Maßstab liefert, den der mehr sozial denkende Teil der Menschheit zugrundelegen muß, wenn er die Vorzüge ihrer Politik erkennen will. Die stechen einem förmlich ins Auge, wenn man die rot-grüne Politik an der Anspruchshaltung mißt, die sich die Unternehmer in 16 Jahren Kohl-Regierung angewöhnen durften: Alle 3 – in Worten: drei – „Fehlentscheidungen“ der alten Regierung – bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, beim Kündigungsschutz und beim Schlechtwettergeld – werden von der neuen prompt rückgängig gemacht. Da läßt sie sich nicht lumpen, schließlich geht es ihr auf dem Feld der Sozialpolitik um
„eine gerechte Verteilung von Leistungen und Lasten“
Auf die recht einseitige Verteilung des Reichtums, die sie in ihrem Gemeinwesen vorfindet, ist ihr Motto dabei weniger gemünzt. Zwischen der vermögenden und der eher minderbemittelten Klasse besteht ja auch kein von Staats wegen eingerichtetes Verhältnis von Leistungen und Lasten, in das sie beherzt eingreifen und einen gerechten Ausgleich bringen könnte. Umso mehr hat der Maßstab der Verteilungsgerechtigkeit für sie innerhalb der minderbemittelten, vom Lohn abhängigen Klasse sein Recht; da, wo der Sozialstaat auf deren Mitglieder den Mangel verteilt, der mit ihrer Einkommensquelle gegeben ist. Wo Lohneinkünfte zur Finanzierung der Unterhaltszahlungen herangezogen werden, die während der zum Leben mit dieser Einkommensquelle nun einmal dazugehörenden Zeiten der Einkommenslosigkeit gewährt werden, da liegen die wirklich großen Herausforderungen für die Leute mit dem ausgeprägten Sinn für Verteilungsgerechtigkeit. Irgendwer muß sich ja auch der Regelung des Gegensatzes zwischen Leistungsempfängern und Beitragszahlern annehmen, in den der Sozialstaat die gerade einkommenslosen und die gerade Einkommen beziehenden Bestandteile ein und derselben Klasse durch seine Verteilungskunst bringt. Auch das eine reizvolle Aufgabe: Stets auf der Seite des in diesem Gegensatz gerade für berechtigt erklärten Interesses in die Lebensmittel der anderen Seite hineinregieren – wer kann das schon?
Richtig spannend wird diese Aufgabe für die gestandenen Sozialpolitiker von der neuen Koalition freilich erst dadurch, daß sie jedem vorrechnen können, daß sich aus dem in der Nation verdienten Lohn beim besten Willen nicht mehr gleichzeitig der Unterhalt der Beschäftigten bestreiten und ein Unterhalt für alle anderen Fraktionen, die davon leben müssen, organisieren läßt; schon gar nicht in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit – womit die rot-grünen „Modernisierer des Sozialstaates“ wieder bei ihrem Haupt- und Generalanliegen wären: Die vielen Arbeitslosen sind einfach nicht mehr auszuhalten. Weitere Radikallösungen sind also gefragt. Und da macht die neue Koalition dort weiter, wo die vorhergehende Regierung aufgehört hat:
„Der Grundsatz unserer aktiven Arbeitsmarktpolitik lautet: Arbeit statt Arbeitslosigkeit“
Ein Appell an den gemeinen Menschenverstand kann da, wo die Dinge grundsätzlich angepackt werden sollen, nichts schaden:
„Die Arbeitslosigkeit kostet rund 170 Milliarden DM im Jahr. Die neue Regierung wird Mittel, die bisher zur Bezahlung von Arbeitslosigkeit ausgegeben wurden, zur Finanzierung von Qualifizierung und Arbeit einsetzen.“
Soviel gutes Geld. Und wofür gibt es der Staat aus? Zur Förderung der Arbeitslosigkeit, über die sich alle Welt beklagt! Natürlich meinen die rot-grünen Sozialpolitiker nicht allen Ernstes, daß die Tätigkeit der Arbeitslosenversicherung bislang darin bestanden hat, mit ihrem Geld die Zahl der Arbeitslosen mutwillig in die Höhe zu treiben. Sie werden schon wissen, daß diese Anstalt nicht die Arbeitslosigkeit, sondern Arbeitslose alimentiert, die eingesammelten Beiträge also für genau den Zweck ausgibt, für den sie gemäß gesetzlicher Vorschrift eingesammelt worden sind. Doch das kommt ihnen um so mehr wie reine unproduktive Verschwendung öffentlichen Eigentums vor, je dauerhafter die bestens funktionierende Marktwirtschaft für einen Millionenüberschuß an nichtsnutziger Bevölkerung sorgt. Dem Gemeinspruch, auf den Sozialpolitiker in dieser Lage sich gern berufen: ‚Der Staat kann keine Arbeitsplätze schaffen!‘ mag man zwar nicht widersprechen; genausowenig wollen Rote und Grüne ihm aber in dem Sinn Recht geben, daß dann von Staats wegen wohl nichts weiter zu machen wäre als eben bloß die Opfer zu betreuen. Mit 170 Milliarden Mark in der Hinterhand, Jahr für Jahr von der gezahlten Gesamtlohnsumme beschlagnahmt, gedenken die neuen Arbeitsmarktpolitiker aktiv zu werden. Dabei planen sie konsequent an ihrem Idealbild vom freien Markt für Arbeit entlang: Einerseits streng angebotsorientiert, streben sie an, daß qualifiziertere Ware auf diesen überfüllten Teilmarkt gelangt. Statt durch mangelnden Gebrauch immer konkurrenzunfähiger zu werden, sollen die Arbeitslosen sich anstrengen – an einschlägigen Erpressungsinstrumenten fehlt es bei den Arbeitsämtern nicht –; dann werden sie vielleicht irgendwann einen Minderqualifizierten wegkonkurrieren können, und schon wieder findet eines der vielen beklagenswerten „menschlichen Schicksale“ doch noch ein gutes Ende. Und wenn nicht, dann ist wenigstens der praktische Nachweis erbracht, daß aktive Arbeitsmarkt-Fördermittel auf dieses Schicksal umsonst verschwendet sind; neue Formen der Bedürftigkeit, die damit fällig wird, sind in der Planung. Wenn andererseits die Nachfrageseite – absehbarerweise – auf ein so vermehrtes und verbessertes Angebot trotzdem nicht anspringt, dann kommt auch in diesem Marktsegment die versprochene nachfrageorientierte Politik zum Zug: Es gilt das Kaufinteresse zu stimulieren. Man muß da nur entschieden genug mit Geldprämien für tüchtige Aufkäufer an die Arbeitgeber herantreten; dann werden sich schon welche finden, die sich bereitfinden, dem Staat ein paar von den Figuren, die ihm die Arbeitsämter einrennen, abzunehmen und auf staatlich subventionierten Niedrigstlohnarbeitsplätzen zu verstauen. Die alte Regierung hat in die Richtung bekanntlich schon einige Möglichkeiten angedacht; die neue wird sie weiterverfolgen.
Ähnlich verhält es sich bei der „Reform der Alterssicherung“, wo die rot-grünen Koalitionspartner zu dem Befund gelangen:
„Die Veränderung im Altersaufbau der Bevölkerung erfordert ein Umdenken in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“
Gut, daß die neue Regierung mit dem Umdenken schon mal angefangen und „ein bezahlbares Rentensystem, das den Menschen im Alter einen angemessenen Lebensstandard garantiert“, in ihren Zielkatalog aufgenommen hat. Denn wenn die Alten immer älter und im Verhältnis zu den Jungen immer mehr werden, dann ist ihre Versorgung nicht mehr gewährleistet.
So, wie der Laden, den sie übernimmt, eingerichtet ist, ist es jedenfalls so: weil die Mehrheit der Bevölkerung am Erwerbsleben mit einer für sie äußerst unergiebigen Erwerbsquelle teilnimmt und deswegen nach Ableistung ihrer Lebensarbeitszeit ohne Geld dasteht; weil sie in dieser Lage von Staats wegen darauf verwiesen ist, daß die Geldeinkünfte derjenigen, die mit derselben für sie untauglichen Erwerbsquelle gerade noch dabei sind, ihr Erwerbsleben zu absolvieren, auch noch die aus ihm Ausgeschiedenen miternähren; und weil dann auch noch die Lohneinkommen, die das hergeben sollen, Gegenstand flotter Sparaktionen von Seiten der Unternehmer sind. Das alles unterstellt, folgt aus dem Umstand, daß die Alten älter und im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung mehr werden, tatsächlich, daß ihr Unterhalt nicht mehr „bezahlbar“ ist.
Mit dieser ‚Folgerung‘ – für die es dann nur noch jemanden braucht, der sie praktisch durchsetzt – macht die neue Regierung ihr Volk in der Weise vertraut, daß sie ihm mitteilt, daß die Renten weiterhin sicher sind. Nämlich aufgrund der Reform der Alterssicherung, die sie durchführen will und welche zum Ziel hat, die „Alterssicherung der Zukunft auf vier Säulen“ aufzubauen, von denen die gesetzliche Rentenversicherung dann nur noch eine neben anderen sein soll. Womit jedenfalls die große Richtung klar ist, in die da „umgedacht“ wird: Aus dem Verkehr gezogen werden soll der Anspruch, daß die gesetzliche Rentenversicherung die Alten irgendwie durchfüttert; ihre Leistungen sind dann künftig – was auch immer die bislang dafür hergegeben haben – von vornherein nicht mehr darauf berechnet, ein Leben zu unterhalten. Aber dafür gibt es dann ja die drei anderen Säulen:
– eine „betriebliche Altersvorsorge“. Bei der geht es darum, Teile des Lohns gar nicht erst auszuzahlen, sondern in Töpfen zu verstauen, die die Unternehmer verwalten, bis aus denen dann irgendwelche Zahlungen an altgediente Betriebsangehörige fällig werden. So kreditieren die ‚Mitarbeiter‘ ‚ihre‘ Firma, bis sie endlich aus ihr ausscheiden;
– die „private Vorsorge“. Da liegt eindeutig der Hauptakzent: Der Sozialstaat delegiert die Vorsorge für die Altersarmut zurück an diejenigen, bei denen er bislang davon ausgegangen ist, daß ihr Einkommen zur Vorsorge fürs Alter nicht reicht;
– eine „Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivvermögen und am Gewinn der Unternehmen“. Eine wunderbare Neuerung: Der sagenhafte Generationenvertrag wird über den Bezug zum Unternehmenserfolg und dem dabei abfallenden shareholder-value ein wenig aufgelockert. So bleiben die ‚Mitarbeiter‘ ihrem Betrieb auch nach dem Erreichen der Altersgrenze verbunden…
Eines zeigen die Vorhaben und Initiativen der neuen Koalition in Fragen des Geldverdienens und Abkassierens sehr eindringlich – um das mal als Zwischenfazit festzuhalten: Es ist keine falsche Bescheidenheit, wenn Rote und Grüne ihre alternative Regentschaft unter das Motto „Kontinuität“ stellen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Wer die BRD regieren will, der will dann auch erstens genau diese Republik; und zweitens ist regieren etwas anderes als verändern oder gar umschmeißen. Man kann es auch so sagen: Wer den bundesdeutschen Kapitalismus als seine politische Gestaltungsaufgabe begreift, der begreift eben dies und sonst nichts; der will weder von der Nation noch von ihrem Kapitalismus etwas wissen, sondern nur von den Aufgaben, die einem Politiker daraus erwachsen, daß er dafür verantwortlich sein will. Wenn so jemand Alternativen anstrebt, dann beziehen die sich von vornherein auf das einfältige Anliegen, den nationalen Aufgabenkatalog buchstabengetreu abzuarbeiten. Noch anders ausgedrückt: Wer sich um das Recht bewirbt, Deutschlands Staatsmacht zu exekutieren, der ist nur konsequent, wenn er dann auch als deutscher Nationalist handelt, also im Innern kein höheres materielles Interesse kennt und anerkennt als den Wachstumserfolg der nationalen Ökonomie. Und ganz nebenher stellen diejenigen, die sich da mit Erfolg ums Amt des Herrschens beworben haben, für Liebhaber dieser besonders albernen Alternative auch noch das klar: Ob das Regierungsgeschäft bei Machthabern oder bei Machthaberinnen landet, ist vollkommen gleichgültig.
Die Probe aufs Exempel liefert die neue Koalition, wo sie sich der „Risiken des modernen Lebens“ auf dem Feld der Energiepolitik annimmt. Da will sie nämlich
„den Ausstieg aus der Nutzung der Atomkraft entschädigungsfrei regeln“
Erstmals ist klar und unmißverständlich von einer deutschen Regierung festgestellt, daß die Atomkraft „wegen ihrer großen Sicherheitsrisiken mit der Gefahr unübersehbarer Schäden nicht zu verantworten“ ist. Da die Risiken der Atomenergie seit längerem bekannt sind, stellt sich erstens die Frage, warum sie heute höchstoffiziell anerkannt werden. Und zweitens: was daraus folgt.
Bevor es zum regierungsoffiziellen Verdikt gekommen ist, hat sich erst einmal die Hierarchie der nationalen Gesichtspunkte geändert. In der hatte die Sicherheitsfrage immer schon ihren Platz, war aber stets viel wichtigeren nationalen Interessen untergeordnet und konnte deswegen nie in den Rang eines auch nur irgendwie ernstzunehmenden Einwandes gegen das nationale Atomprogramm aufsteigen. Der Aufbau einer nationalen Atomindustrie hatte da erst einmal absoluten Vorrang vor jedem noch so begründeten, die „Gefahr unübersehbarer Schäden“ betreffenden Bedenken, weil durch sie die nationale Unabhängigkeit in Sachen Energie hergestellt werden mußte und an ihr lauter ökonomische, politische und militärische Optionen hängen, über die eine Nation aus eigener Macht verfügen muß, die international ganz oben mitmischen will. Diese unschlagbar guten Gründe dafür, alle Sicherheitsbedenken hintanzustellen, mußten sich erst einmal relativieren; daran nämlich, daß Deutschland nach dem erfolgreichen Aufbau seiner Atomindustrie besagte Optionen nun hat: Es ist eine Atommacht, die sich selbst freiwillig und nicht mangels entsprechender Fähigkeit auf den Status einer bloß zivilen Atommacht beschränkt; und was die politische Ökonomie des Rohstoffs Energie betrifft, so hat das Land sich mit seinen Atomkraftwerken und seinem freien Zugriff auf die Energieträger aller Herren Länder unangreifbar gemacht hat; außerdem ist manches von dem, was es sich an atomarer Ausstattung zunächst unbedingt in eigener Regie hinstellen wollte, nun im europäischen Rahmen in jeder Hinsicht preiswerter zu haben. Erst nachdem unter diesen Voraussetzungen ein politischer Bedarf an einem weiteren Ausbau des Atomprogramms nicht mehr besteht und die Energiewirtschaft unter dieser politischen Vorgabe auch gar kein aktuelles Interesse am Bau zusätzlicher Atomkraftwerke hat, kommt die Sicherheitsfrage in den Rang eines anzuerkennenden Arguments.
Und was folgt nun daraus, daß Atomkraftwerke „wegen der
Gefahr unübersehbarer Schäden nicht zu verantworten“
sind? Das will die neue Regierung demnächst in Gesprächen
mit der Atomwirtschaft ermitteln. Schließlich gibt es für
sie nicht nur Strahlenschäden zu
berücksichtigen, wenn es darum geht, „die Nutzung der
Atomkraft so schnell wie möglich zu beenden“. Damit der
Ausstieg entschädigungsfrei
über die Bühne gehen
kann, sind unbedingt – und schon wieder vorrangig
gegenüber jedem Sicherheitsbedenken – die
Schäden zu vermeiden, die den Betreibern aus dem
Abschalten ihrer strahlenden Stromfabriken erwachsen
würden. Die mögen der Perspektive des Ausstiegs zwar
insofern gelassen entgegensehen, als sie gar nicht
prinzipiell darauf bestehen, die Energie, mit der sie ihr
Geschäft machen, in Atomkraftwerken zu produzieren;
schließlich war es vor allem die Staatsgewalt, die
seinerzeit unbedingt diese Kraftwerke haben
wollte. Nachdem sie sich nun aber – unter der politischen
Vorgabe, daß dies unbedingt im nationalen Interesse ist,
und mit entsprechend großzügiger staatlicher Förderung –
ihre AKWs hingestellt haben, sind die Stromproduzenten
keinesfalls bereit, auf das Geschäft zu verzichten, das
mit jedem Tag, den die Dinger länger laufen, immer besser
wird. Um die Berücksichtigung ihres Interesses an
möglichst langen Restlaufzeiten geht es ihnen dann in den
Gesprächen, zu denen die neue Regierung sie einladen
wird. Und letztere läßt wirklich keine Gelegenheit aus,
um bereits im Vorfeld klarzustellen, daß sie dieses
Interesse gebührend berücksichtigen wird, wenn sie
demnächst mit der Atomwirtschaft darüber – sowie über die
für den weiteren Betrieb der Atommeiler so wichtige Frage
der Endlagerung des etwas ausufernden radioaktiven
‚Mülls‘ – in Verhandlungen eintritt. So bleibt für die
nächsten Jahrzehnte die Atomreaktorsicherheit garantiert.
Gerade in Sicherheitsfragen läßt die neue Koalition auch sonst nichts anbrennen. Was die innere Sicherheit angeht, bedient sie die Nation wieder mit jener Kombination aus kongenialer Übernahme des christlich-liberalen Vorbilds und rot-grünem Neuerungswillen, die den gesamten Vertrag auszeichnet. Sie gedenkt da nämlich nach der „Leitlinie“ zu handeln:
„entschlossen gegen Kriminalität und entschlossen gegen ihre Ursachen“
Auch die Neuen begnügen sich also nicht damit, Polizei und Justiz ihr segensreiches Werk der Kriminalisierung und Strafverfolgung allerlei in dieser Gesellschaft sturznormalen, aber verbotenen Verhaltens tun zu lassen. Sie verstehen sich wie ihre Vorgänger darauf und betonen es gebührend, ihre Gesellschaft als einen einzigen großen Sumpf des Verbrechens ins Visier zu nehmen und sich dadurch zu weit mehr als bloß der Vollstreckung der Strafrechtsordnung herausfordern zu lassen – zu einem großangelegten Besserungsunternehmen nämlich. Die nähere Ausführungsbestimmung dazu lautet, aufs Wesentliche konzentriert, wie folgt:
„Strafrecht kann Ursachen von Kriminalität nicht beseitigen; deshalb sind eine gute Beschäftigungs- und Sozialpolitik sowie auch eine an humanen Werten orientierte Gesellschaftspolitik unabdingbar.“
Da hätte die neue Regierung sich ja einiges an Weltverbesserung vorgenommen – wenn die Kritik am Strafrecht und der entschlossene Entschluß zur Ursachenbekämpfung allen Ernstes so gemeint wären, daß der gesellschaftliche Verbrechenssumpf tatsächlich ausgetrocknet werden sollte; mit einer Beschäftigungs- und Sozialpolitik womöglich, die sich solche sozialen Verhältnisse zu schaffen vornimmt, in denen kriminelle Karrieren einfach nicht mehr angelegt sind und sich deswegen Verbrechensbekämpfung erübrigen würde. Ganz so heiß ist das Vorhaben freilich dann doch nicht; weder Innen- noch Sozialpolitiker der Koalition werden ihr Wirken für gescheitert erklären, wenn eine merkliche Abnahme der Kriminalitätsrate nicht zu verzeichnen sein wird – Leute, die versprechen, „entschlossen gegen Kriminalität“ vorzugehen, rechnen nicht damit, daß ihnen dieser Feind abhanden kommen könnte. Das Koalitionsabkommen verspricht aber auch nicht bloß ein paar zusätzliche Therapieplätze für verbesserungswürdige Straftäter und Freizeitheime zur Prävention gegen kriminelle Karrieren. Es steht vielmehr für eine doppelt trostreiche Klarstellung: Die neue Mannschaft erkennt es erstens – wie die alte – als ihre ganz spezielle politische Aufgabe an, die Verbrechensszene nicht bloß überhaupt, sondern öffentlich und demonstrativ unter Kontrolle zu halten, folglich deren Umfeld, letztlich also dem gemeinen Volk insgesamt einige Aufsicht angedeihen zu lassen und letzteres dafür zumindest ideell am allgemeinen nationalen Fahndungsdruck teilhaben zu lassen. Dabei steht sie zweitens dafür ein, daß solcher Radikalismus des Rechts mit Rechtsradikalismus gar nichts zu tun haben muß, wenn man ihn nur in das Gewand eines sozialen Besserungswillens kleidet – was umgekehrt auch so verstanden werden darf: daß ein rechter Radikalismus gerechter Gewalt gegen das Böse überhaupt nicht darunter leiden muß, wenn er sich als linker Gesellschaftsverbesserungsidealismus vorträgt.
In diesem Geist nimmt die rot-grüne Mannschaft sich vor, eine ganze Reihe von Versäumnissen auszubügeln, zu denen es unter der laxen Amtsführung Kanthers gekommen sein muß: bei der Bekämpfung von „Alltagskriminalität“ – dies der Gruß ans gesunde Volksempfinden –, von „Wirtschafts- und Umweltkriminalität“ – das Sonderangebot an die ökologisch-soziale Linke –, von „Korruption und illegaler Beschäftigung“ – die Sozialrevolutionäre in der SPD kommen also auch auf ihre Kosten – und so weiter und so fort. Die Schröder-Fischer-Regierung haut also nicht bloß drauf, wo immer dem staatlichen Gewaltmonopol zuwidergehandelt wird; sie schlägt gezielt und im Interesse einer „humanen Gesellschaftspolitik“ zu – also wie die Rechten es sich nicht besser wünschen können, aber ohne deren ideologischer Scharfmacherei Recht zu geben.
In der – der Herausforderung durch Kriminalität so nahestehenden, nämlich ebenfalls unmittelbar die staatliche Hoheit betreffenden – Ausländerfrage hat die neue Regierung mit ihrer Ankündigung, die
„Integration der auf Dauer bei uns lebenden Zuwanderer“
voranzutreiben, für einigen Wind gesorgt. Und zwar ganz
ohne eigenes Verdienst. Denn die Einführung der doppelten
Staatsbürgerschaft genießt den Ruf einer Maßnahme, die
den in Deutschland gelandeten Ausländern einen Gefallen
tut, nur deswegen, weil Beckstein und Kanther sie für
einen übertriebenen Gefallen halten. Wenn nicht lauter
tüchtige C-Politiker immerzu behaupten würden, mit sage
und schreibe zwei Pässen wären die Gastarbeiter und
sonstige im DM-Land Gestrandeten mit einem Privileg
ausgestattet, nach dem sich Deutsche vom alten Schlag
schon lange die Finger lecken, könnte niemand den recht
banalen Sachverhalt übersehen: Auch die neue Regierung
schlägt sich mit dem für die Nation gebotenen Umgang mit
Ausländern herum! Wie jede Staatsaufgabe stellt auch die
zweckmäßige Behandlung von Ausländern erstens ein
dauerhaftes und grundsätzliches Problem
dar, das zweitens je nach den Umständen nach
aktuellen, der Lage angemessenen
Lösungen verlangt. Dem grundsätzlichen Problem,
welche Rechte der deutsche Staat den Untertanen
auswärtiger Herrschaften, die sich auf deutschem Boden
herumtreiben, gewähren oder vorenthalten soll, trägt ein
Ausländergesetz Rechnung. Dem können die Fremdlinge ihren
Sonderstatus ablauschen: Sie gehören prinzipiell nicht
hierher, dürfen sich grundsätzlich in Deutschland nicht
einmal aufhalten, bekommen dieses Recht nur in besonderen
Fällen, befristet und unter zahllosen Auflagen gewährt
und besitzen auch dann nicht die Rechte, die jeder
dahergelaufene Deutsche als staatlich anerkanntes
Konkurrenzsubjekt – nicht zuletzt gegen sie – geltend
machen kann.
Ausländer bekommen so in der denkbar elementarsten Weise den Witz der vielgepriesenen bürgerlichen Freiheiten zu spüren: daß diese von der Obrigkeit gewährt sind, von ihr also auch entzogen bzw. von vornherein versagt werden können. Sie werden von der Staatsgewalt gar nicht erst als Subjekte von Rechten zugelassen, und zwar einfach deswegen, weil sie im Wortsinn des besitzanzeigenden Fürworts nicht ihre Untertanen sind: Sie gehören einem fremden Gewaltmonopolisten, wodurch die Ausschließlichkeit des Zugriffs, die der Staat auf seine Untertanen hat und ihnen gegenüber unbedingt beansprucht, in ihrem Fall relativiert ist. Sie lassen deswegen Zweifel an der Verläßlichkeit ihres Gehorsams übrig – nicht erst dann, wenn sie es an dem tatsächlich fehlen lassen, sondern grundsätzlich: weil Staaten völlig zurecht davon ausgehen, daß der ihnen entgegengebrachte Gehorsam noch vor jeder Berechnung darauf beruht, daß sich ihre Untertanen ihrer Gewalt nicht entziehen können.
Die ‚aktuelle Lage‘, die nach der passenden Ergänzung des Ausländerrechts schreit, besteht gemäß der Diagnose derer, die die Definitionshoheit über die Drangsale der Nation besitzen, darin, daß die auf unserem Territorium lebenden Ausländer zu viele sind und noch mehr zu werden drohen. Der neue rot-grüne Polizeiminister hat diese Diagnose vom ‚vollen Boot‘, die zunächst die rechtsextremen und konservativen Politiker mit Stolz erfüllte, zum ausdrücklichen Leitfaden der menschenfreundlichen Koalitionsvereinbarung erklärt. Das Ausräumen von Mißverständnissen der Art, daß sich die ‚linke‘ Koalition womöglich der Sortierung zwischen Deutschen und Ausländern gar nicht mehr befleißigen wolle, hielt er nicht für überflüssig. Dabei zielt die hoheitliche Konzession einer doppelten Staatsbürgerschaft auf nichts anderes als auf eben diese Sortierung, freilich vollzogen an dem Menschenmaterial, das sich schon im Biotop des deutschen Wirtschaftskreislaufs eingehaust hat. Dazu ist es gekommen, weil das deutsche Wirtschaften den gewöhnlichen Internationalismus seiner Marktwirtschaft jahrzehntelang durch die Pflege eines Gastarbeiterwesens bereichert hat. So wurden neben brauchbaren Arbeitskräften auch deren Anhängsel ziemlich mobil in Richtung Deutschland, ‚Wirtschafts-‘ und andere Flüchtlinge kamen hinzu, was den Rechts- und Sozialstaat zu dem Eingeständnis nötigt, daß er so viele wirklich nicht (mehr) brauchen kann. Zumal es schon mit der Brauchbarkeit seines angestammten Volkes, also auch mit dessen ordentlicher Versorgung, dem ‚Wohlstand‘, ein bißchen hapert. Das wirft die Frage auf, was mit den nun einmal hier lebenden Ausländern anzustellen ist – und diese Frage ist für einen Staat unserer Machart die nach der Verläßlichkeit der Kreaturen seines Beitrags zur ‚Globalisierung‘. Unabhängig von wirtschaftlichen und anderen Berechnungen, so die Konsequenz, haben sich diese Geschöpfe des deutschen Imperialismus entweder für den bleibenden Dienst an unserer Nation zu entscheiden – oder sich zu ‚ihrer‘ Ausgrenzung zu bekennen.
Mehr als jede andere Staatsaufgabe liefert die der zweckmäßigen Behandlung von Ausländern Stoff für die nationale Gesinnungswirtschaft. Die Moralisten in Parteien und Volk scheiden sich zunächst in die übersichtlichen Lager, die ‚Ausländer raus‘ oder ‚Ausländer rein‘ befürworten – wobei es bei letzteren schon immer ein Genuß war, die guten Gründe zu bestaunen, die sie für die Anwesenheit der Fremdlinge wußten: Aufgezählt wurden und werden da stets die Dienste an irgendeiner deutschen Sache! Heute haben die Lager die Kompliziertheit des ‚Problems‘ erfaßt. Sie verstehen das Fremdwort ‚Integration‘, das die neue Regierung gerne mit dem Ruch des Entgegenkommens versieht – gegenüber den Ausländern – genausogut wie die Lehre vom vollen Boot: Der deutsche Paß ist eine Gnade, die sich seine Anwärter durch ‚Integration‘ verdienen dürfen – Versäumnisse führen zur Ausgrenzung, die das alte ‚Raus!‘ in Erinnerung bringen. Mit einem kleinen moralischen Kopfstand, auf den die Rot-Grünen einigen Wert legen, läßt sich aus der Bedingung der ‚Integration‘ allerdings auch ein schönes Ziel machen, das durch die doppelte Staatsbürgerschaft erreicht wird. Trefflich wird darüber verhandelt, ob dieser rechtliche Schritt die ‚Integration‘ erleichtert oder behindert. Irgendwie geht es auch unter der neuen Regierung weiter – um die Alternative ‚deutscher Untertan‘ oder Ausländer.
Im Verhältnis zu den fremden Herrschaften verspricht die neue Regierung
„außenpolitische Verläßlichkeit“
Auf dem Feld der Außenpolitik will sie gar nicht erst den Eindruck erwecken, daß sich unter ihr etwas ändert. Da besteht sie ausdrücklich darauf, was hinsichtlich aller sonstigen Politikfelder auch gilt: daß der Wechsel in der Besetzung der Schaltstellen der Macht für die Politik folgenlos bleiben soll. Im Verkehr mit anderen Nationen will auch sie keine parteipolitischen Unterschiede, sondern nur deutsche Interessen kennen.
Nach innen will sie damit unbedingt die beruhigende Mitteilung loswerden, daß sie keinen Landesverrat im Sinn hat. Ihren Vertretern ist an der Klarstellung gelegen, daß die Kontroversen, die sie in der Hitze des demokratischen Parteienstreits angezettelt haben, zum Wahlkampf gehören, der nun ja vorbei ist. Jeder soll mitbekommen, daß die kritischen Töne gegen die Nato z.B., die sie da schon mal gespuckt haben, um an die Macht zu kommen, keineswegs so gemeint waren; daß sie nun, da sie an der Macht sind, von der keinen irgendwie alternativen Gebrauch machen wollen. Niemand soll glauben, ein ehemals friedensbewegter Turnschuhträger könnte die deutschen Interessen im Ausland womöglich schlechter vertreten und weniger entschlossen durchsetzen als sein Amtsvorgänger von der FDP, der bekanntlich seinen auswärtigen Kollegen bei fehlendem Entgegenkommen gelegentlich schon mal angedroht hat, ihnen das Kreuz zu brechen. Das Versprechen von Kontinuität ist da unbedingt angesagt, sonst trauen die Bürger ihrem neuen Außenminister nicht über den Weg. Die haben nämlich ein Recht darauf – und brauchen dieses Recht gar erst nicht anzumelden, sondern bekommen es von ihrer Regierung vorbuchstabiert –, daß dort, wo Nationen ihre Interessen mit- und gegeneinander verhandeln, nur der Erfolg des nationalen Interesses zählt. Und dementsprechend staatsmännisch werden sie von dem neuen Ressortchef vom ersten Tag an angesprochen: Als deutsche Idioten, deren partikulare Interessen auf dem Feld der Außenpolitik einfach nichts verloren haben und denen man da deswegen ausnahmsweise auch einmal die Lüge von der Politik als Dienst an ihren Interessen ersparen kann.
Nach außen ergeht an die Regierungen aller Herren Länder die Botschaft, daß Deutschland – als Nato-Partner, Euro-Vormacht, in Freundschaft verbundener, aber auch anspruchsvoller großer Nachbar, mit seinen Interessen überall in der Welt eingemischter imperialistischer Konkurrent usf. – weiterhin zu den ‚Beziehungen‘ steht, die es mit ihren Ländern unterhält. Dies angelegentlich eines Regierungswechsels zu versichern, ist im internationalen Verkehr so Usus und deswegen überhaupt nicht überflüssig, weil besagte ‚Beziehungen‘ aus den Pflichten und Rechten bestehen, die Staaten in ihrem Verhältnis zueinander akzeptiert bzw. sich wechselseitig eingeräumt haben, und dieses Rechtsverhältnis durch keine höhere Macht garantiert wird, sondern allein durch den fortexistierenden Willen und das Kräfteverhältnis der beteiligten Staaten Bestand hat.
Da möchte man im Ausland schon wissen, ob die neue Regierung Deutschlands weiterhin zu den eingegangenen Vereinbarungen steht, ob sie eventuell andersgelagerte Berechnungen anstellt, die in den Beziehungen, auf die man weiter Wert legt, etwas durcheinander bringen, oder ob sich mit ihr neue Perspektiven eröffnen, in den strittigen ‚Fragen‘, die es im Verhältnis zu Deutschland gibt, im eigenen nationalen Interesse voranzukommen. Weil die getroffenen internationalen Abmachungen von beiden Seiten beständig auf den nationalen Vorteil hin abgeklopft werden, den sie von deren jeweiliger Konkurrenzlage her (nicht mehr) bieten; weil in den Beziehungen, die man miteinander unterhält, wegen der jeweils anderen ebenfalls um Einfluß und Geldmacht konkurrierenden Seite nichts so unzuverlässig ist wie die einmal erreichte Machtposition der eigenen Nation, gilt es auszuloten, wie der Wille der anderen Seite, die am Kräfteverhältnis rüttelt, beschaffen ist.
Umgekehrt möchte deswegen die neue deutsche Führung dem Ausland gegenüber auch von vornherein klarstellen, daß es nicht mit einem handsamen Umweltfreund im Amt des deutschen Außenministers rechnen kann. Die Versicherung, daß sich durch den Amtswechsel in Bonn an der Grundlage der auswärtigen Beziehungen nichts ändert, ist ja auch nicht gerade als Ausweis von Bescheidenheit mißzuverstehen. Sie macht überhaupt nur Sinn, weil sich da Machthaber äußern, die sich als Führer einer potenten Nation ihrer Macht bewußt sind, sie könnten auch anders, bei denen sich das Ausland also auch darauf verlassen darf, daß sie die eingerichteten Beziehungen daran messen, was sie Deutschland bringen, und sicher keine Skrupel haben, dort, wo sie es im nationalen Interesse für fällig erachten, ihren Revisionsbedarf anzumelden und ihm mit dem Gewicht ihrer Nation Nachdruck zu verleihen.
Nachdem die neue Regierung ihr Programm in den Grundzügen dargetan hat – es besteht darin, denselben Katalog von Staatsaufgaben mit denselben Mitteln abzuarbeiten, wie die alte Regierung – schließt sie ihren Koalitionsvertrag mit der Mitteilung:
„Die Koalitionspartner verpflichten sich, diese Vereinbarung in Regierungshandeln umzusetzen“
Sich auf das Programm zu verpflichten, das man sich eben selbst gegeben hat, ist nicht etwa ein überflüssiger Zusatz, sondern unbedingt nötig: schließlich wird da eine Koalition beschlossen – und dies sogleich zum Anlaß genommen, ein letztes Signal ans Volk zu geben: Die Bündnispartner beschwören, daß sie zusammenhalten wollen und mit dem Amtsantritt die Differenzen zwischen ihnen in einer Hinsicht keine Rolle mehr spielen sollen: Die Macht soll wegen dieser Differenzen nicht mehr aus der Hand gegeben werden. Mit der Beschwörung der Festigkeit des Bündnisses wird der gemeinsamen Wille, das Amt nicht nur anzutreten, sondern dauerhaft zu behalten, als Grundlage des berechnenden Schachers veröffentlicht, der die Koalitionsverhandlungen bestimmte; dieser Wille, sich nicht spalten zu lassen – womöglich wegen irgendwelcher gegenüber den Wählern eingegangener ‚Verpflichtungen‘ – verbindet sie. Was einerseits das Dementi der für das Wahlvolk demonstrativ aufgebauschten Differenzen zwischen ihnen erforderlich macht; andererseits nicht ohne die Kultivierung des Scheins abgeht, die Spezialität der eigenen Vereins in die gemeinsame Sache ‚eingebracht‘ zu haben. Die Pflege dieses Scheins ist insofern wichtig, als sie den Willen zur gemeinsamen Machtausübung ‚jenseits aller Differenzen‘ noch bekräftigt. Die Präsentation der Einigkeit, das Versprechen, sich von der Hauptsache, der gemeinsamen Entschlossenheit zur Führung, nicht durch nebensächliche Parteigesichtspunkte abbringen zu lassen, ist guter demokratischer Brauch, der auch von der neuen Koalition gepflegt wird.
Die Gemeinheit dieses Brauchs ist nicht zu übersehen; und sie wird auch nicht übersehen von einer demokratischen Öffentlichkeit, die gut und gerne die Hälfte ihrer Betrachtung der Regierungstätigkeit ab sofort darauf verschwendet, die spannende Farge zu ventilieren: Hält die Koalition? Den Zusammenhalt der Führungsmannschaft anzuzweifeln, immerzu nachzufragen, ob das Bündnis bei seiner Zusammensetzung noch zu einheitlicher Führung fähig sei, ist – Demokratie hin, Diktatur her – allerdings nichts weiter als das Einklagen von entschlossener Führung pur. Diesem Bedürfnis trägt die Selbstverpflichtung der rot-grünen Mannschaft auf die Umsetzung ihres Programms in ebenso kindischer wie Demokratie-üblicher Weise Rechnung. So lernen wir denn aus dem Koalitionsvertrag schon wieder etwas über die Prinzipien der Demokratie: Die Ansage, die Macht im Staate auszuüben, der Wille, sie zu behalten und entschlossen zu verteidigen, also mit einem Wort: „es“ unangefochten, folglich anständig zu machen, schafft in dieser Staatsform Vertrauen.