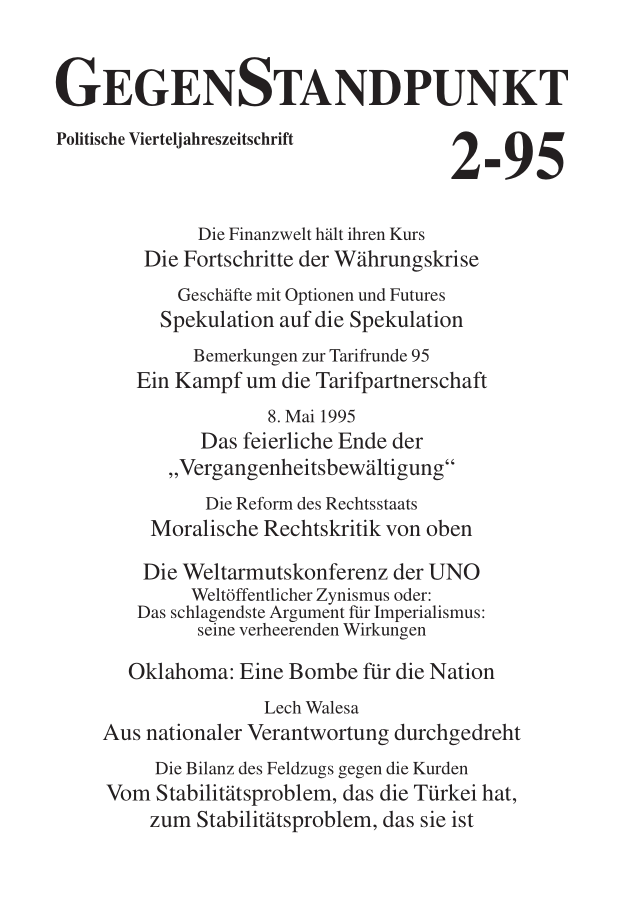Die Reform des Rechtsstaats
Moralische Rechtskritik von oben
Der Rechtsstaat beschließt seine „Notlage“ und meldet Revisionsbedarf: Massendelikte, organisierte Kriminalität, Aufarbeitung des DDR-„Unrechts“ und ihre juristische Bewältigung im Strafrecht und der öffentlichen Moral.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Reform des Rechtsstaats
Moralische Rechtskritik von oben
I. Was der Rechtsstaat leistet und wie er in die Kritik gerät
Der Rechtsstaat ist bei seinen eigenen Agenten in Verruf gekommen. Von oberster Stelle ergeht die Warnung, er drohe zum „Rechtsmittelstaat“ zu verkommen. Nicht wenig, was der Kanzler höchstpersönlich da seinen demokratischen Bürgern an Umdenken zumutet. Immerhin galt die ins offizielle Zwielicht geratene Veranstaltung bis gestern als die größte Errungenschaft demokratischer Zustände, die jeden Einspruch gegen die Staatsgewalt hinfällig machen sollte. Gelobt wurde, daß der Rechtsstaat den Bürgern ihre Freiheit gewährt und garantiert: daß jedermann im Kanon der Rechte und Pflichten sein Interesse aufgehoben und gegen Angriffe gesichert weiß, zugleich aber auch zum notwendigen Respekt vor allen anderen angehalten wird. Angepriesen wurde die Selbstbeschränkung, die sich der Staat mit seiner rechtstaatlichen Verfaßtheit auferlegt: daß er nicht mehr als unbedingt nötig in die gesellschaftlichen Verhältnisse eingreift und sich selbst auf ein Vorgehen verpflichtet, das jeder herrschaftlichen Willkür entsagt, jederzeit rechtlich überprüfbar und anfechtbar ist; weil er seinen Bürgern lauter Abwehr-Rechte
gegen Übergriffe seiner Gewalt zugesteht, deswegen soll der hoheitliche Zugriff prinzipiell in Ordnung gehen. Die rechtliche Verfassung sollte man sich wie eine allen politischen Interessen, ja dem Staat selber vorausgehende Einrichtung des Gemeinwesens nach höheren Grundsätzen vorstellen, die Herrschaft selber wie ein bloßes Ausführungsorgan allgemeingültiger, eben (menschen-, grund-)rechtlicher Prinzipien, mit denen ein Urbedürfnis nach gesellschaftlicher Ordnung bedient wird. Auf diese Weise – so die demokratisch gepflegte Grundüberzeugung – herrscht nicht Gewalt, sondern an ihrer Stelle das Recht. Weil durch rechtsstaatliche Regeln begrenzte und legitimierte Gewalt, sollte sie gleich gar keine mehr sein.
Die Wahrheit über den Rechtsstaat ist das alles nicht. Daß es sich nicht um die Abwesenheit, sondern um eine Organisationsweise der Gewalt handelt, das weiß jeder Bürger. Das denkt er beim Lob des Rechtsstaats immerzu mit, wenn er ihn an der Vorstellung mißt, der Staat könnte ja noch ganz anders gewaltsam in Leben und Eigentum, Handeln und Meinen seiner Bürger eingreifen. Und das merkt man unschwer daran, daß zur Rechtsordnung Justiz und Polizei, Gefängnisse und Strafen, also lauter staatliche Gewalt gegen Person und Eigentum dazugehören.
- Mit dem Erlaß allgemeingültiger Rechtsregeln und ihrer Durchsetzung sichert sich der Staat das Gewaltmonopol: Der Rechtsstaat etabliert die staatliche Hoheit in Form einer über allen gesellschaftlichen Interessen stehenden Gewalt, die verbindlich und gegebenenfalls mit dem Einsatz von Zwangsmitteln feststellt, was wem zusteht. Seine Instanzen allein sind zur Ausübung von Gewalt berechtigt, die Bürger sind ihr verbindlich unterworfen und haben sich ihrer strikt zu enthalten.– Alles, was den Bürgern an Freiheit eröffnet wird, ist Ergebnis rechtsstaatlicher Gewährung. Das Recht erlaubt ihnen ihren gesellschaftlichen Umgang, es schreibt ihnen dabei aber auch die „Spielregeln“, also die Schranken vor. Ihre Interessen, die sie bei Geschäft, Arbeit und Genuß verfolgen, gelten nur soweit, wie es die Rechtsgrundsätze genehmigen. Ihre Geltung ist davon abhängig, ob sie durch „Anspruchsgrundlagen“ im Gesetz gestützt werden. Nur so und nur dann wird aus Bedürfnissen ein Recht; dann haben sie aber auch gegen widerstreitende Ansprüche die Gewalt des Staates auf ihrer Seite. Damit sind alle Beziehungen – auch in ihrer „privatesten“ Gestalt – keine Sache mehr, die die Mitglieder der Gesellschaft unter sich ausmachen, sondern alles, was sie wollen und tun, ist bezogen auf die und eingerichtet nach den funktionalen Grundsätzen der obersten Gewalt. Was der freie Bürger treibt, ist ihr Werk und dient ihrem Bestand. Nur so, von höchster Stelle legitimiert und erzwingbar, finden Bedürfnisse und Interessen Anerkennung; das macht zugleich die Auseinandersetzungen zwischen den lieben Mitmenschen so unversöhnlich.
- Und Auseinandersetzungen gibt es mehr als genug. Denn die Beseitigung jeder persönlichen Abhängigkeit, die Freiheit, die das Recht stiftet, legt jedes Mitglied der Gesellschaft auf die Grundsätze von Privateigentum und Person fest: Jeder ist darauf verwiesen, seinen Lebensunterhalt als Privatperson mit den Mitteln zu bestreiten, die ihm als Eigentum ausschließlich – andere ausschließend, aber auch von allem anderen ausgeschlossen – zur Verfügung stehen. Je nachdem, ob überhaupt und wieviel Eigentum einem zur Verfügung steht, gestaltet sich die Freiheit zur Betätigung der Person recht unterschiedlich: Die einen, Besitzer von Geld und sachlichen Mitteln, sind auf die Vergrößerung ihres Privatbesitzes aus und konkurrieren darum; die anderen stellen sich mit ihrer Arbeitskraft für die Mehrung fremden Reichtums zur Verfügung, um zu leben, weil sie von den Mitteln der Reichtumsproduktion ausgeschlossen sind. Diese Gegensätze innerhalb der kapitalistischen Geschäftswelt, zwischen Käufern und Verkäufern, zwischen Fabrikbesitzern und Arbeitskräften sind also keine dem Staat vorausgehende, naturgegebene Gesellschaftsverfassung, der er mit seinem Recht dient. Im Recht kodifiziert er diese Gesellschaftsordnung als alleroberstes Staatsinteresse.
- Kein Wunder, daß das Recht Kollisionen nicht verhindert. Es macht Streitigkeiten umgekehrt gewöhnlich, unterwirft aber ihre Austragung seiner Kontrolle und dringt auf die Einhaltung der Gesetze. Weil das ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn sich alle Interessen mit ihrer Zulassung zugleich beschränkt sehen, gehört zum Recht der Rechtsbruch, was den Staat überhaupt nicht überrascht. Er rechnet im Gegenteil damit und legt genauestens fest, was gelten soll, wenn gegen die Geltung der Gesetze verstoßen wird. Er unterwirft also alles Treiben seiner Aufsichtsmacht, mißt es am Gebotenen und Verbotenen und setzt seinem Urteil entsprechend laufend das Recht durch: Bei Verstößen stellt er die von ihm gemeinte Ordnung dadurch wieder her, daß er die einschlägigen Taten als Angriff auf seine Rechtsordnung wertet und ahndet. In seinen Strafgesetzen definiert er penibel, was er als Vergehen ansehen will, was noch erlaubt, was schon verboten ist; er legt fest, wo sich die Bürger gegenüber seiner staatlichen Autorität zuviel herausnehmen und damit die Ordnung untergraben, listet alles als „Tatbestände“ säuberlich auf, versieht sie mit einem „Strafmaß“ als „Rechtsfolge“ und hält Richter und Polizei an, das Gesetz entsprechend zu vollstrecken. Er stellt also laufend das verletzte Recht wieder her, wie es sich für eine Gewalt gehört: indem er Person und Eigentum des Übeltäters angreift. So erhält er trotz aller geschädigten Interessen die seiner Hoheit dienliche gesellschaftliche Ordnung aufrecht.
- Indem die politische Gewalt alles in Rechtsverhältnisse verwandelt, sichert sie sich also ihren selbstverständlichen, umfassenden und automatischen Durchgriff auf sämtliche Verhältnisse; alles ist Staatsangelegenheit und dem im Gesetz verobjektivierten Staatswillen verpflichtet, nichts dem Belieben und der Willkür überlassen. Auch und gerade die Staatsinstanzen selber sind davon nicht ausgenommen. Dort, wo Macht ausgeübt wird, da soll es nach allgemeingültigen Grundsätzen sein. Deshalb ist von den Kompetenzen der verschiedenen Staatsorgane über die Verfahrensweisen beim Rechtsetzen und Regieren bis zur Bestellung des Personals und zur Überwachung seiner Amtsführung alles rechtlich geregelt, also staatlicher Selbstkontrolle unterworfen. Auf diese Weise sind alle Beziehungen als Rechtsverhältnisse etabliert: Die zwischen den Staatsorganen, die der Behörden zu den Untertanten, die zwischen den Bürgern – und alles noch einmal gesondert unter dem Gesichtspunkt des strafbaren Verstoßes gegen das jeweils geltende Recht. Von einer Beschränkung oder gar Zurücknahme der Gewalt kann also gar keine Rede sein.
- Dabei dringt die Gewalt, die sich als Rechtsstaat organisiert, darauf, daß sie sich in allen, den entscheidensten wie den alltäglichsten Lebensbedingungen ihrer Bürger mit ihren rechtlichen Regelungen auf Zustimmung, Einsicht in deren Notwendigkeit, also willentliche Unterwerfung stützt. Jeder soll quasi automatisch, gewohnheitsmäßig das Recht anerkennen und der Gewalt seinen Tribut zollen, indem er nur so vorgeht, wie das Recht es befiehlt. Diesem Verlangen wird vom Bürger im Prinzip positiv beschieden. Die rechtsstaatliche Gewalt kann sich erstens der unausgesprochenen Zustimmung sicher sein. Schließlich treten den Mitgliedern der Gesellschaft die durch das Recht kodifizierten Verhältnisse als feste, unverrückbare Ordnung gegenüber, in der er nach den Grundsätzen von Person und Eigentum selbständig sein Glück suchen muß, aber auch darf. Hineingestellt in den Zwang der rechtlich geregelten Lebensbedingungen, beziehen sich die Konkurrenzsubjekte auf sie als Ansammlung von Chancen, um die Herausforderungen zu meistern, die das private und gesellschaftliche Leben eines Geschäfts- oder Arbeitsmannes so mit sich bringt. Insofern kommen sie sich zweitens überhaupt nicht unterdrückt vor, sondern betrachten das Recht als ihre Sache: Sie haben ja „ihre“ Rechte, brauchen sich längst nicht alles bieten zu lassen und können im Streitfall sogar die Gerichte anrufen; dort erfahren sie dann, ob ihr Begehren vor dem Gesetz zählt oder nicht. Das tut der Anerkennung beim Bürger normalerweise keinen Abbruch. Wenn sie sich mit dem wirklichen Recht konfrontiert sehen, nehmen sie von diesem Standpunkt keineswegs Abstand, sondern betrachten das geltende Recht drittens ideell als Angelegenheit in ihrem Sinne und im Dienste ihrer Gerechtigkeitsvorstellungen. Jede Begegnung mit den wirklich geltenden Gesetzen beflügelt nur den Vergleich ihrer eigenen Rechtsvorstellungen, ihres „subjektiven Rechtsempfindens“ mit den staatlichen, den „objektiven Rechtsgrundsätzen“. Als rechtschaffener, moralisch urteilender Mensch faßt er diese Regelungen wie die mehr oder weniger gelungene Verwirklichung der sittlichen Gebote auf, denen er sich verpflichtet weiß, auf die er sich bei der Anmeldung seiner Interessen beruft, an denen er sie aber auch relativiert. Als deren Ausführungsorgan begreift er Recht und Rechtsstaat. Dieser Parteinahme für gerechte Zustände in der Welt verleiht das gültige Recht nicht nur beständig Material und Denkanstöße; als immerzu in Erlaubnissen und Geboten, Rechten und Pflichten denkende Subjekte werden die dem Recht Unterworfenen auch im Recht selber berücksichtigt. Der Bürger wird als ideeller Repräsentant der staatlich erlassenen Gesetze behandelt: Er ist als Rechtssubjekt anerkannt, das das Recht als solches will, also seine Ansprüche nach Maßgabe der „Rechtslage“ sortiert und auferlegte Pflichten erfüllt. Umgekehrt heißt das, daß bei jeder Rechtsverletzung der Wille zur unrechten Tat geprüft, die Schuld festgestellt und entsprechend geahndet wird, weshalb die Strafe für Diebstahl sich nicht nach dem Wert der geklauten Ware, sondern nach dem „Unrechtgehalt“ der Tat und der „kriminellen Energie“ des Täters richtet. Im so definierten Willen zum Recht besitzen die Rechtsinstanzen ein allgemeingültiges Prüfkriterium, wo der Delinquent auf der breiten Skala zwischen Rechtstreue und -feindschaft einzusortieren ist. Indem sie dem Beschuldigten nach bestimmten Verfahrensregeln Gelegenheit geben, Argumente und Beweise für seine Unschuld vorzulegen, sorgen sie dafür, daß die Richtigen im richtigen Maß bestraft werden, und sichern sich zugleich die prinzipielle Zustimmung einer Gesellschaft, die laufend unters Recht gebeugt wird. Unzufriedenheit und Kritik äußert sich als verletztes Gerechtigkeitsgefühl, die geschädigten Interessen wissen sich auf den Rechtsweg verwiesen.
- So ist die Gewalt mit ihren Grundsätzen bis in den letzten Winkeln der Gesellschaft präsent; die Bürger rufen laufend nach ihr, auch und gerade dort, wo sie ihre Beschränkungen erfahren. Wie wenig sie dabei die Subjekte der Verhältnisse sind, in denen sie den Status eines Rechtssubjekts genießen, das zeigt sich daran, daß die Rechtsgrundsätze laufend geändert werden – nicht von den Massen, die sich nach ihnen richten müssen, sondern von den staatlichen Instanzen, die ihren Interessen dadurch neue Geltung verschaffen. Die Politiker, und nur sie, genießen nämlich die Freiheit als Gesetzgeber, das Recht laufend aus- und umzugestalten. Und die nehmen sie ausgiebig wahr, weil ihr Korrekturbedarf sich dauernd regt. Jede Leistung, die die Gesellschaft nicht erbringt, alle Kollisionen, die den erwünschten Gang der staatlichen Dinge stören, werden staatlicherseits als Mängel am Recht verbucht. Das eine Mal klappt es mit der Aufsicht nicht wie gewünscht; das andere Mal mit den Erträgen, die der Staat als seinen Nationalreichtum verbucht. Jedesmal übersetzt sich das für eine Staatsgewalt, die das Recht als Instrument für ihren Erfolg schätzt und handhabt, in ein Rechtsproblem, das es zu lösen gilt. Nicht das Recht herrscht also mit Hilfe der staatlichen Gewalt, sondern der Staat herrscht der kapitalistischen Gesellschaft mit seinen rechtsstaatlichen Methoden die passenden Regeln auf und organisiert seine Hoheit über diese Verhältnisse.
Mit diesem Zustand sind ausgerechnet die Staatsagenten gegenwärtig überhaupt nicht mehr zufrieden. Die Einrichter und Verwalter kritisieren ihre eigene Rechtsordnung und werfen ihr vor, die Hoheit nicht zu sichern, sondern zu gefährden. Mit der zitierten Warnung vor dem „Rechtsmittelstaat“ und anderen Beschwerden tun sie so, wie wenn die geltenden demokratischen Ideologien – das Recht sei ein einziges Gewährungswesen und der Gesetzgeber habe die Bürger eigentlich weitgehend aus seiner Kontrolle entlassen, statt sie ihr unterstellt – die Wahrheit über den rechtlichen Zustand des Gemeinwesens wären. Und sie erklären diesen Zustand jetzt für unerträglich, für unhaltbar und dringend revisionsbedürftig. Nicht diesen oder jenen Mißstand machen sie ausfindig, nicht dieser oder jener Änderungsbedarf des geltenden Rechts liegt ihnen am Herzen, sondern sie verweisen auf einen Mißstand fundamentalerer Natur. Die Verantwortlichen plagen sich und ihre Öffentlichkeit mit der Frage, ob sie noch mit den geltenden rechtsstaatlichen Verfahrensweisen für Ordnung sorgen können oder ob sie es mit der Freiheit nicht viel zu sehr übertrieben hätten . Statt daß der Staat mit seinen Gesetzen für klare Verhältnisse sorgt, so die angemeldete Befürchtung, macht er sich tendenziell ohnmächtig.
Sie konstatieren damit keine geänderten Verhältnisse, sondern melden einen geänderten Anspruch an die Rechtsordnung an. Die Herren über das Recht melden sich kritisch zu Wort, wie wenn sie bloß eine, und zwar dank allzuvieler Freiheiten die geschädigte, Partei im Recht wären. In Wirklichkeit verkünden sie damit als Herren über das Recht ihren hoheitlichen Willen, das Gesetzeswerk grundlegend zu korrigieren. Die Gesetzgeber und die Ausführungsorgane des Rechts wollen nichts so lassen, wie es ist. Und sie müssen dafür nicht zum Rechtsbruch greifen oder sich an irgendeine übergeordnete Rechtsinstanz richten, um gnädig Recht zu bekommen. Diese Rechtskritik von oben unterscheidet sich von der von unten nicht bloß in der Stoßrichtung, sondern auch in der Konsequenz. Wenn die Staatsvertreter das Rechtswesen für unzulänglich befinden, dann krempeln sie es um und passen die Buchstaben des Rechts ihrem neuen Geist an. So gesehen sind die aktuellen Korrekturen selber der Beweis, wie wenig der behauptete Mißstand die Sache trifft; Beweis nämlich, daß das Recht gar kein Hindernis staatlichen Handelns ist, sondern – passende und jederzeit anpassungsfähige – Durchsetzung staatlicher Gewalt.
II. Der Rechtstaat beschließt seine Notlage
Diejenigen, die für die Sicherheit der Nation nach innen und außen Verantwortung tragen, haben eine Debatte angezettelt – und bereits gesetzgeberisch Konsequenzen daraus gezogen –, der zu entnehmen ist, daß sie eben diese Sicherheitslage als zunehmend prekär beurteilen und sehr grundsätzlich gegensteuern wollen. Sie setzen die Unzufriedenheit mit dem Stand der Ordnung im Land als politisches Programm auf die Tagesordnung und die polizeimäßige Sichtweise des ungehinderten Zugriffs auf „Störer“ aller Art ins Recht.
Das bleibt nicht ohne Folgen für die rechtsstaatlichen Verkehrsformen zwischen Bürgern und öffentlicher Ordnungsmacht.
„Massenkriminalität“ – die Konstruktion eines staatlichen Handlungsbedarfs
Politiker haben eine völlig neue Bedrohungslage ausgemacht.
Die „zentralen Themen…, Massenkriminalität, organisierte Kriminalität, Korruption und politischer Extremismus“ stellen „neuartige Herausforderungen an den Rechtsstaat“ dar (Koalitionsvereinbarung vom 11.11.1994). Neben
„nach wie vor hoher Eigentumskriminalität und Gewaltbereitschaft… hat sich mit dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme und den alle staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen betreffenden grundlegenden Umwälzungen die grenzüberschreitende und internationale Kriminalität sowie die Beteiligung neuer Tätergruppen verändert.“ (ebd.)
Das hat mitten in Deutschland zu einer „kriminellen Nebengesellschaft“ (Innenminister Kanther, CDU, SZ 21.9.94), geführt, die – so der Innenminister – nicht mehr mit „klassischen Ladenhüter-Gefechten“ bekämpft werden dürfe, wie dies leider in Deutschland immer noch der Fall sei.
Den sozialen Aspekt des bedrohlichen Szenarios hebt zuständigkeitshalber die SPD hervor:
„Massenkriminalität hat eine alltägliche akute Bedrohung für jüngere und ältere sowie für schwache Menschen geschaffen.“ (SPD-Entwurf für ein Gesetz gegen die Organisierte Kriminalität, BT-Drucksache 12/6784 S.1)
Neben den Jüngeren, Älteren und sozial Schwachen sind auch die sozial Stärkeren aller Altersgruppen „vom Einzelhändler bis zu Großbanken heute von der Organisierten Kriminalität bedroht“ (DIHT-Präsident Stihl, SZ 23.9.94). Kriminelle gefährden die „gesamte gewerbliche Wirtschaft“ (Stihl) mit einem für den Laien verblüffenden Mittel: mit der Investition von Gewinnen!
„Diese kriminellen Gewinne werden zu einem großen Teil in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust“ (Informationsbroschüre der Bundesregierung zum Geldwäsche-Gesetz für Bankkunden),
wobei letzterer unglücklicherweise so beschaffen ist, daß er kriminelles kaum von nicht-kriminellem Geld zu unterscheiden vermag und so neben der legalen Wirtschaft
auch dem organisierten Verbrechen seine Gewinne sichert
(ebd.).
Die Bedrohung einzelner Unternehmer (Kanther, HB 22.9.94) geht dabei so weit, daß sie
„den Verlockungen des ‚schnellen Geldes‘ erliegen… und so zu Komplizen des Organisierten Verbrechens werden.“ (ebd.)
So entsteht „aus der Wirtschaft heraus OK“ (ebd.), mit der Folge, daß die Grenze zwischen Gerechten und Ungerechten bei diesem gefährdeten Personenkreis so fließend wird, daß man das Wirken renommierter Wirtschaftskapitäne im Bau- und Bankenwesen und anderswo erst nach stattgehabter Pleite als großangelegte kriminelle – weil mißlungene – Machenschaft erkennt.
Wer meint, eine kapitalistische Wirtschaft müsse kriminelle Attacken in Form von Investitionen eigentlich gut wegstecken, greift nach Ansicht von Politikern und Polizisten zu kurz.
Auch wenn anderswo sich Nationen mit gut florierenden, formell illegalen „Schattenwirtschaften“ bis in die Spitzengruppe der kapitalistischen Industrienationen hochgearbeitet haben, beruhigt das die bestehenden Besorgnisse nicht: Wenn „international arbeitende Verbrecherorganisationen… gefährlichen Einfluß auf die legale Wirtschaft“ bekommen (Geldwäsche-Broschüre) und
„durch Kapital Einfluß auf gesellschaftliche Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse nehmen, die sich einer demokratischen Kontrolle weitestgehend entziehen“, dann ist „die innere und äußere Sicherheit der Republik gefährdet“ (Verfassungsschutz-Präsident Werthebach, SZ 12.3.94);
dann bekommt die Organisierte Kriminalität „systembedrohende Kraft“ (SPD-Entwurf), mit der sie
„Rechtsstaat und Gesellschaftsordnung Stück für Stück untergräbt und sie letztlich sogar vernichten kann.“ (So ein Landespolizeipräsident a.D., in der „Zeitschrift für Rechtspolitik“, 1994, 465)
Sieht man einmal von der schon fast stamokap-mäßigen Vorstellung dieses demokratischen Verfassungsschützers ab, mit „Kapital“ könne man schon einiges drehen in der Politik und sich mindestens der „demokratischen Kontrolle entziehen“, wenn nicht sogar sich die Politik zu Diensten machen; was bleibt, ist die „Entdeckung“ des Verbrechens als politischer Feind und die Definition der Lage als eine Art Staatsnotstand, in dem die Ordnungsmacht ihrer Gesellschaft mit großem Mißtrauen gegenübersteht.
Wenn angesichts von „Massenkriminalität, organisierter Kriminalität, Korruption und politischem Extremismus“ (Koalitionsvereinbarung) Täter und Opfer gar nicht mehr eindeutig zu unterscheiden sind, wenn die einerseits schutzbedürftigen Bürger andererseits dem Ladendiebstahl, dem Versicherungsbetrug und der Steuerverkürzung als Volkssport frönen, wenn manche Wirtschaftskapitäne sich als betrügerische Bankrotteure und Bankiers sich als Geldwäscher erweisen, wenn sogar Beamte als verläßliche Agenten der Ordnung gegen die Verlockungen der Unterwelt nicht mehr gefeit sein sollen, dann erfordert der Notstand der Ordnung Notwehr: Es muß aufgeräumt werden.
In dieser „geradezu existentiellen Bedrohung unseres modernen Lebens durch die Kriminalität“ – so der schon zitierte Landespolizeipräsident i.R. – muß die Staatsmacht sich auf sich selbst besinnen. Die gewaltbewehrte Rechtsaufsicht über Nutznießer und Opfer des privaten Geschäfts will sich nicht mehr als der hergebrachte Dienst an der Gesellschaft verstehen; und von diesem Standpunkt aus sieht der Staat den exklusiven Gebrauch der Gewalt infragegestellt und wird grundsätzlich: Mag er seine eigene Raison noch so „letztlich“ aus dem Dienst für eine geschäftsnützliche grundgesetzlich geschützte Entfaltung kapitalistischer Arbeiter- und Unternehmerpersönlichkeiten herleiten; der beste Dienst, den er diesem Treiben erweisen kann, wenn es nicht korrekt genug nach Recht und Gesetz abläuft, ist, es verstärkt auf diese Regeln zu verpflichten und – dadurch – sich stark zu machen gegen die Gesellschaft, die sich zuviel herausnimmt für seinen Geschmack.
Der Wille zum Kampf gegen gesetzwidrige Unbotmäßigkeit hat seinen Grund nicht in wachsender Kriminalität. Bei seinem Beschluß zum „Bonner Kriegsrecht“ (Spiegel) kümmert sich der Gesetzgeber gar nicht um kleinliche Verbrechensstatistiken, die die angebliche Springflut des Verbrechens gar nicht hergeben. Ebenso wenig schert er sich um die Einwände der Anwaltskammer, die meint, tiefgreifende Reformen des Kriminalrechts müßten durch neue Befunde der „Rechtstatsachenforschung“ begründet sein und sich auf „zuverlässige Kenntnis der Sachverhalte, die geregelt werden sollen,“ stützen (Stellungsnahme der Bundes-Rechtsanwaltskammer – BRAK – zum „Verbrechensbekämpfungsgesetz“, BRAK-Mitteilungen 1994, 141).
„Die verschiedenen Steigerungen der Deliktzahlen in der PKS (= polizeiliche Kriminalitätsstatistik, d. Verf) bieten keine seriöse Grundlage… für die Rede von einem sprunghaften Anstieg der Bedrohungssituation in der Gesellschaft.“ (Werner Lehne, Kriminologe, zur PKS 1993, FR 11.2.94)
In 1994 wies die PKS erstmals seit fünf Jahren einen Rückgang der Deliktzahlen auf:
„Die bisher nicht veröffentlichte Kriminalitätsstatistik für das erste Halbjahr 1994 weist, verglichen mit dem ersten Halbjahr 1993, einen Rückgang um 3,5 Prozent auf. Besonders augenfällig ist der Rückgang bei den Diebstahlsdelikten: Sie sind um achteinhalb Prozent zurückgegangen. Leicht gesunken sind auch die Zahlen für die Gewaltkriminalität.“ (SZ 21.8.94)
Polizeiliche Statistiker und universitäre „Rechtstatsachenforscher“ winken also ab, angesichts „unseriöser und völlig unnötiger Dramatisierung“ (der Hannoveraner Kriminologe Pfeifer).
Im übrigen kommen einem die Anschläge auf die bürgerliche Sicherheit von Geld oder Leben und die staatliche Ordnung auch der Art nach nicht besonders neu vor:
Gerade die Aufdeckung zahlreicher Korruptionsfälle, besonders im Bereich des öffentlichen Bau- und Beschaffungswesens, die zum Beleg verfallender Rechtstreue im Beamtenapparat dienen soll, zeigt nur die jahre- und teilweise jahrzehntealte Übung auf diesem Feld.
Wenn ein Staatsanwalt in der SAT-1-Talkshow mitteilt, daß Bieter bei öffentlichen Bauvorhaben schon immer den Brauch pflegen, 5 bis 10% der Bausumme für Schmiergelder einzukalkulieren, und andererseits die Finanzämter – der „Wertneutralität“ des Steuerrechts halber – Schmiergelder als „nützliche Aufwendungen“ von der Steuer absetzen lassen, dann ist damit ein übliches Geschäftsgebaren beschrieben. Das wurde nicht heutzutage neu erfunden, sondern ist bloß neu in moralischen Verruf gebracht worden; obwohl – wie sich die älteren Semester erinnern – es schon die Gründerväter im Süden der Republik geschafft haben, Affären mit schönen Titeln wie „Onkel Alois“, „HS-30“ und „Spielbanken“ lange vor den „Amigos“ zum Bestandteil bayerischer Folklore zu machen.
Daß Steuerhinterziehungen im großen Stil, Drogen- und Waffenhandel und die „Wäsche“ des damit verdienten Geldes, die heute als die Domänen des organisierten Verbrechens ausgemalt werden, in früheren Zeiten „unorganisiert“ abgelaufen sein sollen, ist auch keine einfache Vorstellung.
Neben dem Gesetz, das gerade feststellt, was erlaubt und was verboten ist, bestimmen – darauf weisen die Kriminalstatistiker ebenfalls hin – Art und Umfang der ermittelnden Polizeitätigkeit die statistisch erfaßte Delinquenz:
So sinkt im Zuge der verschärften Asylgesetzgebung zwar der „Zustrom“ unerwünschter Ausländer dramatisch ab, andererseits wächst die Zahl der Verstöße gegen das Ausländer- und Asylrecht, weil – durch die Gesetzesänderung – Zugereiste aus „sicheren Drittstaaten“ aufgrund der gesetzgeberischen Erschaffung dieser Sorte von Staaten über Nacht zu Gesetzesbrechern werden.
Der Zonengrenzbezirk um das niedersächsische Gorleben brachte es Anfang der 80er Jahre innerhalb eines Jahres auf eine Steigerung der Kriminalität von 40%, bei Kindern sogar auf 113%, (das „Lüchow-Dannenberg-Syndrom“, da lacht der Kriminologe), weil die dort zum Schutz einer geplanten Atomanlage zusammengezogenen Polizeikräfte infolge ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit über die Atomgegner ihre Langeweile mit „Ermittlungsarbeit“ bekämpften, die sich auch mit solchen Straftaten befaßte, um die man sich früher gar nicht gekümmert hatte (vgl. SZ 23.2.95).
Der staatliche Ordnungswahn – Kampf dem allgegenwärtigen Verbrechen
Die Politik sieht das anders. Sie verweist gegenüber dem abgebrühten Urteil der Kriminalstatistiker, Kriminalität sei heutzutage wirklich „nicht das Problem Nr.1“ (Werner Lehne, Kriminologe, FR 11.2.94), – ungeachtet einiger Prozente mehr oder weniger – bei der jährlichen Auszählung auf die vorhandene Kriminalität und hat sich zu einer anderen Tagesordnung entschlossen.
Im Hinblick auf die „Notwendigkeit wirksamerer Gesetze“ hat sie einen Rückgang der Deliktzahlen um 4 Prozent in 1994 für „irrelevant“ erklärt (Leserbrief des Pressesprechers des BMI an die SZ 21.2.95). Sie hat im Gangstertum als „systembedrohende Kraft“ einen politischen Feind entdeckt, dessen Bekämpfung nicht mehr einfach dem vorbereiteten rechtsstaatlichen Instrumentarium überlassen werden soll.
Bisher hat dieses Instrumentarium in praktischer und ideologischer Hinsicht als verläßlich gegolten: Dem Rechtsbrecher wurde, so man ihn denn dingfest machen konnte, mit dem staatlichen „Strafanspruch“ entgegengetreten, der sich auf die schuldhafte Verletzung des Rechts gründete. Mit Gewalt wird der Verbrecher zur Anerkennung dieses Anspruchs und zum Erleiden der Buße gezwungen; was einerseits zur Heilung des verletzten Rechts, andererseits zur Rückkehr des Täters in die ideelle Gemeinschaft der rechtstreuen Staatsbürger führt.
Dem privaten Moralismus wird dabei – bei aller theoretischen Freiheit dieser Weltanschauung – seine begrenzte praktische Reichweite in Erinnerung gebracht wie auch die Verpflichtung seines Moralismus auf seinen verbindlichen Maßstab im geltenden Recht.
Selbst Taten des schwereren Kalibers führen grundsätzlich zu keinem anderen Verfahren, allenfalls – wenn dem Täter Verbrechen als „Gewohnheit“ attestiert wird – zur dauerhaft sicheren Verwahrung wg. besonderer Gefährlichkeit der „kriminellen Energie“ im Einzelfall. Der häßliche Vorwurf der Systemfeindschaft blieb dem Delinquenten erspart. Nicht zu Unrecht im übrigen, da weder Mord und Totschlag als private Delikte in aller Regel objektiv übermäßig revolutionär sind, noch Diebstahl und Betrug von einer subjektiv kämpferischen Einstellung gegen das Geld als gesellschaftliches Verhältnis zeugen; vielmehr vom Willen, es sich außerhalb der Legalität zu verschaffen und i.d.R. innerhalb derselben zu gebrauchen, wozu Kapitalismus und Privateigentum eine ziemlich gute Bedingung sind.
Heutzutage kommen die Zuständigen für die innere Sicherheit und Ordnung zu dem Urteil, unsere FDGO sei akut gefährdet. Nachdem sich die Verbrechensrate nicht wesentlich geändert hat, kann diese Befürchtung sich nur aus den gestiegenen Ansprüchen an den Ordnungszustand der Gesellschaft ergeben, wobei dann ein paar Prozentpunkte hin oder her wirklich keine Rolle spielen.
Die „normale“, ganz unpolitisch „gemeinte“ Kriminalität erscheint in neuem Licht: Wenn Kriminelle sich zwecks Steigerung ihrer Produktivkraft zusammentun und grenzüberschreitend Aktivitäten entfalten, werden sie unter dem Titel „organisiertes“ und „internationales Verbrechen“ als Gefahr für die innere Sicherheit und Anschlag auf das staatliche Gewaltmonopol ausgemacht. Sie finden sich damit in einer politischen Konfrontation mit der Staatsmacht wieder, von der sie sich nichts hätten träumen lassen: Als Systemfeinde sind sie im Visier der Politiker, die in ihnen nach Erledigung des politischen Terrorismus der RAF[1] die letzten gefährlichen Konkurrenten um das innerstaatliche Aufsichtsmonopol entdecken wollen und eine Gefährdung ihrer politischen Souveränität.[2]
Der Sieg über die äußere Systembedrohung und den inneren Feind aus der linken Ecke läßt also bei den Regierenden keine Zufriedenheit aufkommen. Befreit von systemkritischer Opposition entdeckt die Führung auf einmal ein Maß an privater Ordnungswidrigkeit, das sie zweifeln läßt, ob das neue große Deutschland in diesem Zustand so „fit für die Zukunft“ ist, wie es sein Kanzler von ihm verlangt. Die ausdrücklichen Verbrecher, die gegen Gesetze verstoßen, erscheinen den Regierenden nur als Spitze eines Eisbergs, als die sichtbare Seite eines Abgrunds von Pflichtvergessenheit, in der sich das ganze Volk dem Staatsdienst entzieht. Die Bürger sind auf dem „Ego-Trip“ und bilden eine „privatistische Rückzugsgesellschaft“ (Richard Göhner, CDU-Grundsatzkommission, Spiegel 11/94).
Eine Gesellschaft, die bei ihrem politischen Vorstand den Verdacht erregt, sich rücksichtslos gegen die anstehenden großen politischen „Gemeinschaftsaufgaben“ zu sehr um die Verfolgung von Privatangelegenheiten zu kümmern, und das auch noch in erheblichem Umfang unter berechnendem Mißbrauch von Recht und Gesetz, ist nie und nimmer den historischen Aufgaben gewachsen, vor denen Deutschland steht.
Dem Geist dieser auf das ganze Volk zielenden Inpflichtnahme genügen die geltenden Gesetze und die bis dato verfügbaren Instrumente der Rechtspflege nicht mehr. Die Debatte der regierungsnahen Fachkreise legt Wert darauf, daß nunmehr die Zeit gekommen sei, in der man nicht wieder „in eine gesetzestechnische Flickschusterei verfallen“ dürfe. „Irgendwann einmal müssen eben neue Schuhe gekauft werden.“ (Zeitschrift f. Rechtspolitik 1994, 462) Beim Zusammenschustern der neuen Paragraphen-Stiefel für das neue Deutschland
„stellt sich beileibe nicht nur die Frage, ob an dieser oder jener Stelle eine bestehende Vorschrift geändert oder aber eine neue geschaffen werden muß, sondern es geht um das Grundsatzproblem, ob überhaupt noch die Systematik, in der wir präventiv und repressiv dem Verbrechen entgegentreten wollen, schon im Ansatz überhaupt noch richtig, ja gerecht ist. Gerechtigkeit ist neu gefordert.“ (ebd.)
Der radikalreformerische Neuansatz, der sich da aufbaut, läßt erkennen, daß über dem Beschluß, die Kriminalität zu einem prominenten Thema zu machen, auch ernsthafte Zweifel an der „Richtigkeit“ und „Gerechtigkeit“ der strafrechtlichen „Systematik“ entstanden sind, deren „Liberalität“ man den neu entdeckten Staatsnotstand anlastet.
Wenn der Kauf ganz „neuer Schuhe“ – also eine ganz „neue Gerechtigkeit“ – gefordert ist, hat die alte Tour offenbar versagt. Vom Standpunkt der Reformer hat sie nicht die gewünschte Ordnung, sondern kriminelle Unordnung organisiert. Wenn Straftäter mit den bisherigen Methoden der Prävention und Repression so gut zurechtkamen, daß sie sich zur „ernsten Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Gesellschaft insgesamt“ (Broschüre der Bundesregierung zum Geldwäschegesetz) entwickeln konnten, dann – so der Schluß – war die Repression der kriminellen Neigungen in der Gesellschaft nicht nur nicht hart genug: Die Gesetzeslage hat offenbar den berechnenden Interessen Gelegenheit zu Ge- und Mißbrauch eingeräumt, die nun auf Kosten der Ordnung selbst gehen, die sie sichern sollte. So wird – wenn es nicht leistet, was verlangt ist – Recht zu Unrecht.
Vom Standpunkt der Bedürfnisse der Gewalt werden dann politische Protagonisten polemisch gegen das geltende Recht und machen es schlecht. An ihm entdecken sie überall Zeichen der Perversion, des Umschlags in Unrecht, weil sie nicht darauf verzichten wollen, den vorgesehenen Korrekturen der Ordnung das Gütesiegel des „eigentlich“ Gerechten zu verleihen.
Das führt einerseits zu ein paar unvermuteten Konfrontationen, wenn altliberale Teilnehmer der laufenden „rechtspolitischen“ Debatte, wegen ihrer Verteidigung eines früher halbwegs ehrenwerten Grundrechts – Unverletzlichkeit der Wohnung Art 13 Abs.1 GG – gegen „große Lauschangriffe“ oder strafprozessualer Verteidigerrechte als „Unterstützer der Organisierten Kriminalität“ (SPD-Jurist Krey bei der Anhörung zum Verbrechensbekämpfungsgesetz) oder als „zur Schlammschlacht versammelte linke Aktivisten“ geoutet werden.
Humanitätsselige Freunde des praktisch abgeschafften Asylrechts werden für die „wachsende Ausländerfeindlichkeit“ und die unverantwortliche „Durchrassung und Durchmischung“ (Stoiber) des gesunden deutschen Volkskörpers mit zweifelhaftem Importblut gegeißelt und Richter für die Zersetzung deutscher Wehrkraft wegen deren unzureichender Verteidigung gegen die Zitate toter Dichter.
Andererseits sind solche Klarstellungen ein Angebot an den anständigen Teil des Volkes, das seine Überzeugung, es mit der Ordnung, der es untersteht, gut getroffen zu haben, nicht mehr durch den Genuß überholter „Freiheitsrechte“ nähren soll, sondern durch die Gewißheit der Stärke dieser Ordnung. Durch standfestes Gegensteuern gegen gemeinschaftsschädliche kriminelle Bestrebungen bietet sich die Gewalt den Untertanen als verläßliche Heimstatt an.
Deshalb kommen althergebrachte juristische Positionen, die bislang zum traditionellen Verständnis des grundrechtlich definierten Verhältnisses von Staat und Bürgern gehört haben, jetzt als „Ladenhüter“ (Kanther) in Verruf. Die Grundrechte sollen angesichts der bedrohlichen Übermacht „modern ausgerüsteter, international operierender Verbrechersyndikate“ (Kanther) nicht mehr als „Abwehrrechte“ gegen den Staat „den Schutz der Bürger vor dem Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhunderts“ gewährleisten. Umgekehrt: Schutz vor Verbrechen muß endlich „Priorität haben vor individuellen Abwehrrechten“ (Göhner, Spiegel 11/94). Der Staat des 20. Jahrhunderts muß der „kriminellen Nebengesellschaft“ (Kanther) Paroli bieten. Oder, wenn man dasselbe als liberaler Anwalt modernisierter Bürgerrechte ausdrücken will:
Weil „heute nicht der Staat Freiheit, Eigentum, Leib oder Leben der Bürger bedrängt“, sondern „der Bürger sich durch die kriminellen Angriffe seines Mitbürgers bedroht fühlt“, liegt moderne Rechtspolitik im „Schutz der Rechte des Bürgers vor der Ohnmacht des Staates.“ (Bremer Wirtschaftssenator Jäger, FDP, FAZ 7.12.94)
So zeigen heute praktizierende Grundrechtstheoretiker, daß auch unter demokratischen Fahnen die Einheit der um die bedrohte Gewalt gescharten Volksgenossen geboten und machbar ist und daß deutsches Bürgerrecht am sichersten Seit an Seit mit einer machtvollen Obrigkeit erkämpft wird. Grundrechtsschutz fällt deshalb zusammen mit Staatsschutz. Was der Bürger an Rechten wirklich braucht, definiert sich umstandslos nach dem Bedürfnis der öffentlichen Gewalt, das, von den Parteien in einträchtiger Konkurrenz ermittelt, als praktische Moral von oben die schrittweise Reformierung des bundesdeutschen Rechtsstaates beseelt.
III. Recht kostet Ordnung; erste Reformerfolge
Die Bemühungen um die Neudefinition von Gerechtigkeit haben noch vor Ende der letzten Legislaturperiode im Herbst 1994 zu einem „Verbrechensbekämpfungsgesetz“ geführt, einem Konglomerat von Neuregelungen auf den Gebieten des Straf- und Strafprozeßrechts, des Ausländerrechts und der Polizeiorganisation. Das Verbrechensbekämpfungsgesetz, gemeinsam von Koalition und SPD beschlossen, bringt konsequent den Standpunkt zur Anwendung, daß – in staatlichen Bedrohungslagen, wie der gegebenen – der „Gerechtigkeitsgehalt“ neuer gesetzlicher Regelungen sich in erster Linie daran zu beweisen hat, wie er das staatliche Interesse an ordnungsstiftendem Zugriff bedient. Daß mit der Willkür auch die Gewalt des Staates gebremst sei, ist heute kein idealistisches Kompliment an den Rechtsstaat mehr, sondern ein Vorwurf der Ordnungs-Gewalt an die Adresse reformbedürftigen Rechts und Beweis und Begründung des Reformbedarfs in einem. In diesem Sinne brachte die Koalition das Verbrechensbekämpfungsgesetz im Herbst 1994 „als Einstieg in neue Methoden zum Kampf gegen neue Phänomene der Kriminalität“ (Kanther) im Bundestag ein und kündigte noch vor Inkrafttreten seine Fortschreibung in der neuen Regierungsperiode an.
Das Gesetzeswerk ist in „drei Hauptthemen“ (Bulletin, 17.10.94) gegliedert und zielt auf „Massenkriminalität“, „Organisierte Kriminalität“ und „extremistische Bestrebungen und politisch motivierte Gewalt“ (ebd.).
Zur ersten Abteilung werden einerseits vor allem Delikte aus den Kapiteln des StGB über Eigentums- und Körperverletzungen gerechnet, einschließlich Brandstiftung oder Sachbeschädigung, andererseits aber auch allerlei Demonstrationsstraftaten. Ferner will der Gesetzgeber erreichen, daß man in all diesen Fällen schneller, „ökonomischer“, eben mit weniger strafprozessualen Umständen zu einer Verurteilung kommen kann. Weil er in der Strafprozeßordnung (StPO) eine ganze Reihe unerträglicher Hemmnisse entdeckt, richtet sich sein Augenmerk schwerpunktmäßig – unspektakulär aber durchschlagend – auf deren Reform.
In den beiden anderen Abteilungen sind die auffälligeren Maßnahmen untergebracht, anhand derer die moralisch stilbildenden rechtsstaatlichen Debatten der letzten Zeit abgewickelt wurden: Anti-Geldwäsche-Maßnahmen, Abhörbefugnisse und „Geheimdienst-Polizei“ einerseits, „Auschwitzlüge“ andererseits.
Das sind die Themen, anhand derer Politik und Öffentlichkeit sich gegenseitig und dem Publikum erklären, was eine wehrhafte Demokratie im Zuge ihrer rechtspolitischen Vorwärtsverteidigung heutzutage auf jeden Fall dürfen muß, wenn sie nicht gleich den Löffel an Mafia und Extremisten abgeben will.
Wider die Massenkriminalität – Kurzer Prozeß, höhere Strafen
Zur besseren Bekämpfung der Massenkriminalität
wurde zu Zwecken der übersichtlichen polizeilichen Buchführung über ihre Massen-Kundschaft der StPO ein „Achtes Buch“ angefügt, in dem das neu geschaffene Bundeszentralregister geregelt ist. Das ist eine Datensammlung über alle, die einmal in die Fänge der Strafverfolger geraten sind, sowie über ihre „Identifizierungs-Merkmale“, „Tatzeiten“, „Tatvorwürfe“ und die Historie gegen sie geführter Verfahren. Aus diesem Register können sich ohne große bürokratische Formalitäten „auf Ersuchen“ (§ 474 Abs.4 StPO neue Fassung) auch sämtliche Geheimdienste per EDV (§ 475 StPO n.F.) bedienen. Der Fortschritt liegt hier, wie zu vermuten, wohl weniger im Verfahren selbst als vielmehr in seiner Legalisierung und Systematisierung.
Kernpunkt der StPO-Reformen sind
„Änderungen der Strafprozeßordnung zur effektiven Beschleunigung der Strafverfahren, z.B. durch Straffung des Beweisantragsrechts.“ (Kanther)
Besonders störend macht sich im Strafprozeß erfahrungsgemäß geltend, daß Angeklagte dem Gericht unsinnige Behauptungen, ihre Unschuld betreffend, entgegenhalten und dafür auch noch zeitaufwendige Beweisanträge stellen (lassen) dürfen. Solche Beweisantragsrechte werden durch kleine aber wirksame Kunstgriffe „gestrafft“: Durch die künftig nach Belieben des Gerichts nur mehr schriftliche und nicht mehr mündliche Einbringung von Gutachten, Attesten, Vernehmungsprotokollen von Zeugen oder Mitbeschuldigten etc. in die Hauptverhandlung (Erweiterung des „Selbstlese-Verfahrens“, § 249 Abs.2 StPO n.F.) werden der Verteidigung umfangreiche Möglichkeiten des unmittelbaren Vorgehens gegen belastendes Material genommen, so daß das Gericht „sich schon eine Meinung zum Beweiswert gelesener Urkunden bilden“ kann (BRAK-Mitteilungen 1994, 146) ohne Einwirkungsmöglichkeiten der Verteidigung. Und weil überhaupt Beweisanträge „in letzter Zeit… viel Zeit benötigen“ (Entwurfsbegründung BT-Drucksache 12/6853, S.34), werden in größerem Umfang Gelegenheiten für solche Störungen eines flotten Verfahrens abgeschafft durch die Verpflichtung, „Anträge und Anregungen zu Verfahrensfragen schriftlich“ (§ 257a StPO n.F.) – und damit aus der laufenden Verhandlung heraus entschieden seltener – zu stellen.
Da will es den Strafverteidiger
„schon erstaunen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich der Gesetzgeber von historisch gewachsenen Strukturprinzipien unseres Strafprozesses (Mündlichkeit, Öffentlichkeit, Unmittelbarkeit) verabschiedet, ohne dies auch nur mit einem Wort in der Gesetzesbegründung zu erwähnen oder gar zu gewichten.“ (Dahs, NJW 1995, 553 (556))
Der Vorwurf ist offenkundig unbegründet: Die „historisch gewachsenen Strukturprinzipien“ sind ja – im Resultat als künftig auszuräumende Verfahrenshindernisse – „gewichtet“ und gerade deshalb abgeschafft worden.
Weitere „ca. 100 Vorschläge für ein weiteres Entlastungsgesetz“ mit weiteren drastischen Einschränkungen des Beweisantragsrechtes und des Richterablehnungsrechtes sind bereits angekündigt.
Hinzu kommt der Ausbau eines schon bisher möglichen „beschleunigten Verfahrens“, mit dem bislang überwiegend „Rowdies, Halbstarke, Demonstranten, kleine Diebe und Gastarbeiter, Startbahn-West-Demonstranten“ und in manchen Jahren „bis zu 90% Ausländer“ (BRAK-Mitteilungen 1994, 144) verurteilt wurden, zu einem neuen Verfahrenstypus: Fälle, die „aufgrund des einfachen Sachverhalts oder der klaren Beweislage zur sofortigen Verhandlung geeignet sind“ (§ 417 StPO n.F.), können nun ganz ohne oder mit nur 24-stündiger Ladungsfrist, ohne Anklageschrift, z.T. auch ohne Beweisantragsrecht und ohne Verteidiger durchgezogen werden.
Gerade weil das Beweisantragsrecht als Zentralrecht des Angeklagten im Strafprozeß („konkretisiertes Verfassungsrecht“) sich für den Ablauf störend geltend machen kann, und besonders im „Schnellverfahren“, wo alle – bis auf den Angeklagten – wegen „des einfachen Sachverhalts oder der klaren Beweislage zur sofortigen Verhandlung“ und natürlich Verurteilung schreiten wollen, soll es weitestmöglich gekippt werden. Was altgediente Prozeßrechtler noch als Warnung verstanden –
„Der … Vorzug der Raschheit wird jedoch mit erheblichen Einbußen an Justizförmigkeit des Verfahrens erkauft…; das Verfahren ist etwa bei laufenden aufrührerischen Demonstrationen unangebracht, weil bei der Strafzumessung die Gefahr einer einseitigen Bevorzugung der Generalprävention bestünde. Jedoch kommt eine verstärkte Anwendung bei unpolitischen Bagatelldelikten… in Betracht…“ (Roxin, Strafverfahrensrecht, 23.Aufl. S.423) –,
beschreibt so ungefähr, was das Positive an der Neuregelung ist: Gerade deshalb wird das „beschleunigte Verfahren“ ausgebaut und „das Ziel verfolgt, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht zu einer stärkeren Nutzung dieser Verfahrensart zu veranlassen und damit insbesondere in tatsächlich und rechtlich einfach gelagerten Fällen eine Aburteilung zu ermöglichen, die der Tat möglichst auf dem Fuße folgt.“ (Gesetzesbegründung, BT-Drucksache 12/6853, S.34)
Zum einen setzt das neue Gesetz gerade auf die abschreckende Wirkung – „präventiv-polizeilicher Zweck“ (BRAK s.144) – von Schnellgerichten, wenn es doch einmal „aufrührerische Demonstranten“ zu verurteilen geben sollte. Zum anderen schafft sich die „Rechtspflege“, die immerhin schon vor dem neuen Gesetz 96 von 100 Fällen bei den Amtsgerichten an einem Tag erledigt hat (vgl. SZ 21.9.94), im Bereich der Bagatelldelikte nochmal eine ganze Anzahl von Verfahren beschleunigt und mit verkürztem rechtsstaatlichen Verfahren vom Hals.
Einige Parlamentarier, die meinten, die neuen Maßnahmen verfolgten bloß den Zweck der Entlastung und Rationalisierung des Gerichtswesens, plädierten für die „Herabstufung“ von Ladendiebstählen zu Ordnungswidrigkeiten und die Verfolgung von Schwarzfahrern erst beim vierten Erwischen. Sie mußten jedoch zur Kenntnis nehmen, daß ihre Effizienzüberlegungen nicht ganz dem Geist der laufenden Reformen entsprechen. Von maßgeblicher Seite verwahrte man sich schärfstens gegen die Bagatellisierung und Entkriminalisierung dieser „Alltagsdelikte“; die Staatsgewalt dürfe in ihren moralischen Maßstäben keinesfalls laxer werden.
Über die Einführung einer nach Bedarf zu verhängenden „Hauptverhandlungshaft“ von bis zu sieben Tagen, um den Tatverdächtigen für die Verhandlung „verfügbar“ zu halten, ist noch keine Einigung erzielt worden. Diese Neudefinition des „Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes“ zugunsten der Strafverfolger steht aber fest auf der Agenda der Bundesregierung und hat verhältnismäßig gute Zukunftschancen.
Eine Ausweitung der Untersuchungshaftgründe (u.a. bei „Wiederholungsgefahr“ – festgenommener Demonstrant könnte gleich wieder zum Landfriedensbrechen gehen) ist immerhin ein Anfang.
Insgesamt spielen die Erweiterung der Haftgründe und die diversen Einschränkungen der Beweisantragsrechte zunächst die Hauptrolle in der Gesetzgebung gegen die „Massenkriminalität“. Daß damit ein „elementarer Bestandteil der Subjektstellung jedes Beschuldigten im Strafprozeß“ (Dahs, NJW 1995, 553(556)) ein Stück weit wegreformiert wird, ist der Sinn der Sache. Gerade damit soll ja aufgeräumt werden, daß sich jeder hergelaufene Dieb und Landfriedensbrecher unter Berufung auf Verfahrensrechte als „Subjekt“ eines – teuren – zum Zweck seiner Bestrafung eingerichteten Prozesses aufführen kann und den Rechtsstaat in einen verächtlichen „Rechtsmittelstaat“ (Kohl) verwandelt.
Im Bereich der Körperverletzungsdelikte (§§ 223 StGB ff) hat der Gesetzgeber zwar nicht das Bedürfnis, sich weitere Zugriffsrechte auf seine weniger friedliebenden Untertanen zu verschaffen; die letzten Erfahrungen mit den Autonomen, randalierenden Fußballfans, rechten Schlägern und Brandstiftern haben ihn u.a. aber daran zweifeln lassen, sich mit der bestehenden Gesetzeslage einfach zufrieden geben zu können. Der „gesunden Volksmoral“, die sich darüber empört, was sich die Menschheit heutzutage alles herausnimmt, und wie glimpflich die einschlägigen Straftäter davonkommen, meinte der Gesetzgeber Recht geben zu sollen. So gut er weiß, wie wenig es bewirkt, der fraglichen Kundschaft damit zu drohen, künftig nicht mehr so „glimpflich“ davonzukommen, so sehr legt der Rechtsstaat es auf den Beweis seines Willens und seiner Entschlossenheit zum Durchgreifen an. Die neuen Fassungen der betreffenden Paragraphen enthalten z.T. erhebliche Verschärfungen des Strafrahmens.
Wider die „Organisierte Kriminalität“ – neue Tatbestände, neue Beweismittel, umfassende Kontrolle
Als zweites wichtiges Thema neben der „Massenkriminalität“ gibt der federführende Innenminister die verbesserte Bekämpfung der Organisierten Kriminalität an. Die innerjuristische Debatte sieht sich – teils mit mokantem Verweis auf die „begrifflich“ ungehobelten Bedrohungsszenarien der Politiker – noch weit entfernt von einer subsumtionstüchtigen Definition der Organisierten Kriminalität („OK“):
…eine präzise Beschreibung dessen, was OK eigentlich ist, vor allem bei uns, erfährt man so gut wie nie
(Schaefer, Generalstaatsanwalt a.D., NJW 1994, 774),Das Abkürzel OK täuscht einen anerkannten Gegenstandsbegriff vor
(Eisenberg, NJW 1993, 1034),… Weitläufigkeit und Unbestimmtheit des Phänomens…
(BRAK-Mitteilungen 1994, 142).
Dagegen haben die Politiker per Richtlinie definiert, was (die) Sache ist:
„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- und Machtstreben bestimmte, planmäßige Begehung von Straftaten, … erhebliche Bedeutung, … mehr als zwei Beteiligte… arbeitsteilig, … geschäftsähnliche Strukturen, … Anwendung von Gewalt, … Einflußnahme auf Politik, Medien, Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft… Nicht Terrorismus.“ (Gemeinsame Richtlinie der Justiz- und Innenminister, Kleinknecht-Meyer, Kommentar zur StPO, 40.Aufl., S.2066 ff)
Und sie haben längst gehandelt: Schon am 15.7.92 trat ein erstes Gesetz zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in Kraft, mit dem Regelungen über den „Verdeckten Ermittler“ in die StPO eingefügt wurden, der sich in Fällen des „bandenmäßigen“ Drogen-, Waffen- und Falschgeldhandels, natürlich auch bei „Staatsschutz-Delikten“ unter falscher Identität ins Milieu einschleichen (§§ 110 a-c StPO) und mit den gewonnenen „Erkenntnissen“ später den Strafverfolgungsbehörden als anonymer Zeuge (§ 68 StPO) dienen darf. Außerdem wurden in Fällen der oben genannten Delikte erweiterte Foto- und Videoobservierung sowie Abhörmaßnahmen („außerhalb von Wohnungen“) zur Gewinnung von Beweismitteln in die StPO eingeführt (§ 100 c StPO).
Die „Kriminalisten“ reagierten hierob „herb enttäuscht“, fanden, die Regelung gehe „nicht weit genug“, entdeckten in dem Gesetz eine „beklemmende Praxisferne“, „Bürokratie statt Hilfe“ und beklagten insgesamt die totale Verrechtlichung
ihres Kampfes gegen das Böse. (Alle Zitate aus NJW 1993, 1033 ff) Insbesondere der „Richtervorbehalt“, also die Genehmigung zur Observierung, des Abhörens und des Einsatzes „verdeckter Ermittler“ durch einen Richter, erschien den Gesetzeshütern als „unverzeihliche Gemeinheit, weil er ein tiefsitzendes Mißtrauen gegenüber der Kriminalpolizei offenbare.“ (Burghard, KrimJ 1992, 595)
Dieser tiefsitzenden Enttäuschung trug das im Herbst 1994 erlassene Gesetz zur Verbrechensbekämpfung Rechnung mit dem Bemühen, die justizielle Energie der Polizei wieder ein Stück mehr gegen „totale Verrechtlichung“ und „rechtsstaatlichen Bürokratismus“ freizusetzen, versehen mit dem ausdrücklichen Versprechen, daß es sich hierbei erst um einen „Einstieg“ (Kanther) handele:
Der staatliche Kampf gegen die „Organisierte Kriminalität“ weist die Ernsthaftigkeit der Bedrohung durch eine relativ spektakuläre Maßnahme nach, nämlich durch „eine einschneidende Verletzung des Legalitätsprinzips und des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes“ (Dahs, NJW 1995, 553 (557)), die Einführung einer Kronzeugenregelung, die man bisher nur auf dem Gebiet der terroristischen Straftaten kannte, der bislang „gefährlichsten Bedrohung“ des Rechtsstaats. Die Reformer „riskieren“ dafür eine Verunsicherung der Volksmoral wegen der Bevorzugung arrivierter Verbrecher und Unmut gegen sich selbst,
„wenn sich der Eindruck verfestigt, daß man um so mehr Privilegien genießt, je höher man auf der Leiter des Verbrechens gestiegen ist.“ (Dahs, a.a.O. s.557)
Um des hohen Zieles willen, die staatlich konstatierte Defensive der Ordnung gegenüber kriminellen Banden offensiv zu wenden, mag die neue Kampfgesetzgebung weder auf frühere Rechtsprinzipien noch auf moralische Bauchschmerzen der Öffentlichkeit Rücksicht nehmen, auch wenn der Lohn der Straffreiheit für einen anerkannten Großverbrecher manchem Anlaß zum Grübeln über den notorisch ausfallenden Lohn des eigenen Anstands gibt. Weil solche Unzufriedenheit aber ebenso chronisch wie theoretisch ist, setzt die Staatsgewalt einfach auf die diesbezüglichen besänftigenden Wirkungen des angestrebten Fahndungserfolgs.
Keinen derartigen Dissens stiftet dagegen die erweiterte Strafbarkeit der Geldwäsche
(§ 261 StGB), jedenfalls bei den Vielen, denen am Monatsende kein Geld zum Waschen bleibt. Hier wurde der „Katalog der Vortaten“ erweitert, also die Anzahl der Delikte ausgeweitet, aus denen das zu „waschende“ Geld herrühren kann, um der Strafbarkeit anheimzufallen. Die professionellen Betrachter der Szene bedanken sich beim Gesetzgeber dafür, daß er wenigstens die leicht fahrlässige Geldwäsche straflos gelassen hat („… sonst eine Flut von Verdächtigungen gegen Kreise der Bevölkerung, die tatsächlich der Kriminalität fernstehen…“) und die ursprünglich vorgesehene Steuerhinterziehung wieder aus dem Vortatenkatalog entfernt hat (sonst ein Volk von Geldwäschern?); und sie wundern sich, wie der Gesetzgeber „angesichts allenfalls minimaler praktischer Erfahrung“ mit der lapidaren Begründung, der „Vortatenkatalog“ habe „sich in der Praxis als zu eng erwiesen“, die Strafbarkeit der Geldwäsche „weit über das Ziel einer Bekämpfung des organisierten Verbrechens hinaus“ ausweiten konnte, etwa auf die „banden-untypischen“ Delikte der Untreue, Unterschlagung oder Urkundenfälschung (vgl. Dahs a.a.O. S.555). Aus dem Umstand, daß der Gesetzgeber auch hier den „rechtstatsächlichen Beleg“ für die Notwendigkeit der ausgeweiteten Strafdrohung „schuldig bleibt“ (Dahs ebd., BRAK-Mitt. S.157), mögen die Kommentatoren aber beileibe nicht den Schluß ziehen, daß sich der staatliche Wille zum Durchgreifen von solchen Begründungen unabhängig macht und sich selbst als die einzig maßgebende „Rechtstatsache“ betrachtet.
In einem eigenen „Geldwäsche-Gesetz“ wird den Banken die Verpflichtung auferlegt, die Einzahler von Beträgen über 20000 DM zu identifizieren und sie, wenn der Verdacht besteht, es handele sich um illegale Gelder, den Behörden zu melden. Im Bedarfsfall können die staatlichen Stellen sich dann – da dreht es den Verfechtern des bisher hoch geachteten „Bankgeheimnisses“ den Magen um – Bankaufzeichnungen als „allgemeine Strafverfolgungsinstrumente“ (BRAK-Mitt. S.157) verschaffen.
Geldwäsche ist ein Delikt, das nur aus dem Bedürfnis des Staates nach Verfolgung anderer Straftaten entsteht. Kriminalisiert werden diejenigen, die illegal verdiente Erträge in das legale Finanzwesen einbringen oder dazu beitragen. Weil man hofft, der kriminellen Großverdiener an dieser Schwelle zum legalen Geschäft habhaft zu werden, macht man die Banken zu Erfüllungsgehilfen der Staatsanwaltschaft, die auch selbst zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie sich diesem Dienst versagen.
Dies ist nun aber ein Stück weit systemwidrig: Es ist das Wesen des Geldes, daß es „nicht stinkt“, d.h. daß man ihm seine Herkunft nicht ansieht; im Kapitalismus soll die Privatmacht über Dienste und Reichtum als selbständiger Gegenstand veräußer- und erwerbbar sein und als Ziel aller ökonomischen Operationen getrennt vom Staat und staatlicher Verpflichtung die Bürger auf den Dienst am Wachstum des Kapitals festlegen. Das Geld tut – im internationalen Verkehr schon gleich – diesen Dienst an der Nation um so mehr, je weniger politische Kontrolle seine Bewegung behindert.
Die staatliche Aufsichtsmacht hat sich mit ihrem größer gewordenen Kontrollbedürfnis das holde Drangsal geschaffen, zwischen diesem und dem widerstreitenden elementaren Staatsinteresse an der freien Entfaltung des Privatgeschäfts abwägen zu müssen. Das belebt die politische Auseinandersetzung. Die SPD z.B. wollte die vom „Verbrechensbekämpfungsgesetz“ erweiterten Möglichkeiten, durch Raub und Erpressung erlangtes Geld und das Vermögen von „banden- und erwerbsmäßigen“ Räubern und Erpressern zugunsten der Staatskasse einzuziehen (§ 256 StGB n.F.), mit einem eigenen Knüller übertrumpfen: Sie brachte den Vorschlag ein, bei „Vermutung des Herrührens von Vermögen aus schweren Straftaten“ oder dem „Verdacht einer beabsichtigten Verwendung von Vermögen für schwere Straftaten“ dieses Vermögen einzuziehen und dem Betroffenen die Beweislast für den rechtmäßigen Erwerb aufzuerlegen. Diese grundsätzlich hochanständige und verbrechensfeindliche Idee traf auf eine ebenso entschiedene wie bunte Ablehnungsfront, angeführt von Innenminister Kanther („… widerspricht elementaren Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit“, Plenarprotokoll 12/210 S. 18172), unterstützt vom journalistischen Ober-Rechtsstaats-Wächter H. Prantl („rechtsstaatlich aberwitziges Vorgehen“, SZ 28.1.94) und Vertretern der „Wissenschaft“ („…Verdachtsstrafe restauriert…, endet beim totalitären Strafrecht“, Welp, StV 1994, 165 (166)). – Unabhängig von aller Ideologie liegt hier tatsächlich eine Prinzipienfrage vor. In die Freiheit der Geschäfte, die die Staatsgewalt der freien Marktwirtschaft doch befördern will, einzugreifen, ist ein Widerspruch. Voreilig, ohne den erbrachten Unrechtsbeweis, mag sie – darin sind sich die regierenden Rechtspolitiker einig – darum nicht Geldvermögen brachlegen bzw. einziehen. In der idealistischen Sprache der Juristen heißt das dann: Die „Aufhebung des Privateigentums auf staatlich vorgebrachten Verdacht hin“ (Köhler/Beck, JZ 1994, 797 (799)) würde den „Eigentumsschutz seinem Wesensgehalt nach antasten“ (Art 19 Abs.2 GG).
Zwar bleibt von besagtem Wesensgehalt auch in den längst existierenden Fällen der „Vermögensstrafe“ (§ 43a StGB) nicht viel übrig, wenn dem werten Rechtssubjekt „neben einer lebenslangen oder einer zeitigen Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren“ (§ 48a StGB) sein gesamtes Vermögen und nach den Vorschriften des „Verfalls“ (§§ 73 ff StGB) das „aus der Tat Erlangte“ weggenommen wird. Bloß: einen im Prozeß überführten Täter soll es nach Auffassung der Mehrheit vorderhand schon noch geben, bevor man ihn als Rechtssubjekt beschränkt und ihm die Möglichkeit nimmt, mit seinen materiellen Mitteln zur Steigerung des Bruttosozialprodukts beizutragen. Im übrigen reformiert man ja gerade das Prozeßrecht so eifrig, damit man schneller die schwarzen Schafe unter den Geschäftemachern aussondern kann.
Wenn das der SPD viel „zu lasch“ (Innenminister v. NRW Schnoor, SZ 16.11.93) ist, will sie zeigen, daß erstens die Ordnungsmacht, wenn es um ihren eigenen Bestand geht, vor buchstäblich nichts zurückschrecken darf, noch nicht einmal vor dem Eigentumsrecht selbst. Zweitens aber dürfen Verbrecher sich keinesfalls ihres ungerecht erworbenen Reichtums erfreuen. Mit soviel volkstümlicher Rechtschaffenheit wollen die Sozialdemokraten die Union und ihren Kanther als liberale Weicheier hinstellen, die lieber an Grundrechten herumschützen als Verbrecher auszuräuchern, und die sich an Leuten mit dicken Geldbeuteln ohnehin ungern vergreifen. Das soll Volkes Stimmen bringen.
Eine ziemlich symbolische Debatte haben auch die Reformschritte des Verbrechensbekämpfungsgesetzes auf dem Gebiet der Beschaffung von polizeilichen Erkenntnissen ausgelöst, mit denen der „gestraffte“ Strafprozeß erst erfolgreich geführt werden kann: der Große Lauschangriff
auf Wohnungen (mit Wanzen, Richtmikrophonen etc.) und die Einschaltung der Geheimdienste in die Verbrechensbekämpfung, also die Schaffung einer „Geheimpolizei“ (SZ 7.2.94) „erstmalig seit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches“ (BRAK-Mitt. 1994, 157). Symbolisch deshalb, weil der praktische Neuigkeitswert dieses Vorhabens – der „Große Lauschangriff“ ist noch verschoben auf die laufende Legislaturperiode, die Kompetenzerweiterung der Geheimdienste wurde Gesetz – eher begrenzt ist angesichts dessen, was auf diesem Gebiet schon geltendes Recht und Praxis ist. Das Abhören von Telefonen ist im Bereich der „allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung“, also bei „konkreten Gefährdungen im Einzelfall“ mit mindestens „Anfangsverdacht“ hinsichtlich einer bestimmten Straftat, durch die hierfür einschlägige StPO erlaubt. Ebenso heimliche Foto- und Videoaufnahmen oder das Lauschen mittels Wanzen und Richtmikrophonen – letzteres soweit es sich nicht um „Wohnungen“ handelt. Im Bereich der „allgemeinen Gefahrenabwehr“, also im „Vorfeld der konkreten Gefahr oder des Strafverdachtes“ (Denninger, Prof. für öffentliches Recht FR 1./2.6.94), wo es um FDGO-widrige „Bestrebungen“ (§ 3 Bundesverfassungsschutz-Gesetz) geht, darf von den drei Geheimdiensten – Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischer Abschirmdienst – ohnehin nach Herzenslust Post kontrolliert, Telefonverkehr – auch ins Ausland – abgehört und gefilmt werden, was das Zeug hält. Dafür gibt es schließlich schon seit 1968 ein eigenes „G 10-Gesetz“, in dem die Einschränkungen des Post- und Fernmelde-Geheimnisses (lt. Art 10 GG ein Grundrecht) geregelt sind.
Während es in Deutschland 1992 auf Grundlage des § 100a STPO 3509 richterlich angeordnete Telefonüberwachungen gab (wozu die viel zahlreicheren geheimdienstlichen nicht zählen), erfolgten im selben Jahr in den gesamten USA 770 gerichtliche Abhörungen (FR 26.6.1993 und 16.8.93). „In Deutschland wird mehr abgehört als im übrigen Europa zusammen“ (Justizminister von Rheinland-Pfalz, Caesar, Bonner Generalanzeiger 21./22.8.1993). Richterliche und geheimdienstliche Abhöraktionen „zusammengenommen… sind wir schon im Millionenbereich“ (Der Spiegel 11/1994). „Lauschangriffe“ auf Wohnungen sind für die Geheimdienste längst – seit 1990 – in den einschlägigen Gesetzen (§ 9 II,III BVerfSchG, § 5 MAD-Ges./§§ BND-Ges.) erlaubt und für die Länderpolizeien von Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg in ihren jeweiligen Polizei-Aufgabengesetzen seit 1990 bzw. 1992, wofür bereits eine „Gemengelage von Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrfällen“ (Samper/Honnacker, Polizeiaufgabengesetz, 15. Aufl. (1992) Art. 34) ausreichend ist. Die in der aktuellen Debatte um die „Einführung“ des „Großen Lauschangriffs“ auf Wohnungen strittige Ergänzung nun auch noch der StPO ist „damit praktisch… durch die landesrechtliche Hintertür bereits eingeführt.“ (Kutscha, „Der Lauschangriff im Polizeirecht der Länder“, NJW 1994, 85(88))
Wenn die Polizei sich schon nur mehr unter Einsatz von geheimdienstlichen Mitteln gegen die systembedrohenden Angriffe der Organisierten Kriminalität wehren kann, ist es für die politische Führung nur naheliegend, umgekehrt die Geheimdienste mit polizeilichen Aufgaben zu betrauen und die überlegenen „technischen Möglichkeiten des Bundesnachrichtendienstes auf dem Gebiet der Fernmeldeaufklärung für die Bekämpfung besonders schwerwiegender Formen der Organisierten Kriminalität“ nutzbar zu machen (Kanther). Die „Nutzbarmachung“ sieht dann so aus, daß auf Grundlage der neugefaßten §§ 3 und 5 des G 10-Gesetzes künftig ganz legal vom BND gesammelte „personenbezogene Daten“ zur „Verhinderung, Aufklärung oder Verfolgung von Straftaten verwendet werden“ dürfen; der BND „prüft“, ob diese Daten für Polizeizwecke „erforderlich sind“, und entscheidet dann, ob diese anderen Geheimdiensten, Zoll und/oder Polizei und Staatsanwaltschaften weiterzugeben sind. Der Telefonverkehr zwischen In- und Ausland wird so überwacht, daß sich, „sobald bestimmte Stichworte fallen, Aufzeichnungsgeräte einschalten.“ Mit solchen Wortbanksystemen, mit denen „schon die Stasi den Telefonverkehr überwacht hat“, wird ein „gigantischer elektronischer Staubsauger“ installiert, der – „losgelöst von allen Kontrollen“ – den Informationsstand der Behörden bereichert. (H. Prantl, SZ 19.11.93)
Juristen, denen die Notwendigkeit von Geheimdiensten für den Kampf gegen „umstürzlerische Bewegungen“ und für „das primäre Anliegen, gegen die kommunistische Gefährdung im Innern des westdeutschen Staates eine schützende Instanz zu etablieren“ (FR 1./2.6.94), schwer einleuchtet, mühen sich ab, mit ihren „Auslegungsregeln“ – grammatisch, historisch, teleologisch – zu ergründen, ob Verbrechensbekämpfung mittels Geheimdiensten denn eigentlich noch unter den gesetzlichen Auftrag der „Dienste“ zum Verfassungsschutz gegen feindselige „politisch bestimmte … Verhaltensweisen“ (§ 4 BVerfSchG 1990) subsumierbar sei.
Politiker und politische Polizisten entscheiden solche Fragen: Sie stellen fest, daß
„die Bedrohungsqualität der Organisierten Kriminalität der des politischen Extremismus gleich ist“, weshalb sich der „freiheitliche Rechtsstaat gegen sie auch mit dem Instrumentarium der abwehrbereiten Demokratie zur Wehr setzen“ (Werthebach, FR 1./2.6.94)
müsse, zu dem auch die Geheimdienste gehören. Das verschiedentlich aufkommende Gemurmel über die angebliche Peinlichkeit einer Erinnerung an Zeiten der „Geheimen Staatspolizei“ wurde vom Innenminister als „Unverschämtheit“ zurückgewiesen und ist inzwischen auch schon wieder erstorben. Schließlich hat hier keine totalitäre Staatspartei eine Gestapo eingeführt, sondern die total staatstragenden pluralistischen Parteien haben im Wettbewerb um die härtesten und effektivsten Regelungen demokratischen Geheimdiensten Polizeifunktionen übertragen. Außerdem bestehen bei aller – ausdrücklich gewollten – „rechtsstaatlichen Klimaverschiebung“ (Denninger, FR 1./2.6.94) „Grundrechte, Datenschutz und Bankgeheimnis“ fort. Sie sollen eben künftig nur mehr „rechtstreue Bürger schützen und nicht den Verbrecher“, dessen Anspruch auf diese Wohltaten aufgekündigt wird. Wer der rechtstreue Bürger, wer der Verbrecher ist, werden die Verfolgungsbehörden schon herausfinden, wenn sie den Persönlichkeitsschutz erst hinreichend demontiert haben. Wenn die Staatsmacht gegen den kriminellen Feind, der „die Demokratie untergräbt,… juristisches Neuland“ (Anke Fuchs, SPD, FR 25.2.94) betritt, können die Bürger froh sein, wenn sie sich auf der richtigen Seite des konsequenten und klaren Trennungsstriches zwischen dem rechtstreuen Bürger und dem Rechtsbrecher
(K. Schelter, Staatssekretär im BMI), wiederfinden. Staat und Bürger müssen sich darin einig sein, daß es die Pflicht der Verantwortungsträger ist, „mißbrauchte“ rechtsstaatliche Formalitäten zu beseitigen, und daß verantwortliche Mitglieder der Gesellschaft das rechtschaffene Selbstverständnis vor sich hertragen sollten, daß, wer anständig ist, nichts zu verbergen hat. Auf diese Quintessenz laufen am Ende auch die so lebensfremd scheinenden Debatten hinaus, ob – nach allen bereits bestehenden – noch eine zusätzliche Erlaubnis zum Lauschangriff in der StPO dem „Wesensgehalt“ des Artikel 13 GG endgültig den Garaus macht oder eine noch geheimere als die bisherige Staatspolizei die Freiheit gefährdet.[3]
Tatsächlich wird die Freiheit, die sich die demokratischen Führer künftig gegenüber der Gesellschaft zu nehmen gedenken, umdefiniert. Dafür sind sie schließlich auch gewählt worden; und die Ankündigung, genau dies zu tun, war nicht das schlechteste Wahlkampf-„Argument“.
Doppelte Säuberung der Volksgemeinschaft
Neue Straf- und Verfahrensvorschriften stellen klar, wer auf keinen Fall zu der neu gestifteten rechtsstaatlichen Volksgemeinschaft deutscher Nation gehören soll, und wer eigentlich nicht (mehr) recht dazugehört:
Einerseits die selbsternannten Rechtswahrer der aktiven rechtsradikalen Szene, die dem peinlichen und defensiven Mißverständnis aufsitzen, „Auschwitz“ zu einer „Lüge“ erklären zu müssen, um Deutschlands Anspruch auf einen guten Namen in der Welt geltend zu machen.
Die Justiz war bei der Verurteilung von Auschwitz-Leugnern wg. Volksverhetzung lange überaus zurückhaltend, weil vom BGH, nicht von der Gesetzeslage festgelegt war, daß die Leugnung allein noch nicht zur Verurteilung ausreichte. Es mußten vielmehr bei den Vertretern dieser zunächst noch freien Meinung über einen Vorgang der Geschichte erst noch Umstände oder Äußerungen hinzutreten, aus denen sich ein „Zusammenhang“ dieser Auffassung „mit der nationalsozialistischen Rassenideologie“ ergab. Erst dann sollten die Antinazi-Paragraphen, die es ja von früher noch gibt, Anwendung finden.
Der Gesetzgeber hielt dieses Verfahren für unangebracht umständlich und ineffektiv und führte einfach eine Ergänzung des Volksverhetzungs-Tatbestandes ein, der die „Auschwitzlüge“ ohne besondere Auslegungsprobleme unter Strafe stellt.
Die amtierenden Politiker, die das Anliegen, Deutschland solle sich nicht immer öffentlich für die Vergangenheit schämen, längst selber haben und die KZs als „unfaßbares“ Verbrechen Hitlers an Deutschland abgehakt haben wollen, wollten den Auschwitzleugnern also ihre gute Absicht nicht honorieren. Deutschland gründet seine moralische Unangreifbarkeit vor der Welt auf das Eingeständnis von Nazi-Verbrechen und der Distanzierung von ihnen. Die Leugnung dieser geschichtlichen Fakten paßt also nicht zur nationalen Selbstdarstellung, erregt Anstoß und schadet dem deutschen Ansehen in der Welt.
Wegen dieser negativen Wirkung verbieten Kanther & Co diese Meinung. Doch das war nicht der einzige Grund, weshalb sie den Verbreitern der Lüge attestierten, eine „Gefahr für den öffentlichen Frieden“ zu sein. Sie wußten, daß die kleinen faschistischen Konkurrenzparteien die Auschwitzlüge zum Markenzeichen ihrer rechten Gesinnung und ihres konsequenten Nationalismus erkoren haben. Als Fachleute dafür, wie man mit konkurrierenden, also lästigen, Gesinnungen umzugehen hat, befanden die regierenden Demokraten – nachdem sie andere Meinungen weder kritisieren können noch wollen –, daß man mit einem Verbot am wirkungsvollsten rechtes Gedankengut, das als Werbung für die Falschen – die Neonazis – gedacht ist, unattraktiv und unpopulär machen kann. Bis zu fünf Jahren Knast (§ 139 III StGB) kann sich jetzt einfangen, wer das Aushängeschild neonazistischer Gesinnung vor sich herträgt.
Die anderen, die Ausländer, sind im Verbrechensbekämpfungsgesetz 1994 ausgiebig bedacht worden: Wer sich den Zutritt nach Deutschland mit falschen Papieren verschafft, kann jetzt mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren rechnen (§ 92 II AuslG n.F.), wer sich falsche Aufenthaltspapiere besorgt, mit bis zu zwei Jahren (§ 276a StGB n.F.). Wer rechtens eingereist ist, kann leichter ausgewiesen werden, wenn er straffällig wird (§ 47 AuslG n.F.), und wer als „Schleuser“ zur illegalen Einreise verhilft oder einen Ausländer zur „mißbräuchlichen Asylantragsstellung“ „verleitet“, rückt nach der neuen Gesetzgebung in die absolute Spitzengruppe der Schwerstverbrecher auf: Fünf bis zehn Jahre Haft (§§ 92a AuslG n.F., 84 AsylVerfG n.F.). Neben diesen großkalibrigen Strafandrohungen sorgen auf polizeipraktischem Gebiet das neue Polizei- und Fahndungssystem SIS an den Außengrenzen der EU (SIS = Schengener Informationssystem) nebst „mobilen Kontrollen und Sonderfahndungstagen“ durch die Polizei (SZ 28.3.95) und erweiterten Befugnissen des BGS (Personenkontrollrecht, Recht zu Hausdurchsuchungen, Recht zur viertägigen „Ingewahrsamnahme“) für flankierende Maßnahmen.
Eine eisenharte Ausweisungspraxis erfüllt den Buchstaben des Gesetzes mit Leben: Im Bereich der kriminellen Verstöße werden durch die erweiterten Ausweisungsmöglichkeiten Strafprozesse extrem „gestrafft“ und das „Rückfallproblem“ abschließend bewältigt. Zugleich werden damit die eher politisch unliebsamen Fälle miterledigt: Wer als oppositioneller Kurde die deutsch-türkische Freundschaft stört und per Demonstration eine Autobahn bei den deutschen Sponsoren seiner Folterer blockiert, ist seinerseits ein „Gewalttäter“ (CSU-Innenminister Beckstein), der mit einigem demonstrativen Getöse abgeschoben gehört.
Daß die Abschiebung von Kurden in die Türkei, die an der Endlösung der Kurdenfrage arbeitet, rechtsstaatswidrig wäre, kann man den Becksteins nicht vorhalten. Sie haben – unter Beachtung aller parlamentarischen Spielregeln – das neue Recht geschaffen, das ihnen jetzt beim Abschieben „keine Spielräume“ läßt, „weil halt extrem juristisch gearbeitet werden muß“ (Beckstein, SZ 6.4.95). In der Zwickmühle zwischen den „bewegenden Situationen“ (ebd.) der Flüchtlinge, die „die Rechtslage“ erzwingt, und dem Elend, in das diese den bayrischen Sozialstaat stoßen („allein 56000 Bosnier leben in Bayern von der Sozialhilfe“, ebd.), erweist sich ein derart bedrängter Diener des Gesetzes auch schon einmal als besonders skrupulös: Er läßt sich vom türkischen Botschafter „in die Hand versprechen, daß dem Simsek in der Türkei nichts Schlimmes geschehen wird“ (ebd.), und: Wegen der „schwierigen Situation“ wird „nur bis Istanbul oder im äußersten Fall nach Ankara abgeschoben.“ (Beckstein, SZ 23.3.95)
IV. Die Justiz in der rechtsstaatlichen Klimaverschiebung
Die Rechtsprechung verfehlt bei Ausübung ihres Geschäfts bisweilen noch die Erwartungen der neuen Ordnungsfundamentalisten. Manchmal beharrt sie sogar – nicht minder borniert als jene – auf dem staatsdienlichen Funktionalismus ihres Rechtsstandpunktes gegen aktuelle Aufträge der Politik an Recht und Rechtsprechung. Dafür zieht sie sich immer öfter und zunehmend gröbere Urteilsschelte von Seiten derer zu, die vom Standpunkt der staatlichen Durchsetzungsfähigkeit in den Gerichten nicht eine „dritte Gewalt“, sondern die Behinderung der ersten beiden sehen und einen letzten Hort von Libertinage.
Politische Richterschelte
Als das Landgericht Lübeck im September 1994 in einem Urteil eine „geringe Menge“ Haschisch, mit der der Besitz noch straflos bleiben sollte, höher bezifferte, als dies der Leiter der bayerischen CSU-Staatskanzlei für angebracht hielt, vermutete dieser öffentlich einen „irren Richter“ in dem nördlichen Gericht und hielt dem Mann, bei dem es sich wohl – weil irre – nur um einen „linken Richter“ handeln konnte, „Mißbrauch der richterlichen Unabhängigkeit und drogenpolitischen Amoklauf“ vor.
Derlei Störungen häuften sich vor allem im letzten Jahr auf dem Gebiet des Asylverfahrens- und Ausländerrechts, als das Bundesverfassungsgericht, das „in Eilanträgen ertrinkt…, weil es andere Rechtsschutzmöglichkeiten nicht mehr gibt“ (SZ 20.2.95), oft in letzter Minute den Abschiebebehörden in die Quere kam. Auf seiner verbindlichen Auslegungsbefugnis in verfassungsrechtlichen Fragen immer wieder einmal insistierend, fällt vor allem das Bundesverfassungsgericht ab und zu unangenehm durch Äußerungen und Urteile auf, wonach angeblich Rechtsgründe andere als von der Politik vorgesehene „Lösungen“ anstehender Ordnungsprobleme erzwängen. So hat die Präsidentin des Gerichts im Vorfeld einer für dieses Jahr anstehenden Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des in 1993 geänderten Asylrechts den neuen Art 16a GG kritisiert, die Ablehnung des Asylanspruchs bei Einreise aus einem „sicheren Drittstaat oder einem anderen sicheren Herkunftsland“ als „mit einer sehr heißen Nadel genäht“ bezeichnet (SZ 20.2.95) und eine gerichtliche Abänderung der Regelung als möglich angekündigt.
Das staatstragende Zusammenwirken der Politik und der Verfassungsrichter, die über sich „wirklich nur noch den Himmel“ (J. Limbach, Präsidentin des BVerfG) stehen sehen, ist solange harmonisch, wie letztere sich bei der Auslegung von Gesetzen ihren (Werte-)Himmel von den rechtsetzenden Politikern mit gesetzlichen und moralischen „Prüfungsmaßstäben“ ausstatten lassen und diese sinngemäß zur Anwendung bringen. Wo das Gericht aber glaubt – bei aller Gemeinsamkeit in der Sache –, mit rechtlichen Argumenten Korrekturen im Verfahren und – vom Standpunkt der Politik – hinderliche Umwege vorschreiben zu müssen, muß es sich zunehmend politische Kritik und grobe Töne gefallen lassen. Der Gerichtspräsidentin wurde die Warnung zuteil, sie solle mit „ihren Äußerungen vorsichtiger“ sein, wenn sie nicht an einem erneuten Anschwellen des Asylantenstroms schuld sein wolle. Danach habe sich auch die kommende Entscheidung zum Asylrecht zu richten. (Rupert Scholz, CDU)
Die Herausnahme von Sitzblockaden aus dem Nötigungs-Tatbestand durch Eingrenzung des zunehmend „vergeistigten(!) Tatbestandsmerkmals Gewalt“ (Urteilsbegründung des BVerfG), die dem Bürger dem „Bestimmtheitserfordernis“ des GG entsprechend wieder besser „voraussehbar“ machen soll, „welches Verhalten mit Strafe bedroht ist“, wird als „Niederlage für den Rechtsstaat“ kommentiert (ein CDU-Sprecher), die ihm – dem Rechtsstaat – immerhin sein höchstes Gericht beigebracht haben soll. Regierungspolitiker halten das Abrücken von der bisherigen Rechtsprechung, die bis zum Bundesgerichtshof bestätigt wurde, für ein „falsches Signal“, weil durch den Wegfall des Tatbestandes der Nötigung ihnen eine strafrechtliche Handhabe gegen unliebsame Demonstranten verloren geht. Wenn das BVerfG der bisherigen Strafverfolgungspraxis den Boden entzieht, dann – so der Schluß der regierenden Ordnungsfanatiker – muß die Legislative eben wieder Klarheit stiften, was sich gehört und was nicht. Um die „Strafbarkeitslücke“ (Geis, CDU, SZ 5.5.95) zu schließen, sind die regierenden Christen entschlossen, das StGB zu ergänzen: Die Bürger sollen die Sicherheit haben, daß sie sich mit störendem Herumsitzen auf öffentlichen Straßen eine saftige Geldstrafe oder Knast einhandeln.
Die massivste Reaktion hatte ein Beschluß des BVerfG vom 25.8.94 zur Folge: Ein Verfassungs-„Beschwerdeführer“ wollte sich gegen seine Verurteilung durch die Strafgerichte wg. Beleidigung der Soldaten unserer Bundeswehr und Volksverhetzung vom Verfassungsgericht die Freiheit zur Äußerung seiner ebenso grundverkehrten wie hochmoralischen Auffassung bestätigen lassen, daß Soldaten „Mörder“ seien. Bei Würdigung des mittels Autoaufkleber verwendeten einschlägigen Tucholsky-Zitates ging es dem Gericht – ebensowenig wie dem Beschwerdeführer – darum, ob der Spruch zutrifft, sondern ob man ihn äußern darf, er also von Art 5 I GG „gedeckt“ ist; ob also in diesem Fall die Meinungsfreiheit hinter den Persönlichkeitsrechten der Soldaten, wozu deren „Ehre“ zählt, zurückstehen muß.
Die Frage – wenn sie gestellt worden wäre –, ob Soldaten Mörder im Sinne des § 211 StGB sind, wäre für jedes juristische Erstsemester mit einem Blick ins Gesetz erledigt: Soldaten töten nicht aus „niedrigen Beweggründen“, sondern aus den vornehmsten aller in Frage kommenden Motiven, zu denen der Fortbestand der Nation, ihre „Sicherheit“ und „Interessen“ ebenso zählen wie ihr schönes Grundgesetz. Sie tun es auch nicht „heimtückisch“, sondern in der Regel mit Ansage und vor allem auf Befehl, wenn auch manchmal unbestreitbar – so ist der Krieg – „grausam und mit gefährlichen Mitteln“ (§ 211 StGB); was aber durch die guten Gründe mehr als aufgewogen wird. Deshalb ist soldatischer Auftrag und Dienst nicht nur fester Bestandteil unserer Rechtsordnung, sondern der Soldat – kraft dieses höchsten Auftrags – ein Mann von Ehre.
Und das bekam der Beschwerdeführer in früheren Instanzen zu spüren. Seinen kritischen Moralismus mochten die Strafgerichte dem pazifistischen Gewissenswurm nicht durchgehen lasen. Sie hatten erkannt, daß die Schutzbedürftigkeit deutscher Soldatenehre eher zunimmt in Zeiten, in denen der Beitrag deutscher Landser „zur Friedenssicherung in aller Welt“ (Lorenz, Neue Justiz 1994, 561) gefragter ist denn je. Die Strafgerichte wollten den Tucholsky-Aufkleber „ausschließlich im juristischen Sinne gedeutet“ (BVerfG) wissen und kamen deshalb dazu, dem Beschwerdeführer vorzuhalten, er beschuldige in beleidigender Weise „Bundeswehrsoldaten der Begehung von Mordtaten“ (BVerfG), was hierzulande keiner darf.
Das Bundesverfassungsgericht beging demgegenüber den Fehler, an seiner „gefestigten Rechtsprechung“ weiterzustricken, wonach man „geschützt“ von der Meinungsfreiheit gerade noch solange meinungsäußern dürfe, wie auch eine nicht strafbare Deutung der Äußerung möglich sei. Es nahm den „nur“ moralischen und nicht juristischen Gehalt des Zitats und die „umgangssprachliche Verwendung des Begriffs Mörder“ zur Kenntnis und gestand großzügig eine „Deutungsmöglichkeit“ zu, wonach ein „allgemeines Mißbilligen von Tötungshandlungen“ und zwar „aller Armeen der Welt“ gemeint gewesen sein konnte. Und ließ, weil man sich sowas bei uns straffrei wünschen darf, bei der „Güterabwägung“ zwischen Soldatenehre und freiem Meinen den Art 5 I GG um nur eine Nasenlänge siegen! Vorläufig jedenfalls, denn der Casus wurde an die „Fachgerichte“ zur erneuten Beurteilung unter Berücksichtigung der Auffassung des BVerfG zurückverwiesen.
Diesmal ließen es Politik und Öffentlichkeit nicht beim höflichen Bedauern über das wieder einmal offenkundige Auseinanderfallen von moralisch Gebotenem und rechtlich Erlaubtem bewenden. Vielmehr wurde ein Sturm der Entrüstung inszeniert, wie er in seiner Grobheit und Respektlosigkeit gegenüber dem höchsten deutschen Gericht bis dato beispiellos war: Der Spruch soll ein „Skandal“ (Rühe, CDU), wahlweise ein „Skandalurteil“ (Genscher, FDP) gewesen sein, über das man „bestürzt“ (Kinkel, FDP) war, weil es „unverantwortlich“ und „eine Schande für die deutsche Justiz“ (CDU-Verteidigungsexperte) und in seiner „Wirkung negativ auf die Soldaten“ (Klose, SPD) gewesen sein soll; was auch die Deutsche Bischofskonferenz befürchtet und mit ihr „Millionen Deutsche“, Kohl als Kanzler und „Vater von zwei Söhnen“ sowie „meine Frau und Millionen anderer Eltern“ (Kohl).
Der Bundestag kam – unerhört bislang – wegen des Urteils zu einer Sondersitzung zusammen, um die Soldatenehre in Schutz zu nehmen und das Gericht mit „wüsten Tiraden und fast schon hetzerischen Interpretationen“ (SZ 19.1.95) in seine Schranken zu weisen. Der Verteidigungsminister ließ sogar einen Zweisterne-General von der Leine, der dem Gericht klarmachen durfte, daß seiner Meinung nach der Vergleich von Soldaten mit Mördern „so absurd und ehrabschneidend sei, wie ein Vergleich des Bundesverfassungsgerichts mit dem Volksgerichtshof“ (SZ 15.1.95). Weil er den umgekehrten, vom Gericht angenommenen Fall der Zulässigkeit des einen Vergleichs – und damit auch des anderen – nicht aussprach, hielt man das für „sprachlich geschickt“, nur eine „mittelbare Beschimpfung der Karlsruher Richter“ (FDP-Wehrexperte) und keine disziplinarische Bestrafung durch den Verteidigungsminister für angebracht, sondern viel „Verständnis“ für den ehrverletzten Troupier.
Der deutsche Richterbund sah in dem Aufruhr ein Stück „Demontage der Justiz“ und eine „Gefahr für die richterliche Unabhängigkeit“ (SZ 2.1.95). Genau die ist es, die die Regisseure und Akteure dieser rechtskritischen nationalistischen Wallung so stört, wenn sie dazu führt, daß Gerichte – borniert vom Stand irgendeiner „gesicherten Rechtsprechung“ – jede Sensibilität für nationale Anstandsbedürfnisse vermissen lassen. Der öffentliche Aufstand zur Rettung der Ehre des deutschen Soldaten und seines Auftrags ist eine Erinnerung daran, daß das Recht und die Unabhängigkeit der Gerichte in einem Dienstverhältnis zur Gewalt stehen, das in seiner derzeitigen Ausgestaltung nicht unkündbar ist.[4]
Was den Inhalt der geschuldeten und geforderten Leistung der Justiz betrifft, gibt die öffentliche Moral unter Anleitung der Parteien sachdienliche Hinweise. Zusätzlich wird, weil man auf die Nachhaltigkeit der dem Gericht erteilten Lektion nicht vertrauen mag, die Ergänzung der Beleidigungsparagraphen um einen speziellen Ehrenschutz für Soldaten der Bundeswehr betrieben.
Die Lernfähigkeit der Justiz – gemeinsam gegen rechts
Als die freischaffenden Totschläger und Brandstifter damit begannen, sich des von den Politikern aufgebrachten Problems der „Asylantenschwemme“ eigenhändig anzunehmen, wurden sie von den Regierenden gerne als Beweis dafür zitiert, wie dringlich Deutschland ein neues Asylrecht braucht. In dieser Phase konnte man als Skin noch einen Neger aus der Trambahn werfen und mit fahrlässiger Tötung davonkommen; für versuchte schwere Brandstiftung an einem Asylbewerberheim gab es eine Bewährungsstrafe (vgl. z.B. SZ 30.10.93 und 24.11.93). Aktive Jungbürger, die sich von den offiziellen Klagen, daß „das sozial verträgliche Maß von Ausländern“ überschritten sei, anstiften ließen, mit Sprechchören vor Ausländerheimen dieser nationalen Not Ausdruck zu verleihen, wurden sogar kürzlich noch vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen, weil sie ja nur die „verbale Kurzform für das, was viele Bundesdeutsche meinen“, geäußert hatten (Landgericht Paderborn, SZ 22.3.95).
Diese Urteile waren dem deutschen Ansehen im Ausland nicht unbedingt förderlich. Nachdem der demokratische Staat das Ausländer- und Asyl-„Problem“ auf gesetzgeberischem Weg nun auch erfolgreich gelöst hat, sind die faschistischen Aufwallungen der Volksseele völlig überflüssig und eher lästig. Leute, die ihr Anliegen, Deutschland vor dem Ansturm fremdländischer Horden zu retten, durch die amtierenden Führer nicht ausreichend erledigt sehen, ihnen sogar Kompetenz und Willen zur Organisierung der fälligen faschistischen Programme absprechen und an der eigenen politischen Berechtigung zum Rechtsbruch festhalten, werden nun zunehmend als Staats- und Rechtsfeinde entdeckt und beurteilt: Im Urteil des OLG Schleswig über den Brandanschlag in Mölln wurde den Tätern als Irrtum bescheinigt, sie wären „die radikale Spitze einer breiten Bewegung“. Nach „vielen anderen, verharmlosenden Urteilen“ stellen die Schleswiger Richter klar,
„daß jeder, der ein Haus anzündet, in dem Menschen wohnen oder gar schlafen, mit dem Schlimmsten rechnen muß und als Mörder zu behandeln ist…“ (SZ 9.12.93)
Wenn die Führer der Nation den Beweis nicht schuldig geblieben sind, daß Demokraten in Sachen Nationalismus auch von Faschisten keine Belehrungen brauchen und keine Konkurrenz dulden, steht ein Richter wie der famose Orlet aus Mannheim dumm da. Er wollte ums Verrecken keine Rechtsgründe finden, dem NPD-Mann Deckert die von der demokratischen Öffentlichkeit geforderte „saftige Freiheitsstrafe“ (SZ 22.4.94) für die Leugnung der Judenvernichtung zu verabreichen. (Das Strafmaß von einem Jahr auf Bewährung wurde im übrigen in der ersten Revision nicht beanstandet.) Im Gegenteil, als bekennender „rechtskonservativer Antikommunist“ (Orlet über sich) hatte er Verständnis und hielt es mit der Rechtsordnung für vereinbar und sympathisch, wenn Deutschland, von Juden unter Berufung auf den Holocaust – seiner treudeutschen Meinung nach – über Gebühr in Anspruch genommen, von Männern wie Deckert verteidigt wurde.
Hätte er das milde Urteil allein auf eine „Lücke“ in der Strafbarkeit gestützt, hätte er sich in guter Gesellschaft der sonstigen Rechtsprechung befunden, die „seit 15 Jahren so urteilt“ (SZ 19.3.94), und wäre kaum aufgefallen. Wenn aber gerade der Bundespräsident zum „Kampf gegen Neonazis aufruft“ (SZ 26.5.94), Kanther „den Kampf gegen die Neonazis verstärken“ (SZ 28.5.94) will und die bayerische Staatspartei, die rechts von sich keine Konkurrenz dulden will, die Verfassungsfeindlichkeit der Reps entdeckt, ist das nicht die Zeit, in der ein Richter in und außerhalb einer Urteilsbegründung den Funktionär einer abzuservierenden Partei als „sympathischen Mann mit festen Grundsätzen“ und möglichen „Freund“ bezeichnen darf.
Der gute Mann, den seine eigenen festen faschistischen Grundsätze bislang nie an der Berufsausübung gehindert haben, sah sich – nach seiner Auffassung – der Forderung nach „einem politischen Prozeß“ gegen Deckert ausgesetzt und war dazu „nicht bereit“. Damit war er jedenfalls für die deutsche Öffentlichkeit als Richter, von dem „durchaus höhere Verfassungstreue als vom einfachen Bürger“ (GG-Kommentar Dürig/Herzog) und damit auch die Rücksichtnahme auf den guten Ruf der Nation verlangt werden können, untragbar. Die erste „Richteranklage“ in der Geschichte der BRD ist da einfach fällig und nur durch die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand zu verhindern.
Gemeinsam gegen links – die Verwandlung der DDR in bundesdeutsches Unrecht
Kaum Klagen gab es von politischer und öffentlicher Seite über die zuverlässige Bewältigung der DDR-Vergangenheit durch die siegreiche West-Justiz. Die hat hierzu auch keinen Anlaß gegeben, sondern ist manchmal sogar zu (rechts-)historischer Hochform aufgelaufen, wenn es darum ging, dem Rechtsstaat justiziellen Zugriff auf Mauerbauer und Mauerschützen, Agenten (Ost) und staatstreue Richter zu verschaffen.
Die Mauerschützen-Urteile des BGH setzen Maßstäbe bei der Übertragung von politischer Feindschaft in strafrechtliche Urteilsbegründungen. Die Gerichte hatten die Frage zu beantworten, ob Träger von DDR-Staatsfunktionen damit rechnen können, daß die damalige Rechtmäßigkeit ihres Handelns nach DDR-Recht heute vor Strafe schützt.
DDR-Grenzer, von Amts wegen Außenposten an den Rändern des untergegangenen Reiches des Bösen, bekommen wegen ihres Schußwaffengebrauchs an der Grenze den Bescheid, daß ihnen nach heute geltenden Maßstäben die realsozialistische Gesetzeslage nicht als „Rechtfertigungsgrund“ – d.h. als Grund, der die Rechtswidrigkeit des Handelns ausschließt – dienen kann. Diese Soldaten sind also Mörder. Zu dieser Rechtsfindung kommen die West-Richter über einige „zwar“s und ein „aber“.
Zwar könne man – so der BGH (z.B. NJW 1993, 141) – das DDR-Grenzgesetz so auslegen, „daß das Ziel, Grenzverletzungen zu vermeiden, im Konfliktfall Vorrang vor der Schonung menschlichen Lebens hatte“;
zwar „schloß die Befehlslage zur Vereitelung der Flucht auch die bewußte Tötung des Flüchtenden ein“;
zwar „entsprach das Verhalten der Angeklagten der rechtfertigenden Vorschrift des § 27 II DDR-GrenzG, so wie sie in der Staatspraxis angewandt wurde.“
Aber: Für den BGH stellt sich der Schutz der DDR-Grenze nach dem Grenzgesetz (Ost) als „extremer Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip“ dar, weshalb das DDR-Recht – ausnahmsweise – „wegen Verstoß gegen höherrangiges Recht“ als Rechtfertigungsgrund „unbeachtet“ bleibt. Der bewaffnete Schutz der Grenze durch die DDR ist ein so schwerwiegender
„Verstoß gegen Grundgedanken der Gerechtigkeit und Menschlichkeit“, der „die allen Völkern gemeinsamen, auf Wert und Würde des Menschen bezogenen Rechtsüberzeugungen verletzt“,
daß das „positive Gesetz“ der DDR, das als Rechtfertigungsgrund hätte dienen können, als „unrichtiges Recht der Gerechtigkeit weichen“ muß, die Bestrafung fordert.Dieser souveräne Befreiungsschlag der Bundesrichter stellt das richtige Ergebnis gegen das „unrichtige Recht“ des alten Feind-Systems sicher und führt vor, daß das Verhältnis von Recht und Moral eben eine Frage staatlicher Entscheidungsgewalt ist: Wenn die siegreiche Macht sich entschließt, ihre – auch ungeschriebenen – moralischen Maßstäbe praktisch als „höherrangiges Recht“ zur Geltung zu bringen – da werden nur Titel der obersten Güteklasse ins Feld geführt –, dann kann das widersprechende geschriebene, aber machtlos gewordene DDR-Recht seine ehemaligen Diener nicht mehr schützen.
Das „Problem“ des grundgesetzlichen „Rückwirkungsverbots“ des Art 103 Abs.2 GG wird mit ähnlich brachialer Eleganz gelöst: Nach dieser Verfassungsbestimmung kann eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit zur Tatzeit „gesetzlich bestimmt“ war. „Bleibt also ein früher vorgesehener Rechtfertigungsgrund“ – wie das DDR-Recht – „außer Betracht, so wird das frühere Recht zum Nachteil des Angeklagten verändert“ (BGH), was nach Art 103 Abs. 2 unzulässig wäre. Davon läßt sich der BGH aber nicht beeindrucken: Er gräbt in seinen Urteilen zahlreiche Pakte und völkerrechtliche Verträge aus, mit denen die DDR sich selbst zu Lebzeiten die Achtung der Menschenrechte auferlegt hatte, einschließlich der Ausreisefreiheit, eingeschränkt nur durch den „Schutz der nationalen Sicherheit und öffentlichen Ordnung“ (Erklärung der DDR von 1977 an die UNO zum „Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“, IPBPR). Wenn die DDR sich aber selbst auf diese Prinzipien verpflichtet hatte, so der BGH, dann hatte das DDR-Grenzgesetz von Anfang an, also auch schon zu DDR-Zeiten „als Rechtfertigungsgrund für den Schußwaffengebrauch keine Wirksamkeit.“ Die DDR hatte also durch ihren politischen Kampf um internationale Anerkennung und der damit verbundenen Selbstverpflichtung auf die Menschenrechts-Politik des Westens nach dieser Auslegung des BGH ihr eigenes Grenzgesetz quasi außer Kraft gesetzt. Ein später, aber umso vollständigerer Sieg der „Menschenrechts-Waffe“.
Wenn man also, so das Ergebnis der Bundesrichter, die Strafbarkeit
„nicht im Sinne reiner Faktizität an diejenige Interpretation“ bindet, „die zur Tatzeit in der Staatspraxis Ausdruck gefunden hat“, sondern „wie sie der völkerrechtlichen Bindung der DDR im Hinblick auf die Menschenrechte entsprochen“
hätte, dann hätte die DDR also eigentlich schon selber ihre eigenen Grenzer, die Macher des Grenzgesetzes und letztlich sich selbst ins Gefängnis stecken müssen. (Was den Anschluß natürlich sehr beschleunigt hätte!) Denn nach „dem richtig interpretierten Gesetz“ (BGH) hätte dem Grenzgesetz schon damals kein Rechtfertigungsgrund entnommen werden dürfen. In anderen Worten: Die „Strafbarkeit“ war also – bei „richtiger Interpretation des Gesetzes“ (BGH) – schon damals „bestimmt“, wie es Art 103 Abs.2 GG für die Straferlaubnis heute verlangt. – Was zu beweisen war.
In geschlossener nationaler Formation stehen Politik und Öffentlichkeit hinter den Gerichten, weisen eine – von niemandem im Lande ernsthaft geforderte – Amnestie entschieden zurück, schmettern Vorwürfe des Europäischen Parlaments ab, die „juristische Verfolgung des DDR-Unrechts“ sei eine „Menschenrechtsverletzung“, („… vielmehr ein achtbarer Versuch, die Menschenrechte zu stärken“, Prantl, SZ 10.1.95) und verhindern so, daß durch die Straffreiheit der alten Feinde „Unrecht in noch größerem Maße entstehen kann“ (Kohl, SZ 9.1.95).
Immerhin hat die Republik in dieser Hinsicht bei der juristischen Aufarbeitung der Naziära schon einige Erfahrungen gesammelt. Mit sicherem Gespür für die Anwendung der komplizierten Verjährungsregeln, die „dem Rechtsfrieden“ dienen sollen, setzt sich der BGH kompromißlos für diesen ein: Daß dem Rechtsfrieden durch den Freispruch für den Wehrmachtsleutnant Lehnigk-Emden für sein Massaker an italienischen Frauen und Kindern wg. Verjährung und durch die Verurteilung von Erich Mielke für seine angeblichen Polizistenmorde, noch 12 Jahre früher, wg. Nicht-Verjährung in differenzierter Weise gedient ist, steht für den BGH außer Zweifel. Und damit liegt er wohl auch richtig, wenn er mit solchem Unterscheidungsvermögen trotz einiger kritischer Töne letztlich auch die liberalsten Exponenten der Öffentlichkeit zufriedenstellt: Wenn der BGH schon mit „schlechten Gründen“ den militärischen Schlächter freispricht, kann man doch froh sein, wenn er wenigstens „gute Gründe“ für eine Verurteilung Mielkes gefunden hat (H. Prantl in der SZ).
Auch ehemalige Spionageoffiziere des MfS können sich nicht auf irgendwelche Rechte berufen:
- Nicht auf Art 3 I GG (Gleichheitsgrundsatz). Wenn sie bestraft werden, westliche Agenten aber nicht, dann ist das nicht „willkürlich“, sondern wegen der bestehenden „erheblichen Unterschiede zwischen Angehörigen des BND und Angehörigen des MfS (Ministerium für Staatssicherheit, vulgo: Stasi), die Auslandsaufklärung betrieben“ (BGH NJW 1993, 1406ff) wohlbegründet: „Während der BND ausschließlich Auslandsaufklärung betreibt“, war die HVA (Hauptverwaltung Aufklärung) ein Teil des MfS, welches „der entscheidende Machtapparat in der ehemaligen DDR“ war. Der Unterschied leuchtet doch ein: Westspione im BND sind Teil eines Machtapparats, Ostspione in der HVA/MfS des Machtapparates. Oder noch einfacher: des falschen „Machtapparates“.
- Nicht auf das „Rückwirkungsverbotes“ des Art 103 Abs.2 GG (s. oben): Die Strafbarkeit der Spionage gegen die BRD war nämlich schon zur Tatzeit bestimmt, wie der Art 103 GG es fordert; natürlich nicht nach DDR-Recht, aber nach § 99 StGB-West!
- Und nicht auf den „Grundsatz des Vertrauensschutzes als Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips (Art 20 III GG)“: „Das Volk der DDR“ hat nämlich schon „den MfS-Offizieren den Schutz des SED-Staates entzogen…“ (Bundesanwalt Lampe) „mit dem Rufen ‚das Volk sind wir‘ und ‚Stasi in die Produktion‘“, weshalb Angehörige des MfS „billigerweise nicht davon ausgehen konnten, von Strafe freigestellt zu werden“ (BGH). – Rechtsgeschichtlich einmalig schafft ein Volk, auf der Suche nach einer neuen Obrigkeit, durch Demonstrationsparolen bindendes Recht für die neuen Herren! Wiederholungen dürften ausgeschlossen sein.
Richter und andere Justizangehörige der ehemaligen DDR, die darauf setzen, bei der rückwirkenden Verwandlung des DDR-Rechts in bundesrepublikanischen Rechtsbruch so gut wegzukommen wie ihre Kollegen aus der Zeit des Faschismus, werden enttäuscht. Die aufgezwungene Selbstprüfung der deutschen Justiz nach der großen Niederlage führte in der BRD zu keiner einzigen Verurteilung. Das kommt bei der Überprüfung der Ostrichter durch den Westen nicht in Frage. Der dauernd bemühte Vergleich zwischen Nationalsozialismus und DDR-Regime beabsichtigt keine Gleichsetzung, sondern ein Gerichtsitzen über die ehemaligen Zonenfunktionäre – weswegen sich auch noch kein DDR-Landgerichtsrat als Ministerpräsident wiedergefunden hat.
Laut BGH sollen die Justizangehörigen der Zone nicht strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie sich an das Recht der DDR gehalten haben, ohne „Überdehnung“, „Willkürakte“, „Menschenrechts-Verstöße“ oder „Einzel-Exzesse“ (BGH 13.12.93, zit n. HB 7.2.94). Das aber ist ein weites Feld und wird geprüft von der Justiz des Siegers. Die hat sich mit ihren „Ausnahme-Tatbeständen“ alles offengehalten und macht eifrig davon Gebrauch, um wirklichen und mutmaßlichen Aktivisten des ehemaligen Justizdienstes Ost ihre „perverse Gerechtigkeitsidee“ (HB a.a.O.) auszutreiben.
Das alte „Richterprivileg“, das der BGH für die rechtliche Beurteilung von Nazi-Richtern erfunden hatte, kommt ihnen nicht zugute. Danach
„konnte ein NS-Richter nur noch dann bestraft werden, wenn er mit ‚bestimmtem Vorsatz‘, also wider besseres Wissen geurteilt hatte. Demnach genügte es fortan, wenn die NS-Richter behaupteten, sie hätten es nicht besser gewußt und ihre Urteile eben für Rechtens gehalten. So entgingen sogar die Beisitzer Freislers der Strafe.“ (SZ 1./2.4.95)
In Anbetracht des Umstandes, daß sich die Tätigkeit von Richtern auch auf dem Gebiet der Strafrechtspflege vor, während und nach der Zeit des Faschismus nicht so übermäßig unterschied – da war stets die Nation und ihre Rechtsordnung in jeweils gültiger Fassung gegen kriminelle und politische (d.h. zu allen Zeiten v.a. kommunistische) Anfechtungen zu schützen –, hatten die Nachkriegs-Kollegen stets größtes Verständnis für die Unmerklichkeit von – aus heutiger Sicht – gewissen Verirrungen ihrer Vorgänger. Wie soll auch ein Jurist Recht von Unrecht unterscheiden können, wenn beides in Gesetzesform, und sei es nur als Führerbefehl, daherkommt und ganz seinen Gerechtigkeitsvorstellungen entspricht.
Diese – objektiv unmögliche – Unterscheidungsleistung wird gerechterweise nur von denen verlangt, die sich in den Dienst dieser Anfechtung gestellt haben, als Anwender der „perversen Rechtsidee“ der – in den Augen ihrer heutigen Richter – staatgewordenen Staatsfeindschaft in der DDR. Die hätten, vom Justizangehörigen bis zum einfachen Grenzsoldaten, „trotz politischer Indoktrination“ einfach in sich hineinhören können und müssen, um „den Kernbereich der Ethik“ (BGH) auch gegen das gesetzlich Gebotene erkennen zu können.
Zeitgemäße Initiativen im Polizeidienst
Der beste Rechtsstaat wäre nichts ohne Exekutoren, die die Geltung des Gesetzes zur Not auch mit „roher“ Gewalt durchsetzen. Die Polizei, die dazu da ist, „repressiv“ und „präventiv“ für die innere Ordnung der Nation zu sorgen, beweist auch gerade angesichts der gehobenen Ansprüche auf Geltung von law & order, daß auf sie Verlaß ist. Ihr Auftreten zeichnet sich nicht durch sklavisches Befolgen von Dienstvorschriften aus, sondern ist vom Geist beseelt, Deutschland vor Schmarotzertum, Mißbrauch und Rechtsbruch zu schützen.
Polizisten haben von Berufs wegen ein Gemüt, das im alltäglichen Leben lauter Disziplinlosigkeit und mangelnde Aufsicht entdeckt. Das Pochen auf die eigene Amtsautorität und die Befugnis, die Mitmenschen zur Räson bringen zu können, weiß sich – im Normalfall zumindest – jedoch an die Schranken, die das Polizeiaufgabengesetz zieht, gebunden. Daß der Gesetzgeber mit diesen „lebensfremden“ Regelungen das Ordnungsstiften unnötig erschwert, hält man sich in diesem Berufsstand allerdings als feste Meinung. Gelegentlich hört man auch von praktischen Konsequenzen, die aus dieser Ansicht resultieren.
Heutzutage findet der Ordnungshüter allerdings eine Lage vor, in der die öffentliche Moral Deutschland als einen Sumpf von Unzuverlässigkeit, Unsicherheit und (organisierter) Kriminalität vorstellig macht. Vor allem aber sei dieses Land zu einem Tummelplatz für Leute geworden, die hier gar nichts zu suchen haben: Ausländer, die sich unsere Sozialhilfe erschleichen, als Schwarzarbeiter den Deutschen die Arbeitsplätze stehlen, Drogen dealen und Schulkinder süchtig machen, ihre Bürgerkriege bei uns austragen, also dafür sorgen, daß man sich als Deutscher im eigenen Land nicht mehr sicher fühlen kann. Daß inzwischen als Delinquenten Verdächtigte und insbesondere Ausländer in Deutschland nicht mehr allzu viele Rechte haben, ist den Streife-gehenden Beamten natürlich auch nicht entgangen. Das Bewußtsein, bei Asylanten und sonstigen Negern lauter minderwertiges und rechtloses Gesocks – „Kanakenflut“ (Polizistenspruch, SZ 15.9.94) – vor sich zu haben, führt dazu, daß sich die Fälle häufen, in denen Polizisten ihre Amtsbefugnisse zugunsten privater und gemeinschaftlicher Strafaktionen an ihren Klienten überschreiten.
In Hamburg und Magdeburg, Kiel, Leipzig, Hannoversch Münden, Gießen, Berlin, Brandenburg, Bernau, Biesenthal, Soltau haben – nach einem unvollständigen Zeitungsüberblick – Polizisten Ausländer geprügelt, getreten, mit Tränengas und Desinfektionsmitteln „behandelt“, Kotzmittel verabreicht und eine „Scheinhinrichtung“ inszeniert. Bei der Magdeburger Ausländerjagd im vorigen Jahr wurden die faschistischen Schläger nach zahlreichen Zeugenaussagen von Polizisten ermuntert, zum Teil bezogen Ausländer nach Zeitungsberichten (SZ 8.6. und 21.5.94) von der Polizei zusätzliche Prügel.
Obwohl im Fall des Landfriedensbruches, um einen solchen handelte es sich strafrechtlich bei der Magdeburger Ausländerhatz, eine einzige Gewalttätigkeit aus einer Menschenmenge heraus genügte, die mit vereinten Kräften begangen wurde, um jeden Teilnehmer mit Gefängnis bis zu drei Jahren zu bestrafen, konnte die Staatsanwaltschaft nach stundenlangen Ausschreitungen keinen einzigen Polizeibeamten mit einer hinreichend klaren Zeugenaussage finden.
Das spricht nicht, wie die Süddeutsche Zeitung vermutete, für den „sträflichen Unernst“ der staatlichen Reaktion (SZ 16.5.94). Schon eher dafür, daß Polizei und Justiz ihre eigenen Maßstäbe sehr ernst nehmen: Erstens ist der Landfriedensbruch für linke, also staatsfeindliche und nicht für staatsfreundliche „Störer“ so verschärft worden; und zweitens stehen sich – die Strafverfolgungsbehörden reihen sich da ein – die Schläger mit und ohne Uniform betreffs Sichtweise und Lösungsvorschlägen für das Ausländerproblem allemal recht nahe. Da stellen sich die Ordnungshüter doch lieber auf die Seite derer, die das Problem angehen, als derer, die das Problem sind.
Daß polizeiliche „Übergriffe“ oder demonstratives Nicht-Eingreifen in den einschlägigen Kreisen als im Prinzip zumindest verständlich gewertet wird, beweist sowohl das Zusammenhalten der Kollegen (Korpsgeist) als auch der mäßige Klärungseifer bei der Polizeiführung (und den Staatsanwaltschaften), die – wie im Fall Hamburg – seit Jahren die rassistischen Schläger kannte und auf Diskretion hielt (SZ 6.3.95), bis ein „Nestbeschmutzer“ plauderte. Auch die mit diesen Fällen befaßten Gerichte zeigen Mitgefühl: „Der Frust“ der „immer wieder herausgeforderten Polizei“ kann nämlich „auf Grund ihrer Ohnmacht“ gegen einen „provokativen und hochgradig dickfelligen“ (Landgericht Lüneburg, SZ 23.7.94) ausländischen Dieb und Asylbewerber z.B. zu einer Abreibung für den gefesselten Delinquenten im Wald führen – und zu Strafmilderung für die Polizisten.
*
Die vielfältigen Gesetzesreformen, die geänderten Richtlinien der Rechtsprechung und die öffentliche Begutachtung der neuen Rechtsentwicklung dokumentieren nichts weniger als eine Verschiebung des bisher gewohnten Verhältnisses von Recht und Moral in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Eigentlich wissen Demokraten ja trotz aller Idealisierungen des Rechts um die Differenz von sittlichen Geboten, denen jedermann, sei er Kanzler oder einfacher Mann des Volkes, ideell verpflichtet ist, und rechtlichen Bestimmungen, die das Zusammenleben funktionell regeln, ihm aber nicht lauter moralische Prinzipien vorschreiben sollen. Der Rechtsstaat hält sich sogar zugute, daß das Recht positiv
sei, womit gemeint ist, daß es nicht dem sittlichen Maßstab von gut und böse gehorcht, sondern das in einer bestimmten Gesellschaft Erlaubte und Verbotene regelt, das manches einschließt, was moralisch nicht gebilligt ist. Jetzt wird dieses Recht von den politischen Machern am unbefriedigten Standpunkt staatsgenehmer Moral gemessen, für unzulänglich befunden und korrigiert. Die öffentlichen Moralgrundsätze sind nicht mehr bloße Begleiterscheinung des Rechts, eben die ideellen Prinzipien, mit denen die Staatsmacht die Legitimität ihrer Regelungen begründet und der Bürger sich das staatliche Gesetzeswerk und seine Ausführung als Dienst an seinen Gerechtigkeitsbedürfnissen einleuchten läßt. Die verantwortlichen Betreiber des Rechts befinden, daß der Buchstabe des Gesetzes mit ihrem Geist nicht mehr in Einklang sei. Sie machen sich anheischig, die Differenz nicht gelten zu lassen und der Moral umfassenden Eingang ins Recht zu verschaffen – und zwar wie sie sie verstehen: Oberstes Gebot ist es, eine verläßliche staatsdienliche Ordnung zu stiften und für eine reibungslose staatsbürgerliche Ein- und Unterordnung unter das Allgemeine zu sorgen. Der bisher anerkannte staatsdienliche Funktionalismus der rechtsstaatlichen Verfahrensweisen wird damit gründlich in Zweifel gezogen. Als Zuständige, die mit den nationalen Erfolgen unzufrieden sind und das auf die mangelnde Kontrolle des Staates über die von ihm selber eingerichteten gesellschaftlichen Verhältnisse zurückführen, bekunden die obersten Instanzen ihr umfassendes Mißtrauen in die Zuverlässigkeit der Bürger und ihre rechtlich festgelegten Weisen der Interessensverfolgung. Also wird an sie in rechtlich positiver Form der Gesichtspunkt angelegt, daß sie ganz anders, verbindlicher als bisher zur nationalen Pflichterfüllung angehalten werden müßten. Was sowieso der Inhalt des Kanons von Geboten und Verboten ist, der die Freiheit des Bürgers ausmacht – die Festlegung auf nützliche Dienste an der Herrschaft –, wird jetzt offiziell zu ihrem „eigentlichen Wesensgehalt“ erklärt, gegen die „Gesetzeswirklichkeit“ gewendet und als neues rechtsstaatliches Kritik- und Mißtrauenswesen am Bürger institutionalisiert.
Hochoffiziell wird damit die in der Nachkriegsdemokratie übliche Sozialkundeweisheit über die Segnungen des Rechtsstaats dementiert und folgerichtig aus dem Verkehr gezogen. Die moralische Rechtskritik vom Standpunkt des Bürgers, der auf seine Rechte pocht und entsprechende Gerechtigkeit verlangt, ist darüber weitgehend ausgestorben. Es wird vornehmlich darüber geklagt, daß der Staat zu wenig Gebrauch vom Recht macht, um der Unmoral Einhalt zu gebieten, andere in die Schranken zu weisen und Ordnung zu stiften. So stellen sich die Rechtssubjekte mit ihren Maßstäben auf die gewandelten Vorgaben ein. Die Änderung des geltenden Rechts liefert auch noch die Richtlinien, an denen sich das Meinen und Urteilen des rechtschaffenen Bürgers neu orientiert. Deutschland wird also auch auf diesem Gebiete ganz „unverkrampft“.
[1] Bei den RAF-Terroristen, die sich ausdrücklich auf die politische Zielsetzung ihrer Taten beriefen und die ehrenwertesten Motive anführten, legten die Strafverfolger stets großen Wert darauf, den letztlich rein kriminellen Gehalt der Aktionen herauszustellen, und ihnen die niedrigsten Beweggründe zu attestieren. In Wahrheit haben sie sie zwar wie Kriminelle, aber durchaus nicht wie gewöhnliche Kriminelle behandelt. Die Staatsmacht sah sich zu eigens auf sie zugeschnittenen neuen strafrechtlichen und prozessualen Regelungen veranlaßt: – neu eingeführte Straftatbestände, mit denen man „Unterstützer“, denen kein direkter „Tatbeitrag“ nachweisbar war, dennoch als Mittäter verurteilen konnte, – prozeßrechtliche Regelungen wie Verteidigerausschluß, Verhandeln in Abwesenheit des Angeklagten, Trennscheiben, Kontrolle des Schriftverkehrs mit dem Anwalt, – Fahndungs- und Strafvollzugsmaßnahmen wie Raster- und „Schleppnetz“-Fahndungen, Hochsicherheitstrakte und Isolierhaft. Wo der Wille eben nicht nur fallweise, sondern prinzipiell gegen die Rechtsordnung Front macht, ist es mit seiner zeitweiligen Beugung durch eine „angemessene“ Strafe auch nicht getan. Größere Härte ist da als Prinzip angesagt, die feindselige Persönlichkeit zu brechen, und Rache. So grundsätzlich beurteilt der Staat heute das gewöhnliche Verbrechen und verschafft sich gegen es ähnliche Handhaben.
[2] Auf dem „Neunten UN-Kongreß über Verbrechensverhütung und die Behandlung von Straftätern“ (Mai 95 in Kairo) bekräftigten die Delegierten ihren Entschluß, gemeinsam gegen Verbrechersyndikate, Mafia und Drogenkartelle vorzugehen und sich gegenseitig dabei zu helfen.(FAZ 2.5.95). In ihrem Verfolgungswahn werfen die führenden Nationen der Welt diese Kriminalität mit politischem Terrorismus in einen Topf und ziehen Analogien zu äußeren Bedrohungssituationen wie Kriegen, gegen die man sich durch internationale Bündnisse wappnen müsse.
[3] Die Wächter rechtsstaatlicher Tugenden vom Schlage eines Prantl (SZ), die auch in diesem Fall wieder Zeter und Mordio geschrieen haben, beherrschen es, seit Jahren alle paar Wochen dem Rechtsstaat zu bescheinigen, mit der jüngsten ins Visier genommenen Reform sich endgültig unglaubwürdig zu machen. Auf diese Art gewöhnen sie sich und ihre Leserschaft an die aktuellen Maßstäbe und die jeweils neue rechtsstaatliche Realität, auf die sie dann wieder nichts kommen lassen wollen.
[4] Nicht weniger fundamental fiel die Rechtskritik von Politik und Öffentlichkeit in einer anderen, sachlich völlig belanglosen, aber patriotisch um so bedeutsameren Angelegenheit aus: dem Streit um die Sperrstunde für bayerische Biergärten. In dieser volkstümlichen Sache stellten sich nicht nur lauter Leute, denen Rechtsstreitigkeiten um Nachbarschaftsrechte und Lärmbelästigungsklagen vertraut und lieb sind, auf den Standpunkt des Volksrechts auf Bierkultur. Stadt- und Landespolitiker schalten die Gerichte, weil sie streitsüchtigen Querulanten Recht gegeben hatten. Und der Landesvater demonstrierte persönlich sein verletztes Rechtsempfinden und vor allem seine Macht, mit einem hoheitlichen Erlaß dem falschen Treiben der Rechtsinstitutionen Einhalt zu gebieten.