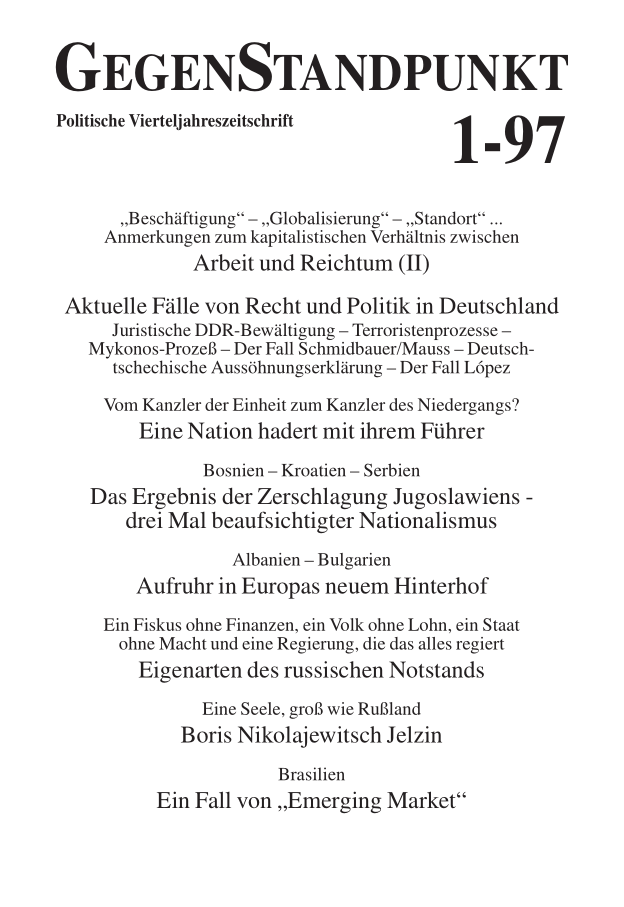Aktuelle Fälle von Recht und Politik in Deutschland besprochen an den folgenden Fällen:
- juristische Bewältigung der DDR als „Unrechtsstaat“;
- Terroristenprozesse: keine „Gnade vor Recht“;
- „deutsch-tschechische Aussöhnungserklärung“: deutsches Recht gilt auch im Osten;
- der „Mykonos-Prozess“: Diplomatie mit innerstaatlichen Rechtsmitteln;
- der Fall Schmidbauer / Maus: Was darf der Geheimdienst?
- Der Fall López: aus der Konkurrenzaffäre zwischen Multis wird eine zwischenstaatliche Standortkonkurrenz.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Gliederung
- Wozu eine unabhängige Justiz ermächtigt ist
- Wie die Politik das Recht als ihr Instrument handhabt
- Die juristische Bewältigung der DDR
- Terroristenprozesse
- Diplomatie mit innerstaatlichen Rechtsmitteln – „Der Fall Mykonos“
- „Männer ohne Gesetz“, „Schatten-“, „Neben-“ oder doch „Außenpolitik aus einem Guß“? – „Der Fall Schmidbauer/Mauss“
- Die Fortentwicklung der deutschen Rechte im Osten
- Die „deutsch-tschechische Aussöhnungserklärung“
- Wie aus einer Konkurrenzaffäre zwischen Multis der Fall einer zwischenstaatlichen Standortkonkurrenz wird: „Der Fall López“
Aktuelle Fälle von Recht und Politik in Deutschland
Kritische Stimmen, die die nachträgliche Verfolgung von DDR-Funktionsträgern mit dem Vorwurf der Siegerjustiz
belegen, anläßlich der jüngsten Urteile gegen RAF-Leute eine Entpolitisierung der Gerichte
fordern, in anderen Verfahren eine politische Instrumentalisierung
beklagen etc., trauen der Justiz zuwenig zu. In den Fällen, in denen ihnen die politische Macht auffällt, die die Justiz exekutiert, melden sie Zweifel an ihrer Unabhängigkeit an. Von politischen Weisungen unabhängige Gerichte
, die stur ihre Paragraphen anwenden, halten sie offenbar nicht für ein Mittel der Herrschaft: Sie übersehen, wieviel Gewalt dem Organ der Rechtspflege überantwortet ist in einem Staat, der sämtliche Beziehungen – die seiner Bürger untereinander, die zwischen ihnen und den staatlichen Behörden sowie die innerhalb des Staatsapparats – gesetzlich regelt. Andere, zumeist maßgeblichere kritische Stimmen, die sich umgekehrt aus Sorge um den politisch brisanten
Stoff, der in solchen Prozessen zur Verhandlung steht, zu Wort melden und die ihrem politischen Geschmack nach fälligen Gerichtsurteile fordern, tun der Justiz ebenfalls unrecht. Wo sich für sie deren Freiheit zur Rechtsprechung störend bemerkbar macht, sehen sie selbstherrliche Richter am Werk, die sich unberechtigterweise ein Stück von der Souveränität anmaßen, die ausschließlich der Politik gebührt. Mit ihrem Vorwurf ignorieren sie absichtsvoll den Dienst, den die Justiz generell an der politischen Herrschaft leistet. Sie pflegt den Rechtszustand, in dem kein besonderes Interesse mehr als das gilt, was es ist. In der Abstraktion des Rechts definiert die Staatsgewalt die Grundsätze, nach denen unter ihrer Hoheit die Verfolgung von Interessen überhaupt nur statthaft ist. Sie legt fest, welchen Interessen ihre Bürger nachgehen dürfen und in welcher Form, indem sie die Anliegen dekretiert, die sie als berechtigt anerkennt. Damit zwingt sie die Untertanen dazu, bei sich und allen anderen Interessen grundsätzlich nur soweit gelten zu lassen, wie sie rechtlich gewährt sind. In Form der Ansprüche, die verfolgt werden dürfen, und durch die Gewährung gleichfalls berechtigter Interessen, die ihnen entgegenstehen, aber respektiert werden müssen, begründet und beaufsichtigt die Staatsmacht zugleich die gegensätzlichen Verhältnisse, in die sie ihre Bürger entläßt. In denen haben die Privatpersonen dann alle Freiheiten, das zu tun, was sie von Rechts wegen tun müssen.
Wozu eine unabhängige Justiz ermächtigt ist
Mit dem Erlaß von Gesetzen, in denen das Recht existiert, gibt das Parlament als höchstes politisches Entscheidungsgremium der Justiz die Maßstäbe vor, denen sie allgemeine Geltung verschaffen soll. Damit wird sie ermächtigt, alles zu einem Rechtsfall zu machen, den sie als eigenständiges Staatsorgan zu entscheiden hat:
– Wo zwischen Privatpersonen die Ansprüche strittig sind, die sie aus ihren Geschäfts-, Arbeits-, Miet- und allen sonst eingegangenen Beziehungen herleiten, entscheiden nicht sie, sondern entscheidet die Justiz über ihren Fall. Sie nimmt ihn als Rechtskollision, die nach den im Zivilrecht abgehandelten Gesetzen zu beurteilen ist, und bestimmt als über den Parteien stehende Instanz für sie verbindlich, was wem zusteht und wer wieviel bezahlen muß. So macht sie gegenüber den Kontrahenten das in den tausend Paragraphen des BGB ausgeführte Rechtsprinzip des Vertrags geltend, daß sie ihre gegensätzlichen Interessen in Form einer wechselseitigen Selbstverpflichtung zur Lieferung bzw. Bezahlung aufeinander zu beziehen und zu bedienen haben. Indem sie ihre Entscheidungsgewalt über die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ausübt, setzt sie dieses Prinzip allgemein in Kraft: Die Privatpersonen müssen sich als Eigentümer anerkennen; sie haben zu respektieren, daß sie von all dem nützlichen Reichtum ausgeschlossen sind, über den sich das Verfügungsrecht eines anderen erstreckt, daß sie nur mit dem Willen des Betreffenden Zugang zu den Dingen erlangen, die sie brauchen, und daß dieser Zugang eine Frage des Preises ist, den ihr Eigentümer berechtigterweise verlangt. Dadurch, daß die Eigentumsordnung das Bezahlen zur allgemein geltenden Bedingung der Partizipation am nützlichen Reichtum macht, legt sie alle Mitglieder der Gesellschaft darauf fest, Geld zu verdienen; und zwar mit den Mitteln, über die sie verfügen: Dem größeren Teil der Gesellschaft, der neben seiner Arbeitskraft gar nichts weiter besitzt, woraus ein Einkommen zu erzielen wäre, eröffnet sie die dauerhafte Perspektive, sich im Dienst an fremdem Reichtum zu betätigen. Während der andere Teil, der ein Vermögen besitzt, sich das durch fremde Arbeit vergrößern läßt. Er muß sich dabei nur an die juristische Form des Vertrags halten, die auch den Eigentümer der Arbeitskraft zum Inhaber berechtigter, einklagbarer Ansprüche macht.
– Wer, statt den Rechtsweg zu beschreiten, sein
Recht in die eigene Hand nimmt und sich an einer anderen Person oder ihrem Eigentum vergreift, wird in anderer Hinsicht zu einem Fall für die Justiz. Das Unrecht liegt in dem Fall nicht darin, daß ein berechtigter Anspruch eines Bürgers nicht bedient, sondern das Recht gebrochen wurde. In solchen Fällen ermächtigt das Strafrecht die Gerichte zur Anordnung von Zwangsmitteln gegen die Betreffenden. Indem sie Rechtsbrecher durch Freiheitsentzug oder Eingriffe in ihr Eigentum zum Gehorsam gegenüber dem Recht zwingt, stellt sie das Recht wieder her. Das gilt auf diese Weise allgemein als ein Katalog von Gesetzen, deren Mißachtung die Staatsgewalt in Gestalt von Justiz & Polizei herausfordert. In dieser Form gewährt der Staat seinen Bürgern „ohne Ansehen der Person“ die Freiheit, im Rahmen des Erlaubten und ihrer Möglichkeiten ihren Interessen nachzugehen, und sichert er sich über seine Gesellschaft die Gewalthoheit, die er zum Schutz von Person und Eigentum ausübt. So stiftet er die Interessengegensätze, die die bürgerliche Gesellschaft beherrschen, und hält er sie zugleich aufrecht: als von allen Privatinteressen getrenntes Gewaltmonopol, das jede private Anwendung von Gewalt als Angriff auf sich verfolgt.
– Der Hüter der Eigentumsordnung kommt seinen Bürgern nicht nur zivil- und strafrechtlich. Den Gewaltapparat, den er zur Aufsicht über sie für notwendig hält, genehmigt er sich in Gestalt seines öffentlichen Rechts nämlich ebenfalls in Form von Gesetzen. Damit wird Herrschaft nicht nur ausgeübt, sondern steht sie selbst auch noch in einem Rechtsverhältnis zu denen, über die sie ergeht: Wo immer die Bürger mit den Wahrern der öffentlichen Ordnung unmittelbar zu tun haben, in Ämtern, Behörden, bei der Polizei oder im Schwimmbad – stets haben sie das Recht, sich nur das gefallen lassen zu müssen, was die Befugnisse der jeweiligen staatlichen Organe gestatten. Umgekehrt haben die Behörden in den Gesetzen die Ermächtigung, dem Bürger all die Pflichten aufzuerlegen, die für das Funktionieren der staatlichen Ordnung als notwendig erachtet werden.
Auch die Staatsdiener selbst haben sich die Prüfung gefallen zu lassen, ob sie von der ihnen per Amt übertragenen Macht rechtmäßigen Gebrauch machen. Wo sie sie in den Dienst ihrer Privatinteressen stellen, sind auch sie nicht vor den Nachstellungen der Justiz sicher. Die gelten der Aufrechterhaltung der Trennung von Amt und Person, mit der die Funktionalität des Machtgebrauchs sichergestellt wird: Er hat ausschließlich der Aufsicht des Staats über die Konkurrenz der Privatinteressen zu dienen und deswegen nicht als Mittel in dieser Konkurrenz funktionalisiert zu werden. Wo sich staatliche Behörden in Ausübung ihrer Herrschaftsaufgaben in die Quere geraten, ist es schon wieder die Justiz, die darüber zu entscheiden hat, wo die Grenzen der jeweiligen Machtbefugnisse liegen. Die gesetzlich geregelten Kompetenzen müssen nämlich auch in der Praxis immer klar geschieden bleiben. Denn nur so können die verschiedenen Institutionen, die der Rechtsstaat sich zur Erledigung seiner Herrschaftsfunktionen schafft, als ein Machtapparat zusammenwirken. Selbst dem Gesetzgeber bleibt es nicht erspart, daß die Justiz sein Tun kontrolliert. Das Verfassungsgericht mißt seine Beschlüsse an den obersten Grundsätzen der Rechtsordnung und entscheidet in Abwägung und Gewichtung höchster Rechtsgüter, die für oder gegen ein neues Gesetz sprechen, ob es vor dem Recht Bestand hat oder an den Gesetzgeber zurückzuweisen ist. Der kann es dann modifizieren oder die Verfassung ändern. Jedenfalls hat er bei seinen Eingriffen in die Rechtsordnung auf deren Systematik Rücksicht zu nehmen, damit der Staatswille im Recht unzweideutig bleibt.
– In all diesen Abteilungen ist die Justiz schwer mit der Prüfung ihrer eigenen Urteile befaßt. Auf dem dafür eingerichteten Instanzenweg prüfen höhere Instanzen die Entscheidungen der untergeordneten daraufhin, ob sie juristisch einwandfrei aus den Gesetzen hergeleitet sind. Die Einwände ergeben sich dabei daraus, daß Rechtsgrundsätze, die für den jeweiligen Fall einschlägig sind, in der Urteilsbegründung nicht oder nicht angemessen berücksichtigt worden sind und deswegen die Subsumtion des Falls unter das Recht zu wünschen übrig läßt. In dieser Subsumtion besteht nämlich die Leistung der Justiz. Ihr Handwerkszeug sind die ihr vorgegebenen Gesetze, die in allgemeiner Form Merkmale strafbarer Handlungen, verbindlicher Verkehrsformen etc. angeben, und ihr Material sind die Interessengegensätze, die zwischen Privatpersonen, zwischen ihnen und dem Staat etc. ausgetragen werden. Sie nimmt und behandelt diese Gegensätze als Fälle, die in den Gesetzen ihre Bestimmungsgründe haben und nach ihnen zu beurteilen sind. Dabei kommt der Fall, daß sie die Entscheidung über Recht und Unrecht einmal schuldig bleiben müßte, weil im Gesetz etwas nicht vorgesehen ist, aus gutem Grund nie vor. Schließlich ist es ihr Werk, in jedem Einzelfall die Rechtslage mit der Sachlage abzugleichen. Sie bestimmt, wie die Gesetze im Hinblick auf den Fall zu interpretieren sind, und wo der Gesetzgeber in den Augen der Justiz schlecht vorgearbeitet hat, wird er von ihr beauftragt nachzubessern. Auf diese Weise schreibt sie das Recht solange fort, bis sich nichts mehr im ganzen Staatswesen zu ihm extern verhält. Erst durch diese Subsumtion sind die Gesetze als die Grundsätze einer flächendeckenden Herrschaft wirksam, als Rechtszustand, unter dem alles, was sich regt, eine Frage der gewährenden Gewalt ist.
Als Instanz, die diese Subsumtion zu vollziehen hat, ist die Justiz im Rechtsstaat mit der Freiheit der Rechtsprechung ausgestattet. Sie betätigt sie, indem sie das Recht auslegt, mit ihren Entscheidungen für künftige Fälle verbindliche Rechtsgrundlagen stiftet, also selbst geltendes Recht setzt. Dort, wo sie entweder Gesetzeslücken
entdeckt oder nach einer eindeutigen Klärung der Rechtslage
verlangt, wird sie selbst initiativ und meldet beim Gesetzgeber den entsprechenden politischen Handlungsbedarf an. Wenn sich Politiker manchmal zu Richterschelten herausgefordert sehen, stoßen sie sich am Gebrauch dieser Freiheit, die die Justiz hat, und bezeugen damit, daß die Rechtsprechung ihrem Einfluß grundsätzlich entzogen ist. Ihr Anspruch, die Justiz habe politisch opportun zu entscheiden und mit ihren Urteilssprüchen den Standpunkten Rechtsverbindlichkeit zu verleihen, die die Politiker zur fraglichen Sache einnehmen, gilt da nur soviel, wie ihn sich die Gerichte in Befolgung ihrer Rechtskriterien zu eigen machen. Aber dort, wo das Recht für eine Regelung fehlt, die sein soll, wird es eben geschaffen.
Wie die Politik das Recht als ihr Instrument handhabt
Die politische Führung bezieht sich auf den bestehenden Rechtszustand als vorgefundene Voraussetzung, in der die staatliche Herrschaft ihren Bestand hat. Daß der gesichert ist, verschafft ihr die Freiheit zum Regieren. Die übt sie aus, indem sie ihr materielles Interesse nach Maßgabe des geltenden Rechts ausübt, und indem sie den Rechtszustand laufend an die aktuellen Anforderungen anpaßt, die sie an ihr Volk und die staatliche Gewaltaufsicht über es stellt.
Jede Unzufriedenheit mit den Diensten, die dieses Gemeinwesen dem Staat leistet, übersetzt sich für sie in eine Kritik an der Rechtslage und damit in den Auftrag, sie zu ändern, weil das ihr Hebel ist, die geforderten Leistungen herbeizuregieren. Wenn z. B. der ökonomische Erfolg der Nation zu wünschen übrig läßt, steht für sie die Diagnose zweifelsfrei fest: Der Staat hat, z. B. in seiner Steuer- und Sozialgesetzgebung, zu viele Ansprüche gegen sich ins Recht gesetzt, hat mit Kündigungsschutz-, Ladenschluß-, Lohnfortzahlungsgesetzen etc. seiner Wirtschaft lauter rechtliche Hindernisse in den Weg gelegt; und da er in Form geltender Gesetze bereits den Zugriff auf die Einkommen seiner Bürger organisiert, beträchtliche Bestandteile des Lohns unter seine Verwaltung gestellt, Arbeitsverhältnisse seiner Definitionshoheit unterworfen hat, muß er nur all das neu regeln, was er schon zur Sache seiner Entscheidung gemacht hat. Und wo die innere Ordnung seinen Maßstäben nicht genügt, ist für ihn derselbe Schluß fällig. An all den Mißständen
, die er zu beklagen hat, von der Rinderseuche über die Kinderschänderei bis zur Drogensucht und zum organisierten Verbrechen zeigt sich für ihn nur, daß es an den passenden gesetzlichen Grundlagen für staatliche Kontrolle und Gewalt gefehlt hat, also die zuständigen Stellen mit neuen Befugnissen auszustatten sind.
Die regierenden Politiker sorgen also dafür, daß das Recht den von ihnen vertretenen und bestimmten Herrschaftswillen verkörpert, die Pflege des Rechts in ihrem Sinn ist ihr Metier. Was sie aus der Hand geben, wenn sie ihre Herrschaft rechtsförmlich ausüben, ist nur die Ausführung der von ihnen beschlossenen Grundsätze staatlicher Gewaltanwendung, und auch da geht alles Rechtens zu: Wo der Staat sich als Betroffener einer Rechtsverletzung sieht, hat er seine Staatsanwaltschaft, eine dem Justizministerium unterstehende und damit an politische Weisungen gebundene Behörde, die in allen Strafangelegenheiten die Ermittlungen führt, die Anklage erhebt und damit maßgeblich darauf einwirkt, wie die staatliche Betroffenheit zu einem Rechtsfall wird. Wo aus politischen Gründen sein Recht gebrochen wird, ist in gesonderter Weise die Generalstaatsanwaltschaft zuständig, die seine Souveränität schützt – als das allerhöchste Rechtsgut, das die Rechtsordnung kennt.
***
Die juristische Bewältigung der DDR
Das Urteil, ihrem Wesen nach ein Unrechtsstaat
zu sein, verdiente sich die DDR Zeit ihres Bestehens durch eines sicher nicht: Am Recht hat es in ihr keinesfalls gefehlt. Staatlich verfaßt war die politische Herrschaft des Realen Sozialismus schon auch; rechtsförmige Gebote und Verbote waren daher auch das Mittel der Staatsmacht, ihre Bürger zu den Diensten anzuhalten, die von ihnen verlangt waren. Auch auf manche Errungenschaften, die sich bürgerliche Staaten im Bereich ihres Kontroll- und Justizwesens eingerichtet haben und unterhalten, wollte der volksdemokratische Staat bei seiner Herrschaftsausübung nicht verzichten. So herrschte auch im Sozialismus der Rechtszustand, der von den einschlägigen Organen auf dem Gebiet von Arbeits-, Zivil-, Familien-, Strafrecht usw. besorgt wurde. Der selbst allerdings unterschied sich seinem Inhalt nach schon wesentlich von dem in bürgerlichen Staaten: schließlich waren die Interessen anders beschaffen, denen das Recht zur Macht zu verhelfen hatte. Daß in bürgerlichen Staaten das Recht das Mittel der herrschenden Klasse
ist, verstanden die realen Sozialisten nicht als dessen Kritik, sondern als ihren Auftrag, es zum Instrument des zur Herrschaft erhobenen Willens der Arbeiterklasse
zu machen. Ausgerechnet in der Form, in der der bürgerliche Staat seine Gesellschaft als Konkurrenz von Privatpersonen organisiert und ihr die Mehrung des Eigentums als den ausschließlich bindenden Zweck vorschreibt, wollten sie eine planmäßige Produktion zum Wohl des Arbeiter- und Bauernstandes aufziehen – und das ging natürlich auch. Freilich ist es nicht das so unabhängige bürgerliche Recht, das dann gilt. Wenn eine Partei den Staat bildet und das Recht in ihm setzt, das ihren besonderen Interessensstandpunkt für allgemeinverbindlich erklärt; wenn sie in die Rechtsprechung eingreift und ihre Richter dazu anhält, in politisch gewünschtem Sinn Recht zu sprechen; wenn sie gegenüber dem Recht, das sie setzt, also laufend den Vorbehalt praktisch geltend macht, ihrem Interesse zu dienen, dann wissen die Profis des bürgerlichen Rechtszustands sofort Bescheid: Das ist kein Recht, sondern ein einziger Fall von Rechtsbeugung.
Weil also der Gebrauch der Rechtsgewalt dergestalt nach anderen Maßstäben als denen erfolgte, wie sie im bürgerlichen Rechtsstaat gültig sind; weil das sozialistische Regime mit seiner Gesetzlichkeit andere gesellschaftliche Interessen freisetzte und beschränkte als diejenigen, die mit der hier herrschenden Freiheit von Person und Eigentum als gesamtgesellschaftlich verbindlich dekretiert werden – deshalb war nach der hierzulande vertretenen Auffassung das Recht der DDR ein einziges Unrecht
. Und weil der Staat sich mit seinem Recht eben nicht auf den ausschließlichen Dienst an den Notwendigkeiten des Privateigentums und seiner grund- und menschenberechtigten Agenten selbst verpflichten wollte und sich zur Unterordnung seines Rechts unter seinen politischen Zweck bekannte, war er selbstredend ein Unrechtsstaat
und der Inhalt seiner Machtausübung bloße Willkür
.
Sein glückliches Ende gefunden hat dieser Fall von weltgeschichtlicher Ungerechtigkeit bekanntlich dadurch, daß der Geltungsbereich der hiesigen politischen Herrschaft ausgedehnt wurde – diese das sozialistische Staatsgebiet samt totem und lebendem Inventar ihrem Recht unterstellt hat: Richtig ins Werk gesetzt hat die westdeutsche Demokratie die Expansion ihres Herrschaftsbereichs durch den Export ihres Rechts- und Justizwesens, um mit demselben staatlichen Organ, das sie sich für die funktionellen Dienste an der Freiheit des privaten Eigentums geschaffen hat, genau diese Freiheit im annektierten Gebiet durchzusetzen. Daher erging an die rechtsstaatliche Justiz in allen ihren Abteilungen der Auftrag, mittels ihrer bewährten Rechtsvorschriften aus allen nach geltendem DDR-Recht eingerichteten gesellschaftlichen Verhältnissen solche zu machen, die eine Marktwirtschaft
mit ihrem privateigentümlichen Erwerbszweck verlangt. Im Zuge der Außerkraftsetzung realsozialistischer Rechte und Pflichten kam mit den neuen Rechtssubjekten, -gütern und -beziehungen auch die gewünschte neue Verteilung von Macht und Mitteln ins neue Staatsgebiet. Das Recht der kapitalistischen Gesellschaft, das bürgerliche Recht eben, trat an die Stelle der Macht der Werktätigen & Bauern und herrschte von den sozialistischen Produktionsbetrieben angefangen bis hinunter zu den privaten Wohn- und Lebensverhältnissen der Bevölkerung und allen vorfindlichen Einrichtungen den neuen Daseinszweck auf, für nichts anderes als für die Mehrung des privaten Eigentums und die freie Entfaltung der dazugehörigen Persönlichkeiten zur Verfügung zu stehen. Insofern also der Export des hier geltenden Rechtszustands in die neu erworbenen Gebiete mit dem der kapitalistischen Klassengesellschaft zusammenfiel, ist das Unrecht
namens DDR nicht nur der Form nach, sondern auch hinsichtlich des materiellen Grundes wirksam beseitigt worden, der für dieses Verdikt maßgeblich war. Allerdings war damit der Auftrag der Justiz, die DDR rechtlich aufzuarbeiten
, keineswegs beendet: Auf seine Weise ist der Rechtsstaat nämlich auch rachsüchtig und besteht ausdrücklich auch auf der rückwirkenden strafrechtlichen Vollstreckung seiner Rechtshoheit. Auch dafür hat er in seiner Justiz das Mittel seiner Macht.
Der erklärte politische Wille der Machthaber des neuen Gesamtdeutschland, nicht nur die Rechtsbrecher des neu geltenden Rechts, sondern auch die Verantwortlichen
für das untergegangene Unrecht
der DDR zur Rechenschaft zu ziehen, hat dafür gesorgt, daß die deutsche Justiz ihren Tätigkeitsbereich auch auf die Verfolgung von sog. Regierungsverbrechen
auszudehnen hatte: Das war nämlich der halbwegs tatbestandlich anmutende Ermittlungsauftrag, in den sich die Nicht-Anerkennung einer souveränen ostdeutschen Staatlichkeit ebenso wie des Rechts, das sie geschaffen hatte, in eine juristisch handhabbare Direktive übersetzte. Mit dem politischen Beschluß, daß nach einer Übernahme der DDR an eine Amnestie
für die politisch Verantwortlichen
nicht zu denken sei, stand für die deutschen Gerichte der Auftrag fest, das strafrechtlich Justiziable am DDR- Unrecht
ernst zu nehmen. Die Staatsanwälte schritten daher zur Anklage, wobei sie – wie im Einigungsvertrag
vorgesehen – bei der Fahndung nach Rechtsverstößen zunächst das Recht des untergegangenen Staates dazu bemühten, über dessen Verhältnisse zu richten. In erster Linie über die politischen Agenten und Funktionäre der DDR, die von der deutschen Justiz an den Rechtsvorschriften des alten DDR-Rechts gemessen wurden, wobei durchaus ein neuer Tenor bei der Findung des geeigneten Rechts zu verzeichnen war. Mit der Verurteilung von einigen DDR-Grenzschützern, die für vom DDR-Recht nicht gedeckte besondere Grobheiten zur Verantwortung gezogen wurden, und von DDR-Politikern, denen sich Wahlfälschung und Veruntreuung von Staatsgeldern nachweisen ließ, landete die Justiz so zwar erste Erfolge. Die ließen aber in mehrerer Hinsicht zu wünschen übrig. Einmal, weil nach Maßgabe des DDR-Rechts für diese entschlossene Justiz gar nicht so viele Rechtsverstöße auszumachen waren, wie ihr Wille zur Abstrafung eines ganzen Staatswesens verlangte. Vor allem aber deshalb, weil von einer Rechtsverfolgung nach DDR-Recht nicht die Richtigen – die politischen Führer des Unrechtsstaates
– und nicht das mit ihr eigentlich Bezweckte – die von ihnen ausgeübte Staatsmacht – zu belangen war. Aus diesem Widerspruch, einerseits dazu ermächtigt zu sein, ein ganzes Staatsleben als Verstoß gegen geltendes Recht zu ahnden, andererseits über das Recht nicht zu verfügen, das diese Ahndung auch wirklich erfolgreich gestattet, hat sich die Justiz endlich befreit: Nach dem BGH hat nunmehr – und damit endgültig – auch das Bundesverfassungsgericht als das oberste Organ des Rechtstaates festgestellt, daß die DDR in Gestalt ihrer führenden Funktionäre und untergeordneten Dienstleister grundsätzlich strafrechtlich zu verfolgen ist.
Mit seiner Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht den Auftrag, gegen Regierungskriminalität
zu ermitteln justiziabel gemacht und damit der Justiz das Mittel übereignet, mit dem sie aus der moralischen Verurteilung des DDR-Staatsrechts Strafprozesse verfertigen kann. Danach mag es in der DDR Gesetz und Recht gegeben haben; es mag auch so sein, daß Grenzschützer und andere Staatsdiener durchaus in Einklang mit der seinerzeit geltenden Rechtslage gehandelt haben und die Todesschüsse an der Mauer vom DDR-Recht gedeckt waren
. Ein Recht, wie es hier gilt, war dieses Recht einfach nicht, weil es den staatlichen Verantwortungsträgern, Beamten und anderen Dienern Taten erlaubte und sogar gebot, die vom hiesigen Standpunkt aus untragbar waren: Ein Staat, der zwar seinen eigenen Bürgern Mord und Totschlag verbietet, bei seinem Grenzregime deren Lebensrecht
aber seinen staatlichen Interessen unterordnet
, ist selbst das Verbrechen, das er anderen verbietet. Der feste Vorsatz, im Fall der DDR nicht anzuerkennen, daß und wie da ein Staat seinen Bestand und seine Rechte nach außen gesichert hat, macht erst aus getöteten Republikflüchtigen Opfer von Mord und Totschlag im rechtlichen Sinn; er macht aus den Staatsagenten strafrechtlich zu belangende Privatpersonen, was sie nach ihrer Entmachtung ja sind, gesteht ihnen also nicht zu, daß sie als Funktionäre einer staatlichen Souveränität gehandelt haben, so daß man ihnen heute für Staaten ziemlich gewöhnliche Machenschaften als persönliche Verbrechen zur Last legen kann; und er beläßt es nicht bei dem moralischen Unwerturteil über das Recht dieses Staates, sondern erklärt dieses rechtsverbindlich zum Unrecht, das deshalb auch rückblickend zu keiner Zeit rechtliche Gültigkeit beanspruchen konnte: Es ist extremes staatliches Unrecht, das sich nur solange behaupten kann, wie die dafür verantwortliche Staatsmacht faktisch besteht
(Entscheidungsbegründung), mit deren Ende und der Ausdehnung der rechtsstaatlichen Hoheit also einfach schon deswegen verfolgt werden muß, weil andernfalls die Strafrechtspflege der Bundesrepublik zu ihren rechtsstaatlichen Prämissen in Widerspruch geraten würde
(ebd.). Den Vertrauensschutz
vor der Verfolgung durch das Strafrecht des Rechtsstaats, den die ehemaligen Staatsdiener der DDR mit ihrer Berufung auf das Grundgesetz für sich in Anspruch nehmen wollten – Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen war
(GG, Art. 103) –, genießen sie nicht, weil – siehe oben – der Rechtfertigungsgrund
für ihre Taten nie bestanden hat: Das Vertrauen der DDR-Staatsdiener, die durch die bloße Ausweitung der BRD-Zuständigkeit plötzlich zu gewöhnlichen Straftätern geworden waren, auf die Rechtfertigung ihres Handelns durch zum Tatzeitpunkt
geltendes DDR-(Un-)Recht wurde kurzerhand für nicht schutzwürdig
erklärt. Die Täter hätten wissen müssen – und bei zumutbarer Anspannung ihres Gewissens auch können –, daß man sich auf sozialistisches Recht nicht berufen kann, wenn man – nach demokratischen Maßstäben – schwerstes kriminelles Unrecht
begeht. So sind nunmehr neben den „Kleinen“, die das Recht bekanntlich nie laufen läßt, auch die sog. „Großen“ reif für den Zugriff der Justiz – erstere haben die Mordtaten an der innerdeutschen Grenze begangen, letztere sind die mittelbaren Täter
.
Diese Befreiung der Justiz von Schranken der Rechtsverfolgung, die ihr ausgerechnet aus ihren eigenen Maßstäben erwachsen waren, ist gemeinhin als juristisch sensationell
gefeiert worden. Die Kommentatoren verkündeten einen großen Sieg, den der Rechtsstaat in der politisch brisanten
Frage der juristischen Vergangenheitsbewältigung
errungen habe. In ihrer Begeisterung darüber, daß die Verfassungsrichter dem moralischen Willen zur Abrechnung mit den Vertretern des Unrechtsstaats
im Wege der richterlichen Rechtsfortbildung
endlich die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt haben, wollten einige im Recht gleich nur noch den Triumph der Moral sehen: Das Vertrauen auf eine menschenrechtswidrige Auslegung des Rechts ist nicht schutzwürdig. Das heißt, daß sich niemand zu seiner Entlastung auf ein pervertiertes Recht berufen darf, daß niemand, sei er Staatschef oder einfacher Soldat, sich auf Gesetze hinausreden kann, die in Wahrheit das Recht verhöhnen. (…) Mord bleibt Mord und Totschlag bleibt Totschlag, auch wenn Minister und Parteifunktionäre sie anordnen.
(SZ) Und auch der Rechtsexperte der „Süddeutschen Zeitung“ bleibt eben der rechtsmoralische Einfaltspinsel, der er immer ist. Kaum hatte er sein heilloses Durcheinander von Staat, Recht und Moral in den Satz gebracht, daß es kein politisches Totschlagsprivileg
gibt, wollte er den noch nachträglich gerne auf Tausende von Urteilen der Nachkriegszeit
gestempelt und so die Versäumnisse
korrigiert haben, die sich die rechtsstaatliche Justiz bei der Verfolgung des NS-Unrechts
angeblich geleistet hat. Es ist nur so, daß der Rechtsstaat dabei überhaupt nichts versäumt
hat. Die deutsche Demokratie hatte eben nicht im Programm, das Recht und den Staat des Faschismus als Verbrechen
zu definieren und dieses zu ahnden; sie hat sich umgekehrt ja bekanntlich als dessen Rechtsnachfolger neugegründet – und dem TÜV für Menschen- und Völkerrecht, dem sie sich als Kriegsverlierer unterziehen mußte, dadurch genügt, daß sie ihren Rechtsstaat die typischen NS-Verbrechen
verfolgen ließ. Das mag Moralisten verwirren, ist rechtlich aber einfach nicht zu beanstanden. So kommt es, daß die juristische Vergangenheitsbewältigung
zwei unterschiedliche Abteilungen hat. In der ersten wird ein kleiner Skandal
aus dem Umstand zu machen versucht, daß etliche SS-Angehörige Opferrenten beziehen – und gleich darauf melden noch etliche mehr bei der zuständigen staatlichen Behörde ihre diesbezüglichen Rechtsansprüche an, von denen sie nicht wußten, daß sie sie haben. In der zweiten Abteilung kommt die ausgerechnet im Tenor einer Suche nach der historischen Wahrheit
abgewickelte Subsumtion eines Staatswesens unter Rechtsmaßstäbe, die für es nicht gegolten haben, auch gut voran. Die laufenden Ermittlungen erstrecken sich auf Funktionäre des DDR-Sports – Verstöße gegen das DDR-Arzneirecht
und systematisches Doping
steckten hinter den beeindruckenden Medaillenspiegeln der DDR; in überschaubarer Größenordnung
werden Richter und Staatsanwälte, die u.a. auch dieses Arzneirecht vertreten hatten, vor Gericht gezogen – wegen des Verdachts auf Rechtsbeugung; gleiches widerfährt in 450 Fällen denen, die in gehobenen Positionen mit den Belangen der staatlichen Sicherheit befaßt waren – die ging überhaupt nur über gemeinschaftlich begangenen Totschlag
zu bewerkstelligen; für Guillaume und andere Erfolge läßt sich der DDR-Geheimdienst schlecht verfolgen – sein Führer aber umso besser, wenn ihm Körperverletzung und Freiheitsberaubung in drei Entführungsfällen
zuzurechnen ist; und dann eröffnet sich noch die Perspektive, STASI-Funktionäre mit einem für sie genau passenden Rechtstitel verfolgen zu können: Weil sie RAF-Aussteigern in der DDR eine unauffällige Existenz verschafft hatten, haben sie sie der hiesigen Strafverfolgung entzogen und sich deswegen als Hintermänner schuldig gemacht, die die Zwecke und Verbrechen der RAF mitgetragen haben.
Aber die gesamtdeutsche Justiz ist nicht einäugig; sie bleibt sich auch den Dienst an anderen Aufgaben im Rahmen der deutschen Vergangenheitsbewältigung nicht schuldig:
Terroristenprozesse
Anläßlich der Urteile gegen die RAF-Frau Hogefeld und die Palästinenserin Andrawes sind in der Presse vereinzelt Nachfragen laut geworden, ob es für den Rechtsstaat nicht an der Zeit wäre, im Umgang mit der RAF zur Normalität zurückzukehren. Heute, wo die RAF zerschlagen ist und selbst die Bundesanwaltschaft öffentlich verkündet, daß von ihr keine Gefahr mehr für die Bundesrepublik ausgeht, könnten deren Mitglieder für ihre Taten doch nach denselben Rechtsmaßstäben zur Verantwortung gezogen werden, die für gewöhnliche Verbrecher gelten. Die Wortmeldungen äußerten ein gewisses Unverständnis darüber, daß der Staat weiterhin an den Sondergesetzen festhält, die er in den Hochzeiten der Terrorismusbekämpfung
erlassen hat, obwohl die praktische Herausforderung für ihn nicht mehr fortbesteht, die er mit ihnen bekämpfen wollte: Sie sahen den Grund nicht mehr, weswegen mit den rechtlichen Waffen der Terrorismusbekämpfung gegen Individuen vorzugehen sei, die sich längst vom Kampf gegen den Staat losgesagt haben; die sich schon in seiner Hand befinden oder nur mehr damit befaßt sind, sich seinem Zugriff zu entziehen; die sich im Ausland verstecken und dort z.T. seit Jahren eine unauffällige bürgerliche Existenz führen. Auf der Grundlage, daß die RAF faktisch erledigt ist – und erst auf dieser Grundlage –, stellten sie Überlegungen an, ob nicht manches für eine Entpolitisierung der Gerichte
spreche, für eine normale kriminologische und strafrechtliche Aufarbeitung der Jahre zurückliegenden Anschläge
, mit der dieses Kapitel deutscher Geschichte zu schließen
wäre; und zwar durchaus im Sinne des Staates, weil der damit einen entscheidenden Beitrag zur Befriedung des Landes
leisten würde.
Diese Überlegungen verkennen ein bißchen die durchaus astrein kriminologischen und strafrechtlichen Leistungen, mit denen der Rechsstaat bei seiner Erledigung der Terroristen seinen entscheidenden Beitrag zur Befriedung des Landes
geleistet hat. Ausgegangen wird in ihnen von einer Voraussetzung, die es beim Umgang dieses Rechtsstaats mit der RAF noch nie gegeben hatte, nämlich der, Terroristen wären irgendwie als gewöhnliche Verbrecher anzusehen und zu behandeln. Sicher – auch diese Verbrecher zogen sich die Aufmerksamkeit des Staats und seiner rechtlichen Behörden durch den Bruch des Rechts zu, den sie bei ihren Taten begingen; aber ihr Rechtsbruch zeichnete sich in jedem Fall durch die vollständige Abwesenheit aller subjektiven Beweggründe aus, wie sie von gewöhnlichen Verbrechern her bekannt sind. Terroristen wollen sich nicht in der bürgerlichen Konkurrenz um Geld, Macht und Anerkennung mit dem Privatpersonen nicht zustehenden Mittel der Gewalt durchsetzen; sie nehmen nicht bei der Verfolgung ihres Nutzens die Verletzung eines – ansonsten von ihnen hingenommenen – Gewaltmonopols und des von diesem gesetzten Rechts in Kauf, sondern sie greifen zur Gewalt als Mittel, gegen alles geltende Recht ein eigenes zu stellen. In dessen Besitz sind sie über die sehr rohe Interpretation der Praxis des staatlichen Rechts als Pflichtverletzung gegenüber einem wirklichen Allgemeinwohl gelangt, wie es ihnen nicht nur der Idee nach vorschwebte: Das sahen sie eben als nur allzu berechtigt an, und im Namen dieses Rechts haben sie sich stellvertretend für alle Betroffenen gegen das der Staatsgewalt gestellt, sich der gegenüber als Konkurrenz um das Gewaltmonopol aufgebaut.[1]
Für den Staat waren die Terroristen deswegen noch nie lediglich in dem Sinne eine Herausforderung, daß sie in besonders dreister Manier seine Rechtsordnung verletzt hätten – diese Würdigung bleibt den Verbrechen aus dem Alltag der Klassengesellschaft vorbehalten. Für den Staat bestand die Herausforderung durch den Terrorismus immer schon wesentlich darin, ihn selbst, die rechtsetzende und die Rechtsordnung insgesamt garantierende Macht bestritten zu haben – und daran bemaß sich auch das rechtsstaatliche Vorgehen gegen die Täter: Deren Verfolgung war von der Absicht des Staates, sich ihnen gegenüber als unangefochten legitime Gewalt in Szene zu setzen, gar nicht zu trennen. Entsprechend entschlossen und umfassend machten sich die Behörden daran, Verbrechen dieser Art zu tilgen. Was die Bestrafung derer betraf, die man erwischte, so hatte auch hier der Rechtsstaat die erforderlichen Mittel bereitgestellt, die eine Behandlung von Schwerstkriminellen
gestatten. Und diese sind weiterhin in Anwendung:
Zur Last gelegt werden den Terroristen ihre Angriffe auf den Staatsapparat und seine Agenten in Politik, Justiz und Wirtschaft ganz nach dem Buchstaben des einschlägigen Strafgesetzbuches, als Bankraub, Freiheitsberaubung, Mord usw. Wo sich bei den Aktionen der RAF Taten und Täter nicht einander zuordnen lassen, jedes Attentat wegen des klandestinen Vorgehens immer nur auf einen potentiellen Täterkreis
und auf ein noch größeres Umfeld
verweist, ist das besonders heimtückisch
. Der zur rechtlichen Verfolgung eigens erfundene neue Straftatbestand der Gründung oder Mitgliedschaft in einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung
macht es möglich, die Zurechnung von Straftaten weitgehend auch ohne den Beweis eines individuellen Tatbeitrages vorzunehmen – trotz zweifelhafter Beweislage
, wie eine aufmerksame Presse berichtet. Auch der Sympathisant wird als Konstruktion einer Tatbeteiligung zum Bestandteil des Strafrechts; das erleichtert den strafrechtlichen Zugriff auf den trockenzulegenden Sumpf
erheblich. Sonst anerkannte Strafmilderungsgründe zählen nichts – Einsicht, Reue, Abkehr vom Terrorismus, Appelle zur Einstellung des Kampfes werden nicht honoriert
. Im Gegenteil: Als wesentliches Tatmerkmal wird die dahinterstehende menschenverachtende Gesinnung
gewertet, die in jedem Fall strafverschärfend gegen den Angeklagten spricht; in ihr wird die Gewalt, die sie in ihren Verbrechen ausübten, als das Motiv ihrer Taten unterstellt.
Mit der so begründeten besonders schweren Schuld
wird ein Sonderstrafvollzug gerechtfertigt, der den Verurteilten nicht in Aussicht stellt, nach 12 bis 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen
zu werden. Mit der Gnade, als gewöhnliche Verbrecher behandelt zu werden, können allenfalls die rechnen, die in Form tätiger Beweise – die Kronzeugenregelung
– ein Bekenntnis zum Staat ablegen. Mit diesem Angebot an Aussteigewillige
wird umgekehrt denen, die sich den Strafverfolgungsbehörden nicht (zur Verfügung) stellen, zur Last gelegt, weiterhin am Terrorismus festzuhalten.
So, mit Strafen, die die Vernichtung des Täters in Kauf nehmen, mit der Kriminalisierung des Umfelds, mit der Verfolgung staatsfeindlicher Gesinnung exekutiert der Rechtsstaat an Terroristen einen Anspruch, der sonst seine alltägliche Behandlung der diversen Verbrecher lediglich als Ideal begleitet: Während er mit den verbotenen außerökonomischen Übergriffen auf Person und Eigentum seiner Bürger gut leben kann und bestens gerüstet reagiert, wenn sie stattgefunden haben, macht er sich hier, im Fall der terroristischen Staatsverbrecher, an die Bekämpfung des Verbrechens. Daß es sie nun nicht mehr gibt, kann er daher als seinen Sieg in diesem Kampf verbuchen. Dazu, die rechtlichen Methoden aus dem Verkehr zu ziehen, die diesen Sieg erbracht haben, sieht er sich nicht veranlaßt. Der Rechtsstaat hat damit seinen Beitrag zur Befriedung des Landes
erbracht, und nach maßgeblicher aktueller Auffassung verträgt sich dieser Frieden eben nicht damit, auch im Fall von Terroristen, die keine mehr sind, Gnade vor Recht
ergehen zu lassen.
Diplomatie mit innerstaatlichen Rechtsmitteln – „Der Fall Mykonos“
Nicht bei jeder Verletzung des deutschen Strafrechts kommt die Routine des Justizapparates wie von selbst in ihren Gang, wird gegen den Täter ermittelt, Anklage erhoben und verurteilt. In Fällen, in denen offenkundig oder zu vermuten ist, daß in politisch motivierte Straftaten andere Staaten oder deren Repräsentanten verwickelt sind, unterliegt deren Verfolgung einem generellen politischen Vorbehalt. Gemäß einer eigenen Rechtsvorschrift der Strafprozeßordnung ist sie auf Weisung des Justizministers auszusetzen, wenn sie zur zwischenstaatlichen Affaire und darüber die Gefahr eines schweren Nachteils für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführen würde.
Offenbar hat im vorliegenden Fall die politische Einschätzung, wie mit den Mördern von vier iranischen Oppositionellen rechtlich zu verfahren sei, zum umgekehrten Befund geführt: Wegen der politischen Vorteile, die man sich ausrechnete, sollte die deutsche Justiz hier den Tätern den Prozeß machen.
Die politische Führung des Iran – im „Mykonos“-Prozeß als Drahtzieher entlarvt
Dieselbe politische Berechnung, die den für politische Straftaten beauftragten Bundesanwalt ermitteln ließ und so überhaupt das Stattfinden des Prozesses ermöglichte, sorgte auch dafür, daß die Justiz genügend Stoff zur schlüssigen Abfassung einer Anklageschrift bekam. Im selben Zug, in dem man sich dazu entschloß, eine vermutete Verwicklung Teherans in das Attentat öffentlich
und damit einen politisch motivierten Mordfall zum Politikum einer zwischenstaatlichen Hoheitsfrage zu machen, öffneten sich auch viele bis dato verschlossene nachrichtendienstliche Quellen. Ein namentlich nicht genannter Zeuge C
– diese „Quelle C“ ist ein inzwischen vom Iran enttarnter ehemaliger „Geheimdiplomat“, der laufend weitere Einblicke
gewährt –, ein ehemaliger iranischer Präsident, der vom sicheren Exil aus das Gericht mit unzähligen deftigen Interna des Mullahregimes sättigte
(NZZ), und ähnlich profunde Erkenntnisse der Geheimpolizei reichten dafür, daß sich nach allen Regeln der Rechtsprechung ein kaltblütiger und politisch motivierter Mord im Auftrag Irans
und so auch ein staatsterroristischer Hintergrund
der Mordfälle in Berlin nachvollziehbar machen ließ: Der ermittelnde Bundesanwalt kam zum Ergebnis, daß Deutschland durch die Morde auf seinem Hoheitsgebiet Betroffener von Staatsterrorismus sei, weil nämlich ihn die Suche nach den niederen Beweggründen
, die Tatbestandsmerkmal von Mord sind, genau dorthin führten, die Tür zur Zentrale des iranischen Staatsterrorismus ein wenig zu öffnen
. So wurde aus einem inoffiziellen Verdacht über im Iran sitzende Hintermänner
eines in Deutschland verübten Anschlags eine von der staatlichen Ermittlungsbehörde offiziell vorgetragene Beweiskette, derzufolge nicht die geringsten Zweifel daran bestehen, daß das Attentat von der islamischen Republik Iran, und zwar von den führenden Männern beschlossen, geplant und vorbereitet
(SZ 16./17. 11. 96) worden ist.
Der Vertreter des staatlichen Rechtsstandpunkts hat in seinem Plädoyer zur Schuld- und Täterfrage ziemlich weit ausgeholt. Er hat sich – erstens – dem Schuldspruch angeschlossen, den die USA zum Zweck einer weltweiten politischen Ächtung des Iran schon seit längerem erlassen hatten. Die waren in ihrer Rolle als Weltmacht und ideeller Weltenrichter so frei und definierten sich den iranischen Staatswillen, an dem sie sich störten, gleich als rein negativen, unbedingt gegen sie gerichteten Machtwillen zurecht. Als Repräsentant des Bösen in der Weltpolitik, als Staatsterrorismus
, als ein Exemplar dieser Terroristenstaaten
eben, die ausschließlich destruktiv und ein einziger Mißbrauch der staatlichen Machtmittel sind, über die sie verfügen, galt der Iran ihnen als Staat, der das Töten fördert, um den Frieden zu zerstören
. Daß die Mullahs mit eigenen nationalen Interessen an der Golfregion aufwarteten und sich dadurch dem Ordnungsstandpunkt der USA widersetzten, definierte Amerika als den ganzen Inhalt ihres politischen Willens:Sie wollen die Region destabilisieren
. Und wenn sie sich für ihre üblen Machenschaften die Mittel suchen, gieren sie nach nuklearen und anderen Massenvernichtungswaffen.
(US-Präsident Clinton) Daher bildeten - zweitens – die Ausführungen des Staatsanwalts schon auch einen gewissen Kontrast zur bis dahin offiziell geltenden Linie der deutschen Außenpolitik mit dem Iran. Kritischer Dialog
hatte nämlich bislang das deutsche Projekt geheißen, in Konkurrenz zu den USA mit dem Iran als im Prinzip anerkanntem und von gleich zu gleich zu behandelndem Souverän zu verkehren, eben einen Dialog
zu führen. An die Klarstellung, daß man sich mit einem auf die Anklagebank der Völkergemeinschaft gesetzten Unrechtsstaat und seinen Machenschaften keineswegs gemein zu machen gedenkt, wenn man mit ihm verkehrt, wurde freilich auch gedacht. Immer und unbedingt kritisch
hatte dieser Dialog zu sein, worin sich ausdrückte, daß und wie die deutsche Außenpolitik die weltpolitische Ächtung des Iran für sich diplomatisch zu nutzen gedachte: Sie schloß sich ihr gleichsam nur methodisch an, um auf dieser Grundlage in Konkurrenz zu den USA und unter Ausnutzung der peinlichen Lage, in die die den Iran versetzt hatten, ihre Beziehungen voranzubringen.
Offenbar wollte man mit der im eingerichteten diplomatischen Dialog
-Wesen ausgesprochenen vorbehaltlichen Anerkennung des Partners Iran vorwärtsweisend Politik treiben – und hat die eigene Justiz einen dazu passenden Prozeß führen lassen: Politisch verlangt war, auch von deutscher Seite den Iran ein bißchen in das Unrecht zu setzen, das er dem Verdikt der Weltmacht zufolge darstellen soll; zu vermeiden war dabei aber, gleich das amerikanische Vorbild einer höchstoffiziellen politischen Aburteilung zu imitieren – mit einem weltpolitischen Strafgericht dieses Formats definiert man einen Delinquenten und legt sich darauf fest, unter die Beziehungen mit ihm einen Schlußstrich zu setzen.[2] Daher der Einfall, angeleiert von der Staatsanwaltschaft einem unabhängigen deutschen Gericht die Mitteilung der passenden politischen Botschaft zu übertragen. Das vertritt zwar offiziell den deutschen Rechtsstandpunkt, aber eben nur
als nicht weisungsgebundene Instanz der deutschen Gewaltenteilung, deren Spruch sich die regierende Exekutive keinesfalls außenpolitisch zueigen machen muß.
Das diplomatische Plädoyer der Verteidigung
Der politische Zweck, dem der „Mykonos-Prozeß“ gehorchte, ist von den Betroffenen in Teheran genau verstanden worden. Genau den politischen Prozeß
, den man hier aus den Verhandlungen im Kammergericht Berlin machen wollte, hat man dort ja schon seit längerem zu verhindern versucht; z.B. mit der – gewissermaßen von Staatsterrorist zu Staatsterrorist ausgesprochenen – Drohung, daß schon auch einmal iranische Gerichte über die deutsche Regierung sprechen
und deren Verwicklung in die irakische Giftgas- und Raketenproduktion bloßlegen könnten. Eine nachhaltige Verschlechterung der Beziehungen wurde der deutschen Regierung in Aussicht gestellt, und mit der das mögliche Ende des bislang für Deutschland und Europa doch so erfolgreichen Kampfes gegen die Monopolisierung der amerikanischen Rolle am Golf
(Irans Außenminister Welajati über die deutsch-iranische Interessensidentität). Offensichtlich ohne Erfolg, so daß man in Bonn vorstellig wurde und die Zumutung eines Prozesses zurückwies, der gar keiner sei, weil hinter ihm eine amerikanisch-israelisch beeinflußte
deutsche Politik als Drahtzieher stehe, und nur darauf ziele, die geistige und religiöse Führung des Iran zu beleidigen
. Diplomatisch-konstruktiv war der Protest durchaus gemeint, und während engagierte Massen im Iran die Rolle des ungestümen Volkszorns
spielten und mit Parolen über Söldner-Staatsanwälte
gegen die deutsche Botschaft zogen, distanzierten sich dessen außenpolitischen Vertreter in Bonn von ihnen und von allen in islamischem Überschwang laut gewordenen Todesdrohungen
. Ob die ausgesprochene Ächtung der iranischen Souveränität als offizielle Linie der deutschen Politik zu verstehen und zu nehmen sei, wollten sie dafür vom Bundeskanzler wissen, und forderten ihn in diesem Sinne dazu auf, sich mit einer prinzipiellen und angemessenen Stellungnahme
für den persönlichen Fehler des deutschen Staatsanwalts
zu entschuldigen. Weil man die politischen Beziehungen selbst weiter pflegen wollte, reagierte man auf die vom geschätzten Partner betriebene Verschlechterung derselben diplomatisch so, daß man bei ihm nachfragte, wie sein politischer Wille denn zu interpretieren sei, den man zur Kenntnis genommen hatte. Obwohl man es selbst besser und genau wußte, daß und wie die deutsche Justiz sich hier zum Erfüllungsgehilfen der deutschen Außenpolitik gemacht hatte, wollte man dem Kanzler Gelegenheit zu einer Äußerung geben, aus der sich eine Trennung von Recht und Politik heraus- und im selben Zug – ein Stück weit wenigstens – eine Distanzierung der Politik vom Spruch ihres juristischen Chefanklägers hineinlesen läßt. Und der Kanzler ließ sich nicht bitten:
„Die Unabhängigkeit der deutschen Justiz“
gegenüber jeglicher politischer Einflußnahme hob er in einem Brief an die iranischen Mullahs hervor; eine Verletzung der religiösen Gefühle des iranischen Volkes und seiner Führung sei wirklich nicht beabsichtigt gewesen; überhaupt könne hierzulande von politisch inspirierten Prozessen
nicht die Rede sein, und dagegen, daß ein von politischen Weisungen unabhängiges deutsches Gericht in einem Strafprozeß allein anhand der Beweislage Verbrechen aufzuklären versucht
, verbiete sich Kritik von selbst – weshalb alle vom Iran vorgebrachten Einwände nicht nur gegenstandslos seien, sondern auch noch bewiesen, wie wenig man sich dort auf Gepflogenheiten versteht, die einem Rechtsstaat selbstverständlich sind. Es sei Sache des Irans, Schlüsse daraus zu ziehen, daß die Justiz in Deutschland unabhängig sei
, ließ ein Sprecher des deutschen Außenministers vernehmen, während im deutschen Bundestag schon die fälligen Schlüsse gezogen wurden, wie mit einem Unrechts-Staat umzugehen sei. Die iranischen Beschwerden über eine politische Entgleisung der deutschen Justiz seien schon für sich genommen der Beleg, wie richtig der Bundesanwalt mit seinem politischen Urteil gelegen ist: Dessen Anfeindung sei eine Kampfansage an das ganze deutsche Volk
(Schily, SPD), ein typischer Fall von Staatsterrorismus
(Spranger, CSU) also, und schon deswegen Grund genug, die Beziehungen zu Iran abzubrechen
(MdB aller Fraktionen, SZ 23./24.11.96).
Das allerdings war von deutscher Seite nicht beabsichtigt, so daß nach der Eskalation wieder De-Eskalation
angezeigt war und man sich dahingehend mäßigte
, den Vorwurf einer politischen Justiz in Deutschland
zurückzuweisen. Gleichfalls wurden aus dem Iran Signale übermittelt, die das dortige Interesse an einer Kontinuität der diplomatischen Beziehungen aktualisierten: Eine namentliche Nennung der Staatsführung dürfe in dem zu erwartenden Urteilsspruch auf keinen Fall vorkommen, mit allem anderen könne man leben… Im selben Zug gab der deutsche Außenminister dann die politische Rechtsgrundlage bekannt, auf der von Deutschland aus die Beziehungen zum Iran weitergeführt werden sollen: Zur
„Politik der aktiven Einwirkung“
sollte sich der mit dem Iran laufende kritische Dialog
umgestalten. Diese alte Floskel hätte allzusehr das Mißverständnis
genährt, das deutsche Recht zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran wäre mit einer Rücksichtnahme auf den Partner verbunden gewesen, also womöglich dadurch beschränkt, daß der sie sich auch gefallen läßt. Deswegen sah man sich dazu veranlaßt, ihm mittels dieser kleinen Begriffs-Korrektur
(Kinkel) mitzuteilen, daß man für seine Belange einfach zuständig ist. Genau dazu sollen die vielfältigen Beziehungen und Kooperationen bis ins Geheimdienstwesen hinein von deutscher Seite aus weitergehen, und genau für diese doppelte Botschaft war das Plädoyer des Staatsanwalts in Berlin gedacht: In Anlehnung an das transatlantische politische Vorbild erledigte die deutsche Justiz den Part der Anprangerung des Iran als Zentrale des Staatsterrorismus
, womit ihm ideell alle Rechte bestritten sind, die er sich als Staat herausnimmt. Die deutsche Politik hat damit ihren, von ihr jederzeit einsetzbaren Titel, in ihrem weiteren außenpolitischen Verkehr mit dem Iran einen grundsätzlichen Vorbehalt anzumelden: Ihrer laufenden Kalkulation unterliegt es, ob und welche politischen Schlußfolgerungen sie aus den rechtlichen Feststellungen zieht, die sie sich von ihrer unabhängigen Justiz hat erstellen lassen.
„Männer ohne Gesetz“, „Schatten-“, „Neben-“ oder doch „Außenpolitik aus einem Guß“? – „Der Fall Schmidbauer/Mauss“
Eher nicht so glänzend ging eine Variante des Konzepts aktiver deutscher Einwirkung auf die Belange fremder Staaten in Kolumbien auf. Gewisse Machenschaften des hiesigen Geheimdienstes flogen auf, weil sie vom dortigen Staat als Untergrabung seiner Souveränität gewertet wurden. Was genau der BND dort zu suchen hatte, war hierzulande nicht von Interesse, irritiert hat die Öffentlichkeit auch nicht, daß ein deutscher Staatsminister sich zu reger Kontaktpflege mit Drogenbossen und anderen Kriminellen veranlaßt sah. Dafür hat sie umso mehr die spannende Frage beschäftigt, ob der BND und sein Minister auch durften, was sie taten; ob sie nicht geltendes Recht verletzt hätten, und zwar nicht das von Kolumbien, sondern das deutsche, nämlich die souveräne Zuständigkeit der deutschen Außenpolitik; ob sie nicht überhaupt in einem rechtsfreien Raum
agierten. Die leicht absurde Frage, ob das Wirken der geheimen Dienste denn auch Rechtens sei, brachte an verantwortlicher Stelle natürlich niemanden in Verlegenheit: Der schlichte Verweis auf den politischen Auftrag, den der BND wahrnimmt, stellte die geltende Rechtslage klar.
Der Skandal: Eine „Panne“ in einer „Grauzone“ namens Schmidbauer
In der Rubrik der Erfolge und Drangsale der deutschen Außenpolitik kommen die Leistungen des geheimen Auslandsdienstes nicht oft vor. Wenn ihm ein Coup gelingt, dessen Veröffentlichung opportun erscheint, ist von ihm die Rede; manchmal wird er als Quelle von Erkenntnissen
zitiert, mit denen ein politischer Kontrollbedarf angemeldet wird. Ansonsten richtet sich die öffentliche Aufmerksamkeit nur dann auf ihn, wenn bei seinen vielen Machenschaften ein Mißerfolg ruchbar wird und darüber auffliegt, daß und wie im einzelnen er in auswärtige Angelegenheiten verstrickt ist – und nur dann hält die demokratische Öffentlichkeit sein Wirken für kritikwürdig. Regelmäßig gerät dann auch noch das personifizierte Bindeglied zwischen der Bundesregierung und ihrem Nachrichtendienst mit ins Zentrum des öffentlichen Interesses, und ein demokratischer Skandal ist perfekt. Der besteht darin, eine gewisse Zeitlang den Verdacht einer Art Nebenaußenpolitik mit geheimdienstlichen Mitteln
(FR) zu nähren, um dann mit dem Vorwurf der mangelnden parlamentarischen Kontrolle
das Wirken des BND vollends von der Interessens- und Auftragslage seines politischen Dienstherrn zu trennen. Und in denselben Zeitungen, die so furchtbar kritisch fehlende Rechtsgrundlagen
beklagen und nach Grenzen für Grauzonen
rufen, wird man eher nebenbei davon in Kenntnis gesetzt, auf welchen höchstoffiziellen politischen Wegen der deutsche Geheimdienst und sein Mauss nach Kolumbien gelangen. Da laufen ein halbes Jahr lang auf höchster Ebene Kontakte zwischen Bonn und Bogotá, in denen beide Seiten Möglichkeiten eruieren, wie Deutschland sich erfolgreich in einen Friedensdialog in Kolumbien
einklinken könne. Die Vertreter des kolumbianischen Staates werden in Bonn mit dem Antrag vorstellig, Deutschland solle seine politische Macht und seinen Einfluß dazu verwenden, nach zwei Seiten der staatlichen Souveränität Kolumbiens beizustehen: Nach innen sollen sie dabei mithelfen, selbige überhaupt erst wirksam herzustellen, im Wege der Vermittlung eines Waffenstillstands mit den Drogenkartellen
und diversen Guerillas
, die knapp die Hälfte des Landes kontrollieren. Und nach außen sollte der Dienst an der kolumbianischen Souveränität in Hilfsleistungen bestehen, sich von den Diktaten zu emanzipieren, die die USA der kolumbianischen Regierung für ihren Umgang mit den Kokainproduzenten aufgeherrscht haben und die in ihrer Summe darauf hinauslaufen, daß der Staat Kolumbien ohnehin am besten von der amerikanischen Drogenpolizei regiert wird. Deswegen gerät die Liste der an diesem Friedensdialog
Beteiligten relativ ausführlich und umfaßt auch Regierungschefs, die sich schon aus vielen anderen Zusammenhängen gut kennen: Die bekommen es hier miteinander zu tun, weil sie spätestens mit dieser politischen Offerte an Deutschland ganz offiziell Konkurrenten um politisch bestimmenden Einfluß in Kolumbien geworden sind: Akteure waren der kolumbianische Präsident Ernesto Samper und Innenminister Horacio Serpa Uribe, Bundeskanzler Kohl, dessen Staatsminister Bernd Schmidbauer sowie der als Vermittler eingespannte deutsche Privatagent Werner Mauss und dessen Frau Ida. US-Präsident Bill Clinton, der nicaraguanische Sandinistenführer Daniel Ortega und kolumbianische Diplomaten waren eingeschaltet.
(FR) Politische Funktionäre des deutschen Geheimdienstes wie Schmidbauer und private Subunternehmer wie Mauss nebst Gattin sind für diesen Dialog
genau richtig, weil hier die außenpolitischen Interessen Deutschlands nur jenseits der ansonsten zwischen Staaten geübten diplomatischen Routine zu verfolgen gehen: Die Vermittlungen
zwischen einer souveränen Regierung einerseits und den von ihr verfolgten Drogenbossen
und anderen Rechtsbrechern andererseits mögen sich zwar ganz offiziell um den Bestand des Staates Kolumbien selbst drehen und auch auf dessen eigene Veranlassung betrieben werden – offiziell mit einem organisierten Verbrechen
können die dafür nötigen Kontakte aber schlecht gepflegt werden. Und eine Geheimhaltung dieser deutschen Einmischung in Kolumbien ist erst recht deswegen gefragt, weil sie zwar de facto die Bestreitung eines amerikanischen Einflußbereiches und Eingriffsrechtes ist und sein soll, im Verhältnis zu den USA aber als das genau nicht erscheinen soll: Im Wissen darum, daß er in einem bislang exklusiv amerikanischen Einflußbereich den politischen Einfluß Deutschlands etablieren will, erkundigt sich der Kanzler beim amerikanischen Präsidenten, ob der gegen die Machenschaften des Konkurrenten etwas unternehmen würde; die diplomatisch-höflich erteilte Zusage Clintons, einen von Deutschland vermittelten Friedensprozeß zu unterstützen
(FR), läßt sich als Duldung der deutschen Einmischung interpretieren – daß sie nur das war, machen dann offizielle amerikanische Stellen deutlich, die klarstellen, daß von einer Unterstützung der deutschen Vermittlungstätigkeiten in Kolumbien keine Rede sein kann. Jedenfalls wird dem Kanzler das deutsche Engagement nicht offiziell verboten, so daß seine inoffiziellen Dienstleister grünes Licht haben. Die kennen sich nicht nur theoretisch in allen Fragen aus, die die innere politische Stabilität
in einem Land, seine militärischen Potenzen, strategischen Ressourcen und überhaupt alles, was für den Unterhalt der dort ansässigen Staatsmacht relevant ist, betreffen; die verfügen auch über die nötigen Mittel und Methoden, operativ
tätig zu werden und den politischen Willen zur Einmischung selbst praktisch ins Werk zu setzen.
Entsprechend walten sie vor Ort ihres Amtes. Ins Land gekommen sind sie diesmal zwar mit Willen und Wissen der kolumbianischen Staatsführung und mit Hilfe vieler ganz offizieller staatlichen Stellen, dort wie hier. Was sie dort aber tun, ist alles, was Deutschlands Projekt dient, in diesem Staat seinen eigenen Einfluß zu mehren. An der kolumbianischen Souveränität vorbei auch mit jenen Kräften
, die deren Bestand bestreiten, politische und andere Deals
einzufädeln – das ist eine der Methoden der Wahl, mit denen sich Deutschland in Kolumbien zu einem Faktor
– innen- wie außenpolitisch – zu machen gedenkt. Dazu gehört, im jeweiligen Bedarfsfall auch gegen den Willen der amtierenden Regierung, der man bei ihren Problemen so gerne behilflich ist, die Verhandlungen
zu führen, die dem Zweck dienen. Also setzt man sich auch – in deutschem Interesse und von Deutschland mit allen erforderlichen Mitteln zur verdeckten Abwicklung der heiklen
Aufgaben ausgestattet – über staatliche Verbote hinweg, mit welchen Guerillas
, Entführungskartellen
oder sonstigen maßgeblichen Machtparteien der Rauschgiftindustrie überhaupt zu verhandeln sei. Dabei kann man aber, selbst in Kolumbien offenbar noch, von der Staatsmacht erwischt werden, und dann wird im Zusammenhang mit dem vermittelten Freikauf einer deutschen Geisel auch einmal bekannt, daß dieser praktizierende Humanist mit den vielen gültigen deutschen Reisepässen mit Hilfe dieser und anderer Erpressungen ganz andere Geschäfte in Gang gebracht hat. Wie man hört, bestanden seine schon mehrfach erprobten Exklusivbeiträge zu den Friedensgesprächen
in Kolumbien u.a. darin, vom Staat bekämpften Guerillagruppen ein Mehrfaches der ursprünglich geforderten Lösegeldsumme zukommen zu lassen, wobei sich die Angehörigen der Entführten über unnötige und unverständliche Erschwerungen der laufenden Verhandlungen
und die namhaft gemachten Entführer darüber beschweren, daß sie niemanden entführt hätten …
Klarstellungen in Sachen politischer Kontrolle von Mauss & Co.
In der öffentlichen Diskussion über die aufgeflogenen Machenschaften der verdeckten Abteilung der deutschen Außenpolitik sind die politischen Interessen, derentwegen sie überhaupt unternommen werden, nicht Thema. Die peinliche Bloßstellung von deutschen Geheimdienstaktivitäten wird auf die Abwesenheit der rechten politischen Kontrolle zurückgeführt, um so die unbedingte Allgemeingültigkeit des Rechts nach innen anzumahnen. Daß in den Beziehungen des politischen Souveräns nach außen dieses Recht keineswegs der Maßstab sein kann, an dem er sich zu orientieren hätte, seine Außenpolitik vielmehr ausschließlich am Erfolg seiner Bemühungen zu messen ist, steht damit fest: Einer dieser kritischen Schreiber, der hochtrabend darauf beharrt, daß für staatliches Handeln auch in Grauzonen ethische Normen und rechtliche Grundsätze gelten
, meint damit genau genommen nur, daß ein so dubioser
Agent wie Mauss die auftraggebende Instanz diskreditiert, die ihn gebraucht. Er landet daher zielstrebig bei folgendem Bekenntnis zu allem, was in der Außenpolitik zur Wahrung deutscher Interessen und Rechte bei der Wahl von Mitteln und Methoden einfach sein muß: Daß die Bundesregierung eine Person braucht, die sich um Operationen außerhalb von Normalität und Routine kümmert, ist unbestritten. Besondere Gaben und Erfahrungen, mindestens aber Fingerspitzengefühl, Ideenreichtum, Beziehungen und Klugheit, sind Eignungsvoraussetzungen, weil in außergewöhnlichen Fällen unkonventionelle Methoden angewendet werden müssen. Zu berücksichtigen ist auch, daß heikle Verhandlungen in Regionen und Staaten zu führen sind, deren innere Zustände nicht an mitteleuropäischen Standards zu messen sind. Schließlich ist es so, daß dabei häufig auf Zwischenträger und Mittelsmänner gesetzt werden muß, die kein Leumundszeugnis der Bonner Polizei vorzuweisen haben.
(FR) Die Suche nach moralischen und rechtlichen Maßstäben der deutschen Außenpolitik in ihren Grauzonen
hat so ihr eindeutiges Kriterium: Die Anliegen Deutschlands selbst sind es, die ihre Unanfechtbarkeit in jeder Hinsicht verbürgen; wo Zweifel hinsichtlich ihrer Methoden aufkommen, ist mit Bezug auf die besonders schwierige Lage, in der es deutsche Interessen zu wahren gilt, erstens darauf hinzuweisen, daß sie in jedem Fall notwendig sind; zweitens muß entschieden angemahnt werden, auch wirklich nur auf die Mittel zurückzugreifen, die den beabsichtigten Erfolg garantieren – dann kommt das Wirken des deutschen Geheimdienstes auch nicht mehr ins Gerede
.
Ein bißchen über es zu reden ist in einer guten Demokratie allerdings doch noch, dort nämlich, wo die Opposition aus dem Skandal Schmidbauer/Mauss
einen der Regierung zu machen sucht. Der peinliche Auslandsauftritt des Geheimdienstes bietet ihr Gelegenheit zur Anfrage, wie denn eine Politik mit Staaten wie Kolumbien, die nicht besonders viel Respekt vor deren Souveränität verrät, zur sonst doch so zivilisierten deutschen Außenpolitik paßt. Sie sagen also, es gibt offensichtlich Staaten minderen Rechts, in denen Sie sich ein Interventionsrecht anmaßen.
(Schily, SPD, Bundestagsdebatte v. 4. 12. 96) Darauf ein politischer Experte für Staatsrecht mit der bündigen Zusammenfassung aller Reflexionen, die die kritische deutsche Öffentlichkeit umtreibt: Man kann nicht ein Land wie Kolumbien … an klassischen außenpolitischen Standards messen und … von Souveränität reden. Hier mischt sich international organisierte Kriminalität … mit einem desolaten Zustand des Staates, dem man in vielfältiger Weise mit Mitleid und Hilfsbereitschaft begegnen muß.
(Scholz, CDU, ebda.) Im Prinzip ist es generell so, daß Deutschland einige Staatswesen – Kolumbien ist da offenbar nur ein, weil gerade Thema gewordener Fall – überhaupt nicht als Souveräne respektiert, im Prinzip muß die deutsche Politik im Umgang mit denen immer auf diese vielfältigen Instrumente und Methoden jenseits der klassischen
diplomatischen Höflichkeiten zurückgreifen. Das mag im vorliegenden Fall zwar nicht so glänzend ausgegangen sein, spricht aber nicht gegen das Prinzip, das im übrigen auch aus humanitären Gründen unanfechtbar ist. Deutscher Imperialismus ist grundsätzlich ein Akt zwischenstaatlicher Barmherzigkeit, der BND daher nur Mittel, weltweit in Souveränitätsnot geratenen Staaten zu helfen. Über einen ähnlichen Humanismus des Geheimdienstwesens hat einmal ein deutsches Parlament laut gelacht; aber das war bei Mielke.
Die Fortentwicklung der deutschen Rechte im Osten
In ihrem außenpolitischen Verkehr mit Tschechien ist der deutschen Außenpolitik ein schönes Kunstwerk gelungen. Der politische Souverän des deutschen Rechts hat sich seinem östlichen Nachbarn gegenüber im Grunde genommen höchst unsouverän präsentiert. Er hat auf das unveräußerliche Eigentumsrecht verwiesen, das die Bürger unter seiner Hoheit genießen, und sich zum unbedingten Diener dieses Rechts erklärt. Gewisse Eigentumsansprüche, die einige seiner Bürger außerhalb seiner Hoheit, in Tschechien nämlich, anmelden, wären daher für ihn unmittelbar verbindlich – als Auftrag nämlich, ihnen im politischen Verkehr mit Tschechien Recht zu verschaffen. Als Anwalt seiner Bürger verlangte er auch vom dortigen Souverän deren Anerkennung, bestritt also im Namen desselben Rechtsguts, das er seinen Bürgern schützt, der tschechischen Republik, daß Eigentumsfragen auf ihrem Boden ihrer Rechtshoheit unterliegen. Als Rechtsgehilfe seiner Untertanen machte er sein staatliches Recht geltend, in Fragen der Ausübung der tschechischen Souveränität mitzubestimmen, so daß die Rechtsansprüche sudetendeutscher Privatpersonen zum Berufungstitel dafür wurden, über den hiermit angemeldeten diplomatischen Vorbehalt mit Tschechien zu verhandeln. Ein schöner Ausgangspunkt für die Konstruktion einer gemeinsamen Erklärung.
Die „deutsch-tschechische Aussöhnungserklärung“
Reden und Mienen von Kohl und Klaus in Prag brachten nicht nur die Gemütslage, sondern, gefiltert durch die parteiliche Brille, auch die Interessenlage beider Länder auf den Punkt. Der tschechische Regierungschef hob hervor, die Erklärung hinterlasse keinen Sieger und keinen Verlierer. Von einem eigenen Erfolg wußte er nichts zu berichten; eher schon von seiner Hoffnung, die Drangsal der tschechischen Nation habe nun ein Ende: Schlußstrich
. Der im Saal anwesende Urheber dieser Drangsal sprach von einem erfolgreichen Schritt in die Zukunft und ließ zugleich wenig Zuversicht aufkommen, der deutsche Sondertitel „Aussöhnung“ sei nun aus der Welt: Doppelpunkt
. Der Tscheche verkniffen-nüchtern, der Kanzler gewichtig-kühl: Irgendeine betont freundschaftliche Geste hätte zum Inhalt der gemeinsamen Erklärung auch gar nicht gepaßt. Was die aufmerksame Presse des Auslands auf ihre Art eifersüchtig argwöhnte,[3] stimmt: Das Papier dokumentiert und unterzeichnet den politischen Anspruch Deutschlands auf ein nationales Exklusivrecht in Osteuropa. Es erntet die (vorläufigen) Früchte seines Junktims zwischen „Versöhnungsbereitschaft“ und „europäischer Integration“. Der Text beweist das.
In der Präambel – niedergelegt „in der Überzeugung, daß zugefügtes Unrecht nicht ungeschehen gemacht, allenfalls gemildert werden kann und daß dabei kein neues Unrecht geschehen darf; und im Bewußtsein, daß die Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme der Tschechischen Republik in die EU und die NATO nachdrücklich und aus der Überzeugung heraus unterstützt, daß dies im gemeinsamen Interesse liegt“ – bekennen die Unterzeichnenden sich nicht nur zu der Sonder-Beziehung, die sie einmal hatten, sondern auch zu ihrem Willen, ein besonderes Verhältnis zwischen sich erneut zu etablieren. Die Stilisierung der alten Kriegsgegnerschaft zu einem unverwüstlichen „Unrecht“, das nach Aufarbeitung schreit, ist Vehikel für die zarte Erinnerung an den Status und die Absichten beider Nationen heute: Wenn Tschechien dorthin will, wo die Deutschen schon sind, dann erfolgt das gemeinsame Wort zur Vergangenheit im vollen Bewußtsein eines ungleichen Kräfteverhältnisses und ungleicher Interessenlagen. Unzweideutig, wer hier wen und wohin führt; präzise beim Namen genannt, womit Deutschland die Tschechen am Wickel hat: Die Materie ihrer Erpreßbarkeit ist der unbedingte Anschlußwille an Europa und NATO; dafür setzen sie auf deutsche Anwaltschaft.[4] Und um die geneigte Fürsprache der europäischen Führungsmacht zu erringen, lassen sie sich einiges ins Stammbuch schreiben:
Ziffer 1: „Teilen heute gemeinsame demokratische Werte, sind den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer Politik des Friedens verpflichtet; sind sich zugleich bewußt, daß der gemeinsame Weg in die Zukunft ein klares Wort zur Vergangenheit erfordert, wobei Ursache und Wirkung in der Abfolge der Geschehnisse nicht verkannt werden dürfen.“ – Ohne Klärung der Vergangenheit no future? Warum die Einschränkung bei so viel Gemeinsamkeit? Unverkennbar, worauf die Betonung bei heute geteilten Werten liegt. Den Tschechen wird nahe gebracht, daß Deutschland ihren Systemwechsel sogleich als günstige Gelegenheit für seine Ansprüche an die gewendete Republik behandelt. Ruhe, die „offengelassene Sudetenfrage“ betreffend, ist mit dem Ende des Sozialismus nicht verbunden. Die renovierten Grundsätze beflügeln vielmehr die Erwartung, der Tschech möge sich nun empfänglich zeigen, mit „einem klaren Wort“ die „Vertreibung“ zu beichten. Die Änderung der Staatsräson wird wie ein Wahrheitsbeweis genommen: Wer mußte zu Demokratie & Marktwirtschaft denn erst konvertieren? Na bitte. Wer bis gestern nach dem falschen Gebetbuch gelebt hat, muß doch wohl zugeben, daß Rechtsstaaten immer ein bißchen rechter haben als frühere „Unrechts“-Staaten. Also unterschreibt unsere Sichtweise, sonst gibt’s heute kein morgen. Die Schuldfrage ist zur Bedingung einer gemeinsamen Zukunft erklärt.
Darauf haben die Tschechen sich eingelassen. Der löbliche Vorsatz, dabei Ursache und Wirkung nicht verwechseln zu wollen, hilft aus der Falle, die ihnen der deutsche Antrag gestellt hat, deshalb nicht mehr heraus. Weil hier keine Wissenschaftstheoretiker, sondern Diplomaten am Werk sind, ist ihnen nämlich klar, über welche Sache sie mit „Ursache und Wirkung“ so eigentümlich methodisch verhandeln: Nazi-Deutschland hat Böhmen/Mähren einkassiert, den Krieg verloren und das Gelände zurückgeben müssen; dann haben die Tschechen die Sudetendeutschen zu einer Sippschaft von Besatzern und Kollaborateuren erklärt und aus dem Land geworfen. Das erste ist die eine, das zweite die andere Sache. Um daraus eine staatsmoralische Schuldfrage zu konstruieren, muß man beide „Ereignisse“ als zwei Fälle verurteilenswerten Unrechts hinstellen und großzügig konzedieren, daß das eine wohl etwas mit dem anderen zu tun haben könnte; das eine vor dem anderen stattgefunden habe und vielleicht sogar Auslöser war. Eine Gleichgewichtung beider mußte Tschechien also nur abwehren, weil es sich der gleichmacherischen Aufrechnung von Schuld zugänglich gemacht hat. Für die deutsche Arithmetik ist die Tür damit offen: Erst wird die „Kriegs-“, dann die „Kriegsfolgeschuld“ bedauert.
Ziffer 2: „Die deutsche Seite bekennt sich zur Verantwortung für ihre Rolle in der historischen Entwicklung, die zum Münchner Abkommen von 1938, der Flucht und Vertreibung von Menschen aus dem tschechoslowakischen Grenzgebiet sowie zur Zerschlagung und Besetzung der Tschechoslowakischen Republik geführt hat; bedauert das Leid und das Unrecht, das dem tschechischen Volk durch die nationalsozialistischen Verbrechen der Deutschen angetan wurde; ist sich auch bewußt, daß die nationalsozialistische Gewaltpolitik gegenüber dem tschechischen Volk dazu beigetragen hat, den Boden für Flucht, Vertreibung und zwangsweise Aussiedlung nach Kriegsende zu bereiten.“ – Wenn Staaten einen Krieg nicht nur verloren haben, sondern auch förmlich verloren geben, so beruht dieses Eingeständnis immer auf dem Diktat der Siegermächte und hat in der Regel Konsequenzen: für den Verlierer. Er zahlt den geforderten Preis seiner Niederlage, hat selber nichts zu melden und muß schauen, wie er mit seiner zurechtgestutzten Größe zurandekommt. Hier wird der Spieß umgedreht: Wo „zugegeben“ wird, was jeder weiß und international verbindlich seit 52 Jahren feststeht (‚Deutschland hat das Schlachten angefangen und schlußendlich kapituliert‘), da will eine Nation – auf Grundlage ihres Wiederaufstiegs in die Erste Liga – das Eingeständnis von Kriegsschuld honoriert wissen. Das Bekenntnis soll als extra Leistung zählen und das Recht auf eine Gegenleistung begründen.
Die Forderung der alten CSSR, Bonn solle das Münchner Abkommen und damit die Annektion des „Reichsprotektorats Böhmen und Mähren“ von Anfang an für null und nichtig erklären, ist mit dieser Erklärung vom Tisch. Im vorliegenden Text wird Hitlers Weltmachtpolitik in das erste, aber keineswegs einzige Glied einer Verkettung unglücklicher Umstände verfabelt. Und Unbill kam über das tschechische Volk nur „durch nationalsozialistische Verbrechen“. Daß der Anschluß kein Fehltritt war, sondern „Unrecht“ als Staatsakt, sagen wir gerade nicht. Was die tschechische Führung als „Vertreibung“ immer zugeben soll – „Es war Unrecht! Bekennen Sie sich zu den Verbrechen!“ (Waigel) –, soll für den Weltkrieg der Deutschen nicht gelten. Nicht vom politischen Willen selbst wird sich distanziert, sondern vom „Leid“, das er so mit sich brachte… Angesichts dieses deutschen Bedauerns soll nun den Tschechen gar nichts anderes übrig bleiben, als ihrerseits zu gestehen. Eine süße Logik: Wenn es eine „deutsche Seite“ gibt, die Dreck am Stecken hat und dazu steht, dann muß die zweite „Seite“ ebenfalls Schuld auf sich geladen haben. Deren Unterschrift steht aber noch aus! Indem Deutschland sich großmütig der Unterwerfung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ bezichtigt, legt es der CR noch in Ziffer 2, dem Betränen seiner Kriegsschuld (damit auch den Boden für…
), das Zauberwort …Vertreibung
in den Mund. Wenn die Deutschen Selbstanzeige erstatten, durch die Besetzung an der späteren „Vertreibung und zwangsweisen Aussiedlung“ mitschuldig geworden sein zu sein, müssen die Tschechen zugeben, daß sie diese Taten begingen. Taten zudem, die – im Unterschied zum „längst gesühnten“ Krieg – noch eine Rechnung „offengelassen“ haben:
Ziffer 3: „Die tschechische Seite bedauert, daß durch die nach Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen, die Enteignung und Ausbürgerung unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt wurde, und dies auch angesichts des kollektiven Charakters der Schuldzuweisung; insbesondere die Exzesse und darüber hinaus, daß es auf Grund des Gesetzes Nr. 115 von 8. Mai 1946 ermöglicht wurde, diese als nicht widerrechtlich anzusehen, und daß infolgedessen die Taten nicht bestraft wurden.“ – Daß die CR überhaupt rechtfertigend zu einem Hoheitsakt Stellung nimmt, mit dem der damalige Souverän sein Staatsvolk definierte, ist die Antwort auf den bundesdeutschen „Sudeten“-Vorbehalt. Als selbsternannter Rechtsnachfolger des Dritten Reiches stellte die BRD nämlich klar, daß die Absage an die „Greueltaten NS-Deutschlands“ keine Absage an die Rechte beinhaltet, die auf dessen Macht gründeten. Verlorene Rechte sind keine verspielten Rechte. Wenn sie auf „ihrem“ Recht herumreitet, das ihr „genommen“ wurde, macht sie geltend, daß ein im Krieg vergeigtes Recht geradesogut ist wie ein erworbenes. So wurde die vermeintlich olle Kamelle „Sudetenfrage“ zur jederzeit wiederbelebbaren diplomatischen Waffe.
Ganz bekommen haben die Deutschen aber nicht, was sie verlangten. Zum totalen Staatsschuldeingeständnis wollten die Tschechen sich nicht hinreißen lassen. Aber das war ja auch kaum zu erwarten, daß sie dem fundamentalen Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihrer souveränen Machtausübung über ein Stück Volk einfach stattgeben. Abwenden konnten sie die deutsche Maximalforderung aber nur, indem sie etwas zugeben, was deren Sichtweise sehr nahekommt. Eingeräumt werden zwar bloß Auswüchse bei „der Vertreibung unschuldiger Menschen“, das Geständnis läßt aber weder den politischen Beschluß zur Ausbürgerung noch das Recht ungeschoren, das die Übergriffe legalisierte. Durch „kollektive Schuldzuweisung“ die Sudetendeutschen als Agenten ihrer Herrschaft zur Lynchjustiz und Abschiebung freigegeben; kein „Transfer“ von Menschen „heim ins Reich“, sondern eben doch eine „Vertreibung“ (was einen angestammten Ort unterstellt, wo sie hingehören): Das Bekenntnis zu den Benesch-Dekreten konnte widersprüchlicher nicht ausfallen. Alles denkbar Schlechte wird ihnen nachgesagt – Exzesse ermöglicht, deren Verfolgung vereitelt –, bis auf eines: Daß sie selber Unrecht waren.[5]
Ziffer 4: „Entschlossen, dem gegenseitigem Einvernehmen Vorrang einzuräumen, wobei jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt und respektiert, daß die andere Seite eine andere Rechtsauffassung hat; erklären deshalb, daß sie ihre Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden politischen und rechtlichen Fragen belasten werden.“ – Unmißverständlicher könnte die Formulierung, um die lange gerungen wurde, die Normalität und die Eigenart des deutsch-tschechischen Anerkennungsverhältnisses kaum zu Protokoll geben. Zum einen ist der Respekt, den zwei Souveräne einander zollen, stets ein bedingter. Sie dulden sich, also lauert in seiner Gewährung der Übergang zur Aberkennung. Das ist immer so zwischen Gewaltmonopolen, und sie sind daran gewöhnt. Ist dieses „Leider“, das in jeder Anerkennung wohnt, jedoch der Erwähnung wert, dann ist etwas Besonderes im Busch. Nur weil eine Seite daran gerüttelt hat, muß eigens betont werden, daß „jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt“; in diesem Fall gilt der Respekt ausdrücklich nicht dem Recht des anderen, sondern der Andersartigkeit seiner Rechtsauffassung. Und zwar arschklar einer Andersartigkeit, die sehr einseitig den Deutschen nicht paßt.[6] Andererseits haben die Tschechen mit der Teil-Kritik an den „Vertreibungs“-Dekreten unterschrieben, daß der Vorbehalt gegen ihre Souveränität nicht einfach aus der Luft gegriffen oder auf deutschem Mist gewachsen, sondern berechtigt ist.
Geradezu zwingend folgt die Frage, was das Kunststück, die Bekundung eines unüberbrückbaren Gegensatzes „Aussöhnung“ zu taufen, für den zwischenstaatlichen Verkehr bedeutet. Die den Hader nicht mal groß verhüllende Beteuerung, dem Einvernehmen in der Beziehungskiste „Vorrang einzuräumen“ – die Herrschaften wollen sich beherrschen! –, ist darum das Gegenteil einer Versicherung, daß dies auch so bleibt. Deutschland – nicht Tschechien, das hat ja gar keinen Einwand gegen deutsches Recht! – dokumentiert seinen Willen, aus dem Imperfekt „herrührende“, also keineswegs entschärfte Munition „nur“ dann einzusetzen, wenn es opportun erscheint: Alles andere würde das Verhältnis über Gebühr belasten. Streit ist schließlich kein Selbstzweck, sondern soll Mittel für das Eigentliche sein: nützliche Beziehungen eben. Dieses offene Geständnis – das Versprechen, europäisches Geschäft und nordatlantische Osterweiterung dem Sudetenvorbehalt nicht zu subsumieren, sondern diesen zum Instrument für jenes zu machen – wird der Tschechischen Republik wie ein einziges Zugeständnis verkauft. Und die setzt darauf.
Gerade so, als wollten beide sich daran erinnern, daß das strittige Objekt der Begierde nicht bedeutungslos geworden ist, gilt die ungeteilte Aufmerksamkeit der zweiten Hälfte der Erklärung deshalb ausschließlich dem Gewicht, das die soeben scheinbar ad acta gelegte Sudetenfrage weiterhin genießen soll. Sie darf „im gegenseitigen Einvernehmen“ am Kochen gehalten werden:
Ziffer 5: „Beide Seiten bekräftigen ihre Verpflichtungen, die Rechte der Angehörigen der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik und von Personen tschechischer Abstammung in der Bundesrepublik Deutschland zu fördern; sind sich bewußt, daß diese Minderheit und diese Personen in den beiderseitigen Beziehungen eine wichtige Rolle spielen.“ – Man beachte den feinen Unterschied. Erstere Personen heißen Minderheit, weil sie sich im Ausland als völkisches Kollektiv nicht nur betrachten, sondern auch benehmen: In ihren Volkstänzen zelebrieren sie einen deutschen Rechtstitel. Letztere Minderheit sind bloß Personen, weil sie sich im Ausland nicht als politische Geschöpfe bewegen und z. B. tschechische Straßenschilder aufstellen, sondern bestenfalls als multikulturelle Farbtupfer des Unterhaltungsüberbaus auffällig werden: Karel Gott und Jiri Nemec singen und kicken für ihren Geldbeutel. Eine gemeinsame Erklärung erfordert eben deren gemeinsame Erwähnung; als was sie erwähnt werden, läßt erahnen, welche Volksgruppe diesseits und jenseits der Grenze hier förmlich ermuntert wird, ihre zwar eingeordnete, aber immerhin berechtete „Identität“ zu pflegen. Auch wenn „der Knackpunkt ausgeklammert wurde“ (Sudetenchef Neubauer) – zur „Rückgabe“ von Häuschen und Ländereien wollte die CR sich einfach nicht verstehen –, vielleicht ist ja schon ein Einfallstor offen:
Ziffer 6: „Sind überzeugt, daß der Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union und die Freizügigkeit in diesem Raum das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen weiter erleichtern wird; geben ihrer Genugtuung Ausdruck, daß wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit einschließlich der Möglichkeit selbständiger und unternehmerischer Tätigkeit erzielt worden sind; sind bereit, bei der Prüfung von Anträgen auf Aufenthalt und Zugang zum Arbeitsmarkt verwandtschaftliche, familiäre und weitere Bindungen besonders zu berücksichtigen.“ – Überaus konsequent, in welcher Hinsicht Europa ein zweites und letztes Mal auftaucht. Die Integration Tschechiens in die EU buchstabiert sich umstandslos als dessen Unterordnung. Nachdem Deutschland eingangs Unterstützung für dessen EU- und NATO-Ambitionen zusicherte, kommt nun auf den Tisch, was der Mentor sich davon verspricht: „Weitere Erleichterung des Zusammenlebens“, also mehr Dampf hinter deutschen Rechten in der CR; noch mehr Niederlassungsfreiheit für deutsche Unternehmer, Pressehäuser und Grundeigentümer; verstärkte „Berücksichtigung familiärer und weiterer (!) Bindungen“; zusammenfassend: Europa ist der neue modus vivendi des Rechts auf Heimat. Das eine schließt das andere gerade nicht aus, sondern ein. So frohlockte der CSU-Abgeordnete Koschyk am Tag der Unterzeichnung: „Im Zuge des Heranrückens Prags an die EU sollte zudem das Heimatrecht der Sudetendeutschen verwirklicht werden“. Kaum war die Tinte trocken, wollte auch der oberste Deutsche keine Minute länger bei sich behalten, daß „die Eigentumsfrage natürlich weiter offen ist.“ Dabei ist die – von Prag sofort als „schockierend“ bezeichnete – Äußerung keineswegs eine Entgleisung Kohls, sondern eine klare Aussage darüber, auf welchem Weg in wessen Zukunft die Versöhnungserklärung ein Meilenstein sein soll: Mit ihr unterstreicht der Kanzler den Anspruch, aus der speziellen Pflege gemeinsamer Beziehungen ein deutsches Sonderrecht für den osteuropäischen Raum zu schmieden – und dabei in der ökonomischen Vormachtstellung Deutschlands in der europäischen Konkurrenz über einen Hebel für eine politische Neuordnung zu verfügen, die kein „Revanchismus“ mehr ist.[7]
Ziffer 7: „Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds (Deutschland zahlt 140 Mio. DM, die CR 20-25 Mio.); wird der Finanzierung von Projekten gemeinsamen Interesses dienen (Jugendbegegnung, Altenfürsorge, Sanatorienbau und -betrieb, Pflege und Renovierung von Baudenkmälern und Grabstätten, Minderheitenförderung, ökologische Projekte, Sprachunterricht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit); die deutsche Seite bekennt sich zu ihrer Verpflichtung und Verantwortung gegenüber all jenen, die Opfer nationalsozialistischer Gewalt geworden sind; in Frage kommende Projekte sollten insbesondere diesen Opfern zugute kommen.“ – Kurzum: Es wird auf allen Ebenen und quer durch die Generationen weiter rumort, unter besonderer Berücksichtigung unserer geliebten Minderheiten, die nicht aussterben dürfen (sudetendeutsche Seniorencenter, deutsch-tschechische Froschteiche). Nebenbei erfahren die noch lebenden Überreste „nationalsozialistischer Greueltaten“, was sie auf keinen Fall brauchen und kriegen: „Entschädigung“ durch DM. Sondern Projekte zur Gesinnungspflege.
Ziffer 8: „Stimmen darin überein, daß die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen, insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der gemeinsamen Erforschung bedarf; daß die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit der deutsch-tschechischen Historikerkommission fortgeführt und der deutsch-tschechische Dialog unter Schirmherrschaft beider Regierungen und Beteiligung aller an einer engen und guten deutsch-tschechischen Partnerschaft interessierten Kreise gepflegt werden soll.“[8] – Ein schönes Schlußwort: Die Versöhnungserklärung erklärt, daß die unversöhnlichen Standpunkte weiterer „Erforschung“ bedürfen. Wahrlich kein akademisches Forschungsprojekt.
Fazit: Die umstrittene Frage der Deutung der Bedeutung des Schriftstücks – „Schlußstrich oder Doppelpunkt?“ – ist beantwortet. Das Ding ist in jeder Hinsicht ein Doppelpunkt. Der deutsche Vorbehalt ist nicht vom Tisch, auch nicht auf Eis, sondern quicklebendig. Für diesen Beweis hätte es nicht mal Kohls Bemerkung bedurft, daß an der Eigentumsfront weiter gebohrt wird. Sie macht nur explizit, was hinter dem Doppelpunkt steht: Die deutsche Osterweiterung kommt voran.
Warum es den deutschen Kanzler allerdings gejuckt hat – berechnend gegen jeden Schein von Gleichberechtigung & Normalisierung –, brüsk zu sagen, was er denkt, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Sache, um die es seiner Nation zu tun ist: Um Eigentumsansprüche geht es hier in einem sehr prinzipiellen Sinn. Deutschland eröffnet und pocht auf eine Sonderbeziehung zu Tschechien nicht sudetendeutschen Rückgabegelüsten zuliebe, sondern formuliert sein Recht auf einen eigenen osteuropäischen Hinterhof: Einen Landstrich, besiedelt mit souveränen, komplett abhängigen Geschöpfen. Dieses Recht ist, erstens, alles andere als ein bloßer Traum: Die CR, Polen und Ungarn sind Kandidaten der ersten Wahl für EU- oder NATO-Osterweiterung; als solche sind sie abhängig von denen, die ökonomisch das Kapital, politisch das weltordnerische Sagen, militärisch die strategischen Mittel haben; und als Teil dieser Allianzen treibt Deutschland deren Ausdehnung mit voran. Damit ist dieses Recht, zweitens, aber nur unzulänglich beschrieben; denn die Nation tritt sozusagen doppelt an: als Bündnispartner und als Deutschland. Im Zuge der Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraumes und des militärpolitischen Geltungsbereichs des Westens will es gegenüber den Konkurrenten ein – im besten Fall: ausschließendes – Primat erringen. Dafür ist es bereits jetzt tatkräftig zugange; besitzt, namentlich in Tschechien, einen gewissen Vorsprung an „Einfluß“, in Gestalt fleißiger Mittelständler von Fielmann bis Mercedes; und setzt darauf, mit der Etablierung dieser Sonderfreundschaft gewissermaßen irreversible Fakten gesetzt zu haben, denen die CR sowieso, aber auch EU und NATO ihren Respekt nicht verweigern können: Wer zuerst kommt… Und mit der Versöhnungserklärung hat sich Deutschland ein Drohpotential verschafft, das seinen benachbarten Vasallen dem Dauertest unterzieht, ob der sich ohne Wenn und Aber wie ein solcher verhält. Mit der Deklaration steht die nach Europa strebende Republik Tschechien bei ihrem deutschen Förderer mehr denn je im Wort.
Anlässe, ihre Treue zu beweisen, wird es genug geben; und der erste ist die fragliche Unterschrift unter das Dokument selbst. Mit seinem gezielten „mündlichen Zusatz“ hat Kohl mitten ins nationale Palaver um die Verabschiedung durch das Parlament eine Stinkbombe geworfen, die Prager Duldsamkeit auf eine harte Probe gestellt und dadurch den wunden Punkt der neuen tschechischen Staatsräson berührt. Alternativlos gen Westen gewendet; Gewehr bei Fuß, Europa- und Nato-Tauglichkeit zu präsentieren; zwecks Präsentation als „geeignetes“ Anlage- und Aufmarschgelände aber nur die politische Bereitschaft dazu in der Tasche zu haben; also umso erpreßbarer mit diesem Willen – da muß die nationale Seele schmerzen, wenn der dicke Schirmherr einen vor aller Weltöffentlichkeit diplomatisch als das vorführt, (als) was man (vorgesehen) ist: Bloßer Satellit der Ausdehnung Deutschlands nach Osten.
Der offenen Demonstration des überlegenen Vertragspartners, daß Deutschland sich durch die Deklaration selbstverständlich nicht daran hindern läßt, Rechtsansprüche warm zu halten und geltend zu machen, solange und wann ihm es paßt, gedachte das Prager Parlament seinerseits durch einen „schriftlichen Zusatz“ zu bremsen, der erneut „explizit und unmißverständlich“ festhalten sollte, weitere deutsche Forderungen verstießen gegen den „Geist“ der Deklaration. Das hätten Regierungschef Klaus und Außenminister Zielenic den Deutschen während der Verhandlungen auch „gesagt“. Ein bemerkenswert angestrengter Versuch, der allerdings voll in der Logik der vereinbarten Sache liegt: Kaum müssen die Tschechen zur Kenntnis nehmen, daß das Versprechen, die Eigentumsfrage ruhen zu lassen, genau so viel wert ist wie der deutsche Wille, diese ruhen zu lassen, wollen sie die nicht vorhandene Bindekraft des Vertrags ausgerechnet durch ihre Beteuerung herstellen, das Ding sei schwer bindend. Andernfalls… könnten auch sie sich nicht mehr dran gebunden fühlen – mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, daß die CR so absehbar wenig in der Hand hat, ihrem europäischen Mentor zu drohen. So hat das tschechische Parlament das Gegenteil dessen dokumentiert, was es mit seiner erbitterten Debatte eigentlich beweisen wollte: Bei allen frommen Gebeten an den Gott des „Schlußstrichs“ – der deutsche Anerkennungsvorbehalt ist in der Welt und durch keine einseitige Willenserklärung aus der Welt zu schaffen.
Wie aus einer Konkurrenzaffäre zwischen Multis der Fall einer zwischenstaatlichen Standortkonkurrenz wird: „Der Fall López“
So wie aus zwischenstaatlichen politischen Händeln immer wieder Fälle für die Gerichte werden – wie im Fall „Mykonos“ –, so wird manchmal aus einem gewöhnlichen, gänzlich unpolitischen Rechtsfall zwischen Privaten ein politischer Fall – wenn es sich nur um die richtigen Prozeßparteien handelt. Wenn nämlich Unternehmen sich verschiedenen Nationen zuordnen und sich zur Wahrnehmung ihrer Rechte entsprechend an ihre jeweilige nationale Justiz wenden, kann aus der Kollision ihrer Interessen eine Konfrontation der politischen Hoheiten erwachsen, die jeweils hinter dem Recht stehen, das in Anspruch genommen wird.
VW besorgt sich Opels Wunderwaffe
Da gibt es bei der Firma Opel einen Mann mit einem eigenartigen Berufsbild. Der ist Kostensenker
und wendet sich in Ausübung seiner Profession der Aufwandsrechnung seines Betriebs auf eine ganz originelle Art zu. Daß man alles, was im eigenen kapitalistischen Betrieb für die beständige Senkung der Kosten für Arbeit anfällt, immer noch viel besser machen muß und kann, hat er zwar überhaupt nicht selbst erfunden. Gleichfalls nicht, daß sich für denselben Effekt auch manche Wirtschaftsbeziehungen ausnutzen lassen, die man zu anderen Unternehmen unterhält. Aber den Weg, die Produktionspreise seiner Firma nicht nur über die entschlossene Rationalisierung
seines eigenen Ladens zu senken, sondern vor allem auch darüber, daß man allen abhängigen Zulieferbetrieben konsequent weniger zahlt, geht er eben besonders zielstrebig. Sein unverwechselbares Markenzeichen ist der günstige Einkauf für Opel, womit nicht das Einsammeln von Schnäppchen gemeint ist, sondern die gelungene Erpressung der Geschäftspartner, mit denen er zu tun hat: Vor die Alternative gestellt, zu billigeren Preisen zu liefern oder auf ihrem Zeug sitzenzubleiben, können sie sich zu letzterem einfach nicht entschließen; lieber geben sie den Kostendruck
, dem sie ausgesetzt werden, an ihre Belegschaft weiter, so daß auch in der tüchtig rationalisiert
wird.
So ist man in Geschäftskreisen von diesem Mann weithin schwer beeindruckt, im Vorstand der Opel AG sogar ausgesprochen angetan. Denn was immer da im einzelnen in welcher Weise für welches Resultat verantwortlich war: Letztlich weist der erzielte Gesamterlös den Erfolg aller Bemühungen aus, die zu ihm geführt haben, und insofern der Erfolg sich ohne den Manager
seiner vielen Bedingungen nicht eingestellt hätte, wird der Mann den Nimbus einfach nicht mehr los, eine personifizierte Erfolgsgarantie zu sein.
Das weckt bei dem großen Autobauer in Wolfsburg Begehrlichkeiten. Auf Rationalisierung und erpresserische Preisgestaltung versteht man sich dort natürlich auch schon seit längerem. Aber ausweislich der Erfolgsbilanz, die der Konkurrent da gegen einen selbst zuwegebringt, offensichtlich nicht so gut. Man wirbt daher den leitenden Mann der Konkurrenz mitsamt seiner Mannschaft ab, damit man erstens selbst in den Genuß seiner famosen Fähigkeiten gelangt. Die kommen umso besser zum Zuge, wenn man mit der Abwerbung zugleich auch noch den Konkurrenten empfindlich treffen und schädigen kann, etwa wenn der neue Mann auch das dafür geeignete Wissen an seinen Arbeitsplatz mitbringt. Soweit dies auch in Form von Unterlagen mitgenommen wird, kommt der Verdacht von „Industriespionage“ auf. Das ist zwar verboten, verschafft aber einem Konzern von seinem Konkurrenten einen Teil der Waffen, die der sich für seinen weiteren zukünftigen Erfolg im Wettbewerb geschmiedet hatte, und ist deswegen manchmal geboten.
Der Konkurrent schlägt multinational zurück
Zu den Sitten des lauteren Wettbewerbs, die der Staat den Eigentümern bei ihrer Konkurrenz verordnet, paßt dies freilich nicht. Daher besinnt sich der wirtschaftlich geschädigte Konkurrent darauf, daß seine Interessen staatlichen Rechtsschutz genießen, und greift zum Recht als seiner Waffe, der anderen Seite – so gut er nur kann und das Recht es zuläßt – wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Der droht sich nämlich in Form von nachhaltigen Imageverlusten für die Marke VW
und erheblichen Absatzeinbußen auf den europäischen Märkten
(SZ) allein schon daraus einzufinden, daß der deutsche Riesenkonzern im Ruch steht, sich seine Erfolge mit verbotenen Mitteln zu erkämpfen. Ihre richtige Brisanz aber erhält die in Angriff genommene rechtliche Auseinandersetzung darüber, daß über sie zwei ganz andere Subjekte wichtig werden und aneinandergeraten, die von jeweils ihrem Multi dazu in Anspruch genommen werden, ihm den rechtlichen Schutz seiner Konkurrenzinteressen zu gewähren. Die in Deutschland geschädigte Firma Opel ist „Tochter“ einer in den USA ansässigen „Mutter“, die nach den dort herrschenden Grundsätzen Rechtsschutz genießt und beansprucht, während der deutsche Multi VW im Recht des hiesigen Standorts verwurzelt ist – und so wird aus einem Rechtsstreit zwischen zwei konkurrierenden Multis ein Konkurrenz- und Problemfall zwischen den Staaten, denen sie sich zurechnen. In Deutschland nehmen sich die politischen Hüter des Standorts des Falles gleich so an, daß sie sich unverhohlen parteilich hinter ihren
Konzern stellen; sie machen den Rechtsfall zu einem Politikum, weil sie in einem mit den Waffen des US-Rechts geführten Angriff auf VW einen auf den Industriestandort Deutschland insgesamt
gemünzten Anschlag entdecken wollen; der wird natürlich nicht von Opel, sondern vom amerikanischen „Mutter-Konzern“ im Verein mit der dortigen Justiz, daher im Grunde vom Standortkonkurrenten USA geführt, so daß sie laut über die Gefahr für die deutsch-amerikanischen Beziehungen
(VW-Aufsichtsrat Lambsdorff) nachdenken und den Kanzler zu einer Intervention beim amerikanischen Präsidenten anregen: So, als Problemfall für die unverletzlichen imperialistischen Rechte ihres Standorts, beziehen sie sich auf den Umstand, daß ein in den USA angestrengtes Klagebegehren nach dem Anti-Mafia-Gesetz womöglich rechtlich Gehör finden und für das nationale Symbol Deutschlands
(VW-Aufsichtsrat Kiep, CDU) bedrohlich ruinös wirken könnte.
Der Vergleich
Den gerichtlich in Gang gebrachten Rechtsstreit aber wirklich zu der Dimension ausarten lassen, zu der sie selbst ihn ausgeweitet hatten, wollen die politischen Anwälte von VW nicht. Ein Kampf um Marktanteile in Form von Rechtsquerelen, bei denen über die damit verbundene Mobilisierung der jeweiligen national denkenden Kundschaft in Deutschland und in den USA gleich ihre wichtigen Auslandsmärkte zerstört werden; umgekehrt ein politisches Engagement im Rechtsstreit, das den nicht nur zur nationalen Hoheitsfrage deklariert, sondern auch als diese praktisch behandelt und gegen das Recht der konkurrierenden Hoheit interveniert, an dem man sich stört: Eine solche Eskalation der Auseinandersetzung, die alle Grenzen des Wettbewerbs überschreitet
(Kiep), findet hierzulande eben doch keine Fürsprecher, und das lesen die beteiligten Prozeßparteien als ein in ihrer Taktik unbedingt zu berücksichtigendes Signal
. Zusätzlich zu allen Unwägbarkeiten des Rechtsstreits hinsichtlich des Verlaufs und des siegreichen Ausgangs des Prozesses, zusätzlich zu den möglichen geschäftsschädigenden Folgen, die ein auf dem Rechtsweg erstrittenes Urteil für beide Parteien beinhalten können, erfahren sie, daß die politischen Vertreter des deutschen Rechtsstandpunkts sich durch ihren Streit zwar im Prinzip betroffen, aber in ihrem Recht doch nicht nachhaltig verletzt sehen wollen. Daß ein Markenzeichen ihres Standorts mit Mitteln einer fremden Rechtshoheit empfindlich geschädigt werden soll, nehmen deutsche Politiker zwar so einfach nicht hin; sich rückhaltlos hinter ihren nationalen Multi zu stellen, unterlassen sie aber weise, weil dabei neben den Absatzmärkten für VW und Opel gleich noch mehr, nämlich der inter-nationale Wettbewerb zwischen Deutschland und den USA insgesamt auf dem Spiel steht. Also findet die Botschaft in Wolfsburg und anderswo Gehör, und der deutsch-amerikanische Autokrieg
nicht statt. Die Parteien einigen sich außergerichtlich, indem der deutsche Konzern eine halbe Entschuldigung murmelt, sich seines Sanierers
entledigt und dafür Buße tut, von dessen Fachkenntnissen unlauter profitiert zu haben: Er kauft beim Konkurrenten Zulieferteile zu Preisen und Bedingungen ein, die es unter López garantiert nicht gegeben hätte.
[1] Eine ausführliche Erläuterung des Terrorismus und des staatlichen Umgangs mit ihm bietet der Artikel „Terrorismus heute: Moralisten für Volk und Nation gegen die Staatsgewalt“, GegenStandpunkt 4-95, S.56
[2] „In Sachen Staatsterrorismus, Fundamentalismus und Menschenrechtsverletzungen haben wir Europäer ja keinen Millimeter unterschiedliche Auffassungen zu den USA.“ Derselbe Kinkel erläutert das dann so: Trotzdem: Wir sind entgegen der Meinung der Amerikaner der Auffassung, daß es besser ist, mit Iran im Gespräch zu bleiben, um zu versuchen, auf den Gebieten, wo wir diametral anderer Meinung sind, Einfluß zu nehmen, gegen aggressiven Fundamentalismus, Staatsterrorismus, Menschenrechtsverletzungen usw.
(FR)
[3] Times (London): Mit dem Vertrag wird eines der bittersten Kapitel der Nazi-Aggression geschlossen. Damit (!) werden auch die letzten Barrieren niedergerissen, die den deutschen Einfluß in Mitteleuropa noch aufhalten konnten.
La Repubblica (Rom): Die bilaterale Erklärung hat politisch den Rang eines Friedensvertrages. Gleichzeitig (!) unterstreicht sie die neue deutsche Rolle in Europa.
[4] Eine grundlegende Würdigung der deutsch-tschechischen Beziehung findet sich in GegenStandpunkt 3-96, S.78: Deutsche Außenpolitik und Tschechien. Anerkennung ja, aber unter deutschem (General-)Vorbehalt!
[5] Bis an die Schmerzgrenze ihres Souveränitätsverständnisses haben wir die CR also getrieben, aber eben auch nur bis dahin. Zufrieden stimmen kann uns, daß sie mit „Nr. 115“ nicht einfach ein Gesetz, sondern immerhin das Gründungsdokument ihrer Republik der Ermöglichung krimineller Handlungen bezichtigt; das ist ungefähr von dem Kaliber, wenn Deutschland sagen würde, sein Grundgesetz begünstige Verbrechen. Umgekehrt bezeugt der scheinbar absurde Streit um die tschechische Übersetzung von „Vertreibung“ (vyhaneni
, statt des in Prag verpönten vyhnani
) die Verbissenheit, mit der um den semantischen Kniefall gekämpft wurde; deshalb wurmt uns der tschechische Stolz, vom deutschen Formulierungswunsch ums Verrecken um wenigstens einen Buchstaben abgewichen zu sein.
[6] Die Formel „…respektiert das Recht der anderen Seite“, auf die Tschechien scharf gewesen wäre, war für Deutschland deshalb inakzeptabel.
[7] Vielleicht können unsere „enteigneten“ Volksgenossen den Laden ja kaufen, wenn sie ihn vom Pilsener Amtsgericht nicht geschenkt bekommen – eine Idee, die „Ängste“ auslöst: „Die Aussicht, in der Europäischen Union einer so empfundenen schrankenlosen deutschen Neubesiedelung Böhmens selbst Tür und Tor öffnen zu sollen, ließe viele Tschechen Abstand von der EU nehmen“ (SZ, 21.12.96). Diese abwegige Empfindung nehmen deutsche Politiker, inklusive Opposition, so ernst, daß „Antje Vollmer und Günther Verheugen, der außenpolitische Sprecher der SPD, alarmiert nach Prag eilten“ (ebd.), um die Position der Regierung zu verdolmetschen. Dort wird der Verdacht natürlich nicht zerstreut, sondern mit einem Ultimatum gekontert: „Verheugen wies vor tschechischen Parteifreunden darauf hin, daß eine Ablehnung der Deklaration Probleme bei der Integration in die europäischen Strukturen bringen könne. Vom Prinzip, daß die EU kein Land aufnimmt, das mit seinen Nachbarn nicht wirklich Frieden zu machen versteht, sind die Tschechen nicht ausgenommen“. Nix Deklaration ist wie nix Frieden, ist sich nix Europa.
[8] Wer diese interessierten Kreise wohl sein mögen? Die Sudetendeutschen müssen also doch nicht vor Tür bleiben. Allerdings domestiziert. Nämlich so: Den Antrag der Heimatvertriebenen, Kohl dürfe die Erklärung „ohne Nachbesserungen“ auf keinen Fall parafieren, wies Schäuble voller Zuversicht zurück: „Nachbesserungen werden in der Anwendung erfolgen.“ Die erste Nachbesserungsforderung liegt bereits vor: „Intensive Beteiligung der Sudetendeutschen am deutsch-tschechischen Gesprächsforum und dem vereinbarten Zukunftsfonds“ (Waigel, 30.1.97).