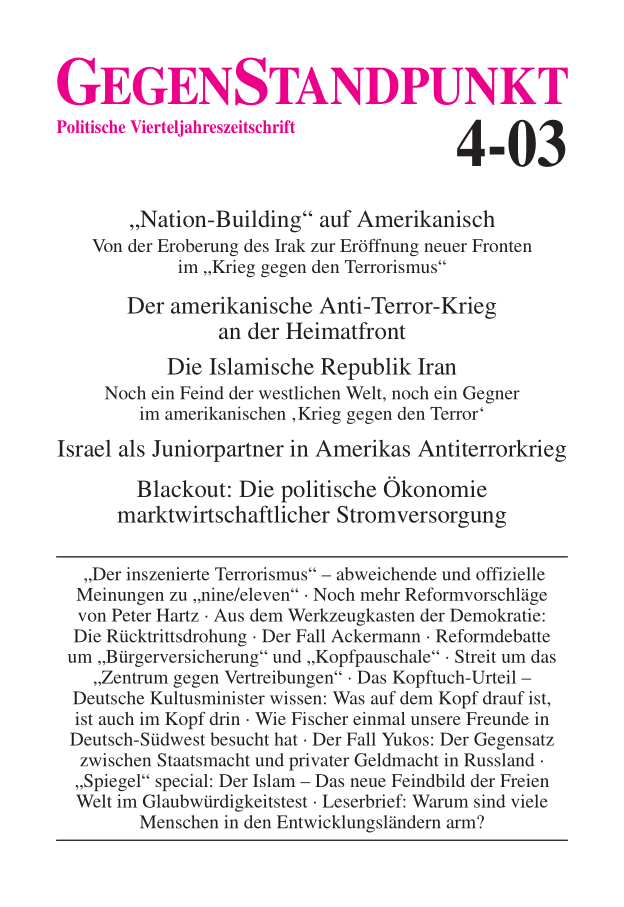Protest gegen den inneren und äußeren Kriegskurs
Das „andere Amerika“ – der Supermacht würdig
Eine kritische amerikanische Minderheit wirft dem Präsidenten vor, seine neuen internen Sicherheitsmaßnahmen zur Terrorbekämpfung seien verfassungswidrig und nutzlos. Statt auf Überwachung und Einschüchterung solle er lieber auf die Loyalität seiner Staatsbürger setzen. Friedensbewegte Amerikaner sind betroffen, weil Bush wegen niederer Motive (Öl) und mit fadenscheinigen Begründungen (Massenvernichtungswaffen, Kontakte zu al Kaida) Krieg im Nahen Osten führt, und damit der höheren Verantwortung nicht gerecht wird, die die Supermacht für Frieden, Freiheit und Demokratie auf der ganzen Welt hat. Politologen warnen vor dem möglichen Misserfolg des rücksichtslosen Imperialismus, Isolationisten fragen nach dem Nutzen des Krieges für die Nation, alternative Patrioten wie Michael Moore fühlen sich von Bush schlecht vertreten. Aus jeglicher Kritik kommt nichts anderes als proamerikanischer Nationalismus heraus.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Innenpolitisch: Protest gegen den Sicherheitsstaat im Namen der amerikanischen Freiheit
- Außenpolitisch: Idealisten der Weltmacht sehen die Mission Amerikas diskreditiert
- Ein unnötiger, also verbrecherischer Krieg …
- … ist Imperialismus
- Warum der ungerechte Krieg dennoch stattfindet.
- Politologen übersetzen das „ungerecht“ der Friedensbewegung in „unnütz“ und gelten als akademische Fackelträger des Protests
- Isolationisten und Anti-Isolationisten streiten ums korrekte Verhältnis von Aufwand und Ertrag der Weltherrschaft
- Lügt Bush? – Glaubwürdigkeit, das Telos aller Kritik in der Demokratie
Protest gegen den inneren und äußeren
Kriegskurs
Das „andere Amerika“ – der
Supermacht würdig
Natürlich gibt es Kritik am Kriegsprogramm der Regierung. Das wäre ja auch gelacht, wenn in der ältesten Demokratie der Welt der Umschwung zu einer neuen Ära der Innen- und Außenpolitik ohne Debatte, Widerspruch und Widerstand über die Bühne ginge. Alles Oppositionelle stößt in Europa auf größtes Interesse. Man hört da genau hin, ob sich nicht doch Alternativen zu Bushs Umgang mit dem alten Europa abzeichnen, und ruft das „andere“ Amerika zum Zeugen dafür an, dass der neue Kurs nicht nur für die Nato-Partner, sondern für Amerika selbst ein Unglück ist. Wenn waschechte Amerikaner Bush kritisieren, dann dürfen Europäer das auch, ohne dass ihre Kritik gleich als antiamerikanischer Nationalismus beleidigter Mit-Imperialisten abgetan werden dürfte. Und wo sie Recht haben, haben sie Recht: Wenn Amis ihren Präsidenten kritisieren, kommt wirklich nur proamerikanischer Nationalismus heraus.
Innenpolitisch: Protest gegen den Sicherheitsstaat im Namen der amerikanischen Freiheit
Auf Demonstrationen und Plätzen, bei Ämtern und den Medien melden sich Familien, die ihren verschwundenen Vater, Sohn, Schwager suchen und vom Staat dessen Freilassung oder wenigstens eine Auskunft über Aufenthaltsort, Dauer der Haft und den Vorwurf, unter dem man ihn einsperrt, fordern. Rechtsanwälte protestieren gegen die Verweigerung anwaltlicher Rechte. Buchhändler und Bibliothekare schalten Annoncen, in denen sie den Auftrag, das Leseverhalten ihrer Kunden auszuforschen, zurückweisen.
Das mag mutig sein im Klima allgemeiner Terroristenhatz;
und dem neuen Konsens – Terrorbekämpfung duldet keine
rechtsstaatlichen Bedenken – verweigern sich die
protestierenden Minderheiten ja tatsächlich. Deshalb
sehen sie sich aber umso mehr in der Pflicht zu
versichern, dass sie keineswegs unpatriotisch sind und
dass ihr Festhalten an den „civil liberties“ natürlich
nicht dazu führen soll und darf, den Terroristen das
Leben leichter zu machen. Keine Protestnote ohne ein
Bekenntnis zur Verfolgung und Bestrafung der Terroristen;
kaum eine ohne Beiträge zu der Frage, wie Amerika seine
Bürger zukünftig besser schützen könne.[1] Civil-Rights-Gruppen werben
für ihr Recht auf Einspruch, indem sie ihre
Verfassungstreue darlegen und dieselbe von der Regierung
fordern: Gegen die neuen Sicherheitsgesetze erheben sie
den Doppelvorwurf, sie seien sowohl „unconstitutional“
wie „ineffective“. Einerseits verlangt man nur, was die
american constitution ohnehin garantiert; andererseits
wüsste man in dieser Krisenlage gar nicht, was man
zugunsten der geschätzten Verfassung anführen könnte,
hätte man nicht das Argument zu Hand, dass
Verfassungsbruch gegen den Terror gar nichts nützt. Da
die Kritiker aber von der Nutzlosigkeit des Schlechten
überzeugt sind, gehen sie einen Schritt weiter und
bezichtigen die Regierung, ihre Rechtsreformen würden in
Wahrheit gar nicht auf die Terroristen, sondern auf
staatsbürgerlichen Widerspruch und freie politische
Betätigung von Amerikanern zielen. Mit Enthüllungen
darüber, dass Entwürfe zu den Staatsschutzgesetzen seit
langem in den Schubladen der Ministerien liegen, suchen
sie zu beweisen, dass diese Gesetze keine Antwort auf die
neue Lage sind, „9/11“ mithin nur ein Vorwand für einen
antidemokratischen Anschlag der Bush-Clique auf die
Freiheit des Amerikaners. Damit holen die verbliebenen
Freunde des Rechtsstaats zum entscheidenden Schlag aus:
Wir fordern von unseren politischen Führern, dass sie
sich Vorschlägen widersetzen, genau die Freiheiten
unrechtmäßig und unvernünftig zu beschränken, die wir als
Nation jetzt gemeinsam zu bewahren suchen.
Mit
Überwachungspraktiken, die sich keineswegs immer auf
das für die nationale Sicherheit nötige Maß
beschränken
, zerstöre Bush das beste Werbeargument
für die USA im Ausland und gefährde, was uns 200 Jahre
lang stark gemacht hat
: die freie Rede, den
politischen Streit und die öffentliche Kontrolle der
Macht.[2]
Da führt die Regierung den als public enemy behandelten Minderheiten und ihren politischen Fürsprechern praktisch vor, was die Verteidigung der amerikanischen Freiheit für ein militantes Programm ist – Krieg nach innen und außen –, und die Betroffenen sind einfach nicht bereit, das, was sie erleben, als Konsequenzen des nationalen Programms anzuerkennen. Von der Freiheit ihrer Nation haben sie eine andere, positive Vorstellung – und in ihrer Parteinahme dafür lassen sie sich durch schlechte Erfahrungen nicht beirren. Lieber zweifeln sie an Bushs Eignung für sein großes Amt und werfen ihm vor, zu verspielen, was er zu verteidigen behauptet: Auf seine Art lässt sich die Freiheit und die Stärke der Nation jedenfalls nicht retten! Einerseits reicht der Einspruch der Kritiker gegen die neue Sicherheitspolitik nicht sehr weit: Sie sind einfach der Meinung, die Kompetenzen für FBI, CIA und andere Geheimdienste, wie sie vor 9/11 bestanden haben, reichten aus; die Regierung habe überreagiert und die Überwachung der Bürger nicht auf das für die nationale Sicherheit nötige Maß beschränkt. Andererseits streiten sie mit Bush dann doch sehr prinzipiell über die wahren Quellen der Stärke und der Unangreifbarkeit der Nation: Diese Quellen verkennt und beschädigt der Präsident nämlich, wenn er auf Überwachung und Einschüchterung setzt anstatt auf die Bürger, die doch gerne und überzeugt für Amerika einstehen, zu vertrauen und im ideellen Schulterschluss mit ihnen dem Terror entgegenzutreten. Kritiker, die zu so einem Streit aufgelegt sind, mögen Idealisten sein und sich darüber täuschen, wie der innere Frieden und die Sicherheit einer Weltmacht funktionieren; die Härte ist, dass sie Idealisten der Stärke und Unangreifbarkeit ihrer Nation sind.
Als solche verschmähen sie es nicht einmal, der Regierung das Verfehlen der rechten Balance von Bürgerfreiheit und polizeilicher Überwachung nach beiden Seiten hin zum Vorwurf zu machen: Vor dem 9. September sollen die „Dienste“ angeblich geschlafen, soll die Regierung Warnungen missachtet haben, um, nachdem die Katastrophe passiert ist, das Kind mit dem Bade auszuschütten.[3] Dass Staatsorgane nach solchen Attacken eine Debatte über das Versagen der Sicherheitsdienste anzetteln, dass die Öffentlichkeit Untersuchungen fordert, um herauszufinden, welcher Dienst wie viel wusste, warum das vorhandene Wissen über die Attentäter nicht zusammengeführt wurde, ob es Warnungen gegeben, wer sie in den Wind geschlagen hat – das alles ist normal. Dass Opfer und Kritiker der Staatssicherheit nichts Besseres zu tun haben, als sich leider auch mit Verbesserungsvorschlägen an diese Debatte anzuhängen, ist weniger selbstverständlich.
Außenpolitisch: Idealisten der Weltmacht sehen die Mission Amerikas diskreditiert
Ein unnötiger, also verbrecherischer Krieg …
Manche Amerikaner finden die Serie von Kriegen im Nahen
Osten einfach furchtbar. Sie stellen sich gegen die
allgemeine Kriegsstimmung, demonstrieren, blockieren und
lassen sich dafür verprügeln und verhaften. Wenn sie ihre
Ablehnung begründen, sprechen sie als besorgte Bürger
einer überlegenen, zu wahrer Führung aufgerufenen
Weltmacht. Anders als bei der deutschen Friedensbewegung
in den achtziger Jahren speist sich ihre Empörung nicht
aus der befürchteten Betroffenheit ihres Landes durch
einen neuen Weltkrieg, sondern aus der hohen Meinung über
die Verantwortung, die der Supermacht für Frieden,
Freiheit und Demokratie auf der ganzen Welt obliegt. Aus
lauter Glauben an die Werte, mit denen die USA ihren
Imperialismus überhöhen, verurteilen alternative
Amerikaner dessen Wirklichkeit. Sie messen Bushs Feldzug
an den Maßstäben des gerechten Krieges; d. h. sie prüfen
die Glaubwürdigkeit der regierungsamtlichen
Rechtfertigungen – und nehmen die noch immer nicht
gefundenen Massenvernichtungswaffen Saddams zum Beweis
dafür, dass Bush lügt. Die behauptete Bedrohung der
Vereinigten Staaten liegt nicht vor, also dient der Krieg
auch nicht der Verteidigung, sondern anderen von
den belogenen Bürgern nicht geteilten Zielsetzungen.
Ebenso wenig können die Kritiker eine gerechte Bestrafung
der für die Anschläge vom 9. September Verantwortlichen
im Irakkrieg erblicken, in dem Saddam Hussein und Bin
Ladin verschont bleiben, während unser Präsident
Bomben auf unschuldige Menschen wirft.
Dafür
entschuldigt sich ein freundlicher Jazzmusiker bei der
Welt. Befreiung? – da kann er nur lachen; die Bewohner
von Bagdad sieht er für Demokratie und Freiheit verloren.
Wie sollen sie nach solchen Lektionen Amerika vertrauen?
Demokratie-Export hätte er sich mehr vom guten Beispiel
versprochen: Wir können anderen Völkern unsern
Lebensstil nicht mit Waffengewalt aufzwingen.
Dass es
erstens um den Export eines Lebensstils geht und gehen
sollte, dass dieser Lebensstil den anderen schon gut tun
würde – alles das ist gegessen, wenn einer den Versandweg
als der vorbildlichen Weltmacht unwürdig
verwirft.
Die Kriegsgegner halten sich an die propagandistisch präsentierten guten Gründe für den Krieg – Verteidigung, Bestrafung, Befreiung – und finden sie unglaubwürdig. Widersprüche, auf denen sie herumreiten, sind leicht zu haben; denn die auf innere und äußere Zustimmung berechneten Rechtfertigungen sind nie die wirklichen Gründe dafür, dass ein Staat einen anderen überfällt. Umgekehrt wird Krieg nicht dadurch besser, dass wunderbar einleuchtende Rechtfertigungen geliefert werden. Genau das aber fordern die Idealisten der Außenpolitik; sie verlassen nie das Feld der – notwendigerweise – verlogenen Rechtfertigungen und vermissen „echte“. Das eigentliche Vergehen, das sie anprangern, sind damit die Lügen des Präsidenten – nicht der Krieg. Der allerdings wird durch die Lügen und sonst gar nichts charakterisiert: Er ist, weil nicht ehrlich gerechtfertigt, ein Verbrechen.
… ist Imperialismus
Die Abwesenheit einer gediegenen Rechtfertigung,
dieses Nicht-Urteil, ist die positive Auskunft
über den Krieg. Harte Vokabeln, wie „völkerrechtswidrige
Aggression“, „Imperialismus“, „Arroganz der Macht“ usw.
haben keinen anderen Inhalt. Ausgerechnet
Veteranen-Vereinigungen unterscheiden scharf zwischen der
ehrenvollen Verteidigung des Vaterlands und Aggression,
und rufen ihre aktiven Kameraden zu Verweigerung und
Fahnenflucht auf. Um ihnen die Augen zu öffnen, erzählen
sie Wahrheiten über die Kriege, für die sie sich
hergegeben haben, in denen Kameraden gestorben oder zu
Krüppeln geworden sind. Durch diese sehr persönlichen
Kosten des US-Imperialismus klug geworden, erinnern sie
die nachrückenden Jahrgänge aber nicht etwa an deren
Interesse zu überleben, sondern an die moralische
Verantwortung eines guten GI: In einem ungerechten
Angriffskrieg sind auch Kollateralschäden keine
entschuldbaren Nebenwirkungen, sondern Mord, und: Im
Mord liegt keine Ehre!
Der nicht gerechtfertigte Krieg muss einen ungerechten Grund haben, den Bush der amerikanischen Öffentlichkeit nie und nimmer hätte auftischen können: das irakische Öl. Es stimmt zwar nicht, dass die Regierung hier viel verheimlicht hätte – sie hat nie verschwiegen, dass sie eine amerikanische Kontrolle des Nahen Ostens wegen seines Öls für entscheidend hält –, aber die Unterstellung eines verheimlichten Materialismus des Feldzugs leistet etwas: Sie trennt den Krieg Bushs, der demnach nicht als Präsident sondern als Lobbyist seiner Kumpels von der texanischen Ölmafia handelt, von den wahren Anliegen der Nation. Die sind und bleiben über alle Zweifel erhaben. Mit dem eigenen „Way of Life“ darf, also kann das Böse, das man verurteilt, nichts zu tun haben.
Warum der ungerechte Krieg dennoch stattfindet.
Der politisierende Romancier Normal Mailer[4] ist radikal in dem Sinn,
dass er den guten Amerikaner nicht gegen den schlechten
Präsidenten in Schutz nimmt; dafür strickt er das
selbstgerechte Weltbild des besseren Amerika in Richtung
auf ein geschlossenes Wahnsystem fort. Er lüftet ein
Rätsel, das sich nur ihm und Seinesgleichen stellt: Warum
kommt es zu einem Krieg, dessen Unverantwortlichkeit und
Unsinnigkeit für jedermann auf der Hand liegen? Die
verachtungswürdigen Kriegsgründe – Vorherrschaft im Nahen
Osten und Zugriff auf einen Haufen Ölmilliarden – erwähnt
er kurz, um zur entscheidenden Frage zu kommen: Warum
geben wir uns dafür her? „Why did we go to war?“ Die
verdeckten, aber wirklichen
Kriegsgründe liefert
ihm ein Psychogramm seiner Mitbürger, das er anfertigt.
Das nationale Selbstbewusstsein soll durch „9/11“
dermaßen erschüttert worden sein, dass der Gegenschlag
zum echten Bedürfnis der kollektiven Psyche wurde: Wir
brauchten einen erfolgreichen Krieg als eine Art
seelischer Verjüngungskur der Nation. Dafür war jede
billige Ausrede recht.
Das „Wir“, das seine gewohnte
Selbstsicherheit verloren hat, identifiziert Mailer näher
als den guten, weißen, männlichen
Mittelklasse-Amerikaner
. Dieser für den Präsidenten
wichtige Wähler hatte moralische Aufrüstung dringend
nötig. Denn erstens hat der Zusammenbruch des
Arbeitsmarkts ihm die Jobchancen vermasselt, zweitens hat
der Sieg der Frauenbewegung seinen Machismo verunsichert,
und drittens vergällt der Aufstieg schwarzer Sporthelden
ihm immer mehr die Identifikation mit einem Siegertypen
per Sportschau.
Krieg als Seelenmassage für weiße männliche
Mittelschichtler, deren Depressionen von allem anderen
herkommen als von Fragen der Außenpolitik; Städte und
ganze Länder in Schutt und Asche zu legen für ein
bisschen Wohlfühlen bei der Stammwählerschaft – das traut
Mailer seinem Präsidenten jederzeit zu. Ob Bush nun einem
seelischen Bedürfnis seiner Wähler nachgegeben oder ihren
psychischen Defekt für sich, seine Wahlchancen oder
sonstige eigennützige Interessen ausgeschlachtet hat, ist
egal. Fest steht: Wenn der Amerikaner schon seelisch
labil ist, bräuchte er wenigstens einen moralisch
sattelfesten Präsidenten, der nicht auf die vox populi
hört! Der Dichter, der sich in seinem Artikel um die
Zukunft der amerikanischen Demokratie sorgt, kann vor
Demokratie in Kriegsfragen nur warnen – erst recht, wo
Führung und Wählerschaft in ihrer Verkommenheit so gut zu
einander passen. So kommt die kulturkritische Absage an
den Gegenstand seiner teilnehmenden Sorge nur wenige
Zeilen nach der Psychoanalyse der unzurechnungsfähigen
Basis zur ergänzenden Einsicht in die Unwürdigkeit der
Führer: Die Motive, die die entscheidenden
historischen Taten einer Nation leiten, können vermutlich
nicht höher sein als das geistige Niveau seiner
Führer.
Politologen übersetzen das „ungerecht“ der Friedensbewegung in „unnütz“ und gelten als akademische Fackelträger des Protests
Philosoph Richard Rorty[5] scheut sich nicht, harte, in
Europa gerne vernommene Worte auszusprechen: Bush wolle
die pax americana auf Dauer stellen
, deren
Bedingungen allein von Washington aus diktieren
und
keine selbständigen Nationen mehr neben sich dulden;
seine unilaterale Arroganz
sei eine demütigende
Bevormundung alter Verbündeter
. Politologe Stanley
Hoffmann[6]
sieht einen nicht so wohl wollenden Imperialismus
, der, besoffen von der eigenen Macht
, drauf und
dran ist, alles über den Haufen zu werfen, was jemals an
Kooperation zwischen Staaten
und
internationalem Recht
nicht zuletzt von den USA
selbst eingerichtet worden ist. Die Führungsnation
sprengt die Nato, spaltet die EU: Es ist traurig, dass
man diejenigen, die solche Positionen unterstützen, daran
erinnern muss, dass in einer Welt mit beinahe 200 Staaten
… die glatte Rückkehr zur Herrschaft des Stärksten eine
katastrophale Regression wäre.
Solche Einlassungen gelten in den Kreisen von Habermas
und Derrida als links, pazifistisch und vernünftig, dabei
kündigen die letzen Worte es schon an: Die Denunziation
des neuesten US-Imperialismus mündet in eine Warnung: Das
wird nicht gut gehen! So wird Amerikas Führungsrolle in
der Welt auf lange Sicht geschwächt und nicht gestärkt.
Rorty erinnert die Bush-Leute daran, dass die
wirtschaftliche und militärische Überlegenheit Amerikas
zwangsläufig vergänglich ist
und dass ein Beharren
auf dauerhafter Vorherrschaft
auf eine
„Konfrontation mit Russland oder China oder beiden
hinausläuft – Atomkrieg eingeschlossen.“ Hoffmann
bezichtigt die Administration der imperialistischen
Inkompetenz: Die aktuelle Doktrin der USA und ihre
Aktionen haben die außergewöhnliche Legitimität ihrer
Führerschaft im internationalen System beschädigt. Die
Sprache von Belohnung und Bestrafung klingt herrisch, ja
imperial. Das dürfte sich auf Dauer als kontraproduktiv
herausstellen.
Frühere Regierungen zeigten ein
Bewusstsein von den Vorteilen, die regionale und globale
Kooperation der dominanten Macht gewährt. Sie lohnte
sich, indem sie militärische und finanzielle Lasten der
USA erleichterte und ihnen zugleich vermehrt Mittel und
Wege an die Hand gab, das Verhalten anderer zu überwachen
und zu beeinflussen.
Die heutigen einseitigen
Präventivkriege sind ein Rezept, um die Welt in einen
Dschungel zu verwandeln.
Dass Experten wie Rorty und Hoffmann die Kritik der Antikriegs-Aktivisten ein wenig umdeuten, stört die gar nicht. Sie halten die fachkundige Warnung, dass all zu viel kriegerische Auswärtsspiele zu „imperial overstretch“ führen können und Hochmut auch bei der Superpower vor dem Fall kommt, für eine Verstärkung ihres Arguments. Zur Bekräftigung dessen, dass sie mit ihren Vorstellungen von einer verantwortlicheren Politik keine realitätsfernen Spinner sind, sondern nur Gebote der Wirklichkeit aussprechen, schlagen sie sich gerne auf die Seite derer, die sie gerade als Verbrecher und Mörder angeprangert hatten, um ihnen zu erläutern, dass sie mit ungerechtfertigten Kriegen ihrer eigenen Sache am meisten schaden. Die Idealisten eines besseren, wirklich wohl wollenden Hegemons, der anderen Völkern bei ihrer Selbstbefreiung uneigennützig hilft und Gewalt in keinem Fall zum nationalen Vorteil anwendet, sehen sich eben als Verteidiger eines ganz vernünftigen status quo, gegen den die Staatsführung nur zum Nachteil der Nation verstoßen kann. „Unrecht Gut gedeiht nicht!“ – in diesem Glauben an das wirkende Gute in Amerika vereinigen sich friedensbewegte Kritiker des US-Imperialismus und akademische Warner vor einem Misserfolg dieses Imperialismus. Zusammen sind sie eine schon recht normale, sozusagen ernst zu nehmende Stimme im öffentlichen Hin und Her um die richtigen Konzepte der Militär- und Außenpolitik. Mit ihrer Gegnerschaft zum Irakkrieg stehen sie ein halbes Jahr nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen keineswegs mehr so allein wie ehedem. Kritik meldet sich jetzt aus noch ganz anderen Ecken als der kosmopolitischen.
Isolationisten und Anti-Isolationisten streiten ums korrekte Verhältnis von Aufwand und Ertrag der Weltherrschaft
Nach dem Sieg über den gnadenlos unterlegenen Feind gefährdet ein Guerillakrieg die Neuordnung des eroberten Terrains, fordert täglich Opfer unter den Besatzern, droht auf Jahre Kräfte zu binden und die Kosten der Besatzung in die Höhe zu treiben. Da braucht es keinen abweichenden Nationalismus, um kritisch zu werden, der ganz normale wird sauer, wenn Verluste an Soldaten und an „tax dollars“ anfallen, und zwar wegen des allgemeinen Vertrauens in die selbstverständliche Überlegenheit der US-Streitkräfte. Die Truppen haben die Lage im Griff zu haben; wenn nicht, entstehen Zweifel an der Überlegtheit und Effektivität der Washingtoner Weltpolitik. Weit entfernt davon, gegen Krieg als solchen Bedenken zu hegen, wälzen Patrioten die coole Frage: Wofür? Was hat die Nation davon? Stehen Kosten und Nutzen in einem annehmbaren Verhältnis? In diesem Zusammenhang sind die Kriegsbegründungen, die vor dem Krieg für Kongress und Öffentlichkeit gut genug waren, ins Gerede gekommen. Sie werden nun von vielen abgelehnt, aber nicht in dem Sinn, den die besseren Amerikaner von der Friedensfront meinen. Wo sie die angebliche Bedrohung der USA durch irakische Massenvernichtungswaffen als lügnerischen Vorwand für eine unprovozierte Aggression entlarven, nimmt die breitere Öffentlichkeit den Umstand, dass sich die Waffen noch immer nicht finden lassen, um einiges emotionsloser: So unmittelbar, wie Bush es darstellte, war die Bedrohung durch den Irak doch wohl nicht, stellen Senatoren fest, die für den Krieg gestimmt haben. So wenig Zeit, eine wirklich geschlossene Front der Partner zu schmieden, andere Methoden, den Irak fertig zu machen, auszuprobieren, hatte man in Wahrheit gar nicht. Wozu der überhastete Krieg, dessen Fehleinschätzungen, dessen fehlende Planung für die Nachkriegszeit und dessen Ablehnung durch Verbündete jetzt Ärger und Opfer verursachen?
Vor dieser patriotischen Prüfung erweist sich der
unverschämteste und zugleich schönste von Bushs
Kriegsgründen als Bumerang: Amerika, sagte er, sei
einmarschiert, um das irakische Volk von einem schlimmen
Diktator zu befreien. Die Idealisten der Weltmacht haben
diese Überhöhung des Krieges als Heuchelei verworfen,
Anhänger Bushs aus dem Umkreis seiner republikanischen
Partei nehmen die Heuchelei für die Wahrheit, zweifeln
keineswegs an der Wohltat, die die Army in Bagdad und
Umgebung verbrochen hat – und werden deshalb ungehalten:
Warum vergießen „wir“ amerikanisches Blut zum Wohl dieser
Araber, die uns ihre Befreiung noch nicht einmal danken?
Die öffentliche Meinung hat sich so sehr an die
Lebenslüge des amerikanischen Imperialismus gewöhnt, der
sich als Engagement für die Freiheit und
Sicherheit anderer Völker porträtiert, dass dagegen ein
nationaler Egoismus aufbegehrt, der der Regierung
vorwirft, mit ihren Kriegen dem Land nur Lasten
aufzuladen und das zum Wohle anderer Völker – als ob
Krieg je etwas andres sein könnte als die äußerste Spitze
des nationalen Egoismus gegenüber anderen Souveränen.
Konsequenterweise steht die Forderung, Amerika solle an
seine eigenen Interessen denken, sich aus den Problemen
der anderen heraushalten und nicht immer als Nothelfer zu
Diensten sein, nicht für imperialistische Bescheidenheit
und schon gar nicht für den Wunsch nach einem Rückzug aus
der amerikanisch dominierten Welt. Der Standpunkt, der
von seinen Kritikern, Isolationismus
geschimpft
wird, ist der Anspruch auf einen US-Imperialismus zum
Nulltarif. Man kritisiert den Aufwand, der getrieben
wird, um die Welt für Amerika dienstbar zu machen, und
verlangt, dass das auch billiger zu haben sein müsste,
ohne die umständliche Bündnispolitik, ohne alles
komplizierende Rücksichten auf Partner, ohne Wiederaufbau
und Bodenpräsenz nach dem Bombenkrieg.
Diesen „Isolationisten“ halten „Internationalisten“ wie Hoffmann und Rorty entgegen, dass Amerikas Vorherrschaft über den Globus Partner braucht, dass Alleingänge auf Dauer nicht durchzuhalten sein werden und der Hegemon sich gefährlich übernehmen könnte, wenn er es sich mit zu vielen Staaten auf einmal verdirbt. Diese besonnenen Strategen verkennen die „Wahrheit“ der Isolationisten: Führung in der Staatenwelt ist ohne Rücksichtslosigkeit und Krieg, ohne Unterwerfung und Unterordnung nicht zu haben. So hauen sich die Experten der Führungsmacht ihre jeweiligen Einseitigkeiten um die Ohren: Die einen bestehen darauf, dass die Weltmacht beim Führen das Unterwerfen nicht vergessen soll und nur Rücksichtslosigkeit das richtige Verhältnis zu anderen Staaten stiftet: Amerika muss sie sich zurecht machen und benutzen – und sich nicht benutzen lassen. Die andere Seite erinnert daran, dass der Führer auch eine Gefolgschaft braucht und sich ihrer nur bedienen kann, wenn diese irgend eine Chance bekommt, ihr Nationalinteresse in Amerikas Dominium einzubringen. Auf diese Weise streiten sich die Kritiker ums rechte Maß von Rücksichtslosigkeit und Einbindung – ein Maß, man sieht es an den aktuellen Schwierigkeiten, das die Bush-Administration jedenfalls nicht zu treffen versteht. So ein Streit unter Fachleuten ist nicht weiter überraschend – peinlich ist, dass die gelehrten oder nicht gelehrten Diskussionsbeiträge zum Gut- und Bessermachen des US-Imperialismus sowohl innerhalb, wie außerhalb der USA in rechts und links, kriegslüstern und kriegskritisch zerteilt, gut oder böse gefunden werden.
Lügt Bush? – Glaubwürdigkeit, das Telos aller Kritik in der Demokratie
Ist Kritik an den Machenschaften der Staatsführung nichts anderes mehr als Ausdruck der Sorge um den Erfolg der Nation, dann ist sie dort gelandet, wo sie in Demokratien hingehört: im politischen Raum; und sie ist Sache derer geworden, die ihn bevölkern, die politischen Konkurrenten um die Macht. Sie werfen Bush vor, durch seinen Fanatismus Amerika zu schwächen und seine Stellung in der Welt zu untergraben, anstatt sie auszubauen; sie säen Zweifel in die Kompetenz des Amtsinhabers, um sich selbst als die besseren Sachwalter des nationalen Erfolgs zu empfehlen. Auch Aktivisten des Protests, die sich Amerikas Rolle in der Welt und den Schutz der Bürgerfreiheiten anders vorgestellt hatten, sehen sich von den Schaukämpfen konkurrierender Amtsanwärter angesprochen, mehr oder weniger gut vielleicht, aber immerhin. Sie haben ja selbst aus Sorge ums Gemeinwesen Protest erhoben und das Gute, für das sie eintreten, als Erfordernis seines Funktionierens verstanden; ihre Kritik hatte daher von Anfang an ihr stärkstes Argument in der Warnung, Verstöße gegen die Verfassung und gegen eine verantwortliche Weltpolitik würden sich rächen.
Der Glauben, ihre Ideale entsprächen nur Sachzwängen der vernünftigen Ordnung ihres Landes, macht sie empfänglich für die ultimative Wahlkampffrage, ob Bush „es“ kann. Von Zweifeln daran, ob der Präsidenten ein guter Führer ist, der das Vertrauen seiner Landsleute verdient, ist es nur ein kleiner aber entscheidender Schritt zu der anderen Frage, zu deren Beantwortung dann endgültig alle Bürger einer Demokratie kompetent sind, ob sie sich nun mit Außen- und Rechtspolitik befassen oder nicht; der Frage nämlich, ob der Präsidenten ein Mensch ist, der Vertrauen verdient, d.h. dessen Worten der Bürger glauben darf. Das Vertrauensverhältnis zwischen Führer und Geführten, das Glauben-Dürfen ist die einzige Instanz der Prüfung, die Bürger ihren Politikern wirklich zumuten dürfen; und mit der unterschreiben sie ihre Unzuständigkeit für alle Sachfragen, die Berufenere als sie zu entscheiden haben.
Ausgerechnet in diesem Sinn bekommt der Streit um getürkte Beweise für irakische Massenvernichtungswaffen auf der heimatlichen Bühne ein Gewicht, das er außenpolitisch längst verloren hat. Verbündete darf der Präsident zum Nutzen seiner Nation vielleicht belügen, nicht aber das amerikanische Volk! Jetzt werden Untersuchungsausschüsse eingesetzt, die prüfen, ob Bush Geheimdienstberichte gefälscht oder übertrieben interpretiert, also gelogen hat. Des Weiteren wird untersucht, ob das Weiße Haus die Gattin des ehemaligen Botschafters in Bagdad, der schon vor dem Krieg dessen Begründungen widersprochen hatte, aus purer Rache als CIA-Agentin enttarnt und so der nationalen Sicherheit geschadet hat. Beweise auf diesem Feld – Vergleiche mit Watergate werden immer wieder mal gezogen – können dem Präsidenten mehr schaden als der ganze Krieg und seine amerikanischen Opfer – von den anderen redet sowieso niemand.
*
Alle Kritik an Bush, die routinemäßige der politischen Konkurrenten ebenso wie die radikale der Protestbewegung mündet in Versuchen, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben, also auch seine Würdigkeit, das hohe Amt zu bekleiden. Zweifel an den menschlichen Qualitäten des Präsidenten, Verdächtigungen, er sei ein Agent des big business, würde lügen und betrügen, sind die Quintessenz aller politischen Kontroversen. Radikalismus, wo er aufkommt, ist radikal auf diesem Feld. Den Präsidenten am Maßstab des wahren Führers messen und scheitern lassen, das lässt sich gegenüber den Gepflogenheiten im Kongress durchaus noch steigern. Der Satiriker Michael Moore[7] und andere erlauben sich maßlose Schmähungen des Analphabeten im Weißen Haus mit seiner gestohlenen Präsidentschaft, und machen damit auch gleich den Übergang vom politischen Protest zur Belustigung der Leute mit den gehobenen Ansprüchen ans Führungspersonal. Moore hat in Europa Berühmtheit erlangt dadurch dass er Mailers „geistiges Niveau der Führer“ in seine zwei Bedeutungen aufspaltet: Sie sind böse und dumm – und zwar das eine durch das andere: „Stupid White Men“ eben! Was kann man lachen über einen trockenen Alkoholiker, der keine drei grammatisch korrekten Sätze hintereinander sagen kann und dann einen Krieg beginnt; der zu blöd ist, das amerikanische Volk in einer Weise zu belügen, dass es nicht gleich seine Intelligenz von allzu plumpen Lügen beleidigt findet; oder über einen Macho, der sich in Pilotenkluft als Krieger porträtiert, selbst aber in der Vietnam-Zeit dem Militärdienst ausgewichen ist und noch nicht einmal seinen Ersatzdienst in der texanischen Flugrettung korrekt abgeleistet hat; oder über ein Söhnchen reicher Eltern, das den Kapitalismus für die breite Masse immer härter macht, selbst aber jedes Geschäft, das es anpackt, in den Sand setzt. Die Maßstäbe, an denen Moore diesen moralischen und praktischen Versager scheitern lässt, nimmt man besser nicht ernst; sonst käme einem das Grausen. Der Humorproduzent und alternative Patriot fühlt sich von Bush junior halt etwa so schlecht vertreten, wie deutsche Intellektuelle einst von Bundespräsident Lübke und „Birne“ Kohl.
[1] Eine Ausnahme ist Noam Chomsky; er beantwortet die Frage, was angesichts des Terroranschlags zu tun sei, mit der Aufforderung, man solle sich das mutwillig verständnislose Gejammer Bushs: „Why do they hate us?“ einmal ernstlich vorlegen. Dann würde man auch wissen, was sich an der amerikanischen Weltpolitik ändern müsste, wenn sie sich nicht immer wieder solche Feinde schaffen will – und was sich natürlich nicht ändern wird. (Noam Chomsky, Wars of Terror, www.zmag.org )
[2] Frei zitiert nach: Jennifer Van Bergen, The USA Patriot Act Was Planned Before 9/11; May 20, 2002, www.truthout.org; The USA Patriot Act Six Month Later: A Statement by Members of the Free Expression Network, www.freeexpression.org; Jessica Azelay, Resolutions as Resistance (anti-USA Patriot Act Resolutions), Z magazine, March 2003, www.third worldtraveler.com
[3] Wenn Kritik dieser Art radikal wird, geht sie in Verfolgungswahn über: Wer die Überwachungspraktiken ablehnt, als Konsequenz aus den Anschlägen aber doch irgendwie logisch findet, verfällt auf einen ungeheueren Verdacht: Könnte Bush die Warnungen verschiedener Stellen absichtlich missachtet haben, um Angst und Entsetzen des Volkes auszubeuten und ein für alle Mal die Freiheit aufrechter Amerikaner abzuschaffen. Aber das ist ein anderes Thema und wird unter „Verschwörungstheorie“ abgehandelt.
[4] Norman Mailer, The White Man Unburdened, New York Review of Books, Vol. 50, Number 11, July 17, 2003.
[5] Richard Rorty, Demütigung oder Solidarität, SZ 31.5.03.
[6] Stanley Hoffmann, America Goes Backward, New York Review of Books, Volume 50, Number 11, July 17,2003.
[7] Autor des Bestsellers „Stupid White Men“ und des Films „Bowling for Columbine“.