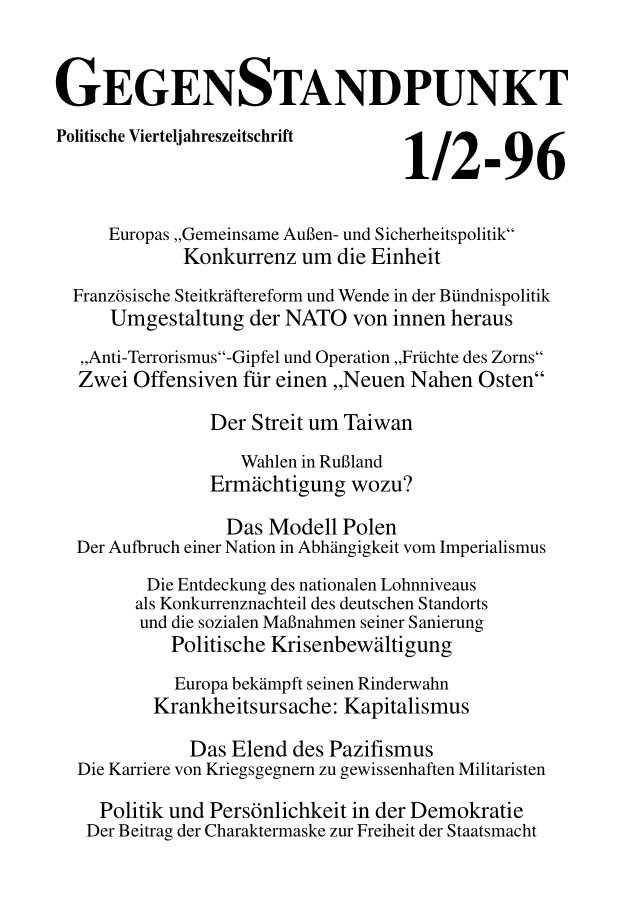Europas „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“
Konkurrenz um die Einheit
Der Bedarf nach weltpolitischer Eigenständigkeit fordert Aufgabe der Souveränität, immer als Forderung an die anderen. Das Projekt GASP dient der Emanzipation von der Nato und dem „Schutz“ durch die USA. Europa leidet daran, dass es auf beides noch nicht verzichten kann. Deutschland arbeitet auf seine Hegemonie hin.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Europas „Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik“
Konkurrenz um die Einheit
Über ihr in Maastricht gemeinschaftlich abgelegtes Grundsatzbekenntnis sind die EU-Staaten mit ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zwar bislang nicht hinausgekommen – sie findet nicht statt –, dennoch hat die Sache an Gestalt gewonnen. Wenn der deutsche Kanzler die Notwendigkeit, mit der „politischen Einigung Europas“ voranzukommen, als eine „Frage von Krieg und Frieden“ beschwört, vor „Rückfällen in die Vergangenheit“ warnt, die er andernfalls in Europa nicht ausschließen kann, also die europäischen Nationen ermahnt, sich der Alternative zu stellen, entweder gegen den Rest der Staatenwelt gemeinsame Sache zu machen oder selbst aneinanderzugeraten; wenn in London und Athen davon gesprochen wird, Deutschland gehe es bei diesem Projekt darum, die „Hegemonie über Europa“ zu erringen; und wenn der in Politik, Öffentlichkeit und Wissenschaft versammelte Sachverstand nur noch über die für das Gelingen des Vorhabens nötige „Bereitschaft zum Souveränitätsverzicht“ debattiert –, dann ist nicht mehr zu übersehen, daß es bei der GASP um die grundsätzlichsten innereuropäischen Souveränitäts- und Unterordnungsfragen geht. Warum das so ist, ist auf den ersten Blick – man denkt, es geht um Außenpolitik – nicht so ersichtlich, es wirft aber ein Licht darauf, was sich die EU-Staaten vornehmen, wenn sie darauf hinarbeiten wollen, künftig gegenüber dritten Staaten „mit einer Stimme“ aufzutreten.
Bezeichnenderweise enthält ihre Übereinkunft keine Angaben darüber, gegen wen, in welcher Angelegenheit und mit welcher Zielsetzung sie gemeinsame Sache machen wollen, und unterscheidet sich schon von daher gründlich von einem gewöhnlichen Koalitionsabkommen. Sie bezieht sich denkbar grundsätzlich auf „alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik“ und macht darin deutlich, daß hier das „gemeinsame Handeln“ nicht die Konsequenz aus einem feststehenden, zwischen den Staaten vereinbarten Handlungsbedarf ist, sondern das Prinzip, das für ihr ganzes Auftreten nach außen Gültigkeit gewinnen soll, aus dem also umgekehrt der Auftrag an die beschlußfassenden Nationen folgt, sich in allen außenpolitischen Fragen einen „gemeinsamen Standpunkt“ zuzulegen und ihre Sicherheitsinteressen in einer „europäischen Verteidigungsidentität“ aufgehen zu lassen. Auch mit diesem Auftrag geht ihr Vorhaben weit über die Erfordernisse der unter konkurrierenden Staaten üblichen Bündnispolitik hinaus, die einschließen, daß Bündnispartner ihre konkurrierenden Anliegen auch einmal zurückstellen müssen, wenn es ihnen darauf ankommt, sich gegen Dritte durchzusetzen – bis andere Verbündete bessere Durchsetzungsperspektiven bieten. Die EU-Staaten haben sich nicht weniger vorgenommen, als die Konkurrenz, die sie untereinander auf dem Feld der Außenpolitik austragen, zu überwinden, um ihren Staatenblock nach außen handlungsfähig zu machen.
Daß die EU-Staaten sich darin beschränkt sehen, was sie als Staatenblock ausrichten können, belegt zunächst einmal, wie selbstverständlich es ihnen in ihrer ganzen außenpolitischen Praxis schon geworden ist, mit der Macht zu kalkulieren, die von einem nach außen geschlossen auftretenden Europa ausgeht. Ihr Beschluß, dieser Macht Schranken aus dem Weg zu räumen, bezieht sich auf eine Konkurrenz, in der die beteiligten Nationen schon bislang mit dem Anspruch antreten, ihre jeweiligen außenpolitischen Belange als europäische Sache zur Geltung bringen zu können, die also auch längst darum geführt wird, wer von ihnen seinen Handlungsbedarf zur europäischen Sache machen kann bzw. dafür eingespannt wird; wer seine Sonderbeziehungen mit den Mitteln der Gemeinschaft ausbauen und pflegen kann bzw. seine bislang förderungswürdigen Vorhaben dadurch entwertet sieht; wer mit der Rückendeckung der ganzen EU internationale Affären anzetteln kann bzw. in die nur hineingezogen und für sie mit haftbar gemacht wird. Weil es in dieser Konkurrenz den Beteiligten in sämtlichen Fragen ihrer Außenpolitik darum geht, sich die Unterstützung ihrer Partner zu verschaffen, ist ihnen auch längst die Notwendigkeit vertraut, ihre Außenpolitik mit den anderen europäischen Staaten abzustimmen – wie sehr, das zeigt sich daran, daß auf diesem Feld von griechischen Ansprüchen in der Mazedonienfrage bis hin zu französischen Atombombenversuchen überhaupt nichts mehr stattfindet, was sich nicht die Frage gefallen lassen muß, ob es sich mit dem „Geist Europas“ verträgt. Dieser Notwendigkeit sich abzustimmen kommen sie in Verhandlungen nach, in denen es zu den üblichen Gepflogenheiten gehört, in den anhängigen Fragen bi- und multilateral zu koalieren, um dritten Mitgliedern des Vereins wirksam in den Rücken zu fallen, gegen Zugeständnisse in einer Angelegenheit in einer anderen Unterstützung auszuhandeln oder den Ruf nach Geschlossenheit laut werden zu lassen, mit dem dann nicht die Bereitschaft zum Kompromiß signalisiert wird, sondern an die Partner der unmißverständliche Antrag auf Unterordnung ergeht. Daß diese Verhandlungen nicht zur allseitigen Zufriedenheit ausfallen, liegt in der Natur der Sache. Nicht zu bestreiten ist allerdings, daß auf diesem Wege durchaus eine europäische Außenpolitik zustandekommt – die EU-Staaten betreiben eine gemeinsame Entwicklungspolitik gegenüber den AKP-Staaten, sie leiten nach allen Himmelsrichtungen ausgreifend Anschlußprojekte in die Wege, treten auf Mittelmeer- und Asienkonferenzen gemeinsam auf etc.
Diese europäische Außenpolitik gibt Auskunft über den tatsächlichen Stand der „gemeinsamen Interessen“, zu denen die EU-Staaten sich als konkurrierende Nationen haben durchringen können. Wo sie um eine gemeinsame Außenpolitik konkurrieren und die nicht zustandebringen – in gar nicht wenigen und für sie ziemlich entscheidenden Affären wie dem Balkankrieg z.B. –, belegt das umgekehrt, daß sie in der betreffenden Angelegenheit von ihren jeweiligen Interessenlagen her weder bündnisfähig noch bündniswillig sind. Von daher wird deutlich, was mit der beantragten Gemeinsamen Außenpolitik gemeint ist, mit der die EU-Staaten darüber hinauskommen wollen. Mit ihr haben sie untereinander die Notwendigkeit anerkannt, daß die Handlungsfähigkeit ihres Staatenblocks künftig weiter reichen muß als der Handlungsbedarf, der zwischen ihnen als konkurrierenden Nationen vereinbar ist. Bei ihrem Vorhaben, den sie störenden Zustand der Konkurrenz zu beenden, geht es folglich nicht mehr um eine Frage ihres Einigungswillens; den haben sie bereits in ihrer Konkurrenz ausgereizt. Insofern sind alle an „gemeinsames Handeln“ erinnernde Sprachregelungen, die schon im normalen Verhältnis zwischen konkurrierenden Staaten ziemliche Euphemismen darstellen, hier gänzlich irreführend. Die Frage, vor die sie sich gestellt haben, ist vielmehr die, wie sie eine europäische Handlungsfähigkeit stiften können, die nicht mehr vom Willen der europäischen Nationen abhängt, also auch nur durch die Beseitigung der für störend befundenen Souveränität dieser Nationen zustandekommt.
Mit ihrem Projekt erklären sich diese Nationen zu untauglichen Subjekten für eine gemeinsame Außenpolitik: Um den zwischen ihnen bestehenden Zustand der Konkurrenz zu beenden, müssen sie sich als Souveräne aus dem Verkehr ziehen. Ein interessanter Befund. Ihm ist nämlich zu entnehmen, daß ihre Konkurrenz keine Unart ist, die sie auch lassen könnten, sondern das Verhältnis, in dem sie als souveräne Staaten notwendigerweise zueinander stehen. Souverän sind sie gerade darin, daß sie sich als oberste Verfügungsgewalten über ein Land und sein Inventar wechselseitig von der Benutzung der unter ihrer Hoheit befindlichen Reichtumsquellen ausschließen. Das mögen politische Beobachter, die angesichts dessen, was die europäischen Staaten mittlerweile alles an grenzüberschreitender Ökonomie veranstalten, das Ende des Nationalismus in Europa ausrufen, etwas aus den Augen verloren haben – überholt ist dieser Grundsatz überhaupt nicht. Immerhin haben auch diese Staaten alles vereinbaren müssen, was sie an Betätigung auswärtiger Interessen in ihrem Hoheitsbereich zulassen. Dabei haben sie in jeder einzelnen Frage um die Bedingungen gerungen, also ihre eigene Souveränität zum Hebel gemacht, den anderen europäischen Staaten Zugeständnisse abzuverlangen – in Fragen, die deren Souveränität betroffen haben. Daß ihnen auf dem Weg in ihr Wirtschaftsbündnis ihre Souveränität abhanden gekommen wäre, davon ist nichts zu merken. Auf deren Abschaffung zielt es ja auch gar nicht, wenn sie immer weitgehendere Vereinbarungen darüber treffen, was sie sich an Freiheiten im grenzüberschreitenden Verkehr noch einräumen – sondern darauf, mit dem Willen der anderen Seite, also unter Inanspruchnahme von deren Souveränität in deren Herrschaftsbereich ökonomische Aktivitäten zu entfalten. Zwischen ihnen geht es also – wie in aller Außenpolitik – nach wie vor darum, fremde Souveränität zum Instrument der eigenen zu machen und dadurch die Reichweite der eigenen zu vergrößern. Das beweisen sie, wenn sie in allen Fragen der Gemeinschaftsbildung konkurrieren.
Mit dieser Konkurrenz haben sie sich aber zu einem Punkt vorgearbeitet, an dem sie sich als konkurrierende Subjekte im Weg stehen – dabei nämlich, die Macht zur Entfaltung zu bringen, die von einem vereinten Europa ausgeht. Auch da geht es ihnen darum, die Reichweite ihrer Souveränität zu vergrößern. Daß sie dafür ihre nationale Souveränität beseitigen und die EU als außenpolitisch souverän agierendes Subjekt konstituieren müssen, birgt für sie in dem Falle – und das ist für sie durchaus etwas Neues – allerdings den Widerspruch, daß die Souveränität, die sie ausweiten wollen, dann nicht mehr ihre ist. Dieser Widerspruch ist den Staaten, die das GASP-Projekt angezettelt haben, bewußt – und sie verleugnen ihn zugleich, wenn sie lässig über die „Bereitschaft zum Souveränitätsverzicht“ verhandeln, als ließe sich die von Nationen ohne weiteres erwarten. Daß es üblicherweise eine „Frage von Krieg und Frieden“ ist, wenn im Verhältnis zwischen Staaten der Punkt erreicht ist, an dem es um ihre Souveränität geht, wollen sie dann nicht mehr wissen. Sie tun vielmehr so, als würden sie sich in der EU ein gemeinsames Mittel ihrer jeweiligen Souveränität verschaffen – und werden schon wissen warum: Keiner der GASP-Staaten betreibt das Projekt in der Absicht, seine Souveränität zur Disposition zu stellen, vielmehr stehen alle auf dem Standpunkt, daß es darum geht, die der anderen zu beschneiden. Auch die Überwindung der Konkurrenz nehmen sie sich also als konkurrierende Staaten vor – die gemeinsame Sache machen. Selbst wo sie merken, worauf die hinausläuft, nämlich auf die Frage, wer da wen unterordnet, tun sie noch so, als wäre das in ihrem Projekt nicht inbegriffen.
Fragt sich nur, mit welchen Anforderungen sie sich konfrontiert sehen, daß sie so einen Bedarf anmelden.
1. Der Bedarf nach weltpolitischer Eigenständigkeit
Daß die ökonomische Weltmacht, zu der es die europäischen Staaten im Rahmen ihres Wirtschaftsbündnisses gebracht haben, mit Abstinenz in Sachen politischer Gewalt unvereinbar ist, daß die allen „Herausforderungen“ der Weltpolitik gewachsen sein muß und sich daraus das Bedürfnis nach universeller, uneingeschränkter Handlungsfähigkeit ableitet, darauf wird heute dermaßen penetrant bestanden, daß fast schon die Frage naheliegt, wie diese Staaten bislang ohne Gewalt ausgekommen sind. Das freilich sind sie gar nicht. Es war nur der von ihnen gepflegte Schein vom seiner Natur nach friedlichen, ökonomischen Engagement, mit dem Europa in die Welt wirkt, der heute durch die Phrase von der „Verantwortung“ abgelöst wird, die eine ökonomisch maßgebliche Macht auch in der Weltpolitik übernehmen muß.
Beruht hat dieser Schein darauf, daß die europäische Staatengemeinschaft bislang ein Wirtschaftsbündnis war. Zu deren Angelegenheiten gehörte auch das gemeinsame Auftreten in den immer wieder fälligen außenhandelspolitischen Affären – die politisch-militärische Aufsicht über den Rest der Staatenwelt, und damit die Grundlage aller sonstigen „äußeren Beziehungen“, war hingegen Angelegenheit der NATO. So, eben nicht als Europäische Gemeinschaft, sondern in der Allianz mit den USA und unter deren Führung, waren die Euro-Staaten bislang mitzuständig für die gewaltsame Absicherung einer Weltordnung, in der nur Staaten zugelassen sind, die das unter ihrer Hoheit befindliche Inventar auswärtigen Kapitalinteressen zugänglich machen. Das amerikanisch-europäische Militärbündnis hat nicht nur gegenüber der Sowjetunion, ihrem Lager und den ihr freundschaftlich verbundenen Nationen klargestellt, daß es jeden Verstoß gegen diese Zulassungsbedingung mit praktizierter Feindschaft quittiert. Mit seiner überlegenen Macht hat es auch sonst in der Welt für entschiedene Gewaltverhältnisse gesorgt. Durch die waren die Staaten darauf festgelegt, sich als Bestandteil des Weltmarkts der internationalen ökonomischen Konkurrenz zu stellen und die herbeigeführten Konkurrenzergebnisse anzuerkennen – auch und gerade dann, wenn die grenzüberschreitenden Geschäfte auf ihre Kosten gegangen sind, Gründe, sich auf die eigene Souveränität zu besinnen, um nachteilhafte Beziehungen gewaltsam zu korrigieren oder zu unterbinden, also durchaus vorhanden waren. Daß die versammelte Macht der NATO von solchen nationalen Eigenmächtigkeiten abschreckte und gegebenenfalls gegen sie vorging, war die solide Grundlage, auf der die paar erfolgreichen Nationen, darunter immer maßgeblicher die europäischen, mit den geschaffenen ökonomischen Abhängigkeiten erpresserisch verfahren konnten; so erfolgreich, daß ihr Imperialismus einen geradezu zivilen Eindruck machen konnte.
Wenn die europäischen Staaten an dieser von einem imperialistischen Gewaltmonopol beherrschten Welt heute eine unerträglichen Diskrepanz zwischen ökonomischer Macht und politischer Gewalt feststellen, liegt ihr Akzent also eindeutig darauf, daß ihnen der Mangel an einer genuin europäischen Aufsichtsgewalt aufstößt. Allein das reicht für sie heute hin, Nachholbedarf anzumelden. Daß der Schutz ihrer ökonomischen Interessen, mit denen sie weltweit engagiert sind, nur durch eigene, ausschließlich ihnen zu Gebote stehende Mitteln zu gewährleisten ist, steht für sie deswegen so prinzipiell und von vornherein fest, weil die Interessen, die sie zu schützen haben, gar nicht nur zu Lasten Dritter gehen. Im Kampf um Märkte und Anlagesphären stehen sich die Aufsichtsmächte selbst als Konkurrenten gegenüber, die sich wechselseitig vom Nutzen aus dem Weltmarkt ausschließen. Deswegen ist es nur folgerichtig, daß auch die Aufsicht über den Weltmarkt Gegenstand ihrer Konkurrenz ist. Denn wenn der politisch-militärische Zugriff auf fremde Souveräne schon die Voraussetzung dafür ist, sie benutzen zu können, dann geht es Staaten, die sich ihre Interessensphären ökonomisch streitig machen, auch darum, sich diesen Zugriff selbst zu verschaffen und nach Kräften Einfluß der Konkurrenten auszuschließen.
Die Selbstverständlichkeit, mit der die europäischen Staaten heute ihren Handlungsbedarf daraus ableiten, daß die Gewalt, die das weltweite Engagement ihrer Wirtschaftsmacht absichert, nicht ihre eigene ist – das hätte ihnen schon früher auffallen können[1] –, zeigt also, wie wenig normal der Zustand einer von den kapitalistischen Hauptmächten gemeinsam ausgeübten Weltaufsicht war und wie sehr er sich nur einer historischen Bedingung verdankte, der Existenz der systemwidrigen Staatsalternative, der diese Mächte den Kampf angesagt hatten und die sie als kapitalistischen Westen geeint hat. Nur unter dieser Voraussetzung war den Euro-Staaten die ihnen von den USA zugewiesene Rolle von untergeordneten Verbündeten erträglich. Sie bedeutete für sie ja auch nicht nur Unterordnung unter den Führungsanspruch der USA, sondern konnte von ihnen auch als Gelegenheit für ihre nationalen Ambitionen und ihr europäisches Projekt begriffen und wahrgenommen werden. Das Interesse Amerikas an potenten Bündnispartnern hat ihren Wiederaufstieg in den Kreis maßgebender Nationen initiiert, ihren Anstrengungen, als Wirtschaftsblock konkurrenzfähig zu werden, die Anerkennung gesichert – selbst dann noch, als längst feststand, daß den USA in Europa ein ernstzunehmender Konkurrent erwachsen war. Der Umstand führte zwar regelmäßig zu diplomatischen Verstimmungen bis hin zur Androhung regelrechter Handelskriege zwischen den NATO-Partnern. In der noch zu erledigenden Systemfrage hatten sie jedoch gemeinsam einen triftigen Grund, ihre Konkurrenz nicht zum Letzten zu treiben.
Wie sehr diese Systemfrage die normale Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Hauptmächten überdeckt hat, zeigt sich, nachdem sie erledigt ist. Damit, daß nun überall Souveräne herrschen, die sich zum richtigen System bekennen, ist für sie die Weltlage nicht politisch bereinigt und der faire marktwirtschaftliche Wettbewerb endlich von allen störenden politischen Beschränkungen befreit. Vielmehr rückt für sie sofort die elementare und alles entscheidende Frage in den Vordergrund, wer von ihnen seine Zuständigkeit in den verschiedenen Weltgegenden durchsetzen und sich „Einflußsphären“ verschaffen kann und wer dadurch an Einfluß verliert. Aus der nunmehr freigesetzten Konkurrenz um diese Frage – die sie maßgeblich mitbetreiben! – ergibt sich für die Euro-Staaten laufend zusätzliches Material für ihren Befund, daß der NATO-Schutz für sie keinen Verlaß mehr bietet.
Zum einen deswegen, weil das überkommene Bündnis mit den USA weder dafür eingerichtet ist noch sich als tauglich dafür erweist, eigene Aufsichtsansprüche nun ohne, geschweige denn gegen die USA zu behaupten. Diese eigenen Ansprüche auf Zuständigkeit betreffen immerhin ganz Europa und werden nicht nur angemeldet, sondern längst praktiziert in einer umfassenden Blockbildungs- und Anschlußpolitik, die darauf abzielt, alle Souveräne in und um Europa auf die EU und ihre führenden Mächte hinzuorientieren: Mit ihrer letzten Erweiterung um die restlichen funktionierenden kapitalistischen Staaten Europas hat die EU nicht bloß ihren Binnenmarkt vergrößert, sondern sich als der Staatenblock vollendet, der den Nationen in seinem Umfeld alternativlos als einziger Bezugspunkt für ihre ökonomischen und politischen Ambitionen entgegentritt und ihnen die Rolle abhängiger Souveränitäten zuweist. Auch wenn diese Nationen der EU tatsächlich als lauter mehr oder minder anschlußwillige Kandidaten entgegentreten, läßt das keine Zweifel am Charakter der „Beziehungen“ zu, die mit ihnen gestiftet und ausgebaut werden sollen. Aus dem, was die Nachbarn, denen das Interesse gilt, ökonomisch zu bieten haben, rechtfertigen sich diese „Beziehungen“ jedenfalls nicht; geschweige denn solche, die mit dem Versprechen verbunden wären, daß aus ihnen etwas wird. Mit ihrer Anbindung schafft sich die EU ihre Einflußsphäre und richtet sie die dort ansässigen Souveräne politisch entsprechend zu. Die Verhandlungen mit ihnen stehen deswegen unter der Prämisse politischer Willfährigkeit, die sie erweisen müssen, bevor ihre Aufnahme- und Kooperationsgesuche überhaupt Chancen haben, behandelt zu werden, und zielen auf die Einrichtung hegemonialer Verhältnisse, die in die Form von Mitgliedschaften und Assoziationsabkommen gegossen werden. Im übrigen haben die EU-Staaten mit ihrer Einmischung in Jugoslawien längst unter Beweis gestellt, daß sie es den Staaten in ihrem Umkreis nicht überlassen, sich in die Rolle abhängiger Bittsteller zu fügen. Mit der Anerkennung der nach Unabhängigkeit strebenden innerjugoslawischen Nationalismen machten sie sich schon einmal um die Zerschlagung einer Souveränität verdient, die sie in einem zerfallenden Vielvölkerstaat nicht mehr anerkennen wollten. Dabei mußten sie freilich auch die Erfahrung machen, daß das gar nicht identisch ist mit der Einsetzung von europäischen Gnaden abhängiger Souveränitäten. Sie sind davon ausgegangen, daß ihr Machtwort in der Frage der Anerkennung neuer Staaten für die Parteien vor Ort gilt und haben gar nicht damit gerechnet, es durchsetzen zu müssen – so sehr haben sie darauf vertraut, daß die überkommenen, NATO-geschützten Gewaltverhältnisse noch intakt sind und sie auf der Grundlage eine neue Ordnung auf dem Balkan stiften können. Als sie sich von den sich wenig gefügig zeigenden Parteien vor Ort dann doch vor die Notwendigkeit gestellt sahen, ihr Machtwort durchzusetzen, haben sie erfahren, daß die Macht, auf die sie vertraut haben, gar nicht ihnen zu Gebote steht – jeder Versuch, die NATO für ihren Ordnungsanspruch zu instrumentalisieren, wurde von ihrem amerikanischen Bündnispartner unterbunden. Außerdem haben sie erkennen müssen, daß sie nicht in der Lage sind, den Fall in eigener Regie zu bereinigen – schon deswegen, weil sie gar nicht den dafür nötigen gemeinsamen Willen aufbringen konnten. Dieser Fall war für sie deswegen so entscheidend, weil er der erste war, an dem sich für sie zeigte, daß ihr sich auf Europa erstreckender Ordnungsanspruch im Zweifelsfall, nämlich wenn er angefochten wird – unterordnungswillige Staaten unterzuordnen, ist eine leichte Übung –, nur soviel wert ist wie die Ordnungsgewalt, mit der sie ihm selbst Nachdruck verleihen. Er bot ihnen also reiflich Gelegenheit zur Einsicht in die Notwendigkeit eigener, von der NATO unabhängiger weltpolitischer Kompetenzen.
Zumal sie sich da – aber nicht nur da, sondern an den entscheidenden „Krisen“fällen seit dem Golf-Krieg – auch klarmachen konnten, wie Amerika seinen imperialistischen Führungsanspruch und das Bündnis mit Europa neuerdings versteht. Sie sehen sich mit einer amerikanischen Weltordnungspolitik konfrontiert, die sich nicht vom Einvernehmen mit den europäischen Verbündeten abhängig macht, sondern mit ihrer überlegenen Militärmacht vor Ort Fakten schafft, die sie anerkennen müssen. Auf der Grundlage setzen sich die USA mit ihren NATO-Partnern ins Benehmen und machen sie ihnen das zweifelhafte Angebot, an der Regelung der Affäre mitzuwirken und dadurch eine Rolle zu bekommen. Das Bündnis handhaben die USA auf die Weise als Instrument der Unterordnung der europäischen Konkurrenten unter ihren Monopolanspruch auf Zuständigkeit in der Welt. Bei der Durchsetzung dieses Anspruchs stellen sie klar, daß Rücksichten auf europäische Belange in der betreffenden Region nicht angebracht sind, weil sie als wesentlicher Bestandteil des Problems betrachtet werden, zu dessen Regelung sich Amerika herausgefordert sieht: Öffentliche Vorhaltungen des Inhalts, daß ein Potentat am Golf seine Macht europäischen Wirtschaftsinteressen verdankt oder der schädliche politische Einfluß Europas auf den jugoslawischen Krisenherd den erst in Brand gesetzt hat, sind in der Hinsicht ziemlich unmißverständlich. Mit seinen militärischen Unternehmungen, mit denen es die Zuständigkeit in einer Weltgegend an sich reißt, bestreitet Amerika unmittelbar den dort vorhandenen europäischen Einfluß; der zählt neben der militärischen Präsenz Amerikas dann erst einmal nicht mehr viel. Darüber hinaus stellt es damit für die europäischen Staaten die ganze, von ihnen bislang so erfolgreich praktizierte Methode in Frage, gestiftete ökonomische Abhängigkeiten in politischen Einfluß umzumünzen. Sie müssen erfahren, daß „Beziehungen“ zur Gewalt eben doch kein alternativer Hebel der politischen Einflußnahme sind, sondern gar keiner, wenn keine entsprechende Gewalt hinter ihnen steht.
Dieser amerikanischen Ordnungspolitik haben die europäischen Staaten erst einmal nur ihre nationale Macht entgegenzusetzen, und die reicht für eine alternative Ordnungspolitik nicht aus. Das beweisen sie damit, daß sie die „Angebote“ der USA, wenigstens als untergeordnete Mitmacher an der Regelung der von Amerika definierten Ordnungsfällen beteiligt zu sein, wahrnehmen und daraus das Beste zu machen suchen.[2]
2. Die Widersprüche des Projekts
Die europäischen Staaten haben also Gründe, ihre bislang von der NATO gesicherte imperialistische Handlungsfähigkeit gefährdet zu sehen. Deswegen steht für sie die Notwendigkeit fest, sie auf eine neue Grundlage zu stellen. Dafür haben sie das GASP-Projekt aus der Taufe gehoben – und dabei ist es bislang auch geblieben. Nach Stand der Dinge ist die GASP eben nur ein Projekt, dessen Realisierung von seinen Initiatoren noch nicht einmal richtig in die Wege geleitet ist. Daß sie unzufrieden mit diesem Stand sind, auf praktische Schritte drängen und darüber gelegentlich ein etwas ungehaltener Ton zwischen ihnen einreißt, ist verständlich. Weniger verständlich ist, was sie eigentlich davon abhält, ihr Projekt in die Tat umzusetzen. Schließlich ist dafür nur ihr Wille erforderlich. Daß es an dem fehlt, und zwar obwohl ihr Handlungsbedarf prinzipiell feststeht, liegt daran, daß dieser Handlungsbedarf für sie eine mindestens zweischneidige Sache ist.
Zum einen stehen sie vor einem ernstzunehmenden Dilemma. Solange sie nicht in der Lage sind, die Gewaltverhältnisse in der Welt sicherzustellen, die ihren Interessen auswärts Geltung verschaffen, sondern auf dem Feld erst noch eine maßgebliche Macht werden müssen, bleiben sie auf die Garantieleistungen der NATO angewiesen, von denen sie sich unabhängig machen wollen. Für entschiedene Gewaltverhältnisse zu sorgen, schließt immerhin ein, die von anderen Nationen aufgeworfenen Gewaltfragen entscheiden zu können und gerade an diesen „Herausforderungen“ – in Bosnien, zwischen China und Taiwan, im Nahen Osten – zeigt sich, daß es sich durchgängig um für die europäischen Staaten unhandliche Fälle nationaler Eigenmächtigkeit handelt. Nicht nur einfach deswegen, weil ihr politischer Einfluß auf die Parteien vor Ort nicht so weit reicht, sich deren Respekt zu verschaffen. Auch nicht allein deswegen, weil ihnen die dann erforderlichen Fähigkeiten fehlen, diesen Respekt militärisch zu erzwingen – im Fall der bosnischen Kriegsparteien ist beides von vornherein gar nicht ausgemacht gewesen, im Falle Chinas steht beides von vornherein fest. Sondern vor allem deswegen, weil die USA ihnen zielstrebig vorführen, daß nur sie, mit und ohne NATO, solche Fälle „regeln“ können – indem sie es machen und damit den Maßstab setzen, an dem sich die Einmischungsversuche der Europäer blamieren.
Nach Lage der Dinge müssen die europäischen Staaten also anerkennen, daß sie den „Herausforderungen“ der Weltpolitik nicht gewachsen sind und auf den Schutz der NATO nicht verzichten können. Daran ändert auch ihr wohlbegründeter Befund, daß dieser NATO-Schutz für sie keinen Verlaß mehr bietet, nichts, solange sie über keine Alternative verfügen. Ihr Bedarf nach Emanzipation von der NATO steht daher unter der Prämisse, daß sie dabei ihrer Abhängigkeit von der NATO Rechnung zu tragen haben. Das GASP-Projekt definiert sich deswegen von vornherein im Verhältnis zur NATO. Sein Kernstück, das Vorhaben, die WEU zu einem „eigenständigen europäischen Pfeiler in der NATO“ auszubauen, tut nicht von ungefähr und auch nicht bloß um einer geheuchelten Beschwichtigung der USA willen so, als wären Eigenständigkeit gegenüber der NATO und Einbindung in sie gar kein Gegensatz. Natürlich läßt sich dem Anspruch auf Eigenständigkeit unschwer entnehmen, daß er aus der Unzufriedenheit mit der NATO erwächst; und natürlich steht er im Gegensatz zum von der NATO beanspruchten Weltaufsichtsmonopol. Er soll jedoch – und zwar der wirklichen Absicht der europäischen Staaten nach – vereinbar sein damit, daß sie als Verbündete der USA weiterhin in der NATO und für sie aktiv sind. Daß sie sich mit solchen Bekenntnissen zur Vereinbarkeit an der Klärung der entscheidenden Frage nur vorbeidrücken, nützt ihnen allerdings nichts. Jeder Schritt, den sie in Richtung Konkretisierung ihres Vorhabens ins Auge fassen, verlangt ihnen dann doch ab, Stellung zu beziehen, in was für ein Verhältnis sie sich mit ihrer WEU künftig zur NATO begeben wollen. Und dabei zeigt sich, wie sehr sie an ihrem Dilemma laborieren: Sie sind gar nicht bereit, sich zu entscheiden, weder dafür, ihre Emanzipationsbemühungen entschlossen voranzutreiben und dabei in Kauf zu nehmen, daß sie damit ihr Bündnis mit den USA untergraben und Amerika auf die Probe stellen, noch dafür, weiterhin auf die NATO zu setzen und ihr Streben nach Eigenständigkeit dem unterzuordnen.
In der deswegen bleibenden Kontroverse darüber, wieviel Emanzipation von der NATO und wieviel Setzen auf sie für Europa notwendig und zuträglich ist, wird dann deutlich, woran es noch liegt, daß die dringlich angemahnten Fortschritte bei der GASP auf sich warten lassen. Diese Kontroverse wird von Nationen geführt, die zu „Europa“ und zur NATO alles andere als deckungsgleiche Standpunkte haben.
Daß sich diese Nationen – in auffälligem Kontrast zur bisherigen Gemeinschaftsbildung im Bereich ihrer ökonomischen Angelegenheiten – auf dem Feld der Außenpolitik mit der Fertigstellung Europas so schwer tun, verweist darauf, daß es sich da mit der „gemeinsamen Sache“ etwas anders verhält. Während ihren Bemühungen um „wirtschaftliche Integration“ im gemeinsamen Binnenmarkt tatsächlich eine Sache zugrundeliegt, die sie in ihrer Konkurrenz eint, an die sie ihre nationalen Berechnungen knüpfen, von der sie ihre Mittel abhängig gemacht haben und um deren Erfolg willen sie sich deswegen auch den „Sachzwang“ einleuchten lassen, den Standpunkt konkurrierender Nationen untereinander immer mehr aufgeben zu müssen, ist die „gemeinsame Sache“, die sie nach außen vertreten, nichts als das in ihrer Konkurrenz hergestellte Resultat erfolgreicher Nötigungen. Ob die nationalen Interessen Griechenlands in der Ägäis oder die Deutschlands im Osten seiner Landesgrenzen da dazugehören oder nicht, das entscheidet sich einzig daran, wieviel Gewicht die jeweilige Nation hinter ihren Anspruch zu legen vermag bzw. Widerstand gegen den der anderen mobilisieren kann.
Für eine Nation, die die europäische Sache maßgeblich bestimmt, stellt sich die Frage, wie weit sie sich auf die GASP einlassen und Europa ihre außenpolitischen Belange überantworten soll, daher ganz anders als für eine, die schon jetzt zum Mitmachen degradiert ist; und für eine Nation, die zu ihrer Rolle in Europa gar keine Alternative hat, wieder anders als für eine, die getrennt von Europa etwas hermacht – z.B. in der NATO. Daß die Abwägung dieser Alternative gar nicht unbedingt zugunsten Europas ausgeht, zeigt sich im Falle Großbritanniens: Da ist eine maßgebliche europäische Nation zu der Auffassung gelangt, daß sie in einem militärisch emanzipierten Europa – und durch die Unterordnung, die diese Europa absehbarerweise verlangt – von ihrem Gewicht verliert, das sie als respektable NATO-Macht besitzt, und lehnt deswegen die „Integration der WEU in die EU“ ab. Frankreich hingegen, das in dieser Angelegenheit die vorwärtsdrängende Kraft ist, betreibt als unabhängige Nuklearmacht mit „globalem Interventionspotential“ die europäischen Emanzipationsbestrebungen mit der Berechnung, sich in einem Europa „unter französischem Atomschirm“ eine unanfechtbare Führungsrolle zu erobern und in diesem Sinne auch NATO-Politik zu betreiben. Deutschland wiederum besteht gerade deswegen beim Ausbau des „eigenständigen europäischen Pfeilers“ auf seiner „Anbindung an die NATO“. Mit seinem Standbein in der NATO sichert es sich dagegen ab, daß ihm als europäische Führungsmacht, der die entscheidenden militärischen Potenzen abgehen, in der WEU eine Abhängigkeit von Frankreich erwächst; schließlich geht es ihm gerade umgekehrt darum, über die WEU Zugriff auf die letzten Machtmittel zu erlangen.
Weil die Betreiber des GASP-Projekts mit ihm gar nicht dasselbe, sondern ihre unvereinbaren Ansprüche meinen, ringen sie um die Dominanz in diesem Projekt. Dabei erweisen sie sich als ziemlich bedingte Anhänger der europäischen Sache. Sie bestehen auf ihrer nationalen Lesart von ihr – im Zweifelsfall auch gegen sie. Dann kommt es zu den Sternstunden der gemeinsamen Außenpolitik. Im Bosnienkrieg z.B., wo Deutschland genau an dem Punkt, an dem die USA die Affäre gewaltsam an sich ziehen und die in Gestalt der vor Ort befindlichen französischen und englischen Truppen behauptete Zuständigkeit der Europäer bestreiten – seine NATO-Treue beweist und sich auf die Seite der USA schlägt, um ein Stück europäischer Ordnungspolitik zu hintertreiben, bei der es nicht selbst, sondern seine Partner die Federführung übernommen haben. Weil es um die geht, paßt dazu bestens, daß deutsche Politiker bei nächster Gelegenheit als eifrigste Verfechter der GASP vorstellig werden und auf dem Feld Fortschritte einklagen.
3. Durchsetzungsmethode
Nämlich in der Weise, daß sie die Außerkraftsetzung nationaler Vetorechte und „Mehrheitsentscheidungen“ fordern, die es der EU künftig erlauben sollen, „im Bereich der GASP auch ohne Konsens“ ihrer Mitgliedstaaten zu handeln, z.B. „bei Fragen mit militärischen Auswirkungen“. Sie sind es leid, daß sie sich mit ihren Partnern noch vereinbaren müssen, wenn sie es für erforderlich erachten, die europäische Initiative zu ergreifen, und verlangen für solche Fälle nach Handhaben dafür, daß in der EU künftig nationale Vorbehalte übergangen werden können – Vorbehalte, die immerhin wohlbegründet sind in den nationalen Interessen, die ein Mitgliedsstaat gefährdet sieht. Wenn in solchen Fällen die Bereitschaft, die Initiative mitzutragen, beim einen oder anderen subalternen EU-Mitglied fehlt – Griechenland wird da von deutscher Seite immer wieder als abschreckendes Beispiel ins Gespräch gebracht –, darf es auf seine Bereitschaft, so der Standpunkt, eben nicht mehr ankommen. Auf seine Mitwirkung und Mithaftung wird dann freilich nicht verzichtet.
Aus den einschlägigen Wortmeldungen Kinkels und Waigels geht einerseits hervor, daß sie sich schon sehr sicher sind, daß es dann Deutschland ist, das die europäischen Initiativen ergreift, daß ihre Nation entsprechende Vorstöße anderer EU-Staaten zum Scheitern bringen kann bzw. die zu solchen Vorstößen gar nicht erst in der Lage sind. Auf entsprechende Erfahrungen kann Deutschland ja auch schon zurückblicken – immerhin ist es ihm auf dem Balkan gelungen, mit seiner Anerkennungspolitik erst die EU in einen Krieg hineinzuziehen und dann zu verhindern, daß in diesem Krieg Frankreich und England die europäische Initiative übernehmen. Dazu bedurfte es weder ein- noch mehrstimmig gefaßter Beschlüsse der EU, sondern einzig eines entschlossenen Setzens darauf, daß an seiner Macht für die anderen EU-Mitglieder kein Weg vorbeiführt.
Andererseits berufen sich deutsche Politiker mit ihrer Forderung nach „institutionellen Reformen“ gar nicht unbegründet auf die „gemeinsame Sache“; was man daran merkt, daß auch die anderen Mitglieder des Vereins – mit Ausnahme Englands – mit dieser Forderung etwas anfangen können, und zwar im Hinblick auf eine handlungsfähige EU, die auch sie beantragt haben.
Was sie sich von daher einleuchten lassen, ist der Antrag auf eine grundsätzliche Revision des Innenverhältnisses ihrer Union. Mit ihm wird ein anderes Europa anvisiert, in dem die Staaten nicht mehr aus eigenen Berechnungen, also aus wohlverstandenem Eigeninteresse Souveränität vergemeinschaften. Dieses Europa der „funktionalen Gemeinschaftsbildung“ war dafür gut, den europäischen Wirtschaftsblock immer enger zusammenzuschmieden, verträgt sich aber nicht mehr mit den weltpolitischen Anforderungen, denen die heutige EU gewachsen sein soll. Dieser Anspruch setzt den Entzug nationaler Souveränitätsrechte auf die Tagesordnung, durch den der Übergang der EU von einem Wirtschaftsbündnis zwischen souveränen Nationen zum außenpolitisch souverän agierenden Subjekt eingeleitet wird, dem die europäischen Nationen dann untergeordnet sind.
Da es dieses über den Nationen stehende Subjekt noch nicht gibt, machen sich stellvertretend die Nationen, die es beantragt haben, an den Vollzug dieser Unterordnung. Ihr Kampf gegen den Nationalismus in Europa hat deswegen eine eindeutige Schlagrichtung – er gilt dem Nationalismus der anderen, der den eigenen behindert. Daher bestehen sie mit ihren einschlägigen Initiativen zu „institutionellen Reformen“ auf rechtlichen Vorkehrungen dagegen, daß nicht ihre Nationen bei der Außerkraftsetzung von Souveränität die betroffenen sind, und eröffnen damit die innereuropäische Konkurrenz auf einer neuen Ebene. Auf der fordern die bevölkerungsstärksten Staaten, daß künftig mit „doppelter Mehrheit“ entschieden wird, also bei Mehrheitsentscheidungen nicht nur die Stimmen zählen sollen, sondern die Stimmen zusätzlich nach Maßgabe der Bevölkerungsstärke gewichtet werden. Gegen diesen Versuch, Kräfteverhältnisse in Stimmenverhältnisse umzumünzen, wenden sich logischerweise die kleineren Staaten, die auf das Gewicht ihrer Stimme pochen – und dabei schon jetzt an die innereuropäischen Koalitionen denken, mit denen sie sich bei Mehrheitsentscheidungen die Möglichkeit verschaffen könnten, Einfluß auf die Politik der EU zu gewinnen. Eingedenk der Gefahr, selbst überstimmt zu werden, beantragen die Befürworter von Mehrheitsentscheidungen, ihre Vorbehalte gegen Mehrheitsentscheidungen gleich mit in die Satzung aufzunehmen; in für sie elementaren Fragen ihrer Souveränität bestehen sie auf ihrem Veto; so herrscht weithin Einigkeit darin, daß sich Nationen bei der Entsendung ihrer Truppen nicht überstimmen lassen. Damit daran andererseits nicht der Beschluß von Aktionen „mit militärischen Auswirkungen“ scheitert, wird über das Institut einer „positiven Stimmenthaltung“ nachgedacht, das es gestatten würde, gegen den Einspruch einzelner Regierungen militärische Auswärtsspiele anzusetzen und die überstimmte Minderheit darauf zu verpflichten, den Beschluß zwar nicht militärisch, aber politisch und finanziell mitzutragen etc.
Wenn aufgrund des allseits hartnäckigen Bestehens auf der eigenen nationalen Souveränität dann doch nur der „kleinste gemeinsame Nenner“ herauskommt und die EU-Staaten sich womöglich demnächst einen für die europäische Außenpolitik zuständigen Generalsekretär ohne alle Handlungskompetenzen zulegen, ist das der Anfang. Die nächste außenpolitische „Herausforderung“ ist dann der erste Anwendungsfall für das dann schon geschaffene zuständige Institut. Wie das Fortschritte macht, wissen die maßgeblichen Betreiber der GASP schon, die sich „ein oder zwei ernste Krisen“ regelrecht herbeiwünschen bzw. den Mitgliedstaaten empfehlen, erst einmal „Einvernehmen über drei oder vier Aktionsfelder zu erzielen“. Den aus der Praxis „gemeinsamer Interessen“ erwachsenden Bedarf nach Handlungsfähigkeit handhaben sie selbstbewußt als Hebel, den Nationen in Europa Stück für Stück ihre Souveränität abzutrotzen. Ein Hebel ist das freilich nur für die Nationen, die diese „gemeinsamen Interessen“ maßgeblich bestimmen und Europa zu ihrer Sache gemacht haben.
4. Die GASP als Instrument im Rahmen eines deutschen Großversuchs
Deutsche Politiker behaupten, daß die Währungsunion ohne „eine entsprechende politische Verflechtung“ der EU-Staaten „nicht machbar“ sei, sie vertreten die Auffassung, daß die Erweiterung der EU ihre politische „Vertiefung“ notwendig mache, und sie verkünden eben auch, daß es für die GASP Mehrheitsentscheidungen braucht. In allen drei Fällen berufen sie sich auf gemeinsam beschlossene, europäische Vorhaben und leiten aus ihnen die Notwendigkeit ab, daß die Mitgliedsnationen der EU für sie Souveränität an Europa abtreten müssen. Was heißt da eigentlich „Notwendigkeit“ – und „müssen“?
1. Deutschland macht sich zum Vorkämpfer dieser Vorhaben. Dafür hat es seine Gründe. So wie auch seine Partner Berechnungen an diese Vorhaben knüpfen, wenn sie sie mitbeschließen. 2. Bei den von Deutschland verlangten Konsequenzen ist zu unterscheiden, ob sie aus der gemeinsamen Sache erwachsen oder aus einem deutschen Erpressungsbedürfnis. 3. Letzteres betätigt Deutschland, indem es die von ihm durchgesetzten Gemeinschaftsinteressen als Hebel ausschlachtet, in anderer Hinsicht mit Europa voranzukommen, hegemoniale Verhältnisse in Europa zu stiften. 4. Von daher ist verständlich, daß es auf der Vollendung der Währungsunion besteht: Da geht es um eine ökonomische Entmachtung, die die Betreffenden für die politische Unterordnung gefügig machen soll. 5. Das ist kein Automatismus, sondern ein Versuch – der erst einmal Streit stiftet.
[1] Es ist ihnen ja auch schon früher aufgefallen. Die Forderung, Europa müsse auch „politisch zusammenwachsen“, hatte deswegen schon zu Zeiten des Ost-West-Konflikts ihren festen Platz im Reich der „Europaideen“. Dort war sie allerdings auch jahrzehntelang eingeordnet, ohne für die Politik Relevanz zu gewinnen. Die Frage ist also die, warum sie heute in den Rang eines politischen Projekts gehoben wird und warum sie damals nur den europäischen Geist beschäftigte. Immerhin belegt letzteres, wie prinzipiell der politisch denkende Verstand überhaupt davon ausgeht und deswegen eben auch damals schon prinzipiell davon ausgegangen ist, daß es auf dem Feld der Weltpolitik darauf ankommt, Eigenständigkeit zu gewinnen.
[2] Z.B. im Nahen Osten von dem der Artikel handelt: Anti-Terrorismus-Gipfel und „Früchte des Zorns“ – zwei Offensiven zur Schaffung eines „Neuen Nahen Ostens“