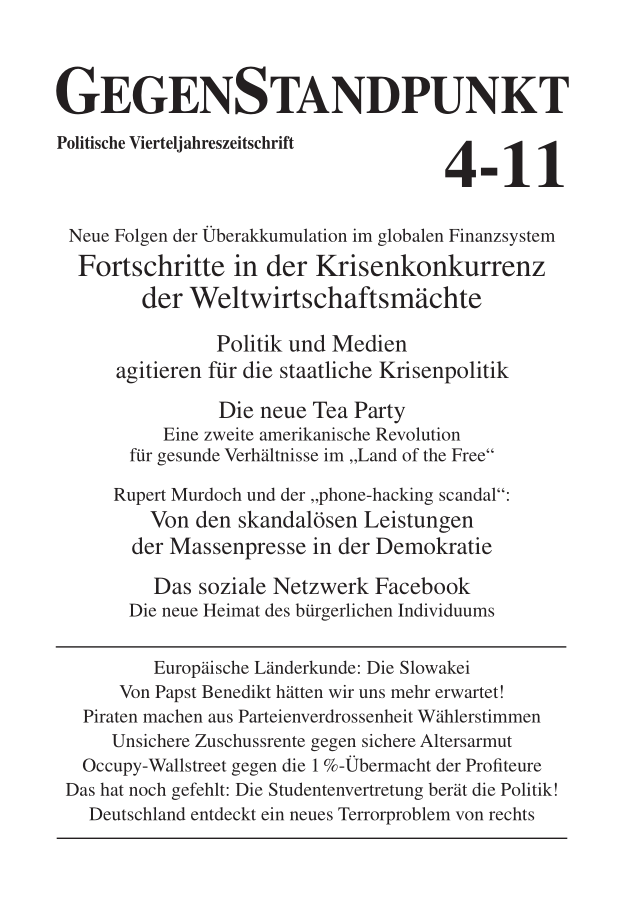Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Gute Presse für Protestpartei:
„Streng öffentlich!“ – Piraten machen aus Parteienverdrossenheit Wählerstimmen
Wenn die etablierten Meinungsmacher sich, Öffentlichkeit und Politik davor warnen, den Berliner Wahlerfolg der Piratenpartei „als Scherz am Rande abzutun“ (SZ, 20.9.11), – wenn sie im Gegenteil der Protestpartei einen ähnlichen Erfolg auf Bundesebene hochrechnen, der die Parteienlandschaft womöglich noch weiter aufsplittert, – wenn sie diesem „Haufen Spinner“ (SZ 20.9.) Ahnungslosigkeit in sämtlichen politisch brisanten Themen bescheinigen, – wenn sie überhaupt das Fehlen eines politischen Programms vermerken, – wenn sie an den Neulingen die realpolitische Professionalität vermissen, – wenn sie ihnen einen utopischen Hang zur direkten Demokratie, wo jeder irgendwie mitbestimmen soll, nachsagen, – und wenn sie sogar davon reden, dass „die neue Bewegung nichts weniger als die Systemfrage stellt“, um „den Politikbetrieb in den kommenden fünf Jahren aufzumischen“ (Spiegel 39, 2011), dann ist daran nur eines ungewöhnlich: dass das alles gar nicht im Tonfall der Beschimpfung, sondern – und da präsentiert sich das Pressespektrum in seltenem Gleichklang – in dem des Wohlwollens, sogar Beifalls vorgebracht wird: Da „kann man nicht anders, als voller Respekt und ohne Ironie den Siegeszug dieser modernen politischen Bewegung zu rühmen“ (faz.net 29.9.). Wie kommen die Rebellen zu der Ehre?
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gute Presse für Protestpartei:
„Streng
öffentlich!“ – Piraten machen aus Parteienverdrossenheit
Wählerstimmen
Wenn die etablierten Meinungsmacher sich, Öffentlichkeit
und Politik davor warnen, den Berliner Wahlerfolg der
Piratenpartei als Scherz am Rande abzutun
(SZ, 20.9.11), – wenn sie im
Gegenteil der Protestpartei einen ähnlichen
Erfolg auf Bundesebene hochrechnen, der die
Parteienlandschaft womöglich noch weiter aufsplittert, –
wenn sie diesem Haufen Spinner
(SZ 20.9.) Ahnungslosigkeit in sämtlichen
politisch brisanten Themen bescheinigen, – wenn sie
überhaupt das Fehlen eines politischen Programms
vermerken, – wenn sie an den Neulingen die realpolitische
Professionalität vermissen, – wenn sie ihnen einen
utopischen Hang zur direkten Demokratie, wo jeder
irgendwie mitbestimmen soll, nachsagen, – und wenn sie
sogar davon reden, dass „die neue Bewegung nichts
weniger als die Systemfrage stellt“, um
den Politikbetrieb in den kommenden fünf Jahren
aufzumischen
(Spiegel 39,
2011), dann ist daran nur eines ungewöhnlich: dass
das alles gar nicht im Tonfall der Beschimpfung, sondern
– und da präsentiert sich das Pressespektrum in seltenem
Gleichklang – in dem des Wohlwollens, sogar
Beifalls vorgebracht wird: Da kann man nicht
anders, als voller Respekt und ohne Ironie den Siegeszug
dieser modernen politischen Bewegung zu rühmen
(faz.net 29.9.). Wie kommen
die Rebellen zu der Ehre?
*
Eher nicht wegen des Kampfs fürs freie Internet, der die
Piraten bekannt gemacht hat. Vielmehr sind diese dabei,
sich Freiheit und Transparenz in einem deutlich
allgemeineren und politischen Sinn auf ihre Flaggen zu
schreiben, wenn sie die etablierte Politik nicht nur der
Gängelung des Individuums im Netz bezichtigen, sondern
ihr überhaupt vorwerfen, für den Bürger eine einzige
Undurchsichtigkeit zu sein: ‚Im Moment spielt sich
Politik doch irgendwo da oben ab‘, sagt (der Pirat)
Weisband, ‚das ist kein Zustand, der haltbar ist.‘
(SZ, 6.10.11) Woraus man als
Pirat folgert: „Also ging es darum, wie man
Politik präsentiert. Die Partei lebt Transparenz
vor. Das hat sehr viele Menschen begeistert. Die sind
nicht politikverdrossen. Die sind
parteienverdrossen.“ (Die Zeit, 29.9.) Jedenfalls
will diese Protestpartei dem Land keinen geringeren
Dienst erweisen, als der Staatsverdrossenheit
entgegenzuwirken
(Piratenpartei
„Unsere Ziele“).
Und damit – mit dem richtigen Thema zur rechten
Zeit
(SZ, 14.10.) –
findet sie nicht nur Wähler, sondern eben auch Applaus
von berufener Seite. Denn das Ideal der
Transparenz politischer Machtausübung gefällt
der Presse, überhaupt den Profis der medialen
Öffentlichkeit, gut. Die spüren die Nähe zu ihrem
Geschäft, ist es doch ihr ureigenstes Ethos, den Bürger
über Ansagen und Anliegen der politisch Mächtigen
lückenlos zu informieren, was schon als Kontrolle der
Macht gilt, und so seine Anteilnahme an den Drangsalen
der Republik wach zu halten. Wo mündige Subjekte stets
Einsicht in die Manöver ihrer Obrigkeit nehmen und diese
sie ihnen schuldet und gewähren muss, sind deren
Zumutungen an die Bürger – wenn offengelegt – schon kaum
mehr Zumutungen; jedenfalls können die Gegensätze
zwischen Regierten und Regierenden nicht grundsätzlicher
und unüberbrückbarer Art sein, sondern vor allem eine
Frage unzureichenden Informationsflusses, fehlender
Transparenz eben.
So sehen es die Vertreter der medialen Gewalt. Das Misstrauen, dass die Politiker etwas verheimlichen und es überhaupt an der Vermittlung ihrer Politik fehlen lassen, gehört von daher zu ihrem Berufsstand. Wo es an dieser Transparenz mangelt, kehrt sich ihnen das demokratische Idyll vom vertrauensvollen Miteinander im Gemeinwesen um in ein Gegeneinander von den Machern da oben, denen die da unten gleichgültig, teilnahmslos bis feindselig gegenüberstehen. Um diese Politikverdrossenheit der Bürger sorgen sich die Meinungsmacher seit geraumer Zeit, sie haben für ihre Brisanz mit der Figur des Wutbürgers einen Namen gefunden – und gratulieren nun den Piraten dazu, dass die den Missstand prompt in ihren Erfolg ummünzen. Sie sehen in ihnen den Partei gewordenen Beleg der Dringlichkeit ihres eigenen kritischen Bemühens um Mediation zwischen Volk und Führung.
*
Diese Stilblüte demokratischer Politikkultur, dass man aus einem Überdruss an den Parteien schon wieder eine Partei zimmert, finden die Kommentatoren von daher völlig nahe liegend. Denn wenn man das verbreitete Misstrauen in die etablierte Politik dadurch in Vertrauen für sich umwandeln kann, dass man sich als Partei das Profil gibt, sich der Sanierung des brüchigen Verhältnisses anzunehmen, passt das gut zum Befund einer Parteienverdrossenheit, also einer allgemein kritischen Stellung zur herrschenden Politik, die soweit ohne jede Kritik an einem politischen Inhalt auskommt: „Mehr als gegen die Inhalte der anderen Parteien richten sich die Piraten gegen die Art und Weise, wie bislang Politik in Deutschland gemacht wurde.“ (Spiegel 39, 2011)
An die inhaltslose Selbstkritik der etablierten Parteien, die im Falle des Misserfolgs mit dem Versprechen vor den Wähler treten, dass sie daran arbeiten werden, ihr an sich richtiges Programm ihm in Zukunft besser rüberzubringen, also an diese selbst verordnete Bürgernähe als Vermittlungsmethode der politischen Agenda, hängen sich die Piraten dran, um aber die Bürgernähe selbst zum zentralen Programminhalt für sich zu machen.
Diese Eigentümlichkeit registrieren öffentliche
Beobachter einerseits etwas befremdet: Die Neuen
wirken irgendwie aufregend, irgendwie frisch und
irgendwie sympathisch. Aber was zum Kuckuck wollen diese
Leute?
(Spiegel 39, 2011)
Andererseits weicht das Kopfschütteln darüber, dass diese
Partei zu Finanzkrise und Afghanistan nichts zu vermelden
hat, der Sympathie dafür, wie offen, locker und
„undogmatisch“ die Neulinge sich ein paar Inhalte
zusammenkratzen, indem sie die Programme der etablierten
Parteien entern, dort ein paar Phrasen abstauben, um sie
jeweils mit ihrer Forderung nach Transparenz
aufzufrisieren. So fordern sie dann z.B. den
„transparenten Umgang mit den natürlichen
Ressourcen“.
Dass die Partei demnächst – streng öffentlich
–
ihr Themenspektrum schrittweise unter breiter
Einbeziehung aller Mitglieder erweitert
(Piratenpartei, „Unsere Ziele“), gilt
dabei bereits als ganz neuer „Politikstil“.
Gutgeschrieben wird der Protestpartei auch, dass sie auf
das herkömmliche „Rechts-Links-Schema“ nichts gibt,
weshalb die Presse Forderungen wie die nach einem
bedingungslosen Grundeinkommen oder kostenlosem
Nahverkehr gar nicht erst für links hält oder als Inhalt
ernst nimmt. Sie findet das eher süß als den unbeholfenen
(weil wirklichkeitsfremden) Versuch, überhaupt so etwas
wie eine inhaltliche Position vorzuweisen. Mit Nachsicht
werden auch Aufrufe wie Der Zwang zum
geschlechtseindeutigen Vornamen ist abzuschaffen
(Spiegel 39, 2011) zitiert,
um großzügig über sie hinwegzugehen.
*
Wenn die Kommentare die Piraten gegen ihren Ruf von der
bornierten „Ein-Themen-Partei“, nämlich
„Internet-Partei“, verteidigen, zielt das also weniger
darauf, dass man von dieser Partei thematisch noch
einiges erwarten darf. Die Medien haben ihr vielmehr ein
anderes Thema, einen höheren Auftrag zugedacht, was sich
die Piraten gern gefallen lassen: Kaum hat die
Protestpartei einige, die schon ins Reich der
Nichtwähler geflüchtet waren
(Spiegel 39, 2011), ins Reich der Wähler
heimgeholt, wird sie für einen wertvollen Beitrag zur
deutschen Politkultur gelobt, als Auffangbecken für
Aussteiger
(SZ, 14.10.),
die sonstwohin abdriften könnten. Dass die
Parteienverdrossenheit genau dadurch zu heilen ist, dass
man eine Partei wählt, die die Parteienverdrossenheit auf
der politischen Bühne repräsentiert, finden die
Kommentatoren, wie gesagt, gar nicht sonderbar. Im
Gegenteil: Etablierte Journalisten halten Leute, denen
die meisten Deutschen vor kurzem nicht mal ihren
Dackel anvertraut
(Spiegel 39,
2011) hätten, auf einmal für sehr tauglich, das
Vertrauen des Wählers (zurück)zugewinnen. Und
zwar schlicht damit, dass sie eben nicht
etabliert sind. Wo die Piraten selbst den Fingerzeig
auf das Alter ihrer Konkurrenz schon für eine Kritik und
die eigene Jugend für ein flottes Wahlargument halten,
geben die Medien das positive Echo: Die Spezies des
jungen, unverbrauchten, unkonventionellen und
unprofessionellen Politnovizen erscheint ihnen gerade
recht, das stark verkratzte Bild vom
glaubwürdigen Politiker aufzupolieren.
Realpolitscher Dilettantismus und sachpolitische
Inkompetenz – sonst der Ruin politischer Glaubwürdigkeit
– eignen sich hier mal bestens als Vertrauenswerbung.
*
Diese allgemein anerkannte Eigenschaft der Glaubwürdigkeit, die sehr vom Willen des Wählers abhängt, dem Gewählten zu vertrauen, setzt freilich voraus, dass der Wähler die Macht beim Repräsentanten abgeliefert und weiter nichts zu melden hat. Denn wieso müsste er ihm sonst immerzu glauben und vertrauen? Schließlich ist die damit unterstellte Trennung der politischen Macht von dem ihr unterworfenen Volk der Ausgangspunkt jeder gelungenen Vermittlung.
Diese Trennung liefert den Maßstab, ist sozusagen die
Hardware der Politiktüchtigkeit, auf die hin die Piraten
eben auch gemustert werden: Kaum sind sie für den neuen
Schwung und Stil in der Mediation zwischen Volk und
Führung gelobt worden, kriegen sie die Gretchenfrage
serviert, wie sie es mit der Souveränität
politischer Entscheidungsträger halten. Also wie ernst so
Flausen von direkter Demokratie
und Jeder kann
mitmachen, wann er will und wie er will
(faz.net 29.9.) gemeint sind. Die Antwort
von einem Oberpiraten: Es geht nicht darum, dass jetzt
jeder Bürger über jedes Thema abstimmt, das würde nicht
funktionieren. Sondern darum, die repräsentative
Demokratie um weitere partizipative Elemente zu
erweitern. Die letztendliche Entscheidung wird trotzdem
wieder von den Abgeordneten getroffen. Das ist auch in
der Piratenpartei so.
(Pirat
Nerz in: Die Zeit, 29.9.)
Das registriert die Presse einerseits mit Genugtuung,
erster Reifetest quasi bestanden. Andererseits bleibt das
Misstrauen, ob es diese Neulinge mit dem
Öffentlichkeitsidealismus, der ihnen Wählerstimmen
bringt, nicht doch etwas zu weit treiben: Werden die
Piraten im Sinne der vollkommenen (!) Transparenz auch
aus nicht öffentlichen Ausschusssitzungen bloggen? ‚Da
gibt es bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche
Ansätze‘ wiegelt (der Pirat) Meyer ab. So richtig auf
Konfrontationskurs ist sie nicht, diese neue
Protestpartei.
(SZ,
20.9.)
So vertrauen die Kommentatoren darauf, dass die jungen
Wilden, die inhaltlich sowieso mit nichts aus dem Ruder
laufen, sich auch mit ihrem Politikstil den Sachgesetzen
verantwortlicher demokratischer Realpolitik
unterordnen werden. Für die Gelassenheit dieses Befunds
spricht auch die ironische Prognose, dass dieselben
Rebellen, die sie heute noch großzügig mit ihrer „betont
unprofessionellen“ Art punkten lassen, morgen schon
etabliert und weniger „sexy“ sein dürften: Sie scheint
sich in Windeseile zu vollziehen, diese Metamorphose vom
Netzrebellen zum Staatsmann
(SZ,
29.9.). Damit trägt die Frischzellenkur der
Demokratie, für die sie die Piraten nominiert haben,
bereits ihr Verfallsdatum in sich; das relativiert all
die Komplimente für das Wie, letztlich zählt
eben doch das Was der politischen Räson. In
diesem Sinn folgt dem Dankeschön an die Politstylisten
für die Brise frischer Wind, über den das Land sich
freuen sollte
, der spöttische Gruß: Den Piraten
ansonsten ein herzliches ‚Viel Spaß!‘ in der
Bezirksverordnetenversammlung
(SZ, 20.9.).