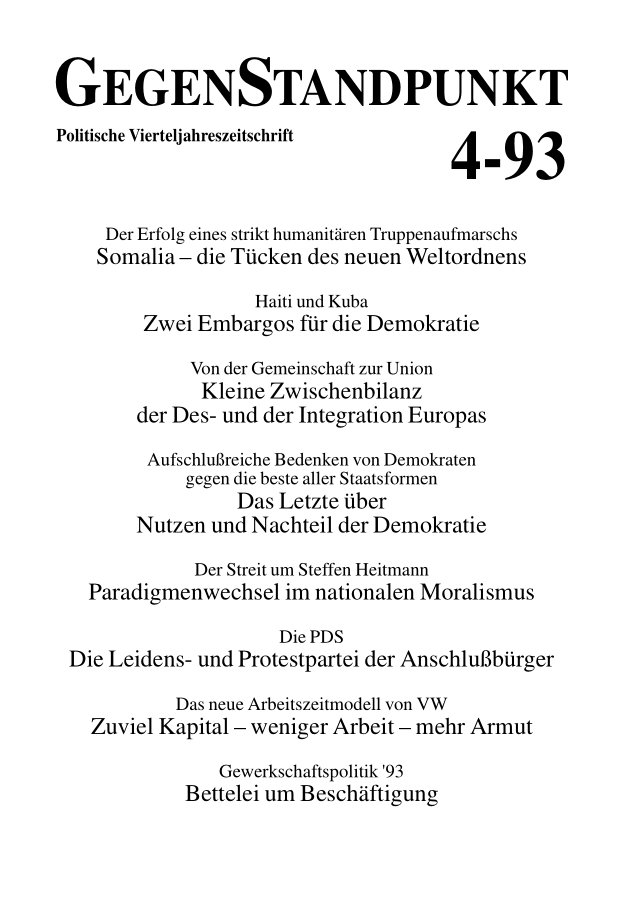Die PDS
Die Leidens- und Protestpartei der Anschlussbürger
Die PDS vertritt und vereinnahmt 2 Sorten des unzufriedenen Zoni-Nationalismus: Als Leidenspartei geläuterter Ex-DDR-Anhänger pflegt die PDS mit ihrem Ringen um eine Sozialismus-Definition und der saubersten Distanzierung von der DDR öffentlich die Bekehrung zu einer demokratisch annehmbaren und kapitalistisch verträglichen Verbesserungsperspektive. Als Protestpartei vertritt sie im Namen eines zu einigenden Deutschlands die enttäuschten Anschlusserwartungen und den ungebrochenen Anschlusswillen der Ostdeutschen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
Die PDS
Die Leidens- und Protestpartei der
Anschlußbürger
Die PDS tritt als Protestpartei an, die umfassend Anklage gegen die Zustände in Deutschland erhebt; die sich für bessere politische und ökonomische Zustände einsetzt; die sich auch im neuen Deutschland für „Sozialismus“ stark macht.
A. Das erste Angebot der „Partei des demokratischen Sozialismus“: die Identitätsprobleme geläuterter Ex-DDR-Anhänger
1. Das Ringen um eine garantiert nachfrageorientierte Sozialismusdefinition
„Der Sozialismus ist für uns ein notwendiges Ziel.“ [1]
Eine etwas merkwürdige Versicherung. Da bringen Kritiker nicht ihre Einwände gegen das System vor, das den Sozialismus erledigt hat; sie legen nicht die besseren Verhältnisse dar, denen sie sich verpflichtet fühlen. Sie bekennen sich dazu, persönlich ohne eine sozialistische Perspektive nicht auskommen zu können. Wie die beschaffen sein soll, ist aber gar nicht so einfach herauszufinden; sie fällt nämlich ziemlich unbestimmt und ununterscheidbar aus:
„Sozialismus ist für uns ein Wertesystem, in dem Freiheit, Gleichheit und Solidarität, menschliche Emanzipation, soziale Gerechtigkeit, Erhalt der Natur und Frieden untrennbar verbunden sind.“
„Sozialismus ist für uns eine Bewegung gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, gegen patriarchalische Unterdrückung, gegen die Ausplünderung der Natur, für die Bewahrung und Entwicklung menschlicher Kultur, für die Durchsetzung der Menschenrechte, für eine Gesellschaft, in der die Menschen ihre Angelegenheiten demokratisch und auf rationale Weise regeln.“
Nicht gerade wenig, was da unter der Überschrift „Sozialistische Erneuerung“ zusammengesammelt wird; und garantiert nichts, zu dem ein programmatisch gestimmter Demokrat Nein sagen könnte. Schließlich wird hier der Wertekanon aufgefahren, mit dem auch christdemokratische, sozialdemokratische, liberale und grüne Parteivertreter ihr politisches Treiben moralisch untermauern; die höchsten Güter des Grundgesetzes, der Kirchen, der regierenden Demokraten – die gängige Liste aller guten Absichten also, mit denen demokratische Politiker sich zu schmücken pflegen bei einem Regierungsgeschäft, das regelmäßig immer genau die ungemütlichen und zerstörerischen Wirkungen hervorbringt, gegen die die Regierenden mit solchen programmatischen Sonntagsreden Abhilfe versprechen. Alle Demokraten führen sie im Programm, und jeder weiß, was damit gesagt sein soll: daß die jeweilige Partei, wenn sie die gültigen politischen und ökonomischen Interessen durchsetzt, das in Verantwortung gegenüber Land und Volk und im Dienst an höchsten Werten macht.
Die PDS verwechselt zielstrebig Politik mit der gemeinsamen Suche nach Lösungen für gemeinsame Probleme aller verantwortlichen „Menschen“ und präsentiert sich als Angebot, beim Ringen um – schon wieder gemeinsame – Lösungen einige garantiert für jedermann attraktive Werte auf Lager zu haben. Wo die Protestpartei grundsätzlich wird, kennt sie keine Täter und Opfer mehr, schon gleich keine Klassen, gesellschaftliche und politische Gegner, sondern nur ein fiktives Subjekt namens „die Menschheit“, welche einen „Ausweg aus ihrer zerstörerischen Entwicklung“ finden soll. Das Wertvollste am Sozialismus soll gerade das sein, was an ihm einfach allgemeinmenschlich ist:
„Auf die humanistischen und demokratischen Traditionen der sozialistischen Idee…darf bei der Suche nach einer menschlichen Lebensperspektive nicht verzichtet werden.“
Die PDS versammelt die uralten und immer neuen demokratischen Reformversprechen, die in der übrigen Parteienlandschaft etwas in den Hintergrund getreten sind gegenüber den Bekenntnissen zu den leidigen „Sachnotwendigkeiten“ nationaler „Krisenbewältigung“, bloß besonders vollzählig in ihrem Programm.
Aber sie beharrt darauf, daß das „Sozialismus“ sei; das soll das Markenzeichen der Partei sein. Mit ihrer „sozialistischen“ Perspektive einer besseren demokratischen Welt besteht die PDS darauf, daß sie es im Unterschied zu allen anderen Parteien als einzige wirklich ernst mit den guten Vorsätzen meint und sie keineswegs als bloße Begleitmusik bei der unveränderten Fortführung der bisherigen Politik verstanden wissen will. Sie will sich damit offensichtlich von dem gültigen Standpunkt absetzen, daß die kapitalistischen Verhältnisse von Haus aus unüberbietbar gut und über jede Kritik erhaben sind. Das kapitalistische System einfach bejahen und seine Wirkungen zu unschönen Seiten, bloßen Folgeproblemen herunterdefinieren, das will sie nicht. Sie deutet sogar immer wieder darauf hin, daß sie diese Wirkungen als „systemnotwendig“ einschätzt; sie läßt sich andererseits von solchen Einschätzungen aber überhaupt nicht davon abhalten, daß es näher besehen doch bloß darum geht, dieses System durch eine systematische politische Betreuung, Begrenzung und Ergänzung unter sozialen, menschheitlichen, demokratischen Gesichtspunkten zu verbessern – gleichgültig dagegen, ob das in diesem System überhaupt vorgesehen ist, und unberührt davon, daß in dieser Nation gerade alle Gesichtspunkte gewerkschaftlicher Lohnsicherung, sozialstaatlicher Rücksichtnahme, demokratischer Berücksichtigung von Bürgerwünschen offensiv gestrichen werden. Sie setzt den wirklichen Verhältnissen einfach den schönen Schein ‚wirklicher‘ demokratischer und sozialer Zustände entgegen, beklagt die Differenz zwischen beiden und meint, daß damit eigentlich für jedermann klar sei, daß einiges getan werden müsse, um diese Differenz auszuräumen. Sie begegnet also der bundesdeutschen Realität mit einer alternativen Weltanschauung, einem abgrundtiefen Idealismus über die bloß noch nicht verwirklichten menschenfreundlichen Grundsätze demokratischer Politik. Eine Feindschaftserklärung an irgendjemand und irgendetwas soll der neue „demokratische Sozialismus“ ausdrücklich nicht sein, sondern eine Bereicherung.
2. Das Ringen um die sauberste Distanzierung von der aufgegebenen geistigen Heimat
Am Angebotscharakter ihres „Sozialismus“ zweifeln die demokratischen Sozialisten aber offenbar selber. Jedesmal wenn sie darüber Klage führen, was das neue Deutschland seinen Bürgern antut, jedesmal, wenn sie die Vorzüge der „für uns…notwendigen“ Perspektive im Munde führen, fühlen sie sich zu Klarstellungen aufgerufen, wie ihre Kritik keinesfalls verstanden sein soll: keinesfalls in dem Sinne, wie sie bis gestern mindestens so entschieden wie die bundesdeutschen Antikommunisten – bloß mit umgekehrter Bewertung – den Sozialismus für „real“ gehalten haben. Kaum wenden sie etwas gegen das real existierende Deutschland ein, meinen sie sich von der verflossenen DDR distanzieren zu müssen, ohne sich der Tour, das erledigte „Unrechtsregime“ mit dem Hinweis „Stasi“ argumentlos zu verdammen, anzuschließen. Gegen diese Tour wollen sie sich damit zur Wehr setzen. Bloß wie!
„Der Zusammenbruch (des realen Sozialismus) war eine notwendige Folge seiner zunehmenden Unfähigkeit, das Eigentum an den Produktionsmitteln in einer für die Produzenten spürbaren Weise zu vergesellschaften… Es gelang nicht, die erforderliche ökonomische Effektivität zu erreichen und sie mit wirtschaftlicher und politischer Demokratie sowie konsequenter ökologischer Orientierung zu verbinden.“
Die PDS bringt das theoretische Bravourstück zustande, im Gewand einer eigenständigen Kritik der DDR die gültige Ideologie vorzutragen, daß sich mit dem Sieg des Westens das bessere, sprich menschendienlichere System durchgesetzt habe und nicht die überlegene staatliche Gewalt und die sachzwangmäßigere Methode, das Arbeitsvolk für die nationale Reichtumsvermehrung dienstbar zu machen. Mit der angeführten Notwendigkeit des „Zusammenbruchs“ – hier mag die PDS überhaupt nicht wie sonst von „Anschluß“ an das siegreiche Deutschland reden! – macht sie sich die Geschichtslüge zueigen, die DDR sei an ihren eigenen inneren Widersprüchen zerbrochen. Allerdings wollen die Vergangenheitsbewältiger aus den Reihen der PDS damit der offiziellen Lesart „Unrechtsregime“ eine andere Beurteilung entgegensetzen. Sie trennen zwischen guter Absicht und schlechter Realität und halten dem anderen Deutschland Unvermögen vor, die Vorhaben guter Politik auch zu verwirklichen: Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel soll nicht gelungen sein – bzw. immer weniger – d.h. immer weniger bemerkbar für die Adressaten dieses löblichen Unterfangens. Hier ist eigentlich weder von Vergesellschaftung die Rede, noch davon, was da im Osten und warum ökonomisch nicht geklappt hat, was die Verstaatlichung im realen Sozialismus sollte und bewirkt hat und ob sie nicht ganz „spürbar“ funktioniert hat. Eigentlich bemängelt die PDS an der Herrschaft drüben nur, daß der erwünschte Effekt auf die Gemüter ihrer Bürger – deren Zustimmung – ausgeblieben ist. Damit begründet sie, daß der Staat abgetreten ist. Das ist mehrfach falsch: Erstens ist die konstatierte allgemeine Ablehnung so allgemein nun auch wieder nicht gewesen und gar nicht quasi naturnotwendig aus den Mängeln des Systems, sondern aus einem falschen Systemvergleich gespeist worden, den die BRD in feindseliger Absicht der DDR angetragen hat und an dem sich die DDR selbstkritisch gemessen hat. Zweitens ist der Irrglaube breiter Bevölkerungskreise der DDR, die überlegenen Methoden der nationalen Reichtumsmehrung im westlichen System würden auch automatisch wachsenden Massenwohlstand einschließen, überhaupt kein Grund dafür, daß ein Staat mit seinen ganzen Gewaltmitteln sang- und klanglos „zusammenbricht“. Im nächsten Atemzug soll die DDR dann laut PDS-Analyse auch wieder an etwas anderem „gescheitert“ sein: der fehlenden „Effektivität“. Einerseits soll der Arbeiter- und Bauernstaat es also nicht geschafft haben, sein Kommando über die Produktion als Dienst für das Volk sichtbar zu organisieren; auf der anderen Seite soll es ihm nicht gelungen sein, die Werktätigen für den Dienst am nationalen Reichtum genügend einzuspannen. Und schließlich – noch eine Wendung um 180 Grad – soll es der realsozialistische Staat versäumt haben, dabei auch noch entschieden auf Umwelt- und demokratische Bürgerbedürfnisse zu achten. Als vertrüge sich die am Westvergleich entdeckte „Effektivität“ in Sachen Staatsreichtum mit den verlangten Rücksichtnahmen.
Solche gedanklichen Kapriolen zeigen, daß die demokratischen Sozialisten weder wissen noch wissen wollen, was es mit dem realsozialistischen System der DDR auf sich hatte, was am Staatssozialismus wirklich zu kritisieren ist, wie er den verrückten Westdrang von großen Teilen seiner Bevölkerung mitproduziert hat, warum er ihn gleichzeitig unterdrückt und warum er sich am Ende schließlich mehr oder weniger widerstandslos dem Anspruch der BRD gebeugt und aufgegeben hat. Statt dessen arbeiten sie sich an einer Erklärung ab, die bloß auf den matten Trost hinausläuft, der reale Sozialismus sei zumindest gut gemeint gewesen.
Genau umgekehrt stehen sie zur Republik, an die sie angeschlossen worden sind. Während sie die DDR an ihrer Unfähigkeit gescheitert sehen, sich vor den geläuterten Idealen einer volksfreundlichen, effektiven, ökologisch orientierten, demokratisch verfaßten Herrschaft zu bewähren, konstatieren sie für das neue Deutschland: Es ist das fähigere System, bloß fehlt es allenthalben am politischen Willen zur Verwirklichung dieser Ideale. Mit der Wahrheit hat das alles nichts zu tun. Es ist ja schwer einzusehen, wie z.B. die Verurteilung der DDR wegen Versäumnissen bei der Emanzipation der Frauen –
„Trotz einiger bedeutender Schritte zur Gleichberechtigung und ökonomischen Unabhängigkeit der Frau wurde auch das Patriarchat nicht ernsthaft erschüttert.“ –
in irgendeiner Hinsicht für den fortschrittlicheren Charakter des Deutschlands der Leichtlohngruppen und des Paragraphen 218 sprechen soll. Und was Frieden, Gerechtigkeit, Menschenrechte… angeht: Das System, das die PDS als den neuen Adressaten der Forderungen behandelt, an denen die DDR gescheitert sein soll, läßt sich an solchen Idealen gar nicht messen, sondern definiert selber, wie sie gemeint sind: als passende Vokabeln für die jeweils gültigen staatlichen Ordnungsansprüche nach innen und außen. Aber für PDSler hat mit der überlegenen Gewalt offenbar die Geschichte ihr verbindliches Urteil gesprochen. Daher erfinden sie lieber in ihren Augen verständliche Gründe für das „Scheitern des sozialistischen Versuchs“ in Ostdeutschland und für den notwendigen Siegeszug des kapitalistischen Deutschland. Auf den Standpunkt, daß der alternative Staat – darum hat es sich nämlich bei dem „Versuch“ gehandelt – schon seine guten oder weniger guten Herrschaftsgründe gehabt haben wird, daß die mit der Kritik des neuen Ladens aber nichts zu tun haben, geschweige denn an der irgendetwas relativieren, wollen sie sich nicht stellen. Die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, sich vom Idealismus verabschieden, man habe schon irgendwie das Beste in der DDR gewollt, bloß nicht hingekriegt, und sich den Verhältnissen widmen, mit denen sie es jetzt zu tun hat, genau das will die PDS auf keinen Fall.
3. Das Ringen um Selbstachtung und Zulassung als verantwortliche Demokraten
Statt mit den Zumutungen im neuen Staat kämpft die PDS mit dem Dilemma, nicht mehr für die alte DDR eintreten zu wollen, aber auch nicht einfach Ja zum neuen Deutschland sagen zu wollen. Sie schlägt sich mit dem Problem herum, diese doppelte Negation hinzukriegen. Statt ihre Kritik an den Mann zu bringen, wälzt sie öffentlich ihre Selbstzweifel und strengt krampfhafte Beweise an, daß sie „trotz allem“ und „immer noch“ zur Vertretung „sozialistischer Positionen“ berechtigt ist. Jeden eigenen Einwand will sie selber nur gelten zu lassen, wenn er als Absetzung vom verflossenen System daherkommt; umgekehrt sollen ihre Bekenntnisse, zum neuen System keine Alternative mehr wissen zu wollen, gleichzeitig ein Stück Ehrenrettung ihrer ehemaligen Alternative sein:
„Für die Geschichte, Gegenwart und Zukunft Deutschlands wie auch für die Politik demokratischer Sozialistinnen und Sozialisten in diesem Land ist es ebenso notwendig, sich mit den Defiziten der DDR-Gesellschaft auseinanderzusetzen, wie die Berechtigung und Rechtmäßigkeit einer über den Kapitalismus hinausgehenden Entwicklung auf deutschem Boden zu verteidigen.“
Statt mit den Zuständen, gegen die sie sich wenden, befassen sich PDSler viel ausgiebiger mit ihren Selbstzweifeln und Leiden und führen öffentlich vor, wie schwer sie es sich mit ihrer Kritik machen. Dieses endlose Selbstrechtfertigungsprogramm halten sie für eine großartige Errungenschaft. Das teilen sie dann auch ständig der demokratischen Öffentlichkeit mit, als müßte die genau ihr Problem teilen, ob man als Mitmacher von Gestern heute überhaupt noch dagegen sein darf, und den Eiertanz der PDS um ihr gewendetes Weiß-Warum als Ausweis moralischer Überlegenheit honorieren:
„Noch nie in der deutschen Geschichte ist der Versuch geglückt, den wir unternehmen, nämlich nach einer politischen Umwälzung zu seiner Herkunft, Verantwortung und auch Schuld zu stehen, sich transparent vor den Augen der Öffentlichkeit – wenn auch mit großen Schwierigkeiten – zu verändern und zu erneuern, aber auch zu bewahren, zu Traditionen und Visionen zu stehen.“ (Gregor Gysi, Rede auf dem 3. Parteitag, in: Disput 13/14,1993)
Das ist zwar nicht ganz die Wahrheit, sondern ein bißchen die Kopie der Masche, mit der Westdeutschland aus Ruinen auferstanden ist und seine Rolle als Nato-Frontstaat und Europa-Aufsteiger mit dem Image eines geläuterten und daher auch wieder zu Ansprüchen berechtigten Mitglieds der westlichen Staatengemeinschaft versehen hat. Aber im Unterschied zu den demokratisch gewendeten Faschisten meinen es die Realsozialisten von gestern wirklich ernst mit ihren Selbstvorwürfen, blind für die „Fehler“ des Systems gewesen zu sein, die sie jetzt wegen seines „Scheiterns“ entdecken wollen. Deswegen reflektieren sie immerzu sich und ihre verhängnisvolle „Biographie“ (PDS-deutsch für die Mitgliedschaft in der SED bzw. die Rolle im alten Staat), führen vor, wie gewissenhaft sie nach dem Zusammenbruch der DDR mit sich selber ins Gericht gehen, wie entschieden sie umgedacht haben, aber in Treue zu sich selbst. Die „Wendehälse“, die sich auf die Siegerseite geschlagen haben, finden sie moralisch verwerflich, die alten Betonköpfe, die auf gewissen Errungenschaften der DDR bestehen, aber erst recht. So schlagen sie sich mit ihrem verrückten Zwiespalt herum, sich nach eigener Auffassung von ihrer alten politischen Heimat lossagen zu müssen, ohne dem neuen Staat deswegen gleich in allem recht geben zu wollen. Sie ersparen sich damit eine vernünftige Kritik ihrer Irrtümer von einst, vor allem aber ersparen sie ihren Gegnern eine vernünftige Kritik des ewigen „Stasi“-Geschreis. Statt dessen führen sie einen Dauerkampf mit sich selber um ihre moralische Qualifikation als Kritiker. Kurz und gut: Sie wälzen öffentlich das Identitätsproblem von Überläufern des anderen Deutschland, die sich dabei treu bleiben und damit auch noch als die besten Demokraten erweisen wollen. Und das gegenüber einer demokratischen Öffentlichkeit und Konkurrenz, die sie moralisch ausgrenzt und politisch, verfassungsschutzmäßig und juristisch erledigen will; die jeden zum Staatsfeind erklärt, der nicht ein für alle Mal und bedingungslos abschwört.
Für diesen öffentlich ausgetragenen Kampf um die Bewältigung ihrer Identitätsprobleme als ehemals überzeugte Mitmacher der DDR und jetzige überzeugte Reformanhänger eines Staates, der weder irgendeine Reform noch ausgerechnet sie zur politischen Verantwortung zulassen will – dafür wollen sie geschätzt und gewählt werden. Aber nicht bloß dafür.
B. Das zweite Angebot der „Partei des demokratischen Sozialismus“: originäre Vertretung enttäuschter Anschlußbürger
1. Immer auf der Seite der Erniedrigten und Beleidigten Ost-Deutschen
Mit der skeptischen Pflege ihrer Bekehrung zu einer garantiert demokratisch annehmbaren und kapitalistisch verträglichen Verbesserungsperspektive fühlen PDSler sich nämlich berufen, neben ihren eigenen Sorgen um ihre lädierte Politseele die Sorgen und Beschwerden der Ostbürger zu vertreten, die entgegen ihren Hoffnungen überhaupt nicht in wachsendem Wohlstand gelandet sind.
Dabei beherrscht die PDS die Demokraten vertraute Kunst, geschädigte materielle Interessen in eine Beschädigung höherer Natur zu verwandeln. Sie verspricht einen entschlossenen Kampf gegen „politische Entmündigung, soziale Demontage und Zerstörung der menschlichen Würde“, macht sich also zum Anwalt der Vorstellung, die Notlage, unter der Millionen leiden, sei ein einziger Anschlag auf die Werte, denen eine Politik „im Namen des Volkes“ verpflichtet wäre. Das Problem der „Massenarbeitslosigkeit“, das die Ostler als erste große Errungenschaft der „sozialen Marktwirtschaft“ erfahren, liegt für die Wendesozialisten nicht in der Banalität, daß jede Menge Lohnabhängige deswegen, weil ihre geschäftliche Anwendung sich nicht lohnt, zu wenig Geld haben in einer Gesellschaft, wo sich jedes Bedürfnis an seiner Zahlungsfähigkeit zu messen hat. Als geläuterte Sozialisten erinnern sie sich im neuen System an das reaktionäre Lob der Arbeit, mit dem der Arbeiter- und Bauernstaat den Einsatz des werktätigen Volkes im Dienste der Gemeinschaft, sprich des Staates gewürdigt und zum Sinnprogramm überhöht hat. Dieses Lob wenden sie jetzt umstandslos auf die Abhängigkeit der Arbeitskraft von den Gewinnkalkulationen kapitalistischer Privateigentümer an – soweit sie zum Dienst am Kapital herangezogen wird:
„Soziologische Untersuchungen bestätigen jedoch: die Arbeit bleibt bestimmender Faktor der Lebensweise und der persönlichen Lebenschancen der Menschen sowie für den sozialen Status. Erwerbslosigkeit läßt Kreativität und Qualifikationen verkümmern, zerstört Kommunikationsbeziehungen, führt häufig zu Mutlosigkeit und Passivität.“ (Positionen zur Diskussion um den Wirtschaftsstandort Deutschland, in: Beiträge zur Wirtschaftspolitik 7/93)
Die Anwälte von Freiheit und Menschenwürde kennen keine Lohnarbeit mehr, die sich der bitteren Notwendigkeit von Arbeitern verdankt, sich mangels Verfügung über die Produktionsmittel deren Besitzern zur Verfügung zu stellen; sie wollen programmatisch nur noch „Erwerbsarbeit“ kennen. Deswegen können sie auch vornehm davon absehen, daß die beklagte Arbeitslosigkeit dem extensiven und intensiven Einsatz der Beschäftigten durch die Kapitalisten geschuldet ist und insofern nur die Kehrseite der gepriesenen produktiven Betätigung ist. Statt dessen beklagen sie, daß dort, wo nicht „beschäftigt“ wird, „Müßiggang“ regiert – offenbar das Fürchterlichste, wozu „Millionen“, die anscheinend nichts anderes als „arbeiten wollen, gezwungen werden“ –, und sinnen auf Abhilfe.
Dafür begeben sie sich in die Alltagsniederungen konstruktiver Vorschläge im Geiste ihres neuen demokratischen Sozialismus. Als erstes klagen sie ganz auf der Linie der Gewerkschaft Beschäftigung ein, teilen also die Vorstellung, es gelte, ein knappes Gut „gerechter“ zu „verteilen“ – und zeigen abgrundtiefe Einsicht in die marktwirtschaftliche Notwendigkeit, den Lohn, von dem Arbeiter leben müssen, als gewinnbringende Kost zu kalkulieren:
„Bei der Diskussion der mit der Arbeitszeitverkürzung verbundenen Probleme steht die Frage des Lohnausgleichs natürlich mit im Vordergrund. Es wäre auch für eine linke Oppositionspartei unrealistisch und wenig glaubwürdig, wenn sie diese Problematik ignorieren würde.“ (ebd.)
Sodann rechnen sie in guter Einheitsgewerkschaftsmanier vor, wieviel sich durch Arbeitszeitverkürzung an Leistung steigern – „Produktivitätseffekt von 40% der Arbeitszeitverkürzung“ – und an Arbeitslosengeld einsparen ließe, kommen mit dem PDS-Rechenschieber auf gut 100 Milliarden Mark im Jahr und rechnen vor, daß mit ein bißchen gutem Willen Unternehmergeschäft, Fiskus und eine „gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit“ mit „weitgehendem Lohnausgleich“ möglich wären, sprich: durch vermehrte Leistung bei gesenktem Lohn. Von Sozialdemokraten vom Schlage Lafontaines unterscheidet sie nur noch die Tour, mit Lohnverzicht zu rechnen: Sie fordern ihn nicht, sondern geben ihn als „weitgehend“ vermeidbar aus. Weil sie anerkennen, daß die Steigerung des knappen Guts „Arbeitsplätze“ vom Kapital nicht so ohne weiteres erwartet werden könne, besinnen sie sich drittens auf die kompensatorischen Fähigkeiten des Staates und eruieren einen
„dringend zu befriedigenden Bedarf von mehr als einer Million Arbeitsplätzen, darunter 400 000 bis 500 000 in den neuen Bundesländern.“ (ebd.)
Natürlich nicht einfach wegen der schnöden Existenzsorgen der Sozialfälle, sondern wegen der Meinung aller „ernsthaften Politiker“, die eine solche „Erweiterung des Feldes der Erwerbsarbeit“ für notwendig halten aus höheren staatlichen Gesichtspunkten: wegen des „sozialen Friedens“ und der drohenden „Verödung ganzer Regionen“. Viertens wissen demokratische Sozialisten inzwischen, daß Kapitalbesitzer nicht den Reichtum privat aneignen, sondern gute Dienste tun – an der Nation und deren Reichtum. Deutsche Unternehmer beuten nicht mehr aus, sie vernachlässigen höchstens ihre Managementaufgaben, schaden also ihren Gewinnbilanzen und damit im Verein mit einer kurzsichtigen Politik dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Konsequent verfallen die Kämpfer für mehr Gerechtigkeit auf so oppositionelle Rezepte wie die steuerliche „Entlastung von reinvestierten Gewinnen“ und „konsequentes Vorgehen gegen Steuerhinterziehung“: „Durch Steuerschulden und Steuerhinterziehung verliert der Staat etwa 130 Milliarden oder fast 20% der gesamten Steuereinnahmen.“ Kurz: Die PDS hat in nur zwei Jahren perfekt gelernt, die Sorgen und Nöte der vielzitierten „Bevölkerung“ – „Arbeiter und Bauern“ sollen sie ja nicht mehr heißen – in „Probleme“ der staatlichen Gemeinschaft, des kapitalistischen Wachstums, des nationalen Reichtums, der öffentlichen Ordnung, des regionalen Lebens zu verwandeln und „Lösungen“ zu verlangen, als könnten sich die „Betroffenen“ davon eine Linderung ihrer Notlage versprechen. Da unterscheidet sie sich gar nicht mehr von der Tour jeder demokratischen Opposition, die im Namen des geschädigten Volkes nach der starken Hand des Staates, nach effektiver Wirtschaftspolitik für das nationale Wachstum, nach gerechter Besteuerung und ordentlichen Staatseinnahmen, nach Standortpflege und politischer Kapitalförderung zum Nutzen der Nation ruft und dem Volk den nationalen Wirtschaftserfolg als sein oberstes Bedürfnis verdolmetscht. Den abgrundtief freiheitlich und fortschrittlich gesonnenen demokratischen Sozialisten ist geläufig, daß Arbeiter und Bauern nur als Mitglieder der staatlichen Zwangsgemeinschaft, als dienstbare Geister an deren Interessen, Ansprüche einklagen und Rechte beanspruchen können.
Was die PDS von ihren politischen Konkurrenten unterscheidet, ist das besondere politische Kollektiv, in das sie die Bevölkerung einsortiert und dessen Interessen und Rechte sie geschädigt sieht: der Osten Deutschlands. Für den macht sich die PDS stark:
„Wir sind bereit und in der Lage, die Interessen der Ostdeutschen originär und ohne populistische Rücksichtnahme auf eine überwiegende westdeutsche Mitgliedschaft und Klientel zu vertreten, das heißt in erster Linie, den Kampf gegen die vielfältigen ökonomischen, sozialen, politischen, kulturellen, moralischen und psychologischen Benachteiligungen der Ostdeutschen zu führen.“ (Gysi, Rede…)
Daß die Industrieanlagen im Osten brachgelegt werden, weil sie sich nach den anspruchsvollen Rentabilitätsmaßstäben westdeutschen Kapitals zumal unter Krisenbedingungen geschäftlich nicht lohnen; daß die ehemals mit einem garantierten Arbeitsplatz ausgestatteten Werktätigen massenhaft außer Arbeit und Lohn gesetzt werden und mehrheitlich die Reservearmee bevölkern; daß überhaupt mit kapitalistischen Löhnen und Preisen, marktwirtschaftlichen Warenangeboten und Mieten, sozialstaatlichen Abgaben und Leistungen statt mehr Wohlstand ganz neue Formen der Armut im Osten Einzug gehalten haben – all dem entnehmen PDSler im Grunde immerzu ein und dasselbe: Ostlern wird ihr Recht vorenthalten und der gebührende Respekt versagt. Betroffen sind die Massen in ihrer Eigenschaft als ehemalige Zonis, verletzt ist ihr Anspruch, als gleichberechtigte Deutsche anerkannt und behandelt zu werden. So übersetzen sich alle Schädigungen in einen Anschlag auf eine höhere Würde, in welcher alle Klassengegensätze ausgelöscht sind: ein Stück nationaler Besonderheit der Ex-DDRler im neuen Deutschland. Die PDS entdeckt eine kollektive Identität der Ostler, die gerade nicht in dem liegt, was sie ihrer Mehrheit nach wirklich sind: nicht benutzte Arbeitskraft, Sozialstaatsopfer und demokratische Untertanen, denen diese aktuelle Behandlung als unausweichliche Folge ihrer eigenen Vergangenheit verdolmetscht wird. Die nationale Eigenart konstruiert sie statt dessen aus der Umdrehung der westlichen Schuldzuweisungen, die sich enttäuschte Ostler als ihre Selbstdeutung zurechtgelegt haben: Sie sind die Opfer einer ungerechten Behandlung durch die Deutschen, die sich ihnen immerzu überlegen wähnen, durch die „Wessis“ bzw. durch die „Wessi“-Politik.
Eine gelunge Absage an „Populismus“, die die PDS da erteilt: Sie macht sich zum Anwalt eines Ost-Nationalismus, der nur noch die Kollektiv-Seele der „Ossi“-Minderheit vertritt, also ihren enttäuschten Wunsch, wie normale Deutsche gestellt und angesehen zu werden. In den übrigen Parteien macht die PDS deswegen gar nicht mehr die Vertreter einer Politik aus, die das Volk den Sachnotwendigkeiten des Kapitals entsprechend regiert und verwaltet, sondern eine Lobby der „Wessi“-Mehrheit im Lande. Deshalb wollen sie sich mit Deutschland, so wie es ist, mit der „Einheit“, so wie sie existiert, mit Marktwirtschaft und demokratischer Politik, so wie sie funktionieren, nicht zufriedengeben.
2. Im Namen des ganzen Deutschland
Aber sie wollen es mit der Unzufriedenheit auch nicht zu weit treiben. Spalterisch wollen sie auch wieder nicht sein, wenn sie sich als Zoni-Lobby anbieten. Als Sondernationalisten, die sich wegen der verletzten Rechte ihres „Volkes“ von der Zentrale lossagen, wollen sie nicht antreten. Umgekehrt: Vereinen wollen sie und bemühen dabei einen eigenen Begriff von „Solidarität“, der die gedeckelten Massen im andern Teil Deutschlands konstruktiv mit dem mit Füßen getretenen Landesteil zusammenschließt, für den sie sich besonders zuständig fühlen:
„Das bedeutet auch Kampf um Solidarität mit den im Westen – nicht nur, aber auch – durch die Einheit Benachteiligten und deren Interessenvertretung. Das ist ein glaubwürdiger Weg hin zur Akzeptanz auch bei Armen und Lohnabhängigen in der westdeutschen Gesellschaft.“ (Gysi, Rede…)
Die demokratischen Sozialisten gehen also selbstverständlich davon aus, daß in den vielbeschworenen sozialen Umständen der Massen gar kein ausreichender Grund für ihre Opposition vorliegt. Sie fühlen sich selber so sehr als Ossi-Vertretung und stehen dermaßen borniert auf dem Standpunkt der beleidigten Anschlußhaltung „ihrer“ Ostler, daß sie sich einen Zugang zu den West-Massen erst noch extra eröffnen zu müssen meinen. Deshalb suchen sie nach Gesichtspunkten, unter denen Westler genau dieselben Probleme haben, wie die Ost-Bevölkerung. Prompt finden sie eine Brücke zwischen Ost und West – darin nämlich, daß es im anderen Landesteil auch Opfer der Einheit gibt. Als Arme mögen die Massen im Westen ja ihre eigenen Vertreter haben, aber als ebenfalls Einheitsgeschädigte, da fallen sie in die Kompetenz der PDS, der zuständigen Instanz für die Probleme des Anschlusses. Der Westbevölkerung wollen die Parteistrategen also am liebsten den Gesichtspunkt ans Herz legen, sie sei letztlich auch ein Opfer der unvollendeten Einheit, der Ungerechtigkeiten gegen den Osten. Damit wollen sie ihr Parteiproblem, den schlechten Ruf einer bloßen, und auch noch linken, Ossi-Vertretung, loswerden.
Solidarität demonstriert die PDS aber vor allem mit den staatlichen Ansprüchen an die „Einheit“. Die zitierten Sorgen um die Wachstums-, Steuer- und Beschäftigungsqualitäten des Standorts Deutschland, mit denen sich die demokratischen Sozialisten würdig in den Umkreis der Politiker von Schönhuber bis Scharping einreihen, beweisen das Bedürfnis der guten Deutschen aus dem Osten, daß ihr Kampf um ‚Solidarität mit dem Osten‘ keine schnöde partikulare Interessenvertretung sein soll. Deswegen bemüht sich die PDS um den Nachweis, daß die ungerechte Behandlung des Ostens ein Schaden für Deutschland, und zwar für das ganze ist. Im Unterschied zu allen anderen Parteien, die bei allem „Verständnis“ für die „Sorgen“ der Ost-Bevölkerung an den Sachnotwendigkeiten des Anschlusses keine Zweifel aufkommen lassen, glaubt sie wirklich, daß so, wie mit dem Osten umgesprungen wird, Deutschland auf dem Spiel steht. – Und sieht sich genau darin überhaupt nicht anerkannt, sondern angefeindet. Dagegen protestiert sie und besteht darauf, daß sich die Nation mit ihren „Wessi“-Grundsätzen ändern müsse.
3. Das nationale Sonderprogramm der PDS: Kampf für die Integration aller Deutschen
Mit ihrem Einsatz will die PDS partout das politische Leben in ganz Deutschlands voranbringen. Dabei sind die Enttäuschungen und Ansprüche und die betont gemeinschaftsdienliche Weise, in der die PDS sie anmeldet, wirklich bloß das Problem der Zonis mit ihrem neuen Status in Gesamtdeutschland: Sie können sich nicht zugehörig fühlen, lassen sich durch die Behandlung, die dem Osten als Teil der vergrößerten Nation widerfährt, aber nicht zur Aufkündigung verleiten, sondern erheben im Namen Deutschlands den Antrag auf vollwertige Eingemeindung. So vertritt die PDS den Ostler in seiner Eigenschaft als „Ossi“, seine enttäuschten Anschlußerwartungen, aber auch seinen ungebrochenen Anschlußwillen, und ist insofern ganz und gar nicht radikal: Die Unzufriedenheit will sie gar nicht aufstacheln, Ostler gar nicht rebellisch machen: als Arbeiter sowieso nicht, aber auch nicht als enttäuschte Nationalisten. Den gewendeten Sozialisten, die doch selber darunter leiden, daß sie nicht einfach alles von ihren alten Hoffnungen, ihrem Stolz und ihrer Abneigung gegen das Deutschland der Revanchisten und Altnazis über Bord schmeißen wollen, fällt nicht einmal ein, mit ihrem moralischen Zeigefinger auf das neue „soziale Elend“, die mit Füßen getretene „Humanität“ und die verletzte „Gerechtigkeit“ zu deuten und ein bißchen triumphierend darauf zu bestehen, wie recht sie mit ihren Warnungen vor euphorischen Erwartungen an die Segnungen des marktwirtschaftlichen Systems gehabt hätten. Lieber bezweifeln sie den guten Willen der Regierenden mit ihrer „Wessi“-Mentalität, endlich Deutschland Ost und West zu versöhnen, demonstrieren den eigenen besseren und kaufen so ihren Anhängern jeden Widerwillen gegen die neuen gesamtdeutschen Lebensumstände als solche ab.
C. Die PDS und ihre Basis: 2x unzufriedener Zoni-Nationalismus
Die PDSler, die immerzu anklagend von „Anschluß“ reden, sind also unverbesserliche Anhänger des Irrglaubens, mit dessen Hilfe sie sich den Anschluß an die Bundesrepublik verständlich gemacht haben: Es sei um die Befreiung der Zonis von ihrem ungeliebten System gegangen, um die Anerkennung ihres Willens, zu einem besseren Deutschland zu gehören, also auch darum, das Zoni-Volk sich mit seinen Eigenarten, seiner politischen Kultur, seinen demokratischen Tugenden und sozialen Hoffnungen einbringen zu lassen in eine neue, demokratisch bereicherte Republik. Die berechnenden Versprechungen, mit denen Westdeutschlands Politiker dem Ostvolk seinen Anschluß verdolmetscht haben und diese ihn mitgemacht haben, haben zwar etwas anders gelautet: Zugang zu den Segnungen des Westens. Auch die Massen haben etwas schlichter gedacht und ganz ohne Wenn und Aber gemeint, mit der Zugehörigkeit zum erfolgreicheren Staat mit seinen marktwirtschaftlichen Warenhäusern und demokratischen Reisefreiheiten am allgemeinen Wohlstand teilzunehmen. Aber die selbstkritisch gewordenen Anhänger der ehemaligen DDR haben sich nur zu gerne die Erledigung des alten Staates als Chance oder zumindest Auftrag für die Verwirklichung besserer „Modelle“ volksfreundlichen Regierens zurechtgelegt und sich damit auch gleich eine Rolle im neuen Staat zugeschrieben. Wo die Republik gerade keinen Zweifel daran läßt, daß sie fertig ist und daß für die Ost-Bevölkerung nichts anderes als die Unterwerfung unter die im Westen geltenden Maßstäbe vorgesehen war, da besteht die PDS auf der Lüge, sie als Ostler hätten ein Anrecht darauf und sie seien mit ihrer Abkehr von den Fehlern ihres alten Systems speziell befähigt dazu, Deutschland noch zu verändern. Sie sind die letzten, die sich und ihrer Klientel eingestehen würden, daß das Ende der DDR die Eingemeindung ins siegreiche System war und sonst nichts. Statt dessen führen sie Beschwerde darüber, daß die Ost-Bürger wie bloße Anschlußobjekte behandelt werden, pflegen also den verletzten und zugleich gebrochenen Stolz von Bürgern, die politisch mitgestaltende Kraft im Lande sein wollen, aber dazu überhaupt erst gar nicht zugelassen werden.
So schließen sich für die bekehrten Realsozialisten ihre eigenen Identitätsleiden und die Ungerechtigkeiten gegen das Volk, Abteilung Ost, schöpferisch zusammen im gemeinsamen Schicksal als gute, aber überhaupt nicht gut angesehene Deutsche. Zwar deckt sich das verquere Anliegen, wie man sich als geknickter Anhänger des realen Sozialismus zur mitgestaltenden Kraft im neuen System mausert und sich dabei die Achtung vor sich selber und die aller aufrechten Demokraten zurückerobert, überhaupt nicht mit den Erwartungen und Bedürfnissen der Mehrheit der normalen Ost-Bürger. Die sind – dafür war der alte Staat viel zu wenig Erziehungs„diktatur“ – nämlich überhaupt keine über sich selbst und „ihren“ alten Staatsglauben nachträglich enttäuschte und sich deshalb ständig rechtfertigende Exsozialisten. Sie sind von Anfang an überzeugte und deswegen enttäuschte Überläufer; Nationalisten, die sich darüber beschweren, daß sie, obwohl doch umstandslos überzeugte Anhänger Deutschlands, immerzu hinter die Wessis zurückgesetzt würden. Sie halten also in ihrer Mehrheit überhaupt nichts von einem „sozialistischen“, „linken“ Angebot. Dennoch entdecken und schätzen viele in der PDS ein Angebot, auch wenn sie dem linken Parteiimage und den Dauerdebatten um die Notwendigkeit und Möglichkeit einer garantiert demokratischen sozialistischen Perspektive wenig abgewinnen können. Sie sehen in ihr die einzig glaubwürdige, weil eigenständige Ost-Adresse für ihren nationalistischen Protest gegen die Überheblichkeit der Wessis. Und sie entdecken deshalb in den Stasi-Vorwürfen gegen die PDS ihre eigene Abqualifizierung als Deutsche, die sich gefälligst mit einem Minderstatus zufriedengeben sollen. Und da ist ja sogar etwas dran.
Auf diese Basis stützt sich die PDS. Diesen Nationalismus will sie für sich vereinnahmen und sich zu seiner Vertretung beauftragen lassen. Für die gewendeten Sozialisten stand und steht ja keinen Augenblick außer Zweifel, daß sich jedes bestrittene Interesse und geschädigte Bedürfnis in die Forderung nach alternativen Politikfiguren übersetzt und sie sich deshalb dem Wähler als geeignete „politische Kraft“ mit dem Drang zur schöpferischen Gestaltung deutscher Verhältnisse anbieten müssen. So bieten sich die orientierungslos gewordenen Sozialisten mit ihrem ungebrochenen politischen Vertretungsdrang den anschlußgeschädigten Ost-Bürgern auf der Suche nach eigenen politischen Vertretern zur Wahl an und bieten ihnen dafür sogar ein Stück eigenständige politische Kultur. PDS-Mitarbeiter veranstalten zum Beispiel als ideelle Anwälte des Ost-Volks öffentliche Scheingerichte über die Schikanen der Sozialstaatsbeamten:
„… Ein (satirisches) ‚antibürokratisches Gericht‘ wird tagen und sich speziell mit der Wohngeldbürokratie befassen. Am Ende wird über den bürokratischen Papierkrieg ein Urteil gesprochen.“ (Dresdner Blätt’l der PDS 16/93)
Mit Mieterberatung und im Notfall Rechtsanwalt, der die Leute beim ‚Kampf um ihre Rechte‘ streng im Rahmen der geltenden Gesetze unterstützt, untermauert sie ihren Anspruch, die Ostpartei zu sein. Sie organisiert das Beschwerdewesen in „Komitees für Gerechtigkeit“, in denen Ostler als Mieter, Rentner und sonstige „Betroffene“ ihrem verletzten Rechtsempfinden Ausdruck geben und sich organisiert beraten lassen können. Und sie pflegt ein bißchen eigenes Gemeinschaftsleben der Ostler für und unter sich. Jetzt noch zum alten sozialistischen System mit seinen diversen Errungenschaften zu stehen, die Zustimmung zum neuen wirklich daran zu messen, was es in sozialer Hinsicht leistet – das wäre unrealistisch, nostalgisch und ewig gestrig. Aber die Erinnerung an die menschlichen Seiten des früheren Staatslebens wiederaufleben zu lassen, z.B. in Form von „Jugendweihen“, denen auch beim bösesten Willen nicht mehr anzusehen ist, daß sie einmal der SED-Ersatz für christliche Formen der Jugendverführung waren – das ist fortschrittliche politische Interessenvertretung. Der PDS-Verein „Roter Baum“ in Dresden verspricht „im Vorfeld zur Jugendweihefeier interessante und erlebnisreiche Jugendstunden“ und spricht damit auch die Eltern an. Solch Anknüpfung an gute Traditionen, von deren politischer Bedeutung man sich gleichzeitig entschiedenst distanziert, bietet ein bißchen Heimat und weltanschauliche Geborgenheit für Zonis. Sie können sich glücklich schätzen, doch etwas von sich in den neuen Staat eingebracht zu haben, in dem sie so wenig gelten. Bodenständige Menschen können dank der PDS mit dem „Sächsischen Bergsteigerchor Kurt Schlosser“ „hinaus in die Berge uns’rer Heimat“ ziehen. Und besser betuchte Gesinnungsnostalgiker können freizeitmäßig die letzten Überlebensversuche des sozialistischen Cuba besichtigen:
„Cuba si. Karibik: Alternativ-Tourismus. Kuba, die ‚Perle der Karibik‘ braucht den Tourismus zum Überleben! Wir bieten für fortschrittliche und linke InteressentInnen einen sanften, verträglichen und sicheren Tourismus mit Einblicken in die gesellschaftliche Realität Kubas… zu einem Solidaritätspreis von 1995.-DM, vor und nach der Rundreise preiswerte individuelle Urlaubsaufenthalte und internationale Arbeitseinsätze.“ (ebd.)
Wer will, kann auch daheim in Dresden im Konkurrenzkampf um die tatkräftigste Bürgerpartei für die PDS eine freiwillige Sonderschicht in Sachen Gemeinsinn einlegen:
„Die CDU hat am Wochenende mit hundert Leuten das rechte Ufer (der Elbe) vom Müll gesäubert. Ich schlage vor, die PDS säubert das linke.“ (Die OB-Kandidatin der PDS in Dresden, Ostrowski, laut Sächsische Zeitung)
Das ist er, der zukunftsweisende demokratische Sozialismus, die Hoffnung der Linken, das Versprechen an gedeckelte Ostbürger, die Säule gegen die ewige „Abwertung der vergangenen gesellschaftlichen Verhältnisse“ durch die Regierenden, – in voller Wahlkampfaktion.
Vom schlechten Ruf, bloß Ost-Partei zu sein, möchte sich die PDS andererseits aber auch freimachen und die eigene Wählerbasis nach Westen verbreitern. Bündnisse mit wahlverwandten linken „Splittergruppen“ lehnt sie deshalb ab – in solchen Angeboten zur (Wahl-)Einheit der „sozialistischen Bewegung“ entdeckt sie unschwer den Pferdefuß, sich in die Radikalenecke zu begeben, aus der sie nach Kräften herausstrebt, und Wahlfähigkeit zu verlieren. Statt dessen überlegt sie öffentlich, ob sie sich nicht durch das Angebot, „einzelnen Persönlichkeiten aus dem linken, demokratischen und antifaschistischen Spektrum“ eine Kandidatur auf der PDS-Liste „zu ermöglichen“, salonfähiger machen könnte:
„… sollten solche Kandidatinnen und Kandidaten entweder wichtige soziale Bewegungen repräsentieren oder als bekannte linke Einzelpersönlichkeiten eine Akzeptanz und eine Denkwelt mitbringen, die unsere Akzeptanz erweitert und unser Denken gerade auch durch kritische Auseinandersetzung mit uns beflügelt.“ (Gysi, Rede…)
Die PDS möchte auch noch die enttäuschten Sozialstaatsanhänger und Demokraten im Westen für sich vereinnahmen. Dabei beißt sie sich aber umgekehrt wie im Osten am Wessi-Nationalismus die Zähne aus. Nicht einmal die Restlinken im Westen, sonst für jede massenwirksame „linke Kraft“ aufgeschlossen, haben für die gewendeten Sozialisten viel übrig. Und die Mehrheit links der Elbe sieht in der „Nachfolgepartei der SED“ sowieso bloß den Beweis für die nationale Unzuverlässigkeit der Ossis, die, statt sich mit dem zufriedenzugeben, was Westler schon immerzu bezahlen müssen, ihr altkommunistisches Seilschaftswesen pflegen und auch noch zusätzliche Ansprüche stellen. Dagegen setzt die PDS das Bemühen, ihre Wählbarkeit für alle am Fortschritt und echter deutscher Einheit interessierten Deutschen zu beweisen. So steht sie, moralisch verachtet, nationalistisch ausgegrenzt, politisch bekämpft und kriminalisiert, unverbesserlich zum Anspruch auf Mitgestaltung des nationalen Lebens. Angesichts dessen ist es in ihren Augen wirklich schon ein Erfolg, den demokratischen Willen Marke Ost mit vierfachem Gütesiegel als
„eine moderne, linke, sozialistische Partei mit aufrechtem Gang in die deutsche Politik eingebracht (zu) haben.“ (Der Vorsitzende Bisky auf dem 3. Parteitag, Juli 1993)
In der ist sie nun und kämpft um drei Direktmandate.
[1] Zitate, soweit nicht anders vermerkt, aus: Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus, hsg. vom Bundesgeschäftsführer der PDS, Berlin 1993