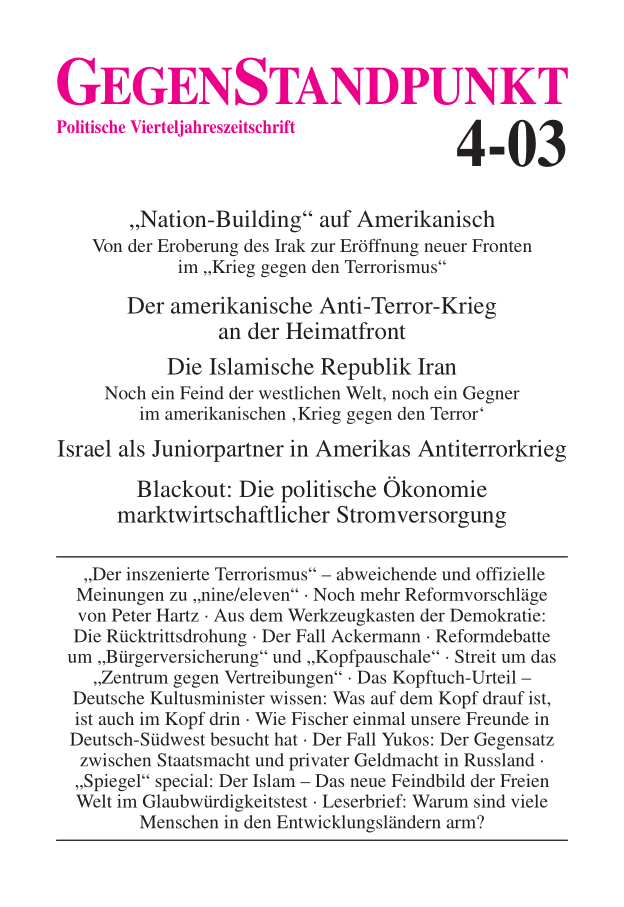Zur sittlichen Lage der amerikanischen Nation:
Volk und Führung einig im Kampf gegen das Böse auf der Welt
Anmerkungen zum Patriotismus einer imperialistisch erfolgreichen Nation
US-Bürger sind ein Musterbeispiel patriotischer Parteilichkeit für den Imperialismus ihres Vaterlandes. Der amerikanische Bürger sieht sich persönlich als Opfer der Anschläge auf Symbole amerikanischer Macht und betrachtet Kriege und interne Überwachung als Maßnahmen zum Schutz seiner Person und Freiheit. Er kann sich nichts anderes vorstellen, als dass jeder Erdenbürger eigentlich so leben will wie er – im privaten Konkurrenzkampf ums Überleben sein Glück zu machen – und deshalb von bösen Staatsmächten befreit werden muss, die ihn daran hindern. Der Religion kommt eine besondere Bedeutung zu: sie beglaubigt die Unanfechtbarkeit des amerikanischen nationalen Sittengebäudes.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- „Nine Eleven“, Taliban in Afghanistan, Saddam Hussein im Irak, iranische Mullahs, Nordkorea… – Eine einzige Verschwörung gegen den „American Way of Life“
- Die patriotische Antwort einer Weltmacht auf die Schlechtigkeit der Staatenwelt: Demokratisierung, mit aller Gewalt!
- „One Nation under God“: US-Imperialismus als göttlicher Auftrag
Zur sittlichen Lage der
amerikanischen Nation:
Volk und Führung einig im Kampf
gegen das Böse auf der Welt
Anmerkungen zum Patriotismus einer
imperialistisch erfolgreichen Nation
In Europas – oder jedenfalls in den meisten deutschen – Feuilletons wird ein kleiner Kulturkampf gegen die USA ausgetragen. Man ist befremdet über die Militanz, mit der die USA die Staatenwelt neu zu ordnen beginnen; man ist abgestoßen von der bornierten Parteilichkeit, mit der die Mehrheit der US-Bürger Krieg befürwortet und Gegner des US-Krieges hasst; man ist erfreut über jede kritische Stimme aus den Vereinigten Staaten, die am „stupid white man“ irgendetwas, was auch immer, auszusetzen hat. Man gibt sich vollgesogen mit abendländischer Altersweisheit, die dem amerikanischen „Schwarz-Weiß-Denken“ abgeht; und auch von Gott als oberstem Patron der „nationalen Sache“ hat man eine deutlich zurückhaltendere gute Meinung als das „bigotte“ Amerika.
Die Attitüde ist lächerlich. Nichts von dem, was der kultivierte Euro-Abendländer „den Amis“ vorwirft, ist ihm selber fremd. Staatlichen Verfolgungswahn und nationale Kriegsbereitschaft würde jeder Repräsentant des ach so besonnenen „alten Europa“ mit gleicher Erbitterung von seiner Führung einklagen und auch prompt geboten bekommen wie die Geistesverwandten auf der anderen Atlantik-Seite, wenn von irgendwo her ein Anschlag auf Europas Zentralbank oder das französische Kriegsministerium verübt worden wäre. Und weil das Bewusstsein einer solchen prinzipiellen Übereinstimmung, den Umgang mit Terroristen betreffend, gar nicht völlig abgemeldet ist, mischt sich ins antiamerikanische Ressentiment und das allgemeine Kopfschütteln über die „Wild-West-Manieren“ der US-Regierung und über die von ihr geschürte Alarmstimmung im Land immer auch eine gute Portion Bewunderung für die Geschlossenheit, mit der amerikanische Bürger „in schwerer Zeit“ hinter ihrem Präsidenten stehen.
In der Hinsicht, das muss der europäische Neid ihnen lassen, sind die US-Bürger in der Tat vorbildlich. Keiner beherrscht so gut wie sie die Kunst der patriotischen Parteilichkeit für den Imperialismus ihres Vaterlandes – wie auch, wenn selbst die größten Konkurrenznationen keine auch nur annähernd gleichrangigen imperialistischen Erfolge zu bieten haben.
„Nine Eleven“, Taliban in Afghanistan, Saddam Hussein im Irak, iranische Mullahs, Nordkorea… – Eine einzige Verschwörung gegen den „American Way of Life“
Nach dem Attentat aufs World Trade Center und das Pentagon haben die US-Bürger keine historische Schrecksekunde gebraucht und erst recht keine Belehrung durch ihren Präsidenten benötigt, um zu der Erkenntnis zu gelangen: Dieser Angriff auf bedeutende Bürogebäude gilt ihnen persönlich, ihrer friedlichen zivilen Existenz, der – jenseits aller Gehalts- und Klassenunterschiede – als nationaltypisch geltenden Lebensweise, die sie sich, jeder auf seine Art, zwischen den Bürotürmen des amerikanischen Weltgeschäfts und dem Steuerungszentrum der amerikanischen Militärgewalt eingerichtet haben. Zwischen den Standorten und Repräsentationsbauten der ökonomischen und militärischen Macht ihrer Nation und ihrem eigenen Privat-, Erwerbs-, Familien-, öffentlichen und sonstigen Leben erkennen sie keine Differenz oder lassen jedenfalls keine gelten. Sie sehen sich persönlich im Visier der Terroristen und aller Machthaber, die ihr Präsident ihnen als „Schurken“ benennt. Sie sind bereit, alle kriegerischen Auswärtsspiele und alle inneren Kontrollmaßnahmen, die die Regierung anordnet, grundsätzlich als Vorkehrungen zum Schutz des eigenen und des Lebens ihrer Liebsten zu begrüßen, und sehen umgekehrt sich ganz persönlich durch die ihnen bekannt gemachten antiamerikanischen Umtriebe in der Welt herausgefordert – zu was auch immer, jedenfalls zu totalem Schulterschluss mit oder hinter ihrem nationalen Führer.
Diese Reaktion hat, rein sachlich und wertneutral gesehen, etwas Absurdes an sich. Immerhin bekommen Amerikas Bürger zu spüren bzw. vorgeführt, und zwar durch die Attentate ebenso wie durch die Kriege an weit entfernten Schauplätzen und durch die internen Überwachungsmaßnahmen, die die Regierung auf die Tagesordnung setzt, was für einer gewaltigen und gefährlichen Großveranstaltung, was für einer Macht- und Interessen-Maschinerie unendlich weit jenseits der Reichweite ihrer persönlichen Bedürfnisse, Anliegen und Fähigkeiten, sie in ihrer „Eigenschaft“ als US-Bürger angehören – einer Macht eben, die mit Geld und Waffen in der ganzen Welt zu Hause ist, sich dort in ungeahntem Ausmaß Abhängige und Verbündete, aber auch ziemlich machtlose Feinde schafft, und die „daheim“ alles Tun und Lassen der normalen Bevölkerung einem Reglement unterwirft, dem jeder Einzelne völlig ohnmächtig ausgeliefert ist. Als privates Subjekt ist keiner auch nur im Entferntesten in der Lage, sich in der ganzen Welt und z.B. bei arabischen Gotteskriegern unbeliebt zu machen, geschweige denn, deren Stützpunkte, wirkliche oder nur vermutete, vorsorglich zu überfallen und auszuräuchern; was sein Staat unternimmt, ist nicht bloß von völlig anderem Kaliber, sondern auch von völlig anderer Art als alles, was ein durchschnittlicher Privatmensch je für sich und auf eigene Rechnung unternimmt. Wo immer ein Zusammenschluss stattfindet zwischen der Nation mit ihren gewaltigen Interessen und weit reichenden Machenschaften und dem einzelnen Landesbewohner, da ist der auf die eine oder andere Art Opfer: ganz direkt, wenn ihn Attentäter erwischen, die Amerikas Geld- und Militärmacht in Gestalt von Gebäuden mitsamt Insassen attackieren und sich dabei in praktiziertem Zynismus sicher sind, keinen Falschen zu erwischen. Aber auch wenn seine Regierung mit „shock and awe“ „zurück“schlägt und die Welt neu ordnet, ist der US-Bürger gerade nicht als vernunftbegabtes einzelnes Lebewesen gefragt, sondern als einsetzbare Manövriermasse seiner nationalen Befehlshaber, und mit seiner praktischen Subsumtion unter die angesagte Staatsaffäre werden ihm Opfer abverlangt – im Extremfall schon wieder das, selber zum Opfer zu werden.
Trotzdem: Ausgerechnet solche kriegerischen oder quasi-kriegerischen „Grenzsituationen“ der brutalsten Ineins-Setzung von individueller Existenz und Staatsaffäre sind am allerwenigsten dazu angetan, Staatsbürger – und zwar solche jeglicher Nationalität! –, über deren Lebensführung so einseitig verfügt wird, von der Staatsmacht, die für ihre Belange darüber verfügt hat und verfügt, zu entzweien. Das gerade Gegenteil ist der Fall – jedenfalls bei Leuten, die ein anständiges staatsbürgerliches Verhalten an den Tag legen und ihrer „Identität“ als Volk Ehre machen; und in der Hinsicht reagieren und agieren US-Bürger, wie gesagt, absolut vorbildlich. Sie fühlen und bekennen sich voll und ganz identisch mit all dem, wogegen die Terroristen vom 11. September ein Fanal setzen wollten und zugeschlagen haben, und sie identifizieren sich buchstäblich mit all den nationalen Interessen, Vorhaben und Unternehmungen, die die Regierung mit ihrer Verfügungsmacht über den riesigen amerikanischen Staatsapparat vorantreibt. Dabei müssen sie von diesen Staatsaffären selber gar nicht weiter Kenntnis nehmen, geschweige denn sich einen Begriff davon machen und ihnen dann überlegt zustimmen; sie brauchen, wie es scheint, noch nicht einmal einen besonderen diesbezüglichen Beschluss zu fassen, den Standpunkt ihres alltäglichen marktwirtschaftlichen Lebenskampfes und familiären Privatlebens zu verlassen und einen davon unterschiedenen Standpunkt des patriotischen Bekenntnisses einzunehmen: Im Hochhalten des „American Way of Life“ geht beides unvermittelt in Eins zusammen, die „Sache der Nation“ mit dem Dasein ihrer Insassen.
Amerikas betroffene Bürger legen hier – mustergültig, wie gesagt – eine Parteilichkeit für ihr Gemeinwesen an den Tag, die tatsächlich quasi stillschweigend und ganz selbstverständlich im normalen bürgerlichen Alltagsleben enthalten ist. Dieses Leben folgt ja immerzu – auch wenn sich normalerweise niemand groß darüber Rechenschaft ablegt, dafür sind die Menschen viel zu befangen in der praktischen Notwendigkeit, mit ihrem Alltag fertig zu werden – lauter Vorgaben der öffentlichen Gewalt, Vorschriften und Einrichtungen der Recht setzenden und durchsetzenden Staatsmacht. Die Leute richten sich ihr höchstpersönliches Dasein zwischen lauter von Staats wegen gültig gemachten und verwalteten Sachzwängen ein, solchen der nationalen Marktwirtschaft vor allem. Niemand kommt darum herum, sich auf die schon vollständig eingerichtete Welt der staatlich überwachten Konkurrenz einzulassen, nach Kräften und Vermögen mitzukonkurrieren, sich so den zu quasi sachlichen Lebensbedingungen verfestigten gesellschaftlichen Interessen und politischen Zwecken anzupassen, die das Gemeinwesen beherrschen. Von diesem praktisch erzwungenen Konformismus ist es ein verkehrter und auf fatale Weise folgenreicher, für gutwillige Mitmacher aber nur allzu folgerichtiger Schritt, die Welt, in die es sie verschlagen hat, und die Instanzen, die über ihre Einrichtung wachen, zu affirmieren; nicht zuletzt in der Form, dass man alle Unzufriedenheit mit den eingerichteten Verhältnissen bei der Macht ablädt, die „die Verhältnisse“ eben so einrichtet, und keine andere durchgreifende Abhilfe erwartet als durch die Machthaber, bei denen man sie beantragt. So betätigt sich der moderne Bürger, und das keineswegs wider Willen, mit seinem Arbeits-, Geschäfts-, Familien- und Freizeitleben als „Charaktermaske“ des Systems der gesellschaftlichen Arbeit, Geschäftemacherei, individuellen Reproduktion usw., das der nationale Gewaltmonopolist seinem Volk aufnötigt. Und als anständiger Bürger erkennt er das Ensemble der ihm gesetzten Existenzbedingungen freiwillig und gewohnheitsmäßig als die quasi naturgegebene Sphäre seiner Freiheit an.
An diesen Willen zum Mitmachen knüpft der Staat an, nimmt ihn gewissermaßen beim Wort, wenn er seine Bürger, über ihre alltägliche lebenspraktische Inanspruchnahme als Manövriermasse durchgesetzter Geschäfts- und Machtinteressen hinaus, für gewisse außerordentliche Konsequenzen und Problemfälle seiner Machtentfaltung mit Opfern besonderer Art gerade stehen lässt, im Extremfall sogar mit Leib und Leben und mit der Bereitschaft, auf Befehl selber über Leichen zu gehen. Umgekehrt führen Amerikas Bürger mit ihrem empörten Kurzschluss vom World Trade Center und dem Pentagon auf ihre persönliche Lebensart vor, wie viel von diesem freien Unterwerfungswillen in ihnen steckt: Sie bieten der Welt ein Vorbild an patriotischer Sittlichkeit.
Die patriotische Antwort einer Weltmacht auf die Schlechtigkeit der Staatenwelt: Demokratisierung, mit aller Gewalt!
Die Einstellung, die das amerikanische Volk zur
auswärtigen Staatenwelt an den Tag legt, ist das Werk
eben dieses exemplarischen Bürgersinns. Auf Anhieb hat es
die Ansage seiner nationalen Führung akzeptiert, dass
hinter den Attentaten das pure Böse steckt und dass
dieses in gewissen „Schurkenstaaten“ seine Heimstatt hat
– erst im Afghanistan der Taliban, ein Jahr später in
Saddam Husseins Irak, Fortsetzung offen. Auf Mitteilung
von oben hin ist es ohne Zögern bereit, ganze Nationen
nach Strich und Faden unter den Vorwurf zu subsumieren,
dort wäre sinnloser Hass gegen das von den USA
hochgehaltene System der Freiheit zu Hause – dass eine
auswärtige Staatsmacht ihre nationalen Gründe dafür haben
könnte, sich von der amerikanischen Weltpolitik
geschädigt zu sehen, und dass die dortigen Völker im
Prinzip gar nichts anderes tun als das amerikanische,
wenn sie diese Schädigung auf sich und ihre guten Sitten
beziehen und zu einer entsprechend abstrakten Vorstellung
von der Unsittlichkeit Amerikas neigen: das bleibt völlig
außer Betracht. Für diese Art von Vergleich lässt
patriotische Parteilichkeit einfach keinen Raum.
Allenfalls kommen Zweifel auf, ob man von Washington aus
wirklich genug dafür getan hat, den Rest der Welt von der
grundsätzlichen Gutartigkeit der amerikanischen Weltmacht
zu überzeugen, oder ob eine Fehlbesetzung an der
Staatsspitze mal wieder ganz unnötigerweise auf fremden
Empfindlichkeiten herumgetrampelt ist: Selbstkritik in
einer Stilfrage. Grundsätzlich funktioniert auch da der
patriotische Schluss vom „Schurkenstaat“ auf ein höchst
verdächtiges fremdes Volk; und es ist mal wieder hohe
Zeit für die Ermahnung von oben und die wohl wollende
Entdeckung von unten, dass durchaus nicht alle
,
die wie Araber aussehen, auch schon Terroristen sein oder
mit dem Bösen sympathisieren müssen; schließlich gäbe es
auch unter denen viele durch und durch anständige Leute,
die gar nichts anderes im Sinn hätten, als ihren
friedlichen Geschäften nachzugehen…
Was speziell diese tolerante Seite des nationalen Urteils
über Menschen aus und in Staaten betrifft, die des
Antiamerikanismus verdächtig sind, so legen US-Bürger
hier schon wieder ein Maßstäbe setzendes
imperialistisches Selbstbewusstsein an den Tag.
Sie sehen es völlig ein und können es nur befürworten,
wenn ihre Regierung einerseits mit überlegener
Militärgewalt den erklärten Feind vernichtet, eine
schlagkräftige Luftwaffe dabei die Hauptarbeit erledigen
lässt und keinen Zweifel daran zulässt, dass ihre Bomben
grundsätzlich keinen Falschen treffen; die Lektion des
Vietnamkriegs, dass nur ein toter Vietnamese ein guter
Vietnamese ist, hat die Nation sich gemerkt. Mit ihrem
„Krieg gegen den Terrorismus“ verfolgt die US-Regierung
aber ein noch viel weiter reichendes Ziel als „bloß“ die
Vernichtung einer Feindmacht. Mit dem Einsatz ihrer
überzeugungskräftigen Gewaltmittel praktiziert sie eine
Politik der radikalen Nicht-Anerkennung antiamerikanisch
eingestellter Regierungen – mit Abstrichen auch solcher,
die dem Antiamerikanismus nach Washingtoner Urteil zu
viel Freiraum lassen –: Sie duldet nicht, dass derart
falsch gepolte Herrschaften unangefochten Länder und
Völker regieren, die Amerika als Bestandteil der von
seinen Ordnungskräften kontrollierten, von seinen
Kapitalisten benutzten, für seine Interessen in Dienst
genommenen Welt betrachtet und mit Beschlag belegt.
Letztlich und im Grunde ist die ganze Welt „Besitzstand“
der USA: Davon geht die Führung des Landes so entschieden
aus, dass verkehrte Regierungen dem Verdikt verfallen,
sie würden der Weltmacht das ihr Zustehende vorenthalten;
sie müssen abgesetzt und ersetzt werden, damit die
menschlichen und sachlichen Ressourcen, über die sie
gebieten, ihrer einzig wahren Bestimmung zugeführt werden
können, zum proamerikanischen Weltgeschehen nützliche
Beiträge zu liefern. Dieses Ziel belegt die US-Regierung
mit dem Stichwort Demokratisierung
. Das ist sehr
passend, weil sie damit eben nicht bloß ihre Feindschaft
gegen falsch regierte Staaten erklärt, sondern ihre
genuine Zuständigkeit für die inneren Verhältnisse in
diesen Staaten, für deren politische und allgemeine
gesellschaftliche Verfassung: Sie reklamiert ihre
Oberhoheit über fremde Völker über den Kopf der darüber
eingerichteten Herrschaften hinweg und in Gegensatz zu
deren Souveränitätsanspruch. Insoweit subsumiert sie
diese Völkerschaften nicht einfach unter die Feindschaft,
die sie deren Regierungen ansagt, sondern zugleich und
vor allem unter ihren eigenen Herrschaftsanspruch,
erklärt sie zum und behandelt sie als Objekt ihrer
eigenen Regelungskompetenz. Im Namen des bislang
„missbrauchten“ Menschenmaterials geht sie gegen dessen
„missbräuchlich“ regierende Herrschaft vor, deklariert
ihre Erpressungen und Militäraktionen als Maßnahmen zur
Befreiung fremder Untertanen und „befreit“ diese auch
tatsächlich – von den Vorhaben ihrer alten
Herren, zur Unterwerfung unter eine Weltordnung
und ein Weltgeschäft unter amerikanischem Regime.
Diese Gleichung, dass eigene Kriege per se Demokratie stiften, lassen US-Bürger sich voll einleuchten. Die heftigste Abneigung gegen Völkerschaften in als feindselig eingestuften Weltgegenden verbinden sie bruchlos mit der fraglosesten Gewissheit, dass Leute mit antiamerikanischer Einstellung zu dieser nur gezwungen oder schlimmstenfalls verführt sein können, weil sie im Grunde ihres Herzens doch auch anständige Erdenbürger sein wollen, die friedlich ihr Geld verdienen und ihre Familie lieben – also genau das tun, was der Amerikaner als seinen „Way of Life“ kennt und schätzt. Völlig fremd ist ihnen die Wahrheit dieses Gedankens, die als dumpfe Ahnung schon mal das Selbstbewusstsein unzufriedener „einfacher Leute“ in Nationen minderen Ranges streift; in Gestalt der Vorstellung nämlich, „die da oben“ wären letztlich doch in allen Ländern dieselben Ganoven und der „kleine Mann“ überall „der Dumme“… Nicht als ob dieser klägliche Überrest einer mit dem Nationalbewusstsein konkurrierenden sozialen Selbsteinschätzung anderswo noch sehr verbreitet wäre. Ein treuer US-Bürger bringt so viel unpatriotische Distanz zum eigenen „American Way of Life“ aber ganz bestimmt nicht auf, und im Blick auf andere Länder schon gleich gar nicht; dies schon deswegen nicht, weil fremde Völker doch glatt einer Regierung gehorchen, die der amerikanischen machtmäßig nicht entfernt das Wasser reichen kann – wie könnte man da deren Untertanen als seinesgleichen anerkennen! Was ein Amerikaner andererseits sofort einsieht und anerkennt, ist der Herzenswunsch aller fremden Erdenbürger, so zu werden wie er: Die Sehnsucht braucht er noch nicht einmal zu ermitteln, von der geht er felsenfest aus. Denn wie sonst könnte ein erfülltes Erwerbs- und Privatleben aussehen, das alle anständigen Menschen sich wünschen, wenn nicht so wie in Amerika, zwischen Pentagon und World Trade Center!
Auf die Art identifizieren sich amerikanische Bürger ganz persönlich mit dem imperialistischen Vorherrschafts- und Allzuständigkeits-Standpunkt ihrer nationalen Führung. Und der imperialistische Erfolg ihrer Nation gibt ihnen allenthalben Recht. Tatsächlich ist die Staatenwelt auf die USA als globale Ordnungs- und dominierende Weltwirtschaftsmacht ausgerichtet, vom Dollar als erster Weltwährung abhängig, von US-Firmen als größten Kapitalanlegern okkupiert, von offiziellen und geheimen Ordnungskräften aus Washington überwacht; und amerikanische Markenware ist auch überall zu haben. Weltweit begegnet die Menschheit nicht bloß den äußerlichen Spuren amerikanischer Lebensart, sondern ist unter Lebensbedingungen gesetzt, deren Geltung alle Mal die USA als Urheber und Nutznießer mit durchgesetzt haben; dies sogar dann, wenn eine nationale Regierung sich um ein gewisses Maß an Abgrenzung der von ihr verordneten Lebensverhältnisse gegen „amerikanischen Einfluss“ bemüht. Das macht zwar noch lange nicht aus allen Erdenbewohnern virtuelle Amerikaner; im Gegenteil: Die amerikanisch betreute Geschäftsordnung des Weltgeschehens sorgt für ganz andere Sorten Elend als diejenigen, die der „American Way of Life“ einschließt, zersetzt Existenzweisen mitsamt den dazugehörigen gesellschaftlichen Sitten, ruiniert Länder und Menschen dermaßen, dass den lebenstüchtigsten unter den Opfern am Ende dann tatsächlich irgendeine Teilhabe am Leben der „1. Welt“ zur einzigen Überlebenschance und zum Ziel aller Wünsche gerät. Doch wie dem auch sei: Auf alle Fälle findet der weltkundige US-Bürger sich von überall her in seiner Gewissheit bestätigt, dass die Welt im Grunde nichts anderes als amerikanisch sein will und das nur deswegen und insoweit nicht längst ist, als sie von verderbten Machthabern daran gehindert wird.
Mit dieser Geisteshaltung ist das Volk der USA das Neid und insoweit Ärgernis erregende Vorbild für alle demokratisch zivilisierten Nationen, die mit ihren imperialistischen Ambitionen und Erfolgen an der amerikanischen Weltmacht Maß nehmen. Deren Regierungen beanspruchen für sich, wenngleich vorerst hauptsächlich im bescheideneren europäischen Rahmen – denn von den Führungsnationen der EU ist hier die Rede –, die gleiche Regelungskompetenz, das Verhältnis zwischen Volk und Führung in unliebsam auffällig gewordenen Ländern betreffend, wie die große Führungsmacht; sie haben sich den Standpunkt zu Eigen gemacht, mit ihrem Interventionismus alle Mal einem malträtierten Volk gegen eine falsche Obrigkeit zu seinem Recht zu verhelfen. Und ihre Bürger haben gelernt, dass nicht bloß ihre Obrigkeit über die Macht verfügt, sondern sie selber auf Grund ihrer so sagenhaft erfolgreichen demokratischen Polit-Kultur und marktwirtschaftlichen Erwerbs-Sitten das Recht, wenn nicht sogar die Pflicht haben, andere, weniger „entwickelte“ Völker an diesen Segnungen teilhaben zu lassen und ihnen notfalls mit Gewalt in diesem Sinne auf die Sprünge zu helfen – selbstverständlich nicht, damit die sich dann gleichermaßen durchsetzen und als Vormünder einer zurückgebliebenen Umwelt aufführen: Es geht nicht um Angleichung, sondern um Bevormundung. Und genau in diesem Sinne versteht und empfiehlt sich mittlerweile auch Europas Imperialismus als Demokratisierungs-Unternehmen. Das schöne Bewusstsein, selber das Ziel zu sein, zu dem die anderen Teile der großen Weltgemeinde erst noch hin wollen – ganz gleich, ob die das selber schon so sehen oder nicht –, ist in den mit Amerika konkurrierenden Nationen der zweiten Liga allerdings dadurch ein wenig getrübt, dass die unbedingte Parteilichkeit für die demokratisch-marktwirtschaftliche Lebensart, mit der der Privatmensch sich mit den imperialistischen Ambitionen seiner Staatsmacht identifiziert, dann doch nicht einfach und nicht bruchlos mit der patriotischen Hingabe ans besondere eigene Heimatland zusammenfällt – dies übrigens aus keinem anderen Grund als dem, dass diesem Vaterland immer noch die Macht abgeht, allein nach Maßgabe seiner nationalen Interessen „demokratisierend“ auf die Welt loszugehen und durch entsprechende Erfolge zu beglaubigen, dass es sich bei dem heimischen „Way of Life“ tatsächlich um das unausweichliche Telos der Weltgeschichte handelt. Nicht als ob dieser ideologische Schönheitsfehler nicht zu bewältigen wäre: Das eifrig propagierte Weltbild, wonach Amerika mit seiner gewalttätigen Art der Weltordnung bloß den zweitbesten Weg zur allgemeinen Durchsetzung von Freiheit und Menschenrecht eingeschlagen hat, Europa hingegen mit seinen – schwächeren, also – „friedlicheren“ Mitteln die bessere Methode der Demokratisierung und Vermarktwirtschaftlichung des Globus gewählt hätte, leistet da schon einiges. Dennoch haben die US-Bürger es leichter: Ihr imperialistischer Patriotismus ist von keiner noch so feinen Differenz zwischen den nationalen politischen und sonstigen Sitten und dem weltweit gültigen Menschenrecht, zwischen „pursuit of happiness“ in Dollarform und dem marktwirtschaftlichen Überlebenskampf der restlichen Menschheit, zwischen US-Bürgerschaft und wahrem Menschentum angekränkelt – auch dies nur aus dem Grund, dass ihr Staat keine Differenz zwischen sich als Subjekt der Beherrschung des Globus und seinen Methoden anerkennt. Mit seiner erfolgreichen Weltmacht verbürgt er seinen Bürgern die universelle Allgemein- und Alleingültigkeit ihrer Lebensart.
Das schärft wiederum den Vernichtungswillen gegen Feinde ganz beträchtlich. Denn was die amerikanische Staatsmacht ihren Bürgern garantiert, das schuldet sie ihnen auch, wenn sich dann doch wer an einem beliebigen „average Joe“ vergreift: In so einem Fall hat der demonstrative Gebrauch überlegener Gewalt jeden Zweifel an der bedingungslos anzuerkennenden Überlegenheit des „American Way of Life“ buchstäblich zu erschlagen. In diesem Sinne fordern friedliebende US-Bürger schon mal die Bombardierung von Ländern, deren Namen sie nicht kennen und die sie auf keiner Landkarte finden würden, sobald ihr Präsident ihnen nur sagt, dass man dort Amerikaner schlecht behandelt. Hemmungen kennen sie in dieser Hinsicht kaum, eben weil sie selbst derartige Strafaktionen als Teil einer Mission betrachten, mit der ihr gesegnetes Land vom Schicksal weniger begünstigte Weltregionen beglückt: Ihre große Nation teilt ihr Glück, nicht indem sie irgendetwas teilen, d.h. von ihrem Reichtum abgeben würde, sondern indem sie den Völkern ihren vorbildlichen „Way of Life“ spendiert. Sie schenkt der Welt Freiheit und Marktwirtschaft; und gute Amerikaner sind sich ganz sicher, dass die nur darauf gewartet hat, weil sie sich eben gar nichts anderes vorstellen können, als dass jeder Mensch auf Erden am liebsten ein Ami wäre, ja im Herzen – und sofern er sich frei betätigen darf – ein Ami ist. Die Kriege, die der Präsident für den Export seines Geschenkartikels dennoch nötig findet, beweisen nur, wie voll die Welt doch noch von falscher Führung ist, die die Menschen unterdrückt und daran hindert, so zu leben, wie sie eigentlich wollen.
„One Nation under God“: US-Imperialismus als göttlicher Auftrag
Die Überzeugung von der Allein- und Allgemeingültigkeit
der nationalen Lebensart, das prinzipiell vorbehaltlose
Einverständnis mit den in Amerika herrschenden
Lebensbedingungen und sittlichen Maximen, die
Idealisierung der eigenen Lebenskünste zur universell
geltenden Norm: dieser Standpunkt schließt ein sehr
spezielles affirmatives Verhältnis zum traditionellen
absoluten Inbegriff sittlicher Verbindlichkeit ein:
US-Bürger verstehen sich als Teilhaber an God’s own
Country
. Dabei sind sie denkbar weit davon entfernt,
einem bestimmten Gottesglauben mit seinen sonstwoher
entlehnten Vorschriften für eine gottgefällige
Lebensführung normative Geltung für ihr bürgerliches
Leben zuzuschreiben; geschweige denn, dass sich unter den
vielen einflussreichen religiösen Spinnern im Land eine
Geistlichkeit fände, die ernstlich das Projekt einer
„Theokratie“ verfolgen würde. Amerikanisches
Gottvertrauen funktioniert genau umgekehrt: Ihres
„American Way of Life“ sind US-Bürger sich
absolut sicher und erkennen keinen anderen Gott an als
einen solchen, andererseits aber auch einen jeden, der
ihnen darin absolut Recht gibt. Die
Funktion des Glaubens, das nationale
Sittengebäude zu bestätigen, steht über dem besonderen
Glaubensinhalt.
Mit diesem Standpunkt sind die US-Bürger zu Vorbildern der Tugend religiöser Toleranz geworden. Ursprünglich, in den Frühzeiten der bürgerlichen Gesellschaft, hatte diese kulturhistorische Errungenschaft den tieferen Sinn, das von Kirchenbeamten dirigierte absolute Knechtsbewusstsein praktisch zu relativieren, die Autorität der Religion in eine von der Welt des öffentlichen Rechts und der politischen Macht getrennte Privatsphäre abzudrängen, die Konkurrenz zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft um den Gehorsam des Volkes definitiv zugunsten der Staatsautorität zu entscheiden und das real existierende Gemeinwesen gegen den Absolutheitsanspruch des geglaubten Gottesreiches zur alleinigen letzt-verbindlichen sittlichen Instanz zu erheben; deswegen war der Kampf für Toleranz und Religionsfreiheit auch regelmäßig mit religionskritischen Tönen verbunden. Von der Religion hat sich die Menschheit dann doch nicht frei gemacht; doch seit der Durchsetzung der bürgerlichen Staatsmacht schreibt diese mit ihrer erklärten Unzuständigkeit für die Religion ihrer Bürger die Unzuständigkeit der bestimmten Götter und ihrer Gebote für die sittlich verbindliche Entscheidungsmacht des Gewaltmonopolisten fest. Aus dieser Relativierung machen US-Bürger, ohne etwas davon zurückzunehmen, eine Apotheose des Gottesglaubens: Das ganz subjektiv zurechtgedachte „höchste Wesen“ beglaubigt die Unanfechtbarkeit des anständigen Lebens, um das ein jeder gute Ami sich bemüht; und weil es sich bei diesem „Way of Life“ um nichts anderes als die nationale Lebensart handelt und bei dem konkurrenztüchtigen Bemühen um entsprechende private Erfolge um nichts anderes als das Ethos des nationalen Gemeinwesens, handelt es sich auch bei dem Produkt der privatreligiösen Phantasie per se um nichts anderes als eine subjektive Variante der Gottheit, die für alle Amerikaner und den Erfolg der ganzen Nation zuständig ist. Deswegen gehört es sich umgekehrt für einen anständigen US-Bürger auch, irgendeinen Gott anzubeten, und wenn es die Absolutheit ist, mit der ein bekennender Atheist an die Überflüssigkeit einer jenseitigen Instanz für sein sittliches Dasein glaubt: Die Idee der absoluten Unanfechtbarkeit der nationalen Lebensart, in der privater Lebenskampf und nationale Sache ineins fallen, möchte schon im Herzen jedes Volksgenossen wohnen.
Auf die Art sichert ausgerechnet die weltanschauliche Neutralität des amerikanischen Staates dem Absolut-Allerhöchsten einen festen Platz im Gefühlshaushalt des anständigen Amerikaners und zugleich eine prominente Rolle im öffentlichen Leben der Nation, nämlich überall da, wo der Privatmensch als deren bedingungslos loyales Subjekt in Erscheinung tritt. Im Parlament, im Fernsehen und überhaupt wird viel gebetet, der Präsident ruft immerfort den Allerhöchsten an, und das ganze Land wickelt seine Jagd nach dem Mammon als immer währenden Gottesdienst ab: Ausgerechnet auf sein Papiergeld druckt es sein Glaubensbekenntnis und bezeugt, auf welchem Kredit (aus dem Lateinischen für ‚Vertrauen‘) das Geben und Nehmen von Dollars im Letzten beruht: „In God We Trust“.
Der Präsident macht sich daher nicht lächerlich, wenn er als Vertreter des wahren Islam auftritt, die islamistischen Attentäter als Ketzer gegen den Geist dieser großen und friedfertigen Religion aus der islamischen Gemeinde ausschließt und ihr Treiben als vom Koran nicht gedeckte Politisierung des Glaubens verdammt. Als eigentlicher Schutzherr aller Privatreligion weiß er eben, dass auch der Islam – richtig verstanden – unmöglich feindselig gegen das Land sein kann, das dieses wie jedes andere Bekenntnis erlaubt. Der Präsident macht sich erst recht nicht lächerlich, wenn er für sich und seine nationale Sache eine religiöse Rechtfertigung in Anspruch nimmt, die sich in ihrem Wortlaut dann doch recht wenig von derjenigen unterscheidet, die er den Islamisten bestreitet: Wenn Amerika andere Länder überfällt, die Welt von antiamerikanischen Terroristen befreit und „unlawful combatants“ wie Tiere in Käfige sperrt, dann selbstverständlich in Ausübung eines Auftrags von oben – „Gott will es!“ „Gott ist in diesem Kampf auf unserer Seite!“ Auch da redet in Washington eben kein Ayatollah, sondern ein waschechter Ami, der so redlich wie jeder US-Bürger seinen Job erledigt – die Mobilisierung der weltgrößten Streitmacht in dem Fall, doch was macht das schon für einen Unterschied! –, demonstriert sein höchstpersönlich gutes Gewissen, spricht jedem anderen waschechten Ami aus dem Herzen – und blamiert sich so lange nicht, wie die überlegenen Machtmittel seiner Nation mit ihrem Erfolg die Inanspruchnahme des allerhöchsten Erfolgsgaranten rechtfertigen. Denn die sind die wirkliche Quelle des nationalen Gottvertrauens.