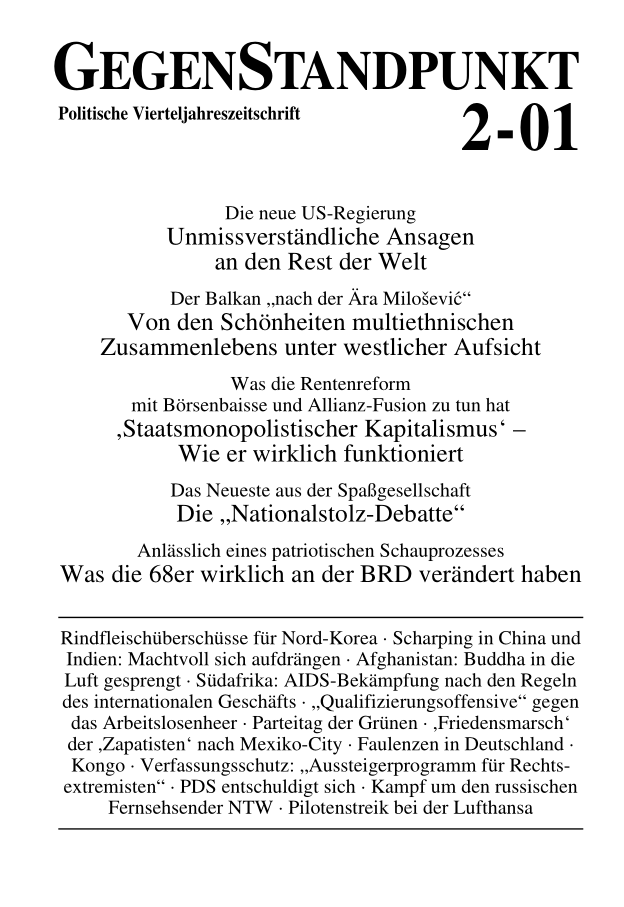Das Neueste aus der Spaßgesellschaft
Die „Nationalstolz-Debatte“
Nationalstolz ist der Fehler von Untertanen, die sämtliche zwischen ihnen und in ihrem Verhältnis zur politischen Gewalt eingeschlossenen Gegensätze für unwichtig befinden, um sich umso mehr auf die Einzigartigkeit des Gemeinwesens einzubilden, dem sie zwangsweise angehören. In der von Lauritz Meyer (CDU) und Jürgen Trittin (Grüne) aufgemachten Debatte wird nicht für oder gegen Nationalstolz argumentiert, sondern er wird unterstellt und darüber gestritten, wie er richtig geht.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Das Neueste aus der
Spaßgesellschaft
Die „Nationalstolz-Debatte“
I.
Der Stolz, als „ausgeprägtes Selbstwertgefühl“ und traditionelle Gemütsverfassung des Spaniers bekannt, genießt im Alltagsleben ein eher zwiespältiges Ansehen. Einerseits wird man zwar kaum jemanden finden, der nicht aus irgendetwas diese tiefe Befriedigung zu ziehen verstünde – und wenn’s seine Briefmarkensammlung ist. Die Einbildung, wegen der Erfüllung allgemein gebilligter Maßstäbe in Beruf und Familie ein ganz toller Hecht zu sein, ist also nicht gerade ungewöhnlich. Andererseits wittert die Umwelt bei allzuviel „meine Frau, mein Auto, mein Haus!“ schnell den Dünkel heraus, sich besser als andere vorkommen zu wollen, und mag dann doch nicht den Hut ziehen. Aus anerkannten sittlichen Leistungen unbedingt persönliches Kapital schlagen zu wollen, gehört sich eben nicht, weil die Berufung auf eine unterstellte Wertegemeinschaft sich mit dem Gestus der Selbstüberhebung schlecht verträgt. Selbstlob stinkt, und mancher Erzeuger wird beim Stolz auf den prächtigen Stammhalter mit dem Spott bedacht, dass die dazu nötige Leistung so großartig auch wieder nicht ist.
Dummheit und Stolz werden nur dort nicht auf einem Holz wachsen gesehen, wo die Identifikation mit dem Allgemeinen, dem Volk als dem Urheber aller Werte, nicht zu privater Angeberei mißbraucht, sondern zum Lob der einzigartigen Gemeinschaft zurückgewendet wird, die so herausragende Individuen hervorbringt. Sich an irgendwelchen persönlichen Leistungen – manche Landstriche bestehen vorwiegend aus Forschern und Entdeckern, andere aus Dichtern und Denkern, wieder andere weisen ein Höchstmaß an Schwermut und Musikalität auf – die Unvergleichlichkeit des großen Ganzen zu Gemüte zu führen, dem man jeweils angehört, ist angesehener Brauch in allen Kulturnationen, die deswegen ja so heißen. – Wobei ein Unterschied nicht zu übersehen ist: Derselbe Nationalstolz, der eine so natürliche Zugabe zur gewöhnlichen Moral darstellt, bedeutet etwas anderes, wenn er von Politikern oder öffentlichen Kulturbeauftragten geäußert, als wenn er vom Volk, das sich da etwas auf sich einbilden darf, auch noch als großes Gefühl empfunden wird. Die ersteren können nämlich wirklich stolz darauf sein, wenn sich ihr Volk als solches aufführt und sich statt als Gemeinschaft der Untertanen einer gemeinsamen Herrschaft als Angehörige einer echt ursprünglichen Wertefamilie sehen will. Das Volk selbst, das sich diese Verfremdung eingehen läßt, macht hingegen einen Fehler, wenn es sämtliche in ihm und seinem Verhältnis zur politischen Gewalt eingeschlossenen Interessengegensätze – die es sehr wohl kennt – zur Nebensache gegenüber dem Unsinn erklärt, dass es ausgerechnet wegen Goethe, Schiller oder der „Elf von Bern“ Grund zur Genugtuung und wegen Adolf allen Anlaß zur Scham hat.
II.
Soweit die ernste Seite der Debatte, die im Frühjahr 2001 über die Menschen im Lande hereingebrochen ist und, glaubt man den Drohungen aus berufenem Munde, neben „Zuwanderung“ und „Leitkultur“ den dritten Knüller des heraufziehenden Bundestagswahlkampfs ausmachen soll. Der bisherige Ablauf der Auseinandersetzung ist dagegen ein einziger Beweis dafür, dass man wohl Nationalist sein, dafür und mit diesem Standpunkt aber nur uneigentlich argumentieren kann – womit die Geschichte ihre eher lächerlichen Wendungen nimmt.
Das fängt schon damit an, dass der Disput von vornherein als reine Stellvertreterdebatte geführt wird. CDU-Generalsekretär Meyer lässt in einem FOCUS-Interview über die Ausländerfrage und die Leitkultur-Idee seiner Partei den Satz fallen „Ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein“, woraufhin ihm der Grüne Trittin etwa drei Monate später „das Aussehen und die Mentalität eines Skinheads“ bescheinigt. Weil die sich den Spruch ja auch auf die Glatzen tätowieren. Bemerkenswert an dieser Konfrontation: Jeder Grund, warum dem einen das Vaterland so schätzenswert und dem anderen diese Haltung so bedenklich erscheint, wird höflich ausgespart; es soll auch niemand durch sachdienliche Hinweise zum Deutschtum bekehrt oder davon abgewendet werden. Stattdessen werfen sich beide machtvoll in die Pose, dass gleichwohl an der Zustimmung zu ihrer Haltung über den aufrechten Gang, den Grad der Aufklärung oder überhaupt die Stimmung der ganzen übrigen Gesellschaft entschieden wird. Weshalb man stolz sein sollte oder nicht, erfährt man nicht, – aber dass die Nation unbedingt eine richtige Einstellung zu sich braucht und keine falsche, das soll sich jeder mit dem genialen Argument hinter die Ohren schreiben, dass er sonst auf den falschen Verführer hereinfällt. Die Krönung dieser „Überzeugungsarbeit“, die offensichtlich keine ist, ist der beiderseitige Verweis auf den Rechtsextremismus, in den falsch verstandener Nationalismus so oder so mündet. Entweder wird das gesunde Nationalgefühl, das uns allen eignet, durch Herumhacken auf natürlichen Stolzempfindungen geschädigt und in jene berüchtigte Ecke getrieben:
„Der ehemalige Vorsitzende der CDU, Wolfgang Schäuble, schaltete sich mit harschen Worten gegen den Grünen in die Diskussion ein. Wenn Trittin den Satz ‚Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein‘ ablehne, treibe er die Menschen scharenweise zu den Rechtsextremen, sagte der Politiker am Dienstag im DeutschlandRadio. ‚Ich glaube, er hat eine viel größere Wirkung als diese wenigen Dummschwätzer und Schreier, die es bei den Extremen gibt.‘“ (Focus 23.3.)
Oder es ist genau andersherum:
„‚Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein‘ – wer diesen Satz vor sich herträgt, der transportiert immer auch die Botschaft, dass er froh ist, kein Ausländer zu sein. Und so spielen sich ausgerechnet die rassistischen ‚Dummschwätzer‘ (Schäuble) zu Hütern der Nation auf, obwohl gerade sie Deutschland wirtschaftlich und politisch massiven Schaden zufügen.“ (Spiegel, 21.3.)
Angesichts dieser bierernsten Schadensbilanz fragt sich eigentlich nur: Was soll sich das geneigte Publikum zu dieser wochenlangen Begutachtung seines Seelenzustands nun eigentlich denken? Liegt es schon richtig und darf sich auf die Schulter klopfen, weil es den Verein, dem es angehört, auch ohne Belehrungen von oben über alles schätzt? Oder soll es vor dem Skinhead erschrecken, der gleich daneben in ihm steckt und auf den geringsten Anlass wartet, das Ansehen der guten Deutschen in aller Welt zu beflecken?
Das Publikum braucht sich gar nichts zu denken. Seine Politiker gehen einfach davon aus, dass ihre Aufrufe zur nötigen Gesinnungshygiene schon niemanden in dem Nationalgefühl erschüttern, das er haben muß, um den Streit seiner Manipulationstheoretiker nicht entweder für Spiegelfechterei oder für einen wirklichen Anlaß zum Ärger zu nehmen. Gäbe es im Lande keinen Nationalismus, mit solchen „Argumenten“ – der falsche schadet Deutschland! – käme er bestimmt nicht zustande. Und gäbe es den, vor dem immerzu gewarnt wird, dann verfinge die Warnung – Vorsicht, extrem! – genausowenig. Der ganze Quatsch taugt also doch nur dazu, die unterstellte grundsätzliche Zustimmung des Volks zu den Lebensumständen, mit denen es beglückt wird, abzurufen, indem ihm alternative Interpretationen seines Dafürseins geboten werden; der Stoff eben, aus dem Wahlkämpfe gemacht werden.
Dafür legen sich die Meinungsmacher allerdings mächtig ins Zeug und geben dank des hochgespülten Themas einen Grundkurs nach dem anderen in der Disziplin „Nationalstolz – aber richtig“.
Erstens muß man sich ja nichts vormachen. Ein Westerwelle, der sich offen und ehrlich zu seinem Stolz auf Deutschland „bekennt“ – wozu unwahrscheinlich was gehört in unserer Miesmachergesellschaft –, kennt sich auch mit der Rolle von Gefühlen in der Politik bestens aus. Aus Vernunftgründen für das eigene Land zu sein, hält der schöne Guido zwar theoretisch für denkbar, praktisch aber doch eher für abwegig bzw. eine zu wacklige Basis des Mitmachens. Wenn da nicht neben und vor dem Verstand ein bißchen was Emotionales im Spiel ist, kommt kein ordentlicher Patriotismus raus:
„Auf Dauer wird der rationale Verfassungspatriotismus nicht bestehen, wenn er nicht auch den emotionalen Stolz auf das eigene Land, für die Menschen in diesem Land enthält.“ (FAZ, 19.3.)
Sagt er einfach so und ist sich völlig sicher, dass das nicht als Kritik an einer offenbar wenig „rationalen“ Einstellung verstanden wird. Ohne Stolz kein Stolz – das überzeugt. Die Miesmacher vor allem, die aufpassen sollen, dass sie nicht sich und andere „entwurzeln“, was vom Gefühl her bekanntlich die größte Sorge von Kritikastern ist.
Zweitens muß man das Unterscheiden lernen. Unser Bundespräsident z.B. ist beim Unterscheiden ein großes Vorbild. Neulich hat er schon „Patriotismus“ und „Nationalismus“ auf nachgerade klassische Art auseinandergehalten – „das eigene Land lieben, aber nicht die anderen verachten“. Auch wenn man dagegen einwenden mag, dass das Hochgefühl für den eigenen Laden zumindest nicht ohne eine gewisse Abwertung Dritter zu haben ist – wo bliebe sonst der Sinn fürs „Eigene“? –: Als Unterscheidung war das astrein. Und zur aktuellen Frage des inwiefern berechtigten Stolzes ist ihm schon wieder ein Unterschied eingefallen:
„Man kann nicht stolz sein auf etwas, was man selber gar nicht zu Stande gebracht hat, sondern man kann froh sein oder dankbar dafür, dass man Deutscher ist. Aber stolz kann man darauf nicht sein, nach meiner Überzeugung. Stolz ist man auf das, was man selber zu Wege gebracht hat.“ (Rau)
Auf das eigene Differenzierungsvermögen beispielsweise. Ohne diese ausgesprochene Selberleistung wären die Deutschen am Ende noch stolz auf ihren Bundespräsidenten, die Lohnarbeit und die Castortransporte. Und nicht froh und dankbar dafür.
Drittens muss, wenn jeder dann die guten und die bösen Gefühle oft genug voneinander geschieden und gegeneinander abgewogen hat, irgendwann auch wieder Schluss sein. Letzten Endes geht es beim Auftrumpfen in nationalen Gesinnungsfragen sowieso um nicht mehr als die Abwehr unguter „Verkrampfungen“:
„Es werde Zeit, ‚dass wir in aller Offenheit ein unverkrampftes und liebevolles Verhältnis zu unserem Land zeigen dürfen‘, sagte der CDU-Politiker.“ (Meyer lt. Focus)
Denn was man liebt, darauf kann man auch stolz sein, und diesen Stolz wird man doch noch „unverkrampft“ zeigen dürfen! Dem können selbst die Anhänger der lieber tiefstapelnden Vaterlandsliebe –
„Wer wirklich Geld hat, protzt nicht; wer stolz auf sein Land, Kind oder Schaffen ist, wirft sich nicht in die Brust. Auf diese trommeln Gorillas, um sich Mut zu machen; es ist eine Gebärde der Unsicherheit.“ –
nicht ganz und gar widersprechen. In aller Offenheit kennen auch sie eine
„Zuneigung, die mehr ist als ein lebenswichtiger, aber blutarmer ‚Verfassungspatriotismus‘.“ (Zeit 13/2001),
halten allerdings die stolzgeschwellte Brust für verkrampft und sind sich in der Hauptsache einig: Man mag am Nationalstolz ja herumdeuteln, was man will. Aber wer nicht ein bißchen unbedingt, liebend, dankbar und vielleicht sogar stolz, zu seinem Vaterland steht, der steht eigentlich gar nicht dazu und hat seinen Beruf als Deutscher verfehlt. Das mußte mal wieder gesagt werden, falls es jemand vergessen haben sollte.
P.S.
Das Lieblingsargument aller Nationalismusdebatten durfte natürlich auch diesmal nicht fehlen. Wie überhaupt die Waldursprünglichkeit und Unschuld des Nationalgefühls dadurch „bewiesen“ wird, dass es überall sprießt, so erhält seine demonstrative Steigerungsform, der Nationalstolz, seine letzte Rechtfertigung selbstredend daher, dass andere Völker sich in der Hinsicht auch nicht so haben. Man nehme nur die Franzosen:
„Die Franzosen hören nicht auf, über ihr Land zu meckern. Sie bringen bei jeder nur denkbaren Gelegenheit ‚die Malaise‘ ins Spiel.“ (Die unkritische Tour, ihren Staat als Ansammlung von Mißständen zu besichtigen, weil sie ihm nur das Beste wünschen, beherrschen sie also auch – Chapeau!) „Und dennoch“ (wieso dennoch?) „zögern sie nicht, in regelmäßigen Abständen und ohne jeglichen Komplex auszuposaunen, dass sie die Weltbesten sind. Die Frage nach dem Nationalstolz stellt sich nicht. Sie ist selbstverständlich. … Von Frankreich aus gesehen hat die deutsche Debatte über Nationalstolz etwas Surreales.“ (FR 29.3.)
Ja, wenn das schon in der „Grande Nation“ so gesehen wird… Vielleicht sollte die nächste Debatte gleich über die Wiedereinführung des Sedanstags gehen: Schmucke Siegesfeiern heben das nationale Selbstwertgefühl sowieso besser als dröge TV-Duelle; die Westermeyers könnten sich endlich in aller Unverkrampftheit „zeigen“; und bevor Deutschland noch am Surrealismusvorwurf verzweifelt, soll der Franzmann doch zusehen, wer hier Komplexe hat. Das wird erst ein Spaß!