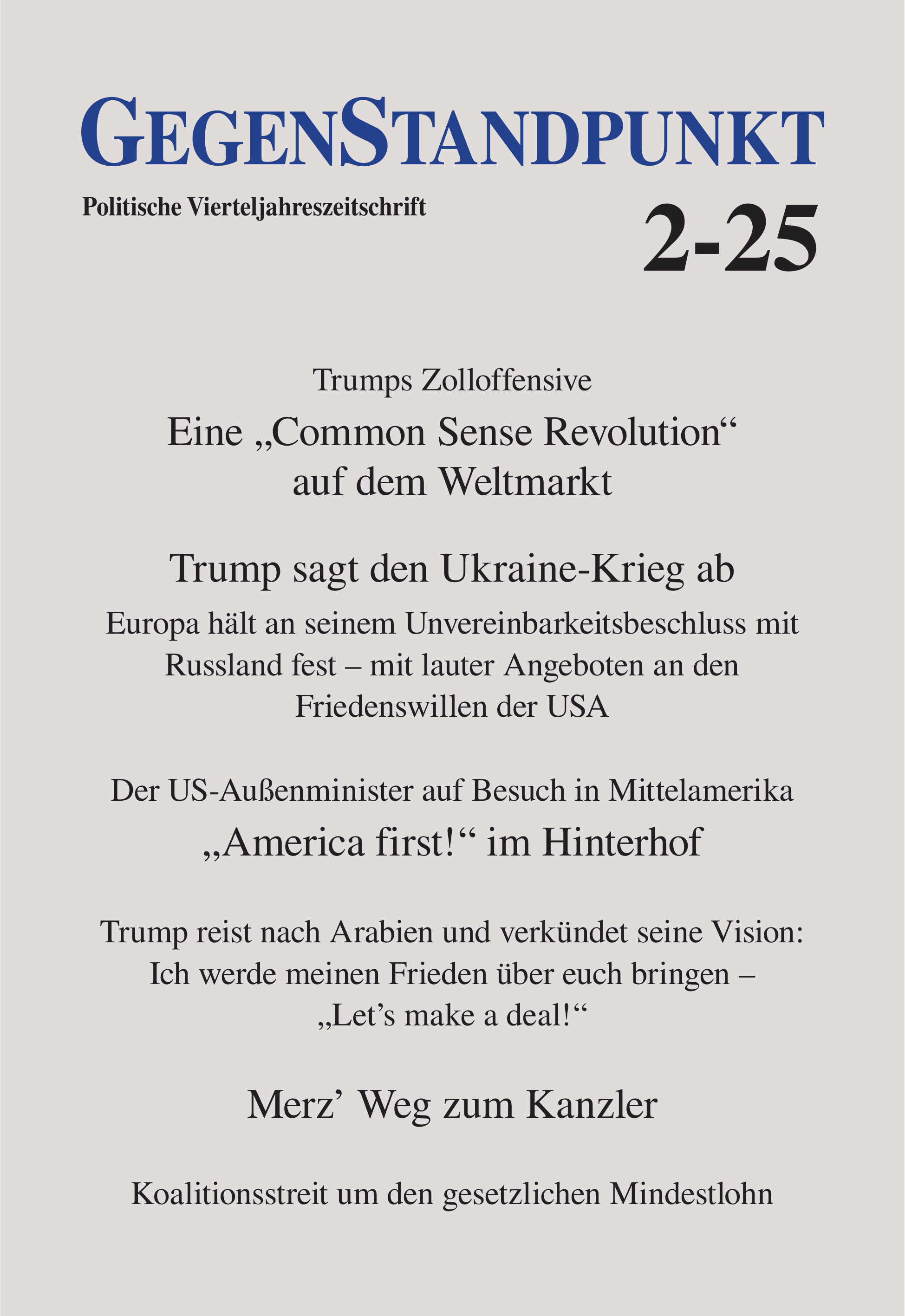Merz’ Weg zum Kanzler
„Wir stehen ja im Grunde genommen vor einer Systemfrage: Hat eine parlamentarische Demokratie in Zeiten von autoritären und autokratischen Regimen noch eine Zukunft, und ich möchte beweisen, dass demokratische Systeme aus sich selbst heraus in der Lage sind, Probleme zu lösen, in der Lage sind, Vertrauen zu bewahren, auch zurückzugewinnen, wo sie’s verloren haben.“ (Merz, FAZ-Kongress, 21.3.25)
In diesem Sinne macht der Kanzlerkandidat der CDU sich schon ab Herbst 2024 ans Werk.
Aus der Zeitschrift
Artikel anhören
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Merz macht – nämlich Wahlkampf um Handlungsfähigkeit
- 2. Der Wahlkampfschlager ‚Migration‘ und sein unbefriedigendes Resultat
- 3. Die Herstellung der Freiheit des Regierens – mit Hilfe einer Grundgesetzänderung für Deutschlands Großvorhaben
- 4. Der Koalitionsvertrag – schnell, einig, entschlossen, also gut
- 5. Führungsstärke verlangt Durchsetzung – Merz bildet sein Kabinett
- 6. Eine vergeigte Kanzlerwahl als krönender Abschluss
Merz’ Weg zum Kanzler
„Wir stehen ja im Grunde genommen vor einer Systemfrage: Hat eine parlamentarische Demokratie in Zeiten von autoritären und autokratischen Regimen noch eine Zukunft, und ich möchte beweisen, dass demokratische Systeme aus sich selbst heraus in der Lage sind, Probleme zu lösen, in der Lage sind, Vertrauen zu bewahren, auch zurückzugewinnen, wo sie’s verloren haben.“ (Merz, FAZ-Kongress, 21.3.25)
In diesem Sinne macht der Kanzlerkandidat der CDU sich schon ab Herbst 2024 ans Werk.
1. Merz macht – nämlich Wahlkampf um Handlungsfähigkeit
Was Merz als die entscheidende Kritik an der Ampelkoalition von früh bis spät zum Besten gibt: Sie sei – öffentlich zerstritten, mit sich beschäftigt, mit abwegigem Gedöns befasst – handlungsunfähig. Seine Blamage zielt damit auf den Maßstab jeder demokratischen Herrschaft: Ob sie das, was sie im Sinne der Nation ökonomisch, strategisch, diplomatisch, sittlich ... für notwendig hält, auch tun kann, ob sie also ihr Land und ihre Bürger im Griff hat. Was sie tut, ist für dieses oberste Beurteilungskriterium ganz nebensächlich: Erfüllt ist es, wenn sie ihre Handlungsfreiheit souverän wahrnimmt und alles durchsetzt, was sie sich vornimmt; das größte Vergehen an ihrer Aufgabe ist es, die Untertanen „führungslos“ und damit „orientierungslos“ dastehen zu lassen.
Dass er als Kanzler an diesem Maßstab versagt haben soll, will Scholz sich nicht nachsagen lassen. Gerade das Ende seiner Ampelkoalition inszeniert er als das Gegenteil seines persönlichen Scheiterns: In einer „Wutrede“ verkündet er, dass er seinen widerspenstigen Finanzminister unehrenhaft entlässt, weil der mit seinem Bestehen auf der Schuldenbremse die nötigen Vorstöße zum Wohle der Nation verhindert und mit seinen Querschüssen die Macht des Kanzlers untergraben hat. Der als eigener Beschluss präsentierte Bruch der Koalition soll noch in seinem Abgang beweisen, dass der Kanzler das Heft in der Hand hält.
Von da an ist Scholz auf Stimmen aus der Opposition angewiesen, um in den Resttagen seiner reduzierten Koalition überhaupt noch Regierungsvorhaben umsetzen zu können. Dem Oppositionsführer Merz bietet er dafür an, die ganzen Forderungen, die dieser im Zuge seiner Tiraden gegen das Nicht-Handeln der Regierung aufgestellt hat, um alle Unzufriedenheiten im Land zu Zustimmung für seine Union zu machen, in etwas wahrhaft Konstruktives zu überführen: Nun kann er sie doch als Mehrheitslieferant der verbliebenen Regierung umsetzen helfen und damit beweisen, dass es ihm mit seinem Tatendrang auch wirklich ernst ist. Merz lässt diesen Funktionalisierungsversuch seinerseits öffentlichkeitswirksam für das Gegenteil sprechen: Sein Karrieresprung vom Oppositionsnörgler zu einem, der von der Regierung umworben wird, beweist (neben seiner Eignung zum Macher) gerade die schändliche Schwäche dieser Regierung, und jede Stimme seiner Union dafür würde diese Schwäche bloß erhalten und verlängern.
Natürlich ist das Kriterium effektiver Tatkraft, mit dem die Opposition ihre Kritik der Regierung und diese ihr Selbstlob vorrangig bestreiten, nicht die ganze Wahrheit. Woran die Regierenden die Tugend erfolgreicher Handlungsfähigkeit zu beweisen haben – oder eben damit scheitern –, ist keineswegs wirklich belanglos. Die Parteinahme für die Sache, derer die Politik sich annimmt, für die Lösungsbedürftigkeit und für die eine oder andere Lösung umstrittener Staatsaufgaben ist immer unterstellt, wenn Entschiedenheit und Effizienz verlangt bzw. vermisst werden. Aber nicht nur im allemal heuchlerisch parteilichen demokratischen Dialog treten die Inhalte des Regierungshandelns regelmäßig hinter der Frage „Können die regieren? Kann Scholz/Merz ‚Kanzler‘?“ zurück. Tatsächlich kommt es für die politische Herrschaft im bürgerlichen Gemeinwesen vor allem darauf an, dass sie den Laden im Griff hat. Ihr Aufgabenkatalog ist mit den Gewalterfordernissen der kapitalistischen Konkurrenz schon so festgeschrieben, dass es auf dessen „rechtssichere“, also alternativlos wirksame Erledigung ankommt. Es passt also, wenn das reibungslose Gelingen des Regierungsgeschäfts die Hauptsache ist, an der sich die Meinung über die Politik, nämlich über die Kompetenz ihrer Macher bildet. Die setzen dann so frei, wie ihre Amtsmacht es ihnen erlaubt, Prioritäten und alternative Lösungen bei der Exekution der Staatsräson, die sie in ihren Ämtern als Regelungsbedarf vorfinden. Und an dem Stoff demonstrieren sie ihren Bürgern ihre Tatkraft, damit der Wähler dann nach ihnen als den glaubwürdigsten Tatmenschen ruft.
Das wunderbare Hin und Her in der Frage, wer die Macht hat und wer sie vergeigt, hätte also sicher noch eine Weile weitergehen können, die Öffentlichkeit als Punktrichter wäre jedenfalls sicher nicht vorzeitig ermüdet. Aber dann findet Merz einen neuen Stoff dafür auf dem Feld, das er zum Dreh- und Angelpunkt der Kontrollhoheit des Staats, also echter Durchsetzung, also guter Regierungsführung, erklärt hat: die „Sicherheit“ der Bürgerinnen und Bürger vor staatlich unerwünschter Migration. Ein Attentat in Aschaffenburg kommt ihm wie gerufen dafür, sein entschlossenes Auftreten durch vorgeführte Tatkraft zu untermauern. Seine Logik: Der Attentäter hätte seine Tat nicht hier verüben können, wäre er nicht (mehr) hier gewesen, also hat die Ampelregierung durch unterlassene Migrationspolitik die Opfer dieses und weiterer Attentate, die unter dem Merkmal ‚Täter Ausländer‘ in einer Reihe stehen, zu verantworten. Dagegen bringt er einen Entschließungsantrag für eine verschärfte Zurückweisungs-, Abschiebungs- und Fernhaltepolitik in den Bundestag ein – die Forderung also, dass das Parlament sich dazu bekennen möge, dass eine solche dringend nötig sei.
Für diesen Vorstoß setzt er sich über die ‚Brandmauer‘ gegen die AfD hinweg, als deren oberster Garant er sich bislang präsentiert hatte, und macht damit deutlich, in welchem Sinne die immer gemeint war:
„Ich gucke nicht rechts und nicht links. Ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus.“ „Eine richtige Entscheidung wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen. Sie bleibt richtig.“
Die Stimmen der Falschen will er nämlich für die nötige Mehrheit benutzen und für den Beweis instrumentalisieren, dass er der migrationspolitische Macher ist. Entgegen dem darauf folgenden Vorwurf des unerhörten Tabubruchs, mit dem Merz gar das „Tor zur Hölle“ aufgestoßen haben soll, besteht dieser darauf, in diesem besonderen Fall gerade nicht als Machtmensch taktiert zu haben, sondern beruft sich, nach eigener Aussage zum ersten Mal „in den über 18 Jahren, die ich diesem Parlament angehöre“, explizit auf das Allerpersönlichste: sein „Gewissen“. Wozu das den Machtmenschen zwingt? Natürlich zum Machen. Was genau zu machen ist, ist klar: Eben das, was Merz mit der größten Selbstverständlichkeit unterstellt, dass nämlich aus Anschlagsopfern mehr praktische Ausländerbekämpfung zu folgen hat. Die Tatsache, dass er diesen unausweichlichen Tatendrang in sich verspürt, macht seinen Vorstoß unwidersprechlich.
Weil es Merz sehr darauf ankommt, dass die Mehrheit, die er sich so verschafft, für ihn spricht und nicht etwa für die Mehrheitsbeschafferpartei, liefert er im Entschließungsantrag gleich die beabsichtigte Interpretation dieses Manövers mit: Die AfD sei „kein Partner, sondern unser politischer Gegner“. Die Ausländerfeindlichkeit, die er im Volk anstachelt und abruft, gehört alleine ihm, der sich in ihrem Namen als handlungsfähig beweist; damit macht er Werbung für die Union gegen die AfD, deren potentiellen Wählern er sich ja gerade als die glaubwürdigere, weil kanzlerfähige Alternative vorstellen will.
2. Der Wahlkampfschlager ‚Migration‘ und sein unbefriedigendes Resultat
Das Wahlergebnis macht dann amtlich, wie gut die Migration als Wahlkampfthema funktioniert hat: Der deutsche Wähler findet es mehrheitlich voll gut und verschafft damit nicht nur den Unionsparteien ihren Wahlsieg, sondern macht zugleich die AfD zum Hauptzugewinner an Wählerstimmen. Damit profitiert ausgerechnet die Partei, die Merz mit seiner berechnenden Themenwahl „halbieren“ wollte, am stärksten von diesem Themenzuschnitt und verdoppelt sich. Das absolute Mehrheitsvotum für die beiden ausländerfeindlichen Parteien ist aber für nichts gut – schließlich will Merz auf keinen Fall gemeinsam mit der AfD regieren. Für ihn bleibt nur die stark geschrumpfte zweitstärkste Partei der „demokratischen Kräfte“ übrig, der damit „natürliche Koalitionspartner“ SPD, den er eben erst als Inbegriff von Taten-, Erfolg- und Gewissenlosigkeit auch und gerade beim Kernthema Migration verunglimpft hat. Das macht aber nichts, denn jetzt, wo der Wahlkampf vorbei ist, kommt es ohnehin auf einen nationalen Aufbruch anderer Art an, der das Migrationsthema fürs Erste überlagert: „Auf Deutschland kommt eine Führungsrolle zu – und die müssen wir ausfüllen.“ Das ist angesichts von „Putin“ und „Trump“ die harte Vorgabe für die Kanzlerschaft der nächsten Jahre, die einfach „keinen Aufschub duldet“. Dafür braucht nicht nur Deutschland seinen Merz als starken Anführer, sondern der für das Programm seiner Regierung eine finanzielle Gestaltungsfreiheit bisher ungekannten Ausmaßes.
Gemessen an dieser Vorgabe ist das Wahlergebnis ziemlich problematisch: Es gibt zwar eine absolute Regierungsmehrheit für Union und SPD her, erschwert bis ausgeschlossen ist jedoch das Erringen von Zweidrittelmehrheiten für fällige Grundgesetzänderungen. Die sind im Sinne des nationalen Aufbruchs zwar notwendig, um die Schuldenbremse so zurechtzustutzen, dass sie nicht zum Hindernis für die benötigten Finanzmassen wird, aber im neuen Bundestag ohne die unerwünschten und verweigerten Stimmen der politischen Ränder einfach nicht zu erzielen.
3. Die Herstellung der Freiheit des Regierens – mit Hilfe einer Grundgesetzänderung für Deutschlands Großvorhaben
Diese missliche Lage kann und darf Merz nicht stoppen. Zu den von ihm inszenierten Führerqualitäten „Mut“, „Durchsetzungsfähigkeit“, „Entschlossenheit“, mit denen er sich bereits als leibhaftigen Garanten seines politischen Erfolgs eingeführt hat, gesellt sich nun eine weitere und vielleicht weniger erwartete, aber eben auch unverzichtbare, wenn der Job es erfordert: die „Fähigkeit zum Umdenken“. Gerade die Tatsache, dass er sich als Oppositionspolitiker im Wahlkampf mit seiner „finanzpolitischen Kompetenz“ noch gegen das „Aufweichen der Schuldenbremse“ ausgesprochen hat, soll das belegen. Er ist zur „Einsicht in das Notwendige“ imstande, gerade dann, wenn es „um Deutschlands Zukunft geht“. Und er ist bereit, im Zweifelsfall auch ungewohnte Wege einzuschlagen, um „das Notwendige“ hinzukriegen: Merz besorgt sich die erforderliche Mehrheit zur Grundgesetzänderung, indem er den alten Bundestag über das Vorhaben der neuen Regierung abstimmen lässt, in dem Union, SPD und Grüne zusammen noch das notwendige Stimmgewicht haben, das ihnen durch die Wahl verloren gegangen ist.
In der eigenen Partei bringt er für dieses Manöver seine gerade erst leicht ausgefranste „Prinzipienfestigkeit“ neu zur Geltung, indem er jeglichen Widerstand gegen seinen Kurswechsel niederbügelt, noch bevor der laut wird. Auch mit der SPD tut sich Merz ziemlich leicht, weil die bei ihrem historisch schlechtesten Ergebnis froh ist, überhaupt weiter regieren zu können. Beim Gewinnen der Grünen, die ebenfalls zustimmen müssen, hilft Klingbeil ihm darum – und beweist damit, wie gut er schon in seine künftige Rolle als Vizekanzler hineingewachsen ist – mit Worten, die der Tragweite des Vorgangs angemessen sind:
„Wenn die Geschichte anklopft, muss man die Tür öffnen, weil man niemals weiß, ob es vielleicht eine zweite Chance dafür gibt.“
Die designierte neue Regierung bietet den Grünen eine letzte Gelegenheit, im Bundestag noch einmal „die Zukunft dieses Landes mitzugestalten“, bevor sie auf der Oppositionsbank verstaut werden. Merz stellt ihnen außerdem in Aussicht, dass anstelle von 50 sogar 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für den Klima- und Transformationsfonds reserviert werden. Das ist noch so ein Fall von unideologischem „Umdenken“, bei welchem der künftige Kanzler seine Vorbehalte gegen den grünen Fetisch zurückstellt, wenn es dem Wohle des Landes dient. Zugleich besteht er dabei darauf, dass das kein Freifahrtschein für grüne Ideologien ist und dass er sich von dieser Partei keineswegs treiben lassen wird: „Was wollen Sie in so kurzer Zeit noch mehr?“ Die Grünen sollen gefälligst an ihre staatspolitische Verantwortung denken und den Dienst tun, den der Kanzler von ihnen braucht: „Ist Scheitern aus Ihrer Sicht eine ernsthafte Option?“ Natürlich nicht. Die Grünen stimmen zu. Die Sache klappt also.
4. Der Koalitionsvertrag – schnell, einig, entschlossen, also gut
Nun wollen die Wahlsieger der Union aber so schnell wie möglich wirklich an die Macht. Das Wahlergebnis mag dafür nur eine einzige „mehrheitsfähige Option im demokratischen Spektrum“ hergeben, aber die ist allemal ausreichend, wenn man nur will. Dementsprechend ist zwischen der Christenunion und der im Wahlkampf noch so gescholtenen SPD ein neuer Ton angesagt: Die Verhandlungspartner lassen das Polemisieren hinter sich, arbeiten total vertrauensvoll zusammen und werden nicht müde, das als die wesentliche Mitteilung über ihre Verhandlungen wirksam nach außen zu kommunizieren. In wohltuender Abgrenzung zur alten Ampel dringen dank des „Stilwechsels im Miteinander“ Meinungsverschiedenheiten oder Streit nicht so sehr nach außen, was allemal ein positives Zeichen dafür ist, dass da als neue Regierung etwas Gelingendes unterwegs ist – und das ist auch ohne nähere Auskunft genau das, was das Land braucht. Dass der „liebe Friedrich“ und der „liebe Lars“ dafür auch auf der zwischenmenschlichen Ebene demonstrativ nichts aussparen, finden manche professionellen Beobachter gut und andere zu bemüht. Macht aber auch nichts, denn was zählt, ist schließlich das Ergebnis.
Und das kommt. Die Verhandler können bald vermelden, dass sie fertig haben. Was könnte die gemeinsame Regierungsfähigkeit der Koalitionäre besser belegen, als dass sie ihren gemeinsamen Regierungswillen in einem großen Koalitionsvertrag dargelegt haben und ihnen das nicht nur glatt gelungen ist, sondern dann auch noch so fair und flink? „Gemeinsame Schnittmengen“ haben sie jedenfalls genug gefunden, auch ihre Differenzen darin unterbringen können, sodass „Lösungen“ für Deutschlands „Probleme“ nichts mehr im Wege steht und der designierte Kanzler stolz verkünden kann:
„Wir wollen und werden den Wandel in der Welt für Deutschland mitgestalten. Der Koalitionsvertrag ist ein Aufbruchssignal und ein kraftvolles Zeichen für unser Land: Die politische Mitte unseres Landes ist in der Lage, die politischen Probleme zu lösen, vor denen wir stehen.“
Ein schöner inhaltlicher Aspekt des Koalitionsvertrages, an dem noch einmal eigens deutlich wird, wie ernst es der neuen Regierung bei allen und jenseits aller Inhalte ihres Regierungsprogramms mit dem guten Regieren ist, liegt mit der Kleinausgabe der Kettensäge vor, die in Trumps Amerika an den Verwaltungsapparat und die Behördenbürokratie angelegt wird, weil sie Bürger und Staat einander entfremden. Aber weil die Koalitionäre keine Populisten, sondern seriöse Demokraten sind, stellen sie dafür ein total seriöses und demokratisches Reformverfahren in Aussicht:
„Die Koalition will in den kommenden vier Jahren zeigen, dass Deutschland zurück ist. Dafür müssen wir in vielen Bereichen besser werden und staatliche Entscheidungen, Prozesse und Strukturen modernisieren. Wir wollen als Bundesregierung zeigen, dass es geht, und vorangehen. Wir wollen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unseren Staat stärken. Dafür braucht die Politik eine ernsthafte und konsequente Bereitschaft zu Reformen. Durch eine grundlegende Modernisierung, Verwaltungsreform, einen umfassenden Rückbau der Bürokratie, Ziel- und Wirkungsorientierung und durch eine verlässliche Justiz werden wir unseren Staat wieder leistungsfähig machen. Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft stellen wir in den Mittelpunkt unseres Handelns. Damit Investitionen wirken, werden wir das gesamte Staatshandeln mit Effizienzsteigerungen und Digitalisierung begleiten und dadurch eine Modernisierungsrendite erzielen.“ (Koalitionsvertrag)
Natürlich wird gegen „Bürokratie“ nur dort polemisiert, wo Politikern die Inhalte und staatlichen Aufgaben nicht passen, die auf diese Weise von Behörden und Institutionen abgewickelt werden – das ist auch hierzulande nicht anders als in den USA unter Trump. Aber die Phraseologie des Koalitionsvertrags mit all ihren Leerformeln, die ohne Bezüge auf irgendwelche politischen Inhalte auskommen, ist alles andere als unpassend, vielmehr konsequent auf die demokratische Hauptsache zugespitzt: Beim Regieren kommt es zuallererst auf Effizienz an. Die wird, verbürgt durch ein zu diesem Zweck neu einzurichtendes Ministerium für ‚Digitalisierung und Staatsmodernisierung‘, wortreich in Aussicht gestellt.
Was es dann als Nächstes noch braucht, ist die Zustimmung der drei Parteien zum ausgehandelten Vertrag und damit zum Eintritt in die Regierung. Die will organisiert sein, und auch das gilt als ein eigener Erfolg, der auf die Spitzen der jeweiligen Fraktion abfärbt, sofern sie das möglichst geradlinig hinkriegen. Dazu trifft es sich gut, dass die notorischen Quertreiber der CSU in einem dafür einberufenen Parteigremium als erste ihre Zustimmung erteilen – „Wir haben einfach Tempo“ (Söder) – und dem Einigungswerk damit einen ersten Praxiserfolg bescheren. Sie reichen den Staffelstab weiter an die Schwesterpartei, die auf einem Kleinen Parteitag ebenfalls ihre Zustimmung zur Koalition organisiert. Zuletzt ist die SPD an der Reihe, die wie üblich auf dem Umweg der Akklamation über eine Mitgliederbefragung besteht. Die Basis soll sich dem neuen Aufbruch als Juniorpartner der Union nicht in den Weg stellen – und tut es in ausreichend breiter Mehrheit auch nicht.
Die Leistung des Zustimmungsverfahrens besteht darin, dass abweichende politische Vorstellungen innerhalb der Parteien damit befriedet werden; zwar nicht in der Form, dass sie verschwinden, aber sie sind damit praktisch bis auf Weiteres erledigt. Und sofern sich künftig Uneinigkeit innerhalb der Koalition auftun sollte, haben alle Seiten mit dem Koalitionsvertrag einen gewichtigen Berufungstitel für ihre jeweilige Position in der Machtkonkurrenz, als welche alle Sachfragen in der Demokratie abgewickelt werden, an der Hand.
5. Führungsstärke verlangt Durchsetzung – Merz bildet sein Kabinett
Fehlt noch das Personal, das die verschiedenen Machtpositionen in der Regierung übernehmen soll. Die Besetzung der Posten, die der CDU zufallen, ist für Merz Chefsache: Sein versprochener Politikwechsel im Land soll unmittelbar „sichtbare Veränderungen“ bringen, was am besten dadurch zu bewerkstelligen ist, dass man wichtige Staatsämter mit neuen Gesichtern besetzt. Langjährige Konkurrenten von Merz disqualifizieren sich entlang dieser zentralen Schlüsselqualifikation praktischerweise ebenso wie personelle Relikte aus der Merkel-Ära, an die Merz eher keine guten Erinnerungen hat. Die neue „Politik der Mitte“ soll damit auch endlich wieder dem reaktionären Selbstverständnis der CDU-Basis entsprechen. Wenn es nach dem Chef geht, soll auch hierzulande „von Tag eins an“ ein Hauch von Trumpismus wehen und die Republik, die immer noch nicht restlos überzeugt scheint, ob der ewige Zweite wirklich das Zeug zum Kanzler hat, endgültig von dessen Führungsstärke überzeugt werden. Für den Beweis, dass er wirklich der starke Mann ist, den die Nation jetzt braucht, übt Merz sich in demonstrativer Rücksichtslosigkeit gegenüber etablierten Gepflogenheiten seiner Partei zur Regelung der Personalkonkurrenz bei der Kabinettsbesetzung: Demonstrativ übergeht er Regionalproporze, Quotenregelungen und sonstige Rücksichtnahmen auf irgendwelche parteiinternen Verbände und besteht auf seiner Freiheit in der Besetzung der Ministerposten. Als Kernkompetenz seines Kabinetts verlangt er unbedingte Loyalität, und gerade die Tatsache, dass er seinen Parteikollegen damit einiges zu schlucken gibt, soll für seine Durchsetzungsfähigkeit, also ihn als geeigneten Chef an der Spitze sprechen. Das beendet den hartnäckigen Zweifel an seiner Person zwar auch nicht wirklich, aber verschiebt die Frage immerhin dahin, ob ihm genau das gelingt, er also die Gefolgschaft bekommt, die er verlangt, oder ob er eventuell überzogen hat. Im positiven Fall spricht das Manöver klar für ihn und beglaubigt seinen Anspruch. Die endgültige Bestätigung steht im letzten Akt auf dem Weg zur Kanzlerwerdung zwar noch aus, aber die ist bei einer definitiven Bundestagsmehrheit der Koalitionäre ja bloße Formsache.
6. Eine vergeigte Kanzlerwahl als krönender Abschluss
Oder doch nicht. So was gab es noch nie in der Geschichte der Kanzlerwahlen in der Bundesrepublik: 18 Abgeordnete aus den Reihen der schwarz-roten Koalition verweigern Merz in der geheimen Abstimmung die Gefolgschaft und lassen seine Ermächtigung zum Regierungschef der Nation im ersten Anlauf scheitern. Dass ein paar Figuren in den Reihen der Koalition seine gerade zum Ausweis von Führungsstärke aufgebaute Kompromiss- und Rücksichtslosigkeit dann doch nicht einfach hinnehmen, verkehrt den angestrebten Beweis sofort ins Negative: Die verweigerte Gefolgschaft haftet Merz damit als Makel an; das Verhalten der Abweichler, das manche egoistisch oder staatspolitisch unverantwortlich finden, spricht letztlich gegen ihn, weil es seine Führungsschwäche offenbart. Dass das Grundgesetz für solch einen – also doch irgendwie im Bereich des Möglichen liegenden – Fall Regelungen getroffen hat, hilft Merz zur Relativierung der Blamage von solch „historisch einmaligem“ Ausmaß ebenso wenig wie die Erinnerung daran, dass es bei früheren Kanzlerwahlen auch schon Abweichler, sogar schon mal zahlenmäßig mehr, gegeben hat: Bei allen anderen hat es unterm Strich halt geklappt. Er ist und bleibt derjenige, der im feierlichen Wahlakt vor der ersten, entscheidenden Qualität versagt hat, auf die es bei einem demokratischen Führer ankommt: Er muss sich erfolgreich durchsetzen, denn in der Demokratie verbürgt der Erfolg im Wahlprozess die Eignung der Person, die Durchsetzung, dass Person und Macht zusammengehören. Nach dieser Herrschaftslogik ist der neue Kanzler bereits angezählt, bevor er überhaupt im Amt ankommt.
Das Einzige, was diesen Misserfolg relativieren kann, ist ein Erfolg. Den braucht es möglichst schnell, damit das Versagen des designierten Mannes an der Spitze sich gar nicht erst so richtig entfalten und festsetzen kann. Entsprechend bemüht sich die Fraktion darum, einen zweiten Wahlgang noch am selben Tag in die Wege zu leiten, wozu es der Kooperation der politischen Konkurrenz bedarf. Die Grünen bekennen sich ein weiteres Mal zu ihrer staatspolitischen Verantwortung, also dazu, dass ihnen eine stabile Herrschaft in Deutschland wichtiger ist als das Ausnutzen der Schwäche des Kanzlerkandidaten. Und die Linke wittert in ihrer Zustimmung die Chance, auch von der Union in den Kreis der anerkannt staatstragenden Parteien aufgenommen zu werden. Die Union legt hingegen Wert darauf, dass ihre Umgehung des Unvereinbarkeitsbeschlusses mit den Linken so gerade nicht zu verstehen sei, sondern eben nur „in der jetzigen Situation“ und künftig, wenn man Zweidrittelmehrheiten braucht, „richtig“ ist. Ist der nächste Wahlgang angesetzt, braucht es nur noch die garantierte Gefolgschaft der Koalition selbst. Da ist es an den Fraktionsführern, ihrer Kernaufgabe nachzukommen und „die Reihen zu schließen“, ihrer Mannschaft bei deren freier Gewissensentscheidung also gehörig ins Gewissen zu reden und sie auf Linie zu bringen.
Im zweiten Anlauf klappt’s dann endlich. Friedrich Merz ist Bundeskanzler.