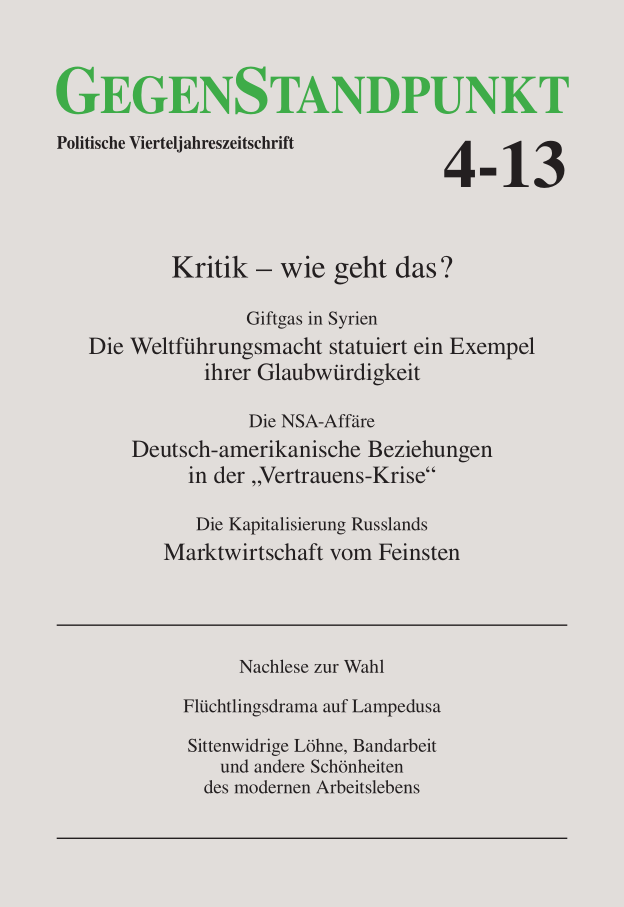Kritik – wie geht das?
Zur hochgeschätzten demokratischen Kultur gehört es, dass da Bürger laufend nicht nur privat, sondern auch öffentlich Kritik üben, unablässig eine bessere Welt vermissen und fordern. Die stellt sich deshalb aber nicht ein, was zur Folge hat, dass ein ansehnliches Standardrepertoire von Beschwerden fortlebt. Das heißt leider nicht, dass die Beschwerde führenden Bürger beherrschen, wie Kritik geht. Ihnen unterlaufen immerzu die gleichen Fehler, durch die sie nicht nur das zunächst einmal theoretische Gewerbe des Kritisierens verpfuschen. Mit ihrem falsch gestrickten Einspruchswesen bilden sie den Willen aus, der sie zum perfekten Mitmacher qualifiziert – bei allem, was ihnen so missfällt. Und mindestens zur selbe Blüte gelangt wie die Pflege kritischen Räsonierens sind im übrigen gewisse Standards der Zurückweisung von Kritik – bis hin zum Verbot...
Aus der Zeitschrift
Artikel anhören
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- 1. Vom Motiv der Kritik und seinen Konsequenzen
- 2. Der Irrweg moralischer Kritik
- 3. Von einer Veranstaltung namens „konstruktive Kritik“
- 4. Die Kunst der Antikritik
- Die Zurückweisung „persönlicher“ Kritik
- Die Entschärfung politischer Kritik durch das Toleranz-An-Gebot
- Die Standards des antikritischen Dialogs, den die Demokratie sich schuldig ist
- Die Blamage jeglicher Kritik am Maßstab der „Realität“
- Das letzte Argument freiheitlicher Antikritik: Die „Gewaltfrage“
- 5. Das falsche Versprechen kritischer Wissenschaft
Kritik – wie geht das?
In einem freien Land wird Kritik nicht gefürchtet und schon gar nicht unterbunden. An freie Bürger, selbst an die vorwitzige Jugend ergeht sogar der Rat, kritisch zu sein. Und dieser Rat wird auch befolgt, so dass lauter „selbstbewusste“ Persönlichkeiten herumlaufen, die ihr „kritisches Bewusstsein“ demonstrieren und eine garantiert „eigene“ Meinung haben, wenn sie Gott und die Welt begutachten.
In einem freien Land ist Kritik kein Privileg. Man braucht nicht zu den politisch und ökonomisch Mächtigen zu zählen, um seinen Zeitgenossen ihre Fehler vorhalten zu dürfen. Die kleinen Leute halten sich keineswegs zurück und werden nicht müde, auch der Elite ihre Defekte anzukreiden. Alle Stände werden mit ihren Beschwerden ausgiebig in den Medien der Demokratie zitiert, ja von professionellen Kritikern zu allerlei Einwänden ermuntert, auf die sie selbst womöglich gar nicht gekommen wären.
In einem freien Land findet Kritik immer und überall statt. Aufgeklärte Bürger verlangen unablässig eine bessere Welt. Die stellt sich deshalb aber nicht ein, was zur Folge hat, dass sich ein ansehnliches Standardrepertoire von Beschwerden wiederholt und über Generationen fortlebt. Aber auch zur Zersetzung von Staat und Gesellschaft führt der Volkssport des Kritisierens nicht. Gegen diesbezügliche Befürchtungen, die in früheren Zeiten manchem Fürsten und anderen Obrigkeiten als Leitfaden ihrer Gesetzgebung dienten, warten Anhänger des modernen Umgangs mit der Unzufriedenheit mit einem merkwürdigen Argument auf: Die Freiheit der Kritik lohne sich für das Gemeinwesen, trage zu seiner Stabilität sogar bei, wirke schließlich auf eine allseitige Veränderung zum Guten hin.
Merkwürdig an solcher Aufklärung ist das einigermaßen idyllische Bild, das sie vom öffentlichen Meinungsaustausch zeichnet. Dessen Lob legt schließlich nahe, dass Kritik allemal Gehör findet und darüber hinaus beherzigt wird, zur Zufriedenheit derer, die sich ins Beschwerdebuch eingetragen haben. Dabei schreibt die Belehrung über den Segen kritischer Umtriebe dem Räsonieren selbst ganz nebenbei und wie selbstverständlich eine Qualität zu, die ihm gar nicht so unbedingt zukommt. Kritik hat in dieser Vorstellung den Charakter eines Verbesserungsvorschlags; eine begründete Ablehnung der Sache, die mit Einwänden bedacht wird, eine „pauschale“ Verurteilung der beurteilten Werke, die Anstoß erregen, wird offenbar nicht in Betracht gezogen.
In einem freien Land ist Kritik zwar nicht verboten, aber deswegen noch lange nicht immer und überall willkommen. Einerseits behalten sich alle Bürger vor, die Angriffe auf Sachen, die ihnen lieb und teuer sind, daraufhin zu überprüfen, ob sie Beachtung und Rücksicht verdienen. So ist die Kunst der Zurückweisung von Kritik zur selben Blüte gelangt wie deren Pflege. Andererseits sind Staatsorganen und Volksvertretern, Rundfunkanstalten und Verlagsleitungen auch gewisse Sorten von Kritik bekannt, die „aus dem Rahmen“ fallen und zu ächten sind. In solchen Fällen bildet das Verbot die passende Konsequenz der Zurückweisung; es taugt darüber hinaus, einmal beschlossen, als Grund für die Ablehnung und zu ihrem Ersatz.
*
Die demokratische Kultur, die in einem freien Land herrscht, lebt davon, dass da Bürger aktiv werden, die sich sicher darin sind, wie Kritik zu gehen hat. Sowohl diejenigen, die ewig Kritik üben, als auch die, welche in der einen oder anderen Art die Zulässigkeit der vielfältigen Anklagen prüfen, präsentieren sich als Kenner und Könner dieses Handwerks. Das heißt leider nicht, dass sie es beherrschen und wissen, wie Kritik geht. Bei seiner Ausübung unterlaufen nämlich den mündigen Bürgern immerzu die gleichen Fehler, durch die sie nicht nur das zunächst einmal theoretische Gewerbe des Kritisierens verpfuschen. Mit ihrem falsch gestrickten Einspruchs- und Beschwerdewesen bilden sie an sich den Willen aus, der sie zum perfekten Mitmacher qualifiziert – bei allem, was ihnen so missfällt.
1. Vom Motiv der Kritik und seinen Konsequenzen
Zum Kritisieren schicken sich Leute an, wo und wann immer sie unzufrieden sind. Also in stolzen „Zivilgesellschaften“ genauso wie in totalitären Völkergefängnissen. Unabhängig von öffentlich-rechtlichen Genehmigungsfragen und kein bisschen heimgesucht von Zweifeln an der Freiheit ihres Willens melden approbierte Lumpen wie sittliche Autoritäten an, was ihnen nicht passt. Denn alle verfügen über die Gabe des praktischen Gefühls, das in sämtlichen großen und kleinen Belangen des Lebens zwischen angenehmen und unangenehmen Erfahrungen zu unterscheiden pflegt. Die theoretische Leistung der Kritik bringt das praktische Gefühl „zur Sprache“; sie belässt es nicht bei der Kundgabe des Eindrucks, dass einem etwas missfällt oder Schwierigkeiten bereitet. Kritik führt den Vergleich durch, den das praktische Gefühl unmittelbar mit dem Befund entscheidet, dass die Umwelt den eigenen Vorstellungen einfach nicht entspricht. Sie formuliert die Unangemessenheit zwischen Bedürfnissen und den Gegenständen ihrer Befriedigung, den Gegensatz zwischen Erwartungen und dem, was die Umstände dafür hergeben; sie zeigt, wie Interessen durch die Taten anderer Leute verletzt werden. Mit dieser Bemühung legt sie es nicht darauf an zu beweisen, dass das werte Ich wieder einmal zu kurz kommt. Das Subjekt der Kritik geht ganz selbstverständlich davon aus, mit seinem freien Willen die Lizenz zum Genuss wie zur Gestaltung der Welt zu haben – darin besteht schließlich der Ertrag ihrer „Aneignung“ durch das Denken. Es lässt sich nicht über seinen höchstpersönlichen Geschmack aus, sondern über das Objekt seiner Begierden und Interessen. Von dem behauptet der Kritiker, dass und inwiefern es nichts taugt. Er legt der Sache, mit der er sich befasst, einen Defekt zur Last – welcher verantwortlich dafür ist, dass sie für die beanspruchten Dienste nicht so recht zu gebrauchen ist oder Schaden anrichtet.
Über die Natur der Umstände und Mächte, die seine Anliegen vereiteln, sollte der Kritiker deswegen auch Bescheid wissen. Denn wer sich nicht darauf beschränken will, seine Unzufriedenheit zu Protokoll zu geben; wem daran liegt, nicht nur zum Ausdruck zu bringen, dass er an diversen Widrigkeiten leidet und sich über seine Lebensumstände ärgert; wer den Mangel, den er verspürt, nicht nur beklagen will, sondern darauf zurückführt, dass an den Bedingungen und Zwängen seines strebenden Bemühens und Schaffens etwas nicht in Ordnung ist; wer sich also Kritik erlaubt, damit auch seinen Willen bekundet, einiges, nämlich was ihm eben unangenehm zu schaffen macht, zu ändern: der bedarf solider Kenntnisse. Wissen um die objektiven Einschränkungen, welche die eigenen Bedürfnisse und Ziele zuschanden werden lassen, ist schon nötig, wenn es darum geht, dem Sein ein Sollen entgegenzuschmettern – um es einmal mit den großen Philosophen auszudrücken. Ohne richtige Urteile über die „Sachen“, die Missfallen erregen und Schäden verursachen, sitzt Kritik nicht. Das macht sie für viele Menschen ziemlich schwer.
Die Erinnerung an derlei Banalitäten ist deswegen nicht überflüssig, weil in den Gesellschaften, in denen Meinungsfreiheit herrscht, eine Kultur des kritischen Getues eingerissen ist, das ganz ohne den Versuch auskommt, ein Urteil über die Quelle der Ärgernisse zu fällen. Legionen von jungen Leuten, auch Frauen und Prominente wie Statisten von Talkshows beherrschen die Kunst, Einwände gegen andere Leute und Instanzen zu erheben und ihre Sätze mit „Ich finde...“ und äquivalenten Formeln zu bestreiten. Ob es sich um eine Schallplatte, einen Politiker oder eine Veranstaltung handelt: Stets erfolgt die Ablehnung einer Sache unter energischem Hinweis auf die werte Persönlichkeit, deren Geschmack und Anspruch nicht Genüge getan wird. Die Redeweise, bei der nach Belieben mit der Bescheidenheit des unzufriedenen Subjekts kokettiert wird – nach dem Motto: ’s ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung ... –, verzichtet zwar großzügig auf die Verbindlichkeit des Urteils. Aber von der Mitteilung, dass sie jedenfalls von dem Zeug nichts halten, wollen solch kritische Geister nicht lassen. Dass ihnen etwas nicht entspricht, bekräftigen sie als die andere entscheidende Botschaft, indem sie ihre Ablehnung gleich zur Eigenschaft der nicht beurteilten, auf jeden Fall aber verurteilten Sache erklären. Die „finden“ sie eben „echt bescheuert, blöd, ätzend, uncool, unerträglich“ – kritikabel eben. Und wie zur Abwehr und Erledigung der fälligen Frage „inwiefern? warum?“ ergänzen sie das Arsenal der modischen Sprachdenkmäler um die Klarstellung „irgendwie“! So steht der Gestus der Kritik in voller Blüte, obwohl die Beteiligten nur verlauten lassen, dass die Welt ihrem Geschmack und ihrem Bedarf auf keinen Fall gewachsen ist.
Die Unart, die Form des Urteils zu bemühen und dann doch nur kundzutun, was das praktische Gefühl entschieden ablehnt, beschränkt sich leider nicht auf die berüchtigten Geschmacksfragen. Auf diesem Feld findet eine bisweilen nervende Betätigung der Eitelkeit statt, die man lieber nicht so ernst nehmen sollte – Kulturvölker jedenfalls, die sonst zu jeder Schandtat bereit sind, warnen sich selber in ihrer eisernen Ration von Redensarten davor, de gustibus, o vkusach und des couleurs zu streiten. Das hindert ihre gewitzten Vereinsangehörigen aber nicht daran, die Schablone des Geschmacks„urteils“ auch auf Abteilungen des Lebens anzuwenden, denen mehr Gewicht zukommt: Den Beweis ihrer kritischen Einstellung zur politischen Herrschaft liefern aufgeklärte Bürger locker ab, indem sie ihre gelegentlich gefragte Wählergunst nur einem Kandidaten für die Regierungsmacht zukommen lassen, den sie sympathisch finden. Auf diese Weise rechnen sie auch schonungslos mit den sozialen Verhältnissen ab und bedenken das marktwirtschaftliche Gefüge von Arm und Reich, Arbeit und Regie des großen Geldes mit schlechten Noten. Da ist manchem der ärmste Mann zu reich, auch die Manager-Gehälter kommen ihm ein bisschen zu hoch vor... Das Unbehagen, das erwachsene Menschen anlässlich von Meinungsumfragen gerne zum Vortrag bringen, ist von vorneherein über den Verdacht erhaben, dass unzufriedene Zeitgenossen Veränderungen anstreben und diesen ihren Willen begründen – sie sagen halt, was ihnen unangenehm aufstößt.
Auf dieses Muster der gelegentlichen Missbilligung von Taten und Umständen, die sich den eigenen Vorstellungen nach nicht gehören, beschränken sich kritische Bürger nicht mehr, sobald ihnen etwas daran liegt, dass ihr Einspruch Zustimmung hervorruft. Wenn um die Anerkennung des geäußerten Tadels geworben wird, um Mitstreiter zu gewinnen; wenn die mit Vorwürfen bedachten Leute oder Instanzen dazu bewegt werden sollen, sich zu bessern, dann bleibt es nicht bei der Beschwerde über Dinge, die man nicht leiden kann. Das Bedürfnis zu überzeugen wirkt sich auf die Art und Weise aus, in der unzufriedene Leute zum Ausdruck bringen, dass ihren Bedürfnissen und Vorstellungen in der Welt, wie sie geht und steht, nicht entsprochen wird. Um zu erreichen, dass andere die eigene Unzufriedenheit teilen, ist eine Verabschiedung vom Kult des „ich finde“ fällig, durch den sich gestandene Individuen ebenso angeberisch wie bescheiden als urteilskräftige Persönlichkeiten präsentieren, die nie und nimmer alles hinnehmen. Wer auch nur ein bisschen „missionieren“ will, wenn er über andere Zeitgenossen oder „die Gesellschaft“ herzieht, wenn er seine „eigene Meinung“ über Bauern und Minister, Markt und Kirche, das Schrifttum und den Gesetzgeber kundtut, kommt um eine Begründung seiner Einwände nicht herum.
Leider heißt das nicht, dass der Versuch, für die eigene Unzufriedenheit „Propaganda“ zu machen, schlicht und allemal darauf hinausläuft, sich und den anderen die objektiven Ursachen des erfahrenen Ungemachs klarzumachen, damit klar ist, wogegen sich da einer wendet, was er mit Hilfe seiner Adressaten wie abstellen will. Vielmehr hat sich in der großen Gemeinde der Unzufriedenen ein anderer Trend durchgesetzt. Um zu überzeugen, bemüht sich Jung und Alt um den Beweis, zur vorgebrachten Beschwerde befugt zu sein. Entweder durch eine mehr oder weniger aufdringliche Art der Selbstdarstellung, die dem Kritiker das Recht erteilt, in Aktion zu treten. Oder durch die Präsentation eines Maßstabs, der den Einwänden zugrunde liegt und deren Wortführer von dem Verdacht befreit, nur aus Egoismus, aus bloßer Laune heraus und wegen seiner partikularen Neigungen zu protestieren.
2. Der Irrweg moralischer Kritik
Betroffenheit als Argument
Die erste Variante hat – den Bürgerbewegungen und den fetzigen Talkshows sei Dank – das Sprachdenkmal der Betroffenheit geschaffen. Bei ihrem Bemühen um Gehör verzichten nämlich kritikbereite Bürger manchmal sogar auf die ausführliche Schilderung ihrer Drangsale, welche die Berechtigung ihrer Einwände verbürgen soll; sie verkürzen das Verfahren, dem sie vertrauen, indem sie als „Betroffene“ vorstellig werden und „im Namen aller Betroffenen“ reden. Gnadenlos traktieren sie ihre Umgebung mit der Versicherung, dass sie „betroffen“ sind, weil sie offenbar meinen, damit die Lizenz zur Kritik erworben zu haben. Ganz als ob jemand, der sein Los zu beklagen weiß, auch schon eine Ahnung davon hat, was faul ist im Staate Dänemark und anderswo! Die Sache, die den Anlass zur Aufregung bildet, wird benannt und allein dadurch zum Übel erklärt, dass von ihr ein Schaden für die Beschwerdeführer ausgeht oder zu erwarten ist. Insofern zitiert der Kult der Betroffenheit den Ausgangspunkt von Kritik, ihr Motiv – und spart sich ihre Durchführung. An unschuldige wie beschuldigte Adressaten ergeht dabei der Appell, sich gefälligst in Mitgefühl zu üben, die Leiden von bekennenden Opfern nachzuvollziehen, sich in deren Lage zu versetzen und aus solchem Verständnis heraus dieselben Missstände und Verfehlungen auszumachen und zu bekämpfen, welche die Opfer beklagen.
Unter denen finden sich etliche, die auf die Überzeugungskraft des Verfahrens nicht vertrauen; die daran zweifeln, dass sie die Zustimmung anderer nur abzurufen brauchen, indem sie die eigene Lage beschwören. Dazu gehört auch nicht viel: Man braucht ja nur zu bemerken, dass andere Interessen und Neigungen, eine andere Stellung in der Gesellschaft zu einer anderen Sortierung der Lebensbedingungen in brauchbare und störende Momente führen. Mit dieser sehr genügsamen Art, einiges Ungenügen zu verspüren, wenn ein Ich allein mit sich argumentiert, ist eine entscheidende Einsicht jedenfalls nicht verbunden. Die nämlich, dass es sich nicht verträgt, kritisch sein zu wollen und sich eine Befassung mit dem Objekt zu ersparen, das an allem schuld ist.
Entsprechend bescheiden fällt auch die „Nachbesserung“ aus, die schon immer zum Standard kritischer Umtriebe gehört. Vor dem modernen Glaubwürdigkeitsbeweis, bei dem sich Kritiker ausgiebig auf ihre Rolle als Opfer berufen, war, und neben den Betroffenheitsphrasen ist ein Konkurrenzmodell des kritischen Räsonierens in Umlauf. Seine Nutzer bedienen sich zunächst auch der Leistung des praktischen Gefühls und demonstrieren, an welch schädlichen Wirkungen von neuen Gesetzen, alten Umgehungsstraßen, Veränderungen im Berufsleben wie im Fernsehprogramm sie laborieren. Alsdann unterstreichen sie, dass der Schaden, der ihnen zugefügt wird, dem Rest der Welt einfach nicht gleichgültig sein kann. Und zwar so, dass sie die Besonderheit ihrer Lebenslage wie ihrer Interessen ausdrücklich herausstellen. Sie klagen mit der Betonung ihrer gesellschaftlichen Funktion die Zustimmung zu ihrer Kritik ein; die „Betroffenheit“, die auch sie vermelden, erhält ihre eigentliche Bedeutung durch die Qualifikation, mit der da jemand zum Protest antritt. Sooft einer als Verbraucher oder Krankenpfleger, als Facharbeiter oder Mittelständler, als Arbeitsloser oder Künstler... das Wort ergreift, verleiht er seiner Beanstandung extra Gewicht; Rücksicht verdient seine Mängelrüge vor allem im Blick darauf, wer da spricht, welcher soziale Charakter sich äußert!
Dieser Versuch, den viele für lohnend halten, ist offenbar darauf gerichtet, das Odium der privaten Nörgelei loszuwerden, das launischen Persönchen anhängt, wenn ihnen wieder einmal was gegen den Strich geht. Wenn Leute ihre Beschwerde durch die einschlägigen Angaben zur Person bekräftigen, heischen sie unter mehreren Aspekten um Respekt: Die einen legen mehr Wert darauf, nicht als meinende Einzelgänger, sondern als Angehörige einer ganzen Gruppe wahrgenommen zu werden; andere verbinden mit ihrer Qualifikation, ob sie nun aus den unteren oder höheren Regionen der sozialen Hierarchien stammen, das Recht auf Anerkennung, das sich ihr Stand durch allgemein bekannte, nützliche Dienste erworben hat; und manche spielen gleich auf die Anerkennung an, die das Gelichter von ihrem Schlag sowieso genießt. So hocken sie dann in den Talkshows beieinander, die Pflegefälle, Nutznießer und Experten der Marktwirtschaft, und hauen sich ihre Argumente um die Ohren. Die haben erstaunlich wenig mit dem Thema des Treffens zu tun, mit den berühmten „Inhalten“, dafür umso mehr mit dem wechselseitigen Vorwurf, die andere Partei würde sich in den Sorgen, Nöten und Betroffenheiten der eigenen Gattung nicht auskennen.
Wenn mit Freiheit ausgestattete Bürger auf diese Weise bemüht sind, ihre Unzufriedenheit in Kritik umzusetzen, betonen sie nicht so sehr, dass ihre Interessen übergangen werden. Vielmehr heben sie hervor, dass in ihrem Schaden eine Verletzung eines berechtigten Interesses stattfindet. Sie haben sich den Prinzipien der Moral verschrieben, wenn sie aus den Mitteilungen über Qualität und Grad ihrer Betroffenheit mehr als eine Schadensmeldung, eine Anklage eben verfertigen; und zwar nach dem Muster „ich als Student, Frau, Patient, Lehrer, alleinerziehender Unternehmer ...“, durch das sie sich als anerkanntes Mitglied von Staat & Gesellschaft, als dienst- und brauchbare Geister vorführen. Aus ihren Drangsalen werden damit Vergehen an hochanständigen Leuten, die notorisch ihre Pflicht und Schuldigkeit tun; auch die Zugehörigkeit zu einer Standes- oder Berufsgruppe („wir mittelständischen Unternehmer“, „wir Haus- und Kassenärzte“), die allemal die Vertretung eines partikularen Interesses ansagt, steht dafür, dass da ein unverzichtbares bis ehrenwertes Gewerbe das Zeug zum Dienst am Gemeinwohl hat, und sei es nur als schlichter Wirtschaftsfaktor. Wenn Leute als Wähler und Steuerzahler, gar als Bürger, Frau oder Volk antreten, um vom Sozialschmarotzer über Behörden bis zu Führungskräften in höchsten Kreisen alles zu tadeln, was sich bewegt, besteht von vornherein kein Zweifel: Es melden sich rechtschaffene Zeitgenossen zu Wort, denen wieder einmal nichts Gutes widerfahren ist und die dafür einen Grund ermittelt haben wollen, der einen objektiven Missstand darstellt, der von allgemeinem Interesse ist. In dem Schaden oder Nachteil, der sie betroffen macht, liegt für sie eine Art Vertragsbruch vor, begangen an ihnen in ihrer Eigenschaft als respektablen Figuren, denen der Lohn für ihre Mühen, ihre untadelige Gesinnung, ihr Können und ihren guten Willen versagt wird.
Die Ideale des Gemeinwesens als Maßstab der Kritik
Die zweite Variante geht einen Schritt weiter in der Relativierung des Interesses, mit dem der unzufriedene Zeitgenosse unterwegs ist und dessen Missachtung ihn dazu bringt, nach objektiven – außerhalb seiner eigenen Zuständigkeit und Leistung liegenden – Gründen dafür zu suchen, dass er nicht auf seine Kosten kommt. Der moderne Bürger, der sich zum Anklagen entschließt, bemerkt durchaus, dass der beredten Selbstdarstellung als Opfer auch dann noch der Ruch schlichter Interessenvertretung anhaftet, wenn das „als“ unmissverständlich die Bereitschaft des Kritikers signalisiert, die ihm zugefallene Rolle in der Hierarchie des Gemeinwesens, in der gesellschaftlichen „Arbeitsteilung“ auszufüllen. Also ermittelt er eine Ursache, einen objektiven Missstand, dessen Verurteilung auch unabhängig von einer privaten Betroffenheit geboten ist und sich allemal der Bestätigung seitens der Adressaten sicher sein kann, die in den Genuss der kritischen Botschaft kommen.
An den Verurteilungen, die sich die Welt von Demokratie und Marktwirtschaft mit ihren aufregenden Unterabteilungen Kultur und Umwelt, Arm und Reich, Jung und Alt etc. so einhandelt, fällt eines sofort auf: Es wimmelt nur so von negativen Urteilen! An den Leistungen von Stars wie Statisten der Zivilgesellschaft monieren professionelle Kritiker wie Amateure unentwegt die Verletzung von Maßstäben, an deren Einhaltung nicht nur ihnen viel liegt – dieses Interesse setzen sie auch umstandslos bei ihrem Publikum voraus. Aus den unterschiedlichsten Anlässen ergeben sich mit Hilfe solcher allseits anerkannter Maßstäbe die Befunde darüber, wo der Grund für eigene und fremde Nöte liegt:
– Un-gerechtigkeiten tragen sich an allen Ecken und Enden des gesellschaftlichen Lebens zu. Wohin das kritische Auge auch blickt – ob in die gesetzgebende Versammlung, wo das Recht gemacht wird, ob in den Gerichtssaal, wo es gesprochen wird, ob in die Niederungen der Tariflöhne oder in die höheren Sphären der Bankiersgehälter ... –, entdeckt es Verstöße gegen das Prinzip Gerechtigkeit. Ob dieses Prinzip wirklich den Leitfaden für das bürgerliche Treiben abgibt, ob auch nur eine der missbilligten Taten einer Absage an dieses Prinzip zu verdanken ist, spielt bei diesem Tadel der realen Geschehnisse keine Rolle.
– Un-sozial ist tagtäglich der Umgang mit den minder Bemittelten, die das Land wie den Erdkreis bevölkern. Leute, denen das erfahrene und beobachtete Elend ein bisschen aufs Gemüt schlägt, wissen eine Ursache für den Mangel: Regierungen, Behörden, Geschäftsleute lassen es an tätiger Rücksicht gegenüber den armen Menschen fehlen, womit sie glatt eine Abmachung brechen, auf deren Einhaltung die Kritiker bestehen.
– Bisweilen artet eine solche Pflichtvergessenheit in un-christliches Benehmen oder – säkularisiert – in verfassungs-widrige, also un-demokratische Maßnahmen aus, was kritische Geister im demokratisch wie von einer verdienstreichen Glaubenstradition geprägten Abendland einfach nicht durchgehen lassen. So erlauben sie sich, die zuständigen Instanzen mutig an deren eigene Grundsätze zu erinnern, denen auch sonst niemand seine Zustimmung verweigert.
Der ausgiebige Gebrauch von Maßstäben, deren Geltung einerseits keinem Zweifel unterliegt, die andererseits flächendeckend missachtet werden, beschert der Kunst des Kritisierens einen wenig begrüßenswerten Fortschritt. Mit Hilfe dieses Handwerkszeugs gerät die Abkehr von der Betroffenheitsmasche nämlich zu deren Fortsetzung mit anderen Mitteln: Die Anwälte der Normen und Werte ersetzen die partikularen Varianten des „als“, mit denen die verschiedenen sozialen Charaktere auf die Unzulässigkeit ihrer Schädigung aufmerksam machen, durch ein „als“ der höheren Ordnung. Sie sind verletzt und unzufrieden, weil und insofern sie sich der Vertretung jener hehren Güter verschrieben haben. Ihre Kritik präsentieren sie als garantiert keimfreies Begehr, das über eigennützige Berechnung hinaus ist, wodurch sie ganz nebenbei für alle Kritik, die aus ihrer Herkunft aus einem Interesse gewöhnlicher Art kein Hehl macht, eine Zulassungsbedingung in die Welt setzen. Das hat Schule gemacht, was man an der verbreiteten Sitte der Heuchelei studieren kann: Ohne Berufung auf ein konsensgestähltes Allgemeingut, das die eigenen Interessen deckt, mag sich kein Individuum und schon gleich gar kein Verein mehr für die eigene Sache gegen andere stark machen!
Was die andere Seite des Fortschritts betrifft: Auch die Befassung mit der Objektivität, in deren Zustand die womöglich abzustellenden Gründe für die subjektiven Nöte liegen, lässt zu wünschen übrig. Die Maßstäbe, die in den Angriffen auf die Zeitgenossen wie auf Institutionen angelegt werden, zeugen ja nicht gerade vom Realismus der Kritiker, die mit ihnen hantieren. Wer sie bemüht, nur um eine Vermisstenanzeige zu formulieren, nimmt den ganzen wohlgegliederten bürgerlichen Laden in Gestalt eines Ideals wahr. Und zwar ausdrücklich und nicht „unbewusst“. Er hat mit den Gesetzen wie mit dem Geld schlechte Erfahrungen gemacht oder auch nur erfahren, dass keineswegs nur „Einzelschicksale“ als menschliche Opfer herumlaufen – und besteht darauf, in seinen Drangsalen eine Missachtung der Grundsätze und Regeln entdeckt zu haben, die er teilt. Das Ideal, mit dessen realer Verletzung er Bekanntschaft macht, taugt in seiner Anrufung eben nicht nur als sinnreiche List, eigene Forderungen mit dem Siegel „nur recht und billig“ zu versehen. Es ist das Bekenntnis zur herrschenden Geschäftsordnung, der attestiert wird, die Interessen ausgerechnet der real zu kurz gekommenen Beschwerdeführer im Programm zu haben. Der Idealismus der ewig eingeklagten Maßstäbe erspart seinen zahlreichen Liebhabern die Suche nach Gründen für die Beschränkungen, die sie unzufrieden stimmen und zur Kritik anstacheln – er beendigt diese Suche mit einem „pauschalen Vor-Urteil“, das kritische Anstrengungen des Verstandes in eine prinzipielle Einverständniserklärung verwandelt. Mit dem Entschluss, die eigene Sache – und mag sie noch so gründlich unter die Räder kommen – als eigentlich vereinbar anzusehen mit den längst etablierten Regeln des demokratisch-marktwirtschaftlichen Verkehrs, wird aus jedem Einwand ein Dokument der Anpassung.
3. Von einer Veranstaltung namens „konstruktive Kritik“
Diese Manier der Abrechnung, die höchste und heilige Rechtsgüter beschwört, an denen sich die Kritisierten zum Leidwesen ihrer Kritiker versündigen, behält in der demokratischen Streitkultur sicher ihren festen Platz. Jedenfalls solange wir in einer Wertegemeinschaft leben, wofür sich nicht nur hochgestellte Persönlichkeiten in ihren bedeutenden Reden verbürgen; auch Lehrer des Glaubens sehen das so, und die Soziologie – eine Wissenschaft – hat herausgefunden, dass gerade komplexe Gesellschaften ohne Orientierung an Werten nicht funktionieren. Allerdings ist der Rückgriff auf den Kanon der großen Prinzipien nicht für jeden Anlass das Geeignete.
Kritische Tauglichkeitsprüfung der Lebenswelt
Denn außer in einer Wertegemeinschaft leben die unzufriedenen Leute auch noch in einem Staat, der sein Gewaltmonopol gebraucht, seine Regierungsmacht betätigt, Gesetze erlässt und auf ihre Einhaltung achtet; sie leben auch in einer freien Marktwirtschaft, in der „Konkurrenz herrscht“, die sich um das Geld dreht. Sie bewegen sich im Straßenverkehr, sind Anhänger von Sportvereinen und pflegen ein Familienleben oder dessen Alternativen – kurz: Die meisten Ereignisse, die ihnen zu schaffen machen, die meisten (Un-)Taten, an denen sie Anstoß nehmen, verdanken sich einfach nicht so fundamentalen Entscheidungen wie: für oder wider Gott, „den“ Menschen, Freiheit oder Unterdrückung etc. Sie entspringen schlicht den interessierten Berechnungen, wie sie mehr oder minder bedeutsame Zeitgenossen anstellen, wenn sie ihres Amtes walten, ihren Vorteil suchen, sich mit den Zwängen ihrer Lebenslage herumschlagen. Diesen Berechnungen, als „gute Gründe“ anerkannt oder auch nicht, fallen der Geldbeutel und sonstige Bestandteile der Lebensqualität zum Opfer, die geschädigte Mitmenschen als ihren Besitzstand reklamieren.
Unzufriedenheit entsteht also aus sehr profanen und geläufigen Interessengegensätzen; und denen widmen sich die kritischen Anstrengungen auch, ohne sie dem endgültigen Verfall der Werte zu subsumieren. Abgesehen von ein paar Ausnahmen, die bei jedem umgefallenen Verkehrszeichen die Menschenrechtskommission mobilisieren möchten, reservieren aufgeklärte Menschen den Einsatz der großen moralischen Keulen als Maßstab der Kritik für Affären, die allgemein – von Zuständigen wie Betroffenen – und von vornherein als „prinzipielle Weichenstellungen“ angesagt sind: Wenn Entscheidungen anstehen, die das Maß gewährter Freiheiten neu festlegen, den Grad zulässigen Reichtums und erträglicher Armut abklären, das Verhältnis von Recht und Gewalt, daheim wie auswärts, abwägen und gewichten... – dann ist der kritische Kultus der Werte in voller Blüte. In der Auseinandersetzung mit den Ärgernissen des gewöhnlichen politischen und wirtschaftlichen Lebens, in der Bewältigung des Regierens und Regiertwerdens, der Ergebnisse eines Konkurrenzkampfes, der im big business wie im Berufsleben der Massen seine Auslese vollstreckt – bei der Begutachtung der alltäglichen Drangsale verläuft das Kritisieren eher in sachlichen Bahnen. Da wird nicht die Einlösung wuchtiger Maximen eingeklagt, sondern die Leistung von gesellschaftlichen Instanzen und Rechtspersonen beurteilt; nach Berufen wie sozialer Stellung unterschiedene Mitmenschen werden einer Überprüfung unterzogen und als Verursacher von Schäden beschuldigt, die den Kritiker erbosen. So befasst sich ein Großteil der volkstümlichen Kritik mit den Verfehlungen höchster wie niederer Amtsträger, großer Beliebtheit erfreut sich die Schelte von Geschäftsleuten – vom Konzernmanager und Bankboss bis zum Handwerker –, und umgekehrt stehen die armen Leute als Objekt der Kritik ebenso hoch im Kurs: Manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die „sozial Schwachen“ viel mehr herausnehmen als sämtliche Versager unserer „Eliten“ zusammen...
Das kritische Bemühen wendet sich also eifrig den vielfältigen Gegensätzen im Rahmen der realen Geschäftsordnung zu, in denen ebenso vielfältige Interessen eingeschränkt oder übergangen werden, und zwar ohne die Anrufung der großen Titel, an deren Beherzigung es die anderen fehlen lassen; stattdessen mit dem Anspruch, in Kenntnis „der Materie“ nichts als das von der Sache selbst Gebotene einzufordern. Denn das ist in den Beschwerden über fremdes Fehlverhalten – über Behörden, die ihren Auftrag verfehlen, über Geschäfts- und andere Partner, die mit dem Ärger, den sie machen, gegen ihr wohlverstandenes Eigeninteresse verstoßen, und anderes von der Art – allemal enthalten: ein Urteil über die Sachlage, deren objektiven Erfordernissen und einbeschriebenen Zwecken allenthalben, nämlich überall da, wo es dem Kritiker einmal darauf angekommen wäre, so wenig entsprochen wird. Der will mit seinen Anklagen ausdrücklich keinen sachfremden Maßstab an die Realität anlegen und kein bloßes Ideal geltend machen, sondern allein auf der Vernunft bestehen, die er in den gesellschaftlichen Einrichtungen und herrschenden Verhältnissen entdeckt haben will und oft auch eindringlich darzulegen weiß. Der Form und dem Anspruch nach verfährt eine solche Kritik immanent: Sie argumentiert mit dem Begriff der Sache, ergreift Partei für deren Funktionieren und legt dementsprechend den Schaden, der aus der einschlägigen Praxis erwächst, einer unzureichenden Verwirklichung ihrer wahren eigenen Zweckbestimmung, einer fahrlässigen oder gar absichtlichen Versündigung dagegen zur Last.
Ganz immanent ist dieser weit verbreiteten Übung immanenter Kritik allerdings vorzuwerfen, dass sie die Einlösung ihres Anspruchs, den Begriff der so unzureichend bis zweckwidrig praktizierten Angelegenheit, regelmäßig schuldig bleibt. Die Praxis der Ämter, die Art der Durchsetzung herrschender oder allgemein anerkannter Interessen: alles Mögliche wird missbilligt, bevor das Urteil über die geltenden Interessen, über Grund und Zweck der kritisierten Institution usw. fertig ist; oft genug unterbleibt überhaupt jede Bemühung, sich und anderen jenseits der beklagten Umgangsweisen gewisser Personen mit „den Gegebenheiten“ diese selbst zu erklären. Argumentiert wird nicht mit dem Begriff, sondern im Namen der geltenden Geschäftsordnung und geltend gemachten Interessen: mit einem Vor-Urteil über deren prinzipiell schätzenswerte Funktion. Ihre Zielrichtung wird implizit unterschrieben oder ausdrücklich geteilt; doch diese Parteinahme folgt gar nicht aus einem begründeten Urteil über die jeweilige Angelegenheit, sondern begründet umgekehrt den kritischen Blick – weniger auf sie als auf den praktischen Umgang mit ihr, der ihren schlichtweg vorausgesetzten guten Sinn und Zweck verdorben haben soll. Die Logik immanenter Kritik, die der Beschwerdeführer für sich in Anspruch nimmt und oftmals in aller Form befolgt, wird durch den Inhalt der Beschwerde nicht eingelöst, sondern auf den Kopf gestellt.
Eine solche falsche Immanenz wird häufig schon
an der reichlichen Verwendung des Gegensatzpaars
eigentlich
und in Wirklichkeit aber
kenntlich. Mit ihm verschafft sich der Kritiker die
sprachliche Lizenz dafür, allem, was ihm oder überhaupt
Ärger macht, einen positiven, allgemein verträglichen
Zweck als dessen „eigentliche“ Bedeutung zu unterstellen
und der „Wirklichkeit“ ihre tatsächlichen Wirkungen
pauschal als Verfehlung des „eigentlich“ Angesagten
anzukreiden: Mit Entlassungen verstößt ein Arbeitgeber
gegen seinen eigentlichen Beruf, die Schule mit
Schulversagern gegen ihren wahren Auftrag, der
Pflegedienst mit seiner „Minutenpflege“ gegen die Absicht
des Gesetzgebers... Das Muster des theoretischen Urteils
ist immer dasselbe und universell anwendbar, auf jeden
Gegenstand: Gut gemeint, schlecht gemacht!
– in
Ordnung, wenigstens halbwegs, wäre die Welt, ginge nur
alles mit rechten Dingen zu
. Zustimmung und Ablehnung
sind so in ein und demselben Urteil verstaut:
Ablehnung des vermeintlich unsachgemäßen
Gebrauchs, der zweckwidrigen Handhabung aller hier und
heute
vorhandenen Mittel für die Realisierung eines
waltenden Zwecks, der selber alle Zustimmung
verdient.
Das materialistische Ideal gesellschaftlicher Harmonie
Der Abschied vom Moralismus ist mit der Übung lebenskluger Unterscheidungen zwischen der „wirklichen“ Realität und ihrem „eigentlichen“ Sinn und Zweck also leider nicht beschlossen. Die Vorstellung von einer einzulösenden Harmonie der Interessen, von einer Verpflichtung, der nachzukommen man Gott und die Welt aufzufordern das Recht hat, wird lediglich in kleinerer Münze in Umlauf gebracht. Die Beurteilung der Umtriebe, die den Kritikern zu schaffen machen, erfolgt unter Zuhilfenahme eines Maßstabs, der den Charakter eines materialistischen Ideals aufweist.
Dieses widersprüchliche Instrument, dessen Name so gelehrt und kompliziert klingen mag, findet sich im Werkzeugkasten aller volkstümlichen Kritiker, ob sie nun in Bierzelten Wahlkampf machen, Zeitungen schreiben oder am Stammtisch schimpfen. Es eignet sich zur Verfertigung negativer Urteile über Finanzminister, Unternehmer, Arbeitslose und Ausländer. Der eine baut die Staatsverschuldung nicht ab, der andere schafft keine bzw. vernichtet Arbeitsplätze, die wiederum lassen es an gutem Willen und billigem Arbeitseinsatz fehlen und jene passen sich nicht an. An solchen alltäglichen Mustern der entschiedenen Missbilligung, der die unterschiedlichsten sozialen Charaktere ausgeliefert sind, wird der gar nicht komplizierte Bau des Handwerkszeugs kenntlich: Den Leistungen aller möglichen Instanzen und Figuren wird der Charakter eines Dienstes – am eigenen Interesse, versteht sich – beigelegt, dessen Erfüllung man vermisst. Der Inhalt des Ideals, das zu den vielen negativen Befunden über amtliche, berufliche und private Großtaten führt, besteht darin, dass die Kritiker allen Umtrieben erst einmal eines zugutehalten: Es geht um die Erfüllung nützlicher Aufgaben; und was da zu tun ist, gehört gescheit erledigt. So stehen Gott und die Welt dauernd in Gefahr, dabei erwischt zu werden, dass sie ihre Sache nicht gut machen.
Wie weit es mit diesem Schema des Kritisierens schon gekommen ist, macht ein weiteres Sprachdenkmal deutlich: Nicht nur Friseure, auch Politiker und Generäle, Immobilienspekulanten und Prostituierte müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, bei der Verrichtung ihres Tagewerks „nicht professionell“ zu verfahren. Immerhin stellt dieser moderne Ertrag des herrschenden Moralismus klar, dass er die sachliche Befassung mit störenden und schädlichen Anlässen nur vortäuscht: Von vornherein und sehr pauschal wird jeder landesüblichen „Profession“ ein Dienst am Wohlergehen der Gesellschaft im Allgemeinen, des enttäuschten Kritikers im Besonderen unterstellt und zugutegehalten, auch wenn so manchem Job die Natur einer Dienstleistung an den Interessen der kritischen Gemeinde partout nicht anzumerken ist und auch nicht nachgewiesen wird. Das Vorurteil, wo es Ärger gibt, hätte einer nicht sein, also auch nicht unser Bestes getan, braucht zwischen wirklichen und erfundenen Zwecken nicht zu unterscheiden.
Seine folgerichtige Fortsetzung findet es in konstruktiven Anträgen, mit denen sämtliche Professionen und Institutionen bedacht werden. Schulmeister und Architekten, Polizisten und Verkäuferinnen werden von ihren Kritikern über ihre wahren Pflichten und deren sachgerechte Wahrnehmung belehrt; Unternehmensabläufe und Verkehrsregeln werden nicht bloß für hoffnungslos unpraktisch befunden, sondern mit den Mitteln kritischer Phantasie immer praktikabler gemacht, theoretisch. Die praktische Produktivkraft kritischer Besserwisserei haben findige Manager im Übrigen auch schon entdeckt: In Beschwerdebüchern für enttäuschte Kunden, in Kummerkästen für frustrierte „Mitarbeiter“, auch in nicht bestellten Äußerungen einer konstruktiv nörgelnden „Schwarmintelligenz“ findet sich immer wieder ein nützlicher Hinweis, wie dem wirklichen Interesse der jeweiligen „Sache“ besser zu dienen wäre. Dem Urheber verwendbarer Ideen winkt gegebenenfalls eine Prämie, weil er sonst meist gar nichts davon hat: Dessen Interesse ist bestenfalls deckungsgleich mit den wirklichen Erfordernissen des Betriebs, bei dem er Verbesserungsvorschläge einreicht. Unrealistische, gerade auch die verstiegensten Besserwissereien zeugen erst recht von dem nimmermüden guten Willen kritischer Gemüter, ihre unbefriedigten Interessen durch konstruktive Einmischung in die problematische „Materie“ voranzubringen. Wo alles, was stört, als Verfehlung gegen das eigentlich herrschende Prinzip gesellschaftlicher Harmonie gedeutet wird, da ist Kritik eben gleichbedeutend mit einem entschiedenen Auftrag an die Welt, sie hätte gefälligst besser zu gelingen. Noch jeder betrübliche Anlass ist da für eine konstruktive Auseinandersetzung gut und verdient einen geharnischten Verbesserungsvorschlag.
Das geschädigte Interesse: Ein Ordnungsfall
Wo Kritik so geübt wird, da geschieht das in der sicheren Gewissheit, damit nichts Unbilliges zu tun. Verlangt wird ja nichts anderes, als dass die gesellschaftlichen Realitäten ihrem wahren Wesen entsprechen sollen. Fürs eigene – immer wieder zu kurz gekommene, immer wieder frustrierte – Interesse wird nicht mehr in Anspruch genommen, als was die herrschenden Zustände und geltenden Imperative versprechen; also mindestens, dass die gegebenen Lebensumstände, wenn man sie schon aushalten muss, dann auch aushaltbar sein müssen; und das ist oft genug auch schon alles. Das eigene Interesse ist in dem Fall zurückgenommen auf den Willen, mit „den Verhältnissen“ zurechtzukommen. Messlatte der Kritik ist die doppeldeutige Kategorie „Bedingung“: Was als Bedingung im Sinne einer festen Voraussetzung fürs eigene Überleben praktisch gültig ist, das hätte deswegen auch als Bedingung im Sinne eines handhabbaren Lebensmittels zu taugen.
So viel Bescheidenheit hat natürlich ihre Kehrseite: Eine Kritik, die nichts anderes in Anschlag bringt als die Vernunft, die den gesellschaftlichen Dingen letztlich innewohnen muss, will sich damit unanfechtbar machen. Wem zu systemeigenen Notlagen nur „Misswirtschaft“, zu staatspolizeilicher Kontrolle nur „Missbrauch“ und als Argument nichts Besseres als die in Mitleidenschaft gezogene Ordnung des Gemeinwesens einfällt; wer überhaupt nicht bloß implizit, sondern ausdrücklich für die Verhältnisse Partei ergreift, unter deren Vollzug er als unzufriedener Mensch leidet, und in deren Namen an seiner Lage Kritik übt: der weiß sich als Kritiker so unbedingt im Recht, dass er sich, je nachdem, auch schon mal was traut. Umstände, die zu solcher Unzufriedenheit Anlass geben, verdienen nicht bloß wohlmeinende Verbesserungsvorschläge; die sind ein Skandal, und Forderungen nach Abhilfe verdienen Respekt und Gehör. Da schlägt Bescheidenheit nicht selten um in ein Auftrumpfen dessen, der es besser weiß.
Ausgerechnet damit wird dem eigenen verletzten Interesse freilich ein neuer und gar nicht anspruchsvoller Stellenwert zugeschrieben. Der Kritiker meint, die allgemeine Bedeutung seiner besonderen Drangsale und damit einen unabweisbaren guten Grund für deren Behebung dargelegt zu haben. Die Allgemeinheit und Bedeutung seines „Falls“, die er geltend macht, hat jedoch nichts mit dem allgemeinen Begriff seiner Lage, i.e. mit den wesentlichen Bestimmungen der allgemein herrschenden Lebensverhältnisse zu tun, unter die er subsumiert ist und deren immanente Notwendigkeiten ihn zu einem „Fall“ machen. Vielmehr übernimmt er, so gut er es versteht, die Optik dieser Verhältnisse, den Blick „von oben herab“ auf ihn als „Fall“. In der guten Meinung, „der Allgemeinheit“ könne doch unmöglich an einem Konflikt mit ihm und seinen ehrbaren Anliegen gelegen sein, entnimmt er dem Konflikt, in dem er sich mit den herrschenden Verhältnissen befindet, nicht, was der über diese Verhältnisse und seinen Stellenwert darin aussagt; er nimmt ihn als Beispiel für ein allgemeines Funktions-und Harmonieproblem der Gesellschaft, nimmt also deren Standpunkt ein, so als wäre der die wahre allgemeine Fassung seines eigenen geschädigten Interesses.
In einer Gesellschaft, die zu jedem systemeigenen
Interessenkonflikt einen institutionalisierten
Konfliktregelungsmechanismus parat hat, bedarf es für
diesen Fortschritt in der Kunst des Kritisierens keiner
großen Anstrengung: Wer seinen Lohn zu niedrig findet,
hat im Betriebsrat die Adresse, die ihn über die
Einstufung seiner Arbeitsplatzes belehrt, womit der
Beschwerde ihr angemessener Gesichtspunkt und Stellenwert
zugewiesen ist; wer von Amts wegen schikaniert wird, kann
sich von einer Beschwerdestelle den Bescheid abholen,
inwieweit seine Behandlung dem behördlichen Regelwerk
entspricht, wo er sich also seinen Ärger hinzustecken
hat; Talkshows bieten reichlich Gelegenheit, einen Anlass
zur Unzufriedenheit als Mängelrüge an verantwortlichen
Instanzen vorzutragen und mit Experten von der
„Gegenseite“ „Lösungsmöglichkeiten“ zu diskutieren. Was
auf solche Art zur Gewohnheit wird, ist eben dieser
entscheidende Übergang in der Methodik falscher Kritik:
hin zur falschen Verallgemeinerung der unbefriedigenden
eigenen Lebenslage, nämlich zu ihrer Subsumtion
unter das, was allgemein gilt und womit generell
über Interessen entschieden ist, so als wäre das
die Wahrheit über die kritisierte Sache. Den Standpunkt
des Streits, in dem er sich mit den herrschenden
„Gegebenheiten“ befindet, hat der Kritiker
ideell ausgetauscht gegen die Perspektive genau
der „Allgemeinheit“, mit der er nicht klarkommt, und
damit praktisch aufgegeben. In der Meinung,
darin läge die wahre und eigentliche Bedeutung seiner
unbefriedigenden Lebenslage, begibt er sich gedanklich
und willentlich in die Position des Objekts
allgemeiner, im Sinne der gesellschaftlichen
Gesamtordnung zu treffender Verfügungen – und hat damit
in ganz anderer Weise recht, als er meint: In seiner
Vorstellung schwingt der Kritiker sich zum Manager seiner
Existenznöte auf, der begriffen hat, worauf es ankommt;
tatsächlich hat er, ganz ohne sie zu begreifen, die
Funktion anerkannt, die ihm und seinesgleichen
in der Welt, wie sie ist, zukommt. Die Probleme, die
er mit anderen, gewichtigeren Interessen und
maßgeblichen Zwecken, mit Institutionen und gegebenen
Machtverhältnissen hat, verwandelt er so, ganz
selbstbewusst und dem eigenen Selbstbewusstsein nach
durchaus anspruchsvoll, in Probleme, die die
gesellschaftliche Ordnung, wie er sie sich
denkt, mit „Fällen“ wie dem seinen hat; in ein Problem
also, das er und seinesgleichen mit ihrem Schaden und
ihrer Unzufriedenheit darstellen. Am Ende
verlangen dann gewerkschaftliche Arbeitervertreter einen
„Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit“, weil ihre
Klientel sonst wieder einem Hitler nachlaufen würde; und
mit der Beschwerde über fehlende Kindertagesstätten, die
die Frauen in den Gebärstreik treiben, so dass die
nationale Alterspyramide vollends entartet, übersetzen
die Anwälte alleinerziehender Akademikerinnen deren
Stress in Maximen
, die sich – um den Ahnvater der
Kritik der praktischen Vernunft
auch mal zu Wort
kommen zu lassen – ganz prima als Prinzip einer
allgemeinen Gesetzgebung
eignen würden.
Der konsequente Fortgang zur „politisierten“ Kritik
Mit dem Standpunkt konsequent konstruktiver Parteinahme für eine gesellschaftliche Ordnung, der rundherum gutes Gelingen zu wünschen ist, bringt sich der Kritiker ideell „auf Augenhöhe“ mit den wirklichen Inhabern gesellschaftlicher Macht, die ihrerseits ihre Befugnisse gerne als Wahrnehmung einer Verantwortung für das gesellschaftliche „große Ganze“, fürs Gelingen des Gemeinwesens und für sein Wohl interpretieren. Die Höhe dieses Standpunkts hat einige Folgen.
So beschränkt sich der kritische Blick auf die Welt nicht länger auf die Lebensbedingungen, die dem Kritiker zu schaffen machen. Sein Leiden am Weltlauf emanzipiert sich von jeder materiellen Betroffenheit; die vorgestellte Verantwortung für eine intakte gesellschaftliche Verkehrsordnung stößt überall auf Geisterfahrer und Missstände, die Missbilligung verdienen; die Welt erscheint als Sammlung von Beispielen gemeinschaftsschädlichen Verhaltens und folgenreichen Versagens sowie von Ausnahmen, die die traurige Regel bestätigen. Wer so auf die Welt blickt, braucht gar keine eigenen schlechten Erfahrungen und verletzten Interessen mehr, um als Beschwerdeführer aktiv zu werden: Sein Standpunkt wird selber zur Quelle größter und tiefster Unzufriedenheit, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nach Belieben ihre Ärgernisse findet.
Wem solche Unzufriedenheit in erster Instanz gilt, steht damit auch schon fest: Es sind „die Leute“, denen die gesellschaftliche Ordnung gilt. Die verstoßen immerzu gegen die Regeln, an die sie sich zum allgemeinen Besten zu halten hätten, „denken nur an sich“, kümmern sich „um nichts“, schon gar nicht ums allgemeine Wohl, stattdessen „bloß ums Geld“, was in dem Zusammenhang kein Zeichen eines intakten Erwerbssinns und schon gar nicht die sachzwanghafte Folge der herrschenden Marktwirtschaft ist, sondern ein Motiv aus dem Reich der niederen Beweggründe, die auch in der besten Weltordnung immer wieder für Misshelligkeiten sorgen. Mit der Diagnose ist bereits vorgezeichnet, wen die Kritik am Weltgeschehen sich in zweiter und höherer Instanz vorknöpft: die Institutionen und zuständigen Verwalter der öffentlichen Ordnung, die es an einem hinreichend effektiven Regime über „die Gesellschaft“ so offensichtlich fehlen lassen. Zuerst und oftmals auch schon zuletzt kommt das Personal schlecht weg, das anerkanntermaßen – an dessen herrschaftlicher Zuständigkeit wird ja keineswegs gezweifelt! – über das Weltgeschehen Regie führt: Inkompetenz, Fahrlässigkeit, Korruption und dergleichen mehr erklären dem Kritiker, der sich gerne mal ein paar Frechheiten gegen die Mächtigen traut, so ziemlich alle Übel von der Klimakatastrophe bis zur Finanzkrise und von der Ausländerfeindschaft bis zur Säuglingssterblichkeit; ganze Kriege sind nur „ausgebrochen“, weil die Inhaber des politischen Oberbefehls ihre Feindseligkeiten nicht ausbruchssicher verwahrt haben. In der Kunst der politisierten Kritik haben aber auch Diagnosen über problematische Strukturen ihren Platz: Vorgestellte oder wirkliche Ordnungsprinzipien und Herrschaftsinstitutionen werden an dem anspruchsvollen Ideal gemessen, sie müssten gegen die Gefahr von Missbrauch und Fehlverhalten immun sein und ihr eigenes Gelingen garantieren, und werden für unzureichend befunden; gerade angesichts der Fehlbarkeit des Menschen, auch im höchsten Staatsamt, müssten z.B. Institutionen und Mechanismen zur „Konfliktprävention“ den Verkehr der höchsten Gewalten miteinander so regulieren, dass sie ihre feindlichen Ziele auch ohne Gewaltanwendung erreichen, versagen in der Realität aber nur allzu oft. Zu jeder solchen Fehlanzeige findet sich nicht bloß ein Verbesserungsvorschlag, sondern auch ein Experte, der Wirtschaftskrisen durch eine Finanztransaktionssteuer oder Arbeitslosigkeit durch Lohnsenkung verhindern will und auf jeden Fall den Verdacht, die Übel dieser Welt wären mit gutem Willen und verbesserten Regeln zu beheben, unbestreitbar ins Recht setzt.
Gar nicht selten freilich zielt die Kritik an den
verantwortlichen Instanzen schnurstracks und umstandslos
auf deren Pflicht, die Bürgerschaft zur Ordnung zu rufen.
Gegen notorische Übeltäter braucht es wirksamere
Abschreckung; gegen den allgemeinen allmählichen
Sittenverfall ist es immer wieder einmal nötig, dass
ein Ruck durch die Gesellschaft geht
; auch
international sind Missstände bisweilen nur mit
Strafexpeditionen und einer Portion Shock & Awe
zu
beheben. Leute, die sich an kritischer Einstellung nicht
übertreffen lassen, aber nicht wissen, wie Kritik geht,
dafür umso besser, wie sie zu gehen hat, landen
folgerichtig beim Ruf nach der Herrschaft und
nicht selten ausdrücklich bei dem Antrag auf Maßnahmen
aus dem weit gefächerten Repertoire „erzieherischer“
Gewalt – gegen ihresgleichen!
4. Die Kunst der Antikritik
In einem freien Land ist es jedermanns Recht zu kritisieren, was ihm missfällt; und von diesem Recht wird in weitestem Umfang Gebrauch gemacht. Dass der frei geäußerten Kritik nach reiflicher Prüfung Rechnung getragen oder dass sie sachlich widerlegt wird, ist freilich eher selten der Fall. Unwidersprochen bleibt sie auf alle Fälle nicht, im Gegenteil: Dem ehrenwerten gesellschaftlichen Brauch, nichts unkritisiert zu lassen, entspricht vollumfänglich die Übung, Beschwerden zurückzuweisen.
Besser als die Kritik ist die Antikritik in aller Regel nicht.
Die Zurückweisung „persönlicher“ Kritik
Niemand muss Kritik an sich, an seinen Leistungen, an Personen oder Sachen, die er so, wie sie sind, mag oder in Ordnung findet, also an seinem Urteilsvermögen auf sich sitzen lassen. Wer auf sich hält, und wer tut das nicht, setzt sich zur Wehr; und zwar – unter zivilisierten Menschen – mit dem Vortrag guter Gründe für den eigenen Standpunkt und die eigene Sicht der Dinge.
Die betreffen allerdings in den seltensten Fällen
wirklich die Dinge, um deren Beurteilung es geht. Ihr
Vortrag ist von dem Bedürfnis getragen, die abgelehnte
eigene Auffassung zu rechtfertigen; und genau das drücken
die geltend gemachten guten Gründe in der Regel auch aus:
die Berechtigung des kritisierten Verhaltens
bzw. des angegriffenen Standpunkts. Wer sich z.B. anhören
muss, er läge mit seinen Vorlieben und Einschätzungen
ziemlich daneben, greift gerne zu dem Hinweis, dass er
damit überhaupt nicht allein steht, sogar anerkannte
Autoritäten auf seiner Seite hat, sich mit seiner Meinung
also keineswegs blamiert. Dem Vorwurf, den
wahren und eigentlichen gemeinnützigen Aufgaben des
eigenen Jobs nicht gerecht zu werden, wird durchaus schon
mal die Wahrheit entgegengehalten, dass man seine Arbeit
unter dem Zwang des Geldverdienens verrichtet und nicht
mit der Freiheit, einen Beitrag zur allgemeinen Wohlfahrt
zu leisten; doch gemeint ist damit nicht eine Kritik an
den Zwängen der Konkurrenz, die auf deren Grund zielt,
sondern ein mildernder Umstand, eine Entschuldigung vor
dem Kriterium harmonischen Zusammenwirkens in einer
arbeitsteiligen Gesellschaft, das der Kritisierte mit
seinem Kritiker teilt und neben der Erinnerung an die
Diktatur des Geldes als letztlich verbindliche Messlatte
gelten lässt. Meist wird aber erst gar kein Fehlverhalten
zugegeben und entschuldigt, sondern die eigene Kompetenz
beteuert – man versieht seinen Job schließlich schon
lange zur allgemeinen Zufriedenheit – und die des
Kritikers bestritten; ein Recht auf Vorwürfe steht der
Gegenseite nämlich schon deswegen nicht zu, weil die
selber schon mal was falsch gemacht hat. Damit erübrigt
sich jede Aussage zur Streitsache selbst. Die Rüge
ungehörigen Benehmens wird nach dem gleichen Muster
abgeschmettert: Die Sitten, auf deren Einhaltung der
Kritiker besteht, sind überhaupt nicht auf der Höhe der
Zeit; und wer zweifelsfrei anzuerkennende moralische
Werte vermisst, sitzt im Glashaus und wird von niederen
Beweggründen getrieben, was aus sachlich und zeitlich
beliebig weit entfernten Episoden seiner Lebensführung
hervorgeht, mit denen er sich jede Befugnis zum
Richteramt des Kritikers verscherzt hat. Der hat’s
grad nötig!
ist eine der Floskeln, die den Auftakt zu
einer entsprechenden Abrechnung bilden und explizit
ankündigen, dass die Replik sich mit der Angelegenheit,
auf die die Kritik sich bezieht, erst gar nicht befasst.
In allen ihren Varianten dokumentiert die Kunst der Zurückweisung „persönlicher“ Kritik, dass es um Legitimation geht und dass die nicht bloß gut ohne Sachlichkeit auskommt, sondern gerade darin besteht, von der in Frage stehenden Sache wegzugehen und Gesichtspunkte ins Feld zu führen, die auf die eigene Einstellung in Bezug auf was auch immer ein günstiges Licht werfen oder gleich auch noch ein ganz schlechtes auf die Urteilsfähigkeit und die wahren Absichten des Kritikers. Sie bewegt sich damit auf derselben Ebene wie die Kritik, die freie Persönlichkeiten an ihresgleichen zu üben pflegen. Die zielt selber weniger auf die Korrektur von Fehlern als auf die Blamage des Kritisierten an irgendwelchen Maßstäben dessen, was sich moralisch oder unter Gesichtspunkten der erwünschten gesellschaftlichen Brauchbarkeit „eigentlich“ gehört. Und diese Unsitte verkehrter Kritik wird im herrschaftsfreien Dialog unter modernen Menschen vom Kritisierten weder ihrerseits kritisiert noch in eine sachliche Verständigung über den Begriff der strittigen Sache überführt, sondern übernommen: Man verwahrt sich gegen einen Angriff auf die eigene Ehre, besteht auf der Anerkennung der eigenen Person einschließlich einer „eigenen Meinung“, die man sich nie und nimmer von anderen „vorschreiben“ lässt – offenbar erfüllt ein kritischer Meinungsaustausch in einer freien Gesellschaft den Tatbestand eines Machtkampfes; und daraus gehen zwei Dinge hervor. Erstens, dass es den Beteiligten in ihren Stellungnahmen um die Geltung ihres immerzu von irgendwem bestrittenen Interesses geht. Und zweitens, dass ihnen ihre Urteile nur so viel wert sind wie das Recht, das sie für ihren Interessenstandpunkt meinen ins Feld führen zu dürfen: Ihr letztes Argument ist ihr unveräußerliches Menschenrecht, ein Interesse und die dazu passende Meinung überhaupt zu haben. Richtig in Schwung kommt die zwischenmenschliche Kommunikation dann mit einem Entlastungs- oder einem Gegenangriff, der die Zulässigkeit, ja Überlegenheit des eigenen Standpunkts mit der Ausgrenzung der Position des Kritikers aus dem Reich des sittlich Vernünftigen und zeitgemäß Gebotenen, am Ende mit der Diskreditierung der Person selber begründet. Und nirgends lässt die Antikritik eine Differenz zu den Techniken einer Kritik erkennen, die das Verhalten anderer Menschen direkt oder unter dem Schein der Sachlichkeit auf geltende Normen und Werte bezieht und den Vorwurf erhebt, es genüge denen nicht. Moralische Rechtspositionen streiten da miteinander – und die „Gewalt“, die auch da vonnöten ist, um zwischen gleichen Rechten zu entscheiden, besteht in der publikumswirksamen Autorität einer der beiden Parteien oder in der Autorität des Publikums. Jedenfalls solange es noch zivilisiert zugeht.
Die Entschärfung politischer Kritik durch das Toleranz-An-Gebot
Wo diese Gepflogenheit, kritische Auseinandersetzungen als zivilisierten Konkurrenzkampf ums „letzte Wort“, ums Recht-Behalten zu führen, ihren Ursprung und dauerhaft wirkenden Grund hat, das wird deutlich, wenn gewichtigere Mitglieder der freiheitlichen Diskursgemeinschaft sich zur Zurückweisung von Kritik veranlasst sehen, und speziell wenn die politisch Verantwortlichen, die in letzter Instanz für nicht unterbundenes Fehlverhalten – der Bürger, ihrer Beamten, am Ende ihr eigenes – haftbar gemacht werden, in die Debatte eingreifen. Da gehört sich nämlich als Erstes die Versicherung, dass Kritik erlaubt ist und auch und gerade von den Inhabern eines Zipfels gesellschaftlicher Ordnungsmacht grundsätzlich hingenommen werden muss. In der Sache ist damit klargestellt, dass sich unbefangenes Kritisieren auch in einem freien Land durchaus nicht von selbst versteht; dass man als Machthaber auch anders könnte und tatsächlich Verzicht übt, wenn man die Äußerung von Unzufriedenheit nicht unterbindet. Die Freiheit des Kritisierens stellt eben, wie jede politische Freiheit, eine Konzession dar, die ein Verhältnis von hoheitlicher Gewalt und bürgerlicher Unterordnung voraussetzt und nicht etwa aufhebt, sondern mit einem bürgerfreundlichen Zusatz versieht; hier eben mit dem, dass es keinem gesetzestreuen Bürger verwehrt ist, ein ganz eigenes Interesse zu haben und eine eigene Ansicht darüber und über dessen Behinderung in Worte zu fassen. Dieser Zusatz will wichtiger genommen sein als das Gewaltverhältnis selbst, dem er hinzugefügt wird. Und so wird die gewährte Freiheit in der Regel auch verstanden. Die Bereitschaft der Verantwortlichen, Einwände gegen ihr Tun und Lassen auszuhalten statt mundtot zu machen, wird von mündigen, jederzeit zum Kritisieren aufgelegten Bürgern honoriert, nämlich als Entgegenkommen geschätzt, auch und gerade dann, wenn der geäußerten Kritik selber überhaupt nicht entsprochen wird und das darin geäußerte Interesse weiterhin nichts zählt. Dass eine abweichende Meinung geduldet wird, ist anscheinend den Inhabern dieser Meinung selber wichtiger als deren Inhalt. Wo an einem kritischen Urteil das Recht, es zu äußern, das Entscheidende ist, kommt es eben auf das Urteil selber nicht mehr so sehr an.
Natürlich hat auch diese Freiheit ihren Preis. Toleranz von Seiten der etablierten Macht ist mit der Gegenforderung verbunden, es mit fremden Meinungen, auch mit dem Standpunkt derer, die das Sagen haben, genauso zu halten, also Toleranz gegenüber der Obrigkeit zu üben und dabei die Kleinigkeit zu übersehen, dass mit dem allgemein geltenden Duldsamkeitsgebot den Bürgern etwas ganz anderes abverlangt ist als den Repräsentanten der Staatsmacht. Wofür die hohen Verantwortungsträger „Duldung“ verlangen, ist schließlich keine unverbindliche Meinung, sondern ihr rechtsverbindliches politisches Handeln; was sie im Gegenzug tolerieren, ist ein kritisches Meinen, das darauf verzichtet, den Verantwortlichen ins Handwerk zu pfuschen. „Getauscht“ wird unter dem Titel wechselseitiger Toleranz die an keinerlei Bedingung geknüpfte Anerkennung der Freiheit der Machthaber, ihre Gewalt zu gebrauchen, gegen die ebenso pauschale Anerkennung auch negativer Urteile darüber als bloße Ansichtssache ohne praktische Konsequenzen; jedenfalls ohne andere als diejenigen, die die Zuständigen für angesagt halten. Oder andersherum: Die Lizenz, sich auf alles, auch auf die Praxis staatlicher Gewalt einen eigenen Vers zu machen, unterstellt beim Lizenznehmer die Bereitschaft, eben diese Praxis zu akzeptieren, das eigene negative Urteil mit dem Vorbehalt zu versehen, dass man es den Kritisierten zur gefälligen Beachtung unterbreitet, und sich insoweit praktisch mit der Irrelevanz des in der Kritik geltend gemachten eigenen Interesses abzufinden.
In der Demokratie, einer „lebendigen“ zumal, hat es mit diesem freiheitlichen Tauschgeschäft jedoch keineswegs sein Bewenden.
Die Standards des antikritischen Dialogs, den die Demokratie sich schuldig ist
In einem freien Land finden sich alle, die ein Stück Verfügungsmacht über andere innehaben, verpflichtet, ihr Treiben gut zu begründen. Beständig genötigt werden sie dazu durch eine Institution namens Öffentlichkeit, hergestellt durch Medien, die teils als privates Geschäft, zum Teil gleich von der politischen Macht selber betrieben werden, mittlerweile angereichert durch einen ununterbrochenen Strom kritischer Meinungsäußerungen im Internet. Diese Institution, von ihren professionellen Betreibern gelegentlich als „4. Gewalt“ im demokratischen Rechtsstaat gepriesen, verlangt allen, die im Land etwas zu bestimmen haben, permanent eine Rechtfertigung ihrer Entscheidungen ab. Kritik bleibt da keine Privatsache, sondern findet statt als Dauerveranstaltung fürs gesamte Volk. Ebenso beständig wird in dieser Sphäre den Verantwortungsträgern aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Raum und Gelegenheit gegeben, ihrerseits Kritik zu üben – an ihresgleichen, am weniger verantwortungsbeladenen Volk, an Gott und der Welt überhaupt – sowie auf Kritik an ihrem Treiben zu antworten. Hier findet er statt: der nichtendenwollende demokratische Dialog zwischen Regierung und Opposition, zwischen „politischer Klasse“ und Volk, zwischen Wirtschaft und Publikum, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Macht und Geist. Und vor allem eben: zwischen Kritik am Treiben der Mächtigen und einer demokratischen Antikritik, die ebenso wie die Kunst des Kritisierens ihre Standards entwickelt hat.
Die Techniken der Legitimation kritisierter
Standpunkte kommen hier in reifer Form zur Anwendung;
dafür haben die Profis des demokratischen
Meinungsaustauschs Argumentationsmuster erarbeitet, die
vom breiten Publikum gerne für seine Belange aufgegriffen
werden. Nicht nur in Talkshows zur Perfektion gebracht
hat man da z.B. die Manier, kritische Vorwürfe dadurch
ins Leere laufen zu lassen, dass man ganz andere als die
erhobenen, am besten gleich eigenhändig zum Zwecke
nachdrücklichster Zurückweisung konstruierte Einwände
abschmettert. Ganz hoch im Kurs steht jedoch die
Entkräftung gegnerischer Meinungen durch öffentlich
gemachte Zweifel an der moralischen oder sachlichen
Berechtigung des Kritikers, sie geltend zu machen. Auch
wenn der sich für seine Einwände gar nicht auf eine
persönliche Betroffenheit durch die kritisierte Affäre
beruft, gilt die Entdeckung, dass er selber gar nicht zu
den unmittelbar Betroffenen zählt, als stichhaltiger
Gegeneinwand; die ortsfremde Aussprache offenbart bereits
die Ungültigkeit eines so ausgesprochenen Protests; und
wer kein Deutscher ist, sollte in deutschen
Angelegenheiten überhaupt den Mund halten. Andersherum
funktioniert es ebenso: Wer als
Repräsentant eines
ehrenwerten Standes spricht oder auch bloß einer
besonderen Bevölkerungsgruppe zuzuordnen ist, verrät
damit gegebenenfalls schon seine Parteilichkeit für ein
bloß partikulares, also unbeachtliches Interesse. Erst
recht sprechen Einwände gegen die moralische Integrität
einer Person gegen jede kritische Meinung, die sie
äußert: Schon der allemal leicht glaubhaft zu machende
Verdacht, kritischen Argumenten läge irgendeine
eigennützige Berechnung zugrunde, nimmt denen viel von
ihrer Überzeugungskraft; und der Vorwurf, jemand hätte
sich mal mit einer kriminellen oder gar staatsfeindlichen
Gruppierung eingelassen, disqualifiziert mit der Person
deren Einwände gegen was auch immer. In politischen
Kontroversen, wie sie in Wahlkämpfen aufleben, tut
Polemik gegen die subjektive Glaubwürdigkeit eines
Kritikers weit bessere Dienste als jede Prüfung der
Stichhaltigkeit seiner Argumente und beansprucht
dementsprechend eine ganze Abteilung in der Sphäre der
öffentlichen Meinungsbildung. Im Übrigen lässt sich schon
dem Vortragen von Kritik als solchem ein Malus anheften:
Der Vorwurf, wer kritisiert, wolle „nur alles schlecht
machen“, bestreitet dem „Miesmacher“ nicht bloß jeden
Grund und Anlass zur Unzufriedenheit, sondern nimmt das
Moment von Negation, das noch jeder Kritik innewohnt,
gleich für deren ganzen Inhalt und diesen für das
Ergebnis einer rein negativen, also bösen Absicht. Diese
Art der Antikritik gehört zum festen Repertoire einer
jeden Regierung in ihrem demokratischen Dialog mit
Oppositionellen: Die „reden schlecht“, worum die Nation
sich ehrlich, aufrecht und aufopferungsvoll bemüht – was
insofern immer stimmt, als die amtierende Herrschaft ihr
Volk ja schließlich per Gesetz zu den erbrachten Diensten
nötigt – mustergültig hier der Verteidigungsminister, der
sich im Namen der Ehre seiner Soldaten Bedenken gegen von
ihm angeordnete Kriegseinsätze verbittet. Wer meckert,
will zersetzen; und dass letzteres sich nicht gehört,
versteht sich auch in einer kritikfreudigen Gesellschaft
von selbst.
Dort taugen auch anerkannte Höchstwerte, bei aller
Beliebtheit für großkalibrige Beschwerden, insgesamt weit
besser dazu, Kritiker in die Schranken zu weisen; und
auch das ist kein Wunder. Die allgemeine Anerkennung so
hoher Berufungstitel belegt ja schon, dass das
Gemeinwesen, in dem sie solche Achtung genießen,
einschließlich der Macht, die darüber Regie führt, im
Prinzip in Ordnung geht. Dessen Sachwalter sind deswegen
auch die ersten Nutznießer dieser Idealisierung ihres
Herrschaftswesens: Das nimmt ja in ihren Verfügungen
reale Gestalt an; niemand sonst kann für sein Tun und
Lassen in Anspruch nehmen, es wäre die praktische
Verwirklichung aller höchsten Imperative. An dem Maßstab
müssen sie sich zwar auch messen lassen. Doch wo immer
man ihnen eine Verfehlung ideeller Normen und Werte
vorwirft, da wird ihnen erstens zugute- gehalten, dass
ihre Herrschaft im Prinzip ein Dienst am Höheren ist; und
deswegen können sie zweitens immer darauf bestehen, dass
sie mit ihrer Praxis allemal noch das Beste herausgeholt
haben aus einer widrigen Wirklichkeit. Wenn Kritiker im
Namen des Wahren, Guten und Schönen ihnen zu frech
werden, dann nehmen regierende Idealisten sich ohne
Weiteres die Freiheit, mit Verweis auf „die Realitäten“
und mit der Forderung, man solle doch bitte sachlich und
auf dem Boden der Tatsachen bleiben, Kritik als bloßen
Idealismus
zurückzuweisen. Nach der Logik der
Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit in dieser
Welt etwas nach Wunsch funktioniert, geben überhaupt alle
Imperative, deren Befolgung unzufriedene Leute in der
realen Welt vermissen und bei den Adressaten ihrer
Beschwerden anmahnen, ebenso gut eine glatte
Rechtfertigung der kritisierten Affären und
Angelegenheiten her: Entlassungen dienen der Rettung von
Arbeitsplätzen; Lohnverzicht sichert den Lebensunterhalt;
das einzige Mittel gegen steigende Mieten sind
Mietsteigerungen, die den Wohnungsbau beleben;
Friedenssicherung braucht gelegentlich Krieg und immerzu
die Bereitschaft dazu... Die Scholastik der Antikritik
hat längst herausgefunden, dass schwarz in Wahrheit weiß
ist und alles von irgendwem für verwerflich Befundene in
Wahrheit sein gutes Gegenteil.
Die Blamage jeglicher Kritik am Maßstab der „Realität“
Vor und neben den Kunstgriffen der Delegitimation und der
wertebewussten Richtigstellung kritischer Einwände gilt
in der Öffentlichkeit freier Länder, die sich auf die
Lizenz zum Kritisch-Sein viel zugutehalten, als
allererster und schlagendster Einwand der Hinweis, dass
es überhaupt nichts bringt und nichts taugt, bloß zu
kritisieren. Geradezu zum bedingten Reflex
verfestigt hat sich die Aufforderung an jeglichen
Kritiker, doch bitte anzugeben, wie er denn die Dinge,
die ihn unzufrieden stimmen, besser zu erledigen gedächte
und was er denn an alternativen Maßnahmen auf Lager
hätte, wenn schon die tatsächlich getroffenen ihm nicht
passen. Noch der letzte meinungsumfragte Passant ist
jederzeit bereit, Leuten, die irgendetwas nicht so gut
oder auch nur so selbstverständlich finden wie er, die
Frage Was wollt ihr denn?
entgegenzuschmettern.
Damit ist auf alle Fälle festgeschrieben, dass nur solche
Kritik Gehör verdient, die für die kritisierte Sache
prinzipiell Partei ergreift, den Standpunkt ihrer
verantwortungsvollen Verwaltung einnimmt, die Welt also
aus dem Blickwinkel des Regimes über sie begutachtet und
allein unter dem Aspekt verbesserungsbedürftig findet.
Dabei ist es im Übrigen völlig gleichgültig, ob mit der
Nachfrage nach Alternativen konstruktive
Verbesserungsvorschläge gefordert oder schon vorgetragene
ignoriert werden: Auf Streit über und Einigung in der
Sache ist sie ohnehin nicht berechnet; eine Antwort ist
weder bezweckt noch wird sie abgewartet. Ausgedrückt wird
vielmehr die Gewissheit, dass es
, was auch immer –
jedenfalls was zu den „herrschenden Verhältnissen“
gehört –, anders als so, wie es ist, nicht zu haben,
Kritik daran also sinnlos ist. Dass das es
, die
kritisierte Angelegenheit, selber abzulehnen sein könnte,
kommt im Horizont demokratischer Antikritik nicht vor,
erfüllt jedenfalls nicht den Tatbestand von Kritik, mit
dem Profis und Amateure des demokratischen Dialogs etwas
anzufangen wissen.
Im Fall jener konstruktiven Kritik, bei der die Forderung nach Verbesserungsvorschlägen für jeden Mist offene Türen einrennt, bleibt es nicht bei der polemischen Gegenfrage nach Alternativen. Da kommt ein Grundbestand an jederzeit verwendbaren antikritischen Argumenten zur Anwendung und bringt den öffentlichen Diskurs in Schwung; vorbildlich und Maßstäbe setzend auch hier wieder der demokratische Parteienstreit:
– Erstens geht das, was wohlgesinnten
Weltverbesserern z.B. für einen anständigeren und
zweckgemäßeren Umgang mit Billiglöhnern und Arbeitslosen,
mit Pflegefällen oder Börsenspekulanten, mit
Hausbesitzern und Asylbewerbern vorschwebt, erst einmal
und überhaupt schon rein rechtlich
nicht.
Politiker, die im Hauptberuf Gesetze machen, also
Interessen, die in ihren Augen zu kurz kommen, ins Recht
setzen und andere rechtlich beschränken, scheuen sich
nicht, gegen Ansprüche, denen sie einfach nicht
nachkommen wollen, die gegebene Rechtslage als Einwand
geltend zu machen; wo Elend zum Himmel schreit, sind
ihnen, zu ihrem tiefsten Bedauern selbstverständlich,
durch Gesetze die Hände gebunden
. Bis zu der
Fiktion völliger Ohnmacht angesichts der Rechtslage
lassen Politiker und diskutierende Öffentlichkeit es
freilich auch nicht kommen. Schließlich wollen die
Verantwortlichen nicht bloß Vollzugsorgane des Rechts
sein, sondern „gestalten“, „die Zukunft“ z.B. und
dergleichen mehr, und zwar im Dienste des Volkes. Das
gibt in der Demokratie ein zweites antikritisches
Argument her:
– Abweichende Meinungen haben keine Mehrheit
, was
schon daraus hervorgeht, dass sie vom Bestehenden, also
demokratisch Gebilligten abweichen. Solange sich
diejenigen, die als regierende Politiker die Mehrheit
haben oder als Schützlinge der Regierungsmacht ein Stück
berechtigte Kommandogewalt besitzen, einem
Änderungsvorschlag nicht anschließen, ist die Kritik, auf
der jener beruht, ersichtlich nicht mehrheitsfähig
und damit als unerheblich, als unberechtigt oder gleich
in beiden Hinsichten disqualifiziert. Damit es dabei
bleibt, verwenden mit Macht und Mehrheit ausgestattete
Politiker und freie Sympathisanten des Status quo als
drittes Argument gerne die Berufung auf den höchsten
aller marktwirtschaftlichen Sachzwänge, das Geld:
– Was noch nicht als Posten im öffentlichen Haushalt oder
einer anderen ehrenwerten Aufwands- und Ertragsrechnung
rangiert, ist damit schon mehr oder weniger seiner
Unfinanzierbarkeit
überführt. Politiker, die
jährlich über eine Budgetziffer mit der Überschrift
„Nettoneuverschuldung“ beschließen, und öffentlich
auftretende Experten, die täglich vom Börsengeschehen und
von volatilen Anleihekursen berichten, schämen sich
nicht, Kritik an der Verteilung von Haushaltsmitteln und
noch so biedere Anträge auf Umschichtung von Geldmitteln
mit der Dummheit abzulehnen, man könne schließlich nicht
mehr ausgeben, als man zuvor eingenommen hat; wer
trotzdem für andere als die tatsächlich – nicht zuletzt
mit Schulden – finanzierten Zwecke Geld locker machen
will, „kann nicht mit Geld umgehen“, wäre also ein
Schadensfall fürs Budget der Volksgemeinschaft.
So erfolgt die Zurückweisung kritischer
Verbesserungsideen stereotyp im Namen von Recht,
Demokratie und Marktwirtschaft – also genau jener
Verhältnisse, die zu Unzufriedenheit Anlass geben und auf
deren Korrektur die Kritik zielt. Deswegen ist es nur
konsequent, wenn die in einem freien Land übliche
Antikritik, kurz und knapp zusammengefasst, in dem
Hinweis gipfelt, was der Kritiker wünscht, sei bei Licht
besehen schlicht unrealistisch
. Als Einwand ist
das zwar insofern einigermaßen absurd, als es in jeder
noch so schlechten Kritik allemal um Veränderungen an der
gegebenen Realität geht, um Dinge also, die noch nicht
real sind; insofern drückt der Hinweis gar nicht mehr
aus, als dass der Kritiker das Kritisieren sein lassen
sollte. Dem Publikum wird damit ein denunziatorisches
Quidproquo zugemutet, nämlich die Gleichsetzung des
Wunsches, „die Realität“ zu ändern, mit der Unfähigkeit
oder einer ganz unvernünftigen Weigerung, sie überhaupt
zur Kenntnis zu nehmen: „Realitätsblindheit“ resp.
„Realitätsverweigerung“ lauten die entsprechenden
Schlagworte, in denen ganz unmittelbar „real“ für
„unanfechtbar“ steht. In diesem Sinne reicht schon die
Kennzeichnung eines Verbesserungsvorschlags als
utopisch
aus, um ihn als bloße Phantasterei, den
Antrag darauf als weltfremd
zu disqualifizieren
und den Antragsteller als Weltverbesserer
, was im
bürgerlichen Sprachgebrauch ein Synonym für Querulant und
Spinner ist. Was „der Realität“ tatsächlich die Qualität
eines Berufungstitels für ihre Unveränderbarkeit
verschafft, ist dabei kein Geheimnis und geht schon aus
der üblichen Rollenverteilung beim Gebrauch dieses
Arguments hervor: „Realität“ steht für die
Macht, die die real existierenden
gesellschaftlichen Verhältnisse eingerichtet hat und
durchsetzt; und als Argument gilt „die Realität“ genau so
lange, wie die jeweiligen Machthaber an der Macht sind
oder bis die von sich aus Änderungen auf die Tagesordnung
setzen. Dann heißen die real existierenden Zustände auf
einmal „Besitzstände“, was schon ausdrückt, dass die
einfach nicht mehr aufrechterhalten werden können; und
die für fällig bis überfällig erachteten Änderungen an
„der Realität“ laufen unter dem Titel Reformen
,
der im freiheitlichen Sprachgebrauch die Notwendigkeit
beschwört, Dinge zu ändern, damit sie im Prinzip so
weiterlaufen können wie bisher.
Auf Reformen lautet daher auch, was konstruktive Kritiker in einem freien Land anzumahnen pflegen. Das nimmt ihren Verbesserungsvorschlägen den Beiklang des unrealistisch Abweichenden, empfiehlt sie den Machern der real existierenden Verhältnisse als Beitrag zu deren dauerhafter Erhaltung. Und genau das ist schließlich Absicht und Quintessenz der Kritik, wie sie in einem freien Land zu Hause ist: Sie mahnt die Verantwortlichen, ihre Verfügungsmacht über die Lebensverhältnisse der regierten Völkerschaften effektiv, nachhaltig und erfolgreich wahrzunehmen. In letzter Instanz zielt sie darauf ab, die erste und entscheidende Bedingung jeden zweckmäßigen Gewaltgebrauchs, nämlich die Verfügungsmacht der Machthaber selbst zu optimieren. So ermahnt sie die Verantwortlichen dazu, dem ersten und obersten Zweck ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Und insoweit trifft Kritik dann auch nirgends auf antikritische Zurückweisung.
Das letzte Argument freiheitlicher Antikritik: Die „Gewaltfrage“
Dass Kritik sich im Rahmen und in den Bahnen des Konstruktiven hält und spätestens vom Gebot, „realistisch“ zu bleiben, beeindrucken lässt, dafür gibt es in einem freien Land keine Garantie. Es muss noch nicht einmal der Ausnahmefall eintreten, dass Kritiker objektive Urteile fällen, von Unzufriedenheit und Empörung zu einer begründeten Ablehnung eines Bestandteils der gesellschaftlichen Realität gelangen und auf Abschaffung schädlicher Verhältnisse dringen. Es langt schon, dass kritische Bürger sich von ihrer nationalen Führung missachtet fühlen, dass sie die Unterwerfung unter die als machbar deklarierten Alternativen guten Regierens hartnäckig verweigern, dass sie mehr an ihrer Abweichung festhalten als am konstruktiven Geist ihrer abweichenden Vorstellungen: Auch dann ist es mit demokratischer Antikritik nicht mehr getan. Dann ist die Toleranz des Rechtsstaats herausgefordert und eine Klarstellung fällig: Die Lizenz, frei zu kritisieren, hat nicht bloß einen freiwillig zu entrichtenden Preis; die Bereitschaft, die Gestaltung der Realität den auf Gesetz, Mehrheit und Finanzierbarkeit abonnierten Machthabern zu überlassen und den Inhalt der eigenen Einwände mitsamt den darin angemeldeten beschädigten Interessen zur unverbindlichen Ansichtssache herabzustufen, wird von den Hütern des Toleranzgebots als unerlässliche Bedingung fürs Ertragen von Kritik geltend gemacht.
In diesem Sinne wird die öffentliche, auf Störung des Alltagsbetriebs der Nation drängende demonstrative Kundgebung oppositioneller Standpunkte von Staats wegen unter Auflagen zur Vermeidung jeglicher Betriebsstörung und damit vor die Alternative gestellt, die unantastbare Geltung des rechtsstaatlichen Gewaltmonopols als Prämisse jeden Protests anzuerkennen – oder als Übergriff gegen die öffentliche Ordnung und deren Garanten und insofern als Gewalttat verboten und bei Zuwiderhandlung kriminalisiert zu werden. Die Duldsamkeit des freiheitlichen Rechtsstaats endet aber nicht erst da, wo Kritiker zur Großtat einer Protestdemonstration schreiten und mit ordnungswahrenden Maßnahmen kollidieren. Kritische Meinungen, die den Umkreis des im Parteienstreit und in der etablierten Öffentlichkeit Gewohnten erkennbar verlassen und entschieden mangelnde Anpassungsbereitschaft verraten, finden als virtueller Verstoß gegen die hoheitliche Ordnungsgewalt deren ganz handfestes Interesse, auch ohne dass unerlaubte Widerstandshandlungen daraus folgen. Schon wenn ein solcher Kritiker, was eigentlich ganz selbstverständlich ist, für seine Sicht der Dinge wirbt, verspielt er im Grunde seine Lizenz und findet sich auf der Agenda einschlägiger Sicherheitsbehörden wieder: in Verfassungsschutzberichten, in Extremisten-Karteien, als Objekt der Observierung und einer Ruf und Berufschancen schädigenden Denunziation. Eine solche offizielle behördliche Ausgrenzung aus dem Bereich des gesinnungsmäßig Zulässigen schafft ihre Opfer – und wirkt überdies in einem freien Land als schlagendes antikritisches Argument. Nichts diskreditiert eine Kritik vor dem Forum einer demokratischen Öffentlichkeit so gründlich und sorgt so wirksam für ihren Ausschluss vom öffentlichen Disput wie der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit. Denn damit ist sie nicht bloß moralisch geächtet, sondern nach bürgerlich-rechtsstaatlicher Lesart eines unheilbaren Widerspruchs überführt: Sie richtet sich gegen das Grundgesetz, dessen Freiheitsgarantie sie doch benutzt, wenn sie sich hören lässt!
Wer kritisiert, nimmt eine Erlaubnis wahr; die Instanz, die sie gewährt, ist schon damit über Kritik erhaben; wer sich mit seiner Kritik daran vergreift, verstößt gegen die Geschäftsgrundlage seines eigenen kritischen Nachdenkens: In der Gewissheit sind der Verfassungsstaat und der kritische Untertanengeist ganz und gar beieinander.
5. Das falsche Versprechen kritischer Wissenschaft
So viel ist klar: Wer an die Welt, in der er lebt, ernsthaft den Maßstab seines Interesses anlegt, wer will. dass das Leben sich lohnt, der braucht Wissen; über das, was ihm nützen soll, was er zu nutzen gedenkt, und vor allem über das, was ihm schadet. Er benötigt darüber ein objektives Urteil, aus dem entweder folgt, dass er mit seinem Anspruch richtig liegt und dass, wenn er mit einer Sachlage nicht klarkommt, die Gründe dafür in einer unvollkommenen Verwirklichung eines an sich vernünftigen Zwecks oder in seinem verkehrten Umgang mit ihrer Natur nach brauchbaren Verhältnissen liegen; oder er entdeckt einen notwendigen, in der Natur der Sache liegenden Widerspruch zum eigenen Bedürfnis und weiß damit den Grund für die Ablehnung der Sache selbst und für entsprechende Initiativen zu ihrer Überwindung oder Beseitigung. Klar ist allerdings auch: Im bürgerlichen Alltag ist es um eine derart zweckmäßige Betätigung der Urteilskraft schlecht bestellt; der Wille zur Anpassung verdirbt regelmäßig die notwendige Sachlichkeit. Daneben jedoch hat es die moderne Welt zu einer umfangreichen, hoch in Ehren gehaltenen, fest institutionalisierten Sphäre des Nachdenkens gebracht, die eben dies, nämlich unbestechliche Objektivität und praktisch relevantes Wissen verspricht: zu professionell ausgeübter Wissenschaft.
Was sie verspricht, löst sie auch ein; und zwar da, wo sie sich mit der Natur befasst, überaus erfolgreich. Zwar wird auch da manches – aus sachfremden Gründen wie einer an kommerziellen Interessen orientierten Auftragslage oder einer Voreingenommenheit aus privatem Ehrgeiz – an Fehldeutungen produziert; mit vielen Dingen sind die einschlägigen Wissenschaften auch noch lange nicht fertig. Der Umfang „gesicherten“, i.e. objektiven Wissens ist aber enorm, derjenige wissenschaftlich begründeter Praxis ebenso. Kritisch in dem Sinn, dass man begriffene Naturphänomene bei Nicht-Gefallen verwerfen könnte, ist dieses Wissen zwar nicht; zur Bekämpfung schädlicher Dinge taugt es aber durchaus, nicht zuletzt dazu, die Vermeidung und Heilung von Krankheiten auf eine vernünftige Grundlage zu stellen. Und insgesamt sind naturwissenschaftliche Urteile, soweit richtig, das wichtigste Mittel, um Teile der Natur dem eigenen Interesse – freilich: nach Maßgabe und im Maße seiner gesellschaftlichen Relevanz – gemäß und dienstbar zu machen.
Etwas anders sieht es da aus, wo die Interessen der diversen Bewohner eines freien Landes selber und die Bedingungen ihrer Relevanz, die Gründe ihrer Irrelevanz und überhaupt die Einrichtungen der Gesellschaft und die damit vorgegebenen Lebensverhältnisse wissenschaftlich beackert werden. Was die verschiedenen „geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen“ Disziplinen an Theorien zustande bringen, das füllt Bibliotheken, überfüllt inzwischen auch größere Datenspeicher und wird hier nicht im Einzelnen durchgenommen. Auffällig und aufschlussreich ist aber erstens schon die Vielfalt der Disziplinen selber; insofern nämlich, als die sich erklärtermaßen gar nicht einfach mit verschiedenen Sachverhalten, sondern mit mehr oder weniger denselben Gegenständen aus dem Bereich des speziell Menschlichen unter verschiedenen Aspekten befassen und ihren besonderen Gegenstandsbereich durch ihren besonderen Blick darauf definieren oder sogar überhaupt erst zu gewinnen behaupten. Wo schon der Form nach jedes Urteil – und jedes „gesicherte“ Wissen dem Inhalt nach – den Übergang von der subjektiven Betroffenheit und Perspektive zur Befassung mit der Sache in deren eigener Beschaffenheit macht, da reklamieren ausgerechnet die Wissenschaften von Mensch und Gesellschaft einen solchen Vorrang ihrer besonderen Sichtweise vor dem besichtigten Objekt, dass von einer „Sache an sich“, einem für sich bestimmten und in seinen Bestimmungen zu erfassenden Sachverhalt gar nicht die Rede sein könne. Hinzu kommt zweitens ein wissenschaftliches Ethos, das auch innerhalb der einzelnen Fächer den beteiligten Wissenschaftlern ein Recht auf einen eigenen „Forschungsansatz“ zuspricht, „Originalität“ bei der Durchführung der fachspezifischen Perspektive sogar zur Pflicht macht, einen „Pluralismus“ wissenschaftlicher „Annäherungen“ an die Themen der Disziplin ausdrücklich für geboten erklärt, also die Überordnung der Subjektivität des Forschers über die Identität seines Forschungsobjekts nicht bloß wie selbstverständlich voraussetzt, sondern als Bedingung seriöser Wissenschaftlichkeit fordert.
Dabei wird – um mit dem Letzteren anzufangen – ein Bemühen um Sachlichkeit, um aus der Natur des jeweiligen Gegenstandes zu begründende Urteile, um Wissen darüber, was die Sache selbst ausmacht, durchaus verlangt. Von vornherein steht aber fest, dass ein Erfolg in diesem Bemühen nicht zu haben ist. Als Kriterium der Wissenschaftlichkeit von Forschung wird dem Fachmann abverlangt, dass er seine Befunde und Behauptungen zu den Theorien und Forschungsergebnissen – möglichst vieler – anderer Forscher ins Verhältnis setzt, diese nicht oder allenfalls ausnahmsweise als sachlich falsch verwirft, sondern gelten lässt, dafür aber darlegt, weshalb und inwiefern es an seinem theoretischen Zugriff auf die Sache gerade noch gefehlt hat. Kritische und auch ablehnende Urteile über konkurrierende „Ansätze“ sind nicht nur genehmigt, sondern gefordert, allerdings nur oder jedenfalls hauptsächlich solche von der Art einer Fehlanzeige, eines Versäumnisses bei der Anwendung verschiedener theoretischer Vorentscheidungen auf den Gegenstand, einer womöglich Unkenntnis verratenden Übernahme veralteter Betrachtungsweisen und dergleichen. Auf die methodische Inszenierung des eigenen wissenschaftlichen Vorgehens kommt es an; und was sich dabei überhaupt nicht gehört, ist die auch nur implizite Behauptung, nicht bloß einen neuen Blick auf Altbekanntes geworfen, sondern etwas Abschließendes, weil Richtiges zur Sache ermittelt zu haben. Wissenschaftliche Redlichkeit wird nachgewiesen durch Bescheidenheit in der Wahrheitsfrage und normgerechte Angeberei mit der Vielzahl der zu Rate gezogenen „Literatur“, der noch nie erreichten Tiefe des eigenen Einfalls, der berücksichtigten Komplexität des Gegenstandes, der Neuartigkeit der an ihn herangetragenen Problemstellung und anderem von der Art. Die Kriterien sind also durchaus streng; nur mit Objektivität haben sie nichts zu tun: Sie verlangen Richtigkeit im Sinne einer korrekten Erfüllung formeller Kriterien der jeweiligen Disziplin, was hier geradezu wörtlich zu nehmen ist, und sind unter dieser Bedingung ein Freibrief für die Phantasie des Forschers. So hält unter dem Titel des „Pluralismus“ die Dialektik der Meinungsfreiheit – der Generallizenz für jedes formvollendete Urteil unter der Bedingung seiner Irrelevanz – Einzug ins Reich des wissenschaftlichen Nachdenkens.
Inhaltlich diszipliniert wird die Phantasie des modernen
Human- und Gesellschaftswissenschaftlers durch das als
„Formalobjekt“ präsentierte, zur Methode des Nachdenkens
ausgearbeitete Vor-Urteil des jeweiligen Faches darüber,
als was in seinem theoretischen
Zuständigkeitsbereich Mensch und Gesellschaft zu
betrachten seien. Einig sind sich die verschiedenen
fachspezifischen Betrachtungsweisen darin, dass sie alle,
eine jede auf ihre unverwechselbare Weise, ihren sich
mindestens weitgehend überschneidenden, wenn nicht
identischen Gegenstandsbereichen eine Bedeutung
abgewinnen resp. zuerkennen; sei es unter dem
Gesichtspunkt wichtiger Normen und Werte, als
deren mehr oder weniger gelungene Verwirklichung das
gesellschaftliche Leben zu betrachten sei; sei es im
Lichte eines fundamentalen Menschheitsproblems,
als dessen Lösung sich z.B. die Wirtschaftstätigkeit
derselben Gesellschaft entschlüsseln lässt. Dabei
verstehen sich alle wissenschaftlichen Disziplinen
insofern als kritisch, als sie kein
gesellschaftliches „Phänomen“ und kein geistiges Produkt
„einfach so“ als mehr oder minder schätzenswerte
Gegebenheit gelten lassen. Ihren Auftrag sehen sie eben
darin, die gegebenen Realitäten fachspezifisch zu
hinterfragen
, was so viel bedeutet wie: auf ein
„dahinter“ liegendes Prinzip – einen am Gegenstand erst
noch aufzuzeigenden Funktionszusammenhang, eine höhere,
aller bewussten Zwecksetzung vorausliegende
Zweckbestimmung, einen nicht gleich ersichtlichen
allgemeinen Gehalt – zu beziehen. Worauf die
Wissenschaftler ihren Forschungsgegenstand jeweils zu
befragen haben, welcher „Fragestellung“ sie ihn
unterwerfen müssen, um ihn „zum Reden zu bringen“, das
steht mit dem Fach, dem sie angehören, grundsätzlich
fest; nachgedacht wird darüber, ob und inwieweit die
erforschte Sache erfüllt oder verfehlt, was die
wissenschaftliche Disziplin als deren „eigentliche“
Bedeutung: als ihren Begriff
unterstellt. Jede
Einzelwissenschaft begründet und rechtfertigt sich
überhaupt mit ihrem besonderen Gesichtspunkt und der
entsprechenden Methode, „Geist“ und „Gesellschaft“ zu
problematisieren, i.e. auf einen Sinn
zu befragen, der den Dingen innewohnt, aber auch verfehlt
werden kann. Eine jede würdigt die Realität auf ihre Art
als eine Angelegenheit, auf deren Gelingen es ankommt,
sowie als Ensemble von Bedingungen und Umständen, auf die
es für ein fachgerechtes Gelingen im Sinne eigentlicher
guter Zwecke ankommt. Dazu will die Fachwelt in ihren
diversen Abteilungen ihre Erkenntnisse beisteuern.
Im Zeichen dieser Sorge um eine erfolgreiche Abwicklung des Weltgeschehens üben die Fächer untereinander friedliche Koexistenz: Keines bestreitet, jedes belässt dem anderen seinen besonderen Blick auf die Welt; kein Fach stört sich daran, dass die anderen Wissenschaften demselben Weltgeschehen eine andere Zielsetzung unterstellen und sich ideell um andere Erfolgsbedingungen kümmern als es selbst. Ob die Fachleute der verschiedenen Disziplinen sich wechselseitig als externe Ergänzung anerkennen oder als eher belanglosen Seitenzweig, gar als Sumpfblüte des wissenschaftlichen Ringens um Sinnstiftung und Problemlösung verachten, bleibt denen selbst überlassen: Zum Reich der Wissenschaften von Geist und Gesellschaft gehören sie alle auf Grund dessen, dass sie sich alle der Menschenwelt als ihrem ideellen Sorgeobjekt widmen, sie also ganz selbstbewusst im Sinne ihrer besonderen geistigen Fürsorge zurechtkonstruieren. So bringen diese Wissenschaften als Einlösung der Sorte Sachlichkeit, die sie anstreben, das Prinzip falscher Immanenz zur Geltung: die Unterstellung eines guten Sinns als Prämisse jeder sachlichen Befassung mit welcher gesellschaftlichen Einrichtung auch immer, als für die Disziplin konstitutives ‚Apriori‘. Varianten falscher Immanenz begründen die Vielfalt und das Nebeneinander der humanwissenschaftlichen Fächer.
Was die Gelehrtenwelt da treibt, das reflektiert sie natürlich auch. Zur wissenschaftlichen Arbeitsteilung gehört sogar eine besondere Disziplin, die die Erkenntnisleistung des menschlichen Verstandes zum Gegenstand hat. Dabei fällt an den vielfältigen, ja disparaten, dennoch mehr oder weniger friedlich koexistierenden Theorien zum Thema, zu denen es auch diese Einzelwissenschaft gebracht hat, wieder eine Gemeinsamkeit auf: Ihre Erklärungen widmen sich weniger dem Wissen, das es nachvollziehbar gibt, als vielmehr der Frage, ob und wie Wissen überhaupt möglich ist; die Antwort suchen sie, der Fragestellung entsprechend, nicht im Nachvollzug, sondern getrennt vom wissenschaftlichen Erkenntnisgang selbst. Das, was Wissen allemal ausmacht und schon in der Wortbedeutung von Erkenntnis enthalten ist: die schöne Leistung des Verstandes, dem wirklichen Begriff einer Sache auf die Spur zu kommen, ist durchaus der Bezugspunkt und Leitfaden dieser Theorien; freilich in der eigentümlich begriffslosen, verfremdeten Form einer Übereinstimmung von Verstand und Objekt als zwei verschiedenen Sachen; einer Deckungsgleichheit, über deren Ge- oder Misslingen durch sie, also von einem Standpunkt außerhalb der Wissenschaften selber und unabhängig von deren Erkenntnissen – und Fehlschlüssen – zu befinden sei. Von dieser externen Warte aus, aus einem Blickwinkel, der sich als überlegene Sicht der wissenschaftlichen Dinge versteht, ergeht dabei, vor und jenseits aller wirklichen Überprüfung, das Generalurteil, dass Wissen im „naiven“ Sinn einer theoretischen Erfassung und Synthese der objektiven Bestimmungen eines Forschungsgegenstandes und ihres notwendigen Zusammenhangs ganz grundsätzlich nicht geht. Was nicht überrascht; denn ein anderes Ergebnis kann bei so einer Problemstellung gar nicht herauskommen: Die Frage gebietet ja bereits die Begutachtung der einschlägigen Leistung des Verstandes als eine Veranstaltung des Subjekts, deren Erfolgsmöglichkeit innerhalb dieser Veranstaltung gar nicht zu beurteilen ist und die folglich eines ganz sicher nicht zu ihrem Inhalt hat, nämlich Wissen über ihren Gegenstand. Schon in der Fragestellung ist Erkenntnis definiert als offenes Problem, über dessen Lösbarkeit im Erkenntnisprozess selber nicht zu entscheiden ist; was immer die Erkenntnistheorie an Lösungsbedingungen namhaft macht, enthält auf jeden Fall die Negation wissenschaftlicher Erklärung, die mit ihren Argumenten über ihre Richtigkeit – und über noch offene Fragen – befindet. Und zu diesem Fazit bekennen sich die diversen Wissenschafts- und Erkenntnistheorien in der Regel auch ausdrücklich: Sie sprechen dem Verstand alle möglichen Fähigkeiten zu, aber die eine Leistung ab, Sachen objektiv auf ihren Begriff zu bringen.
Plausibel gemacht wird dieses Verdikt bisweilen mit dem Verweis auf falsche Auffassungen, die lange als wahr gegolten haben, bis ein wissenschaftlicher Fortschritt sie als verkehrt erwiesen hat – was freilich genau das Gegenteil beweist, nämlich die Ausräumung einer unwissenschaftlichen Ansicht durch richtige Schlussfolgerungen aus dem zu erklärenden Material; die Erkenntnistheorie hat dazu jedenfalls noch nie etwas beigetragen. Gerne wird auch mit der Vorstellung einer „absoluten Wahrheit“ operiert, die dem endlichen und fehlbaren Menschengeist schon deswegen nicht zugänglich sei, weil der doch selber gar kein bisschen „absolut“, sondern heillos relativ ist – als wäre es einer gescheiten Wissenschaft um etwas ganz anderes als ein paar objektive Urteile über ein paar ihrerseits relative, aber relativ wichtige Gegenstände zu tun, nämlich womöglich um einen schlagartig alles erklärenden „Stein der Weisen“. Auf jeden Fall wird, wer sich um Wissen bemüht, und erst recht, wer sich in der Welt der Wissenschaft engagiert, dringlich ermahnt, objektive Erkenntnis nicht für ein erreichbares Ziel zu halten, sondern als heuristische Idee zu begreifen und allem, was als „gesichertes Wissen“ gilt, von vornherein und ganz grundsätzlich den Status vorläufiger, noch nicht widerlegter fachgerecht konstruierter Mutmaßungen zuzuschreiben. Der Ton liegt dabei auf „von vornherein“ und „grundsätzlich“: Nie geht es um etwas so Triviales wie die Warnung davor, eine unfertige Erklärung für fertig zu halten und Wissenslücken zu übersehen oder gar zu ignorieren – wie weit man in der Erforschung einer Sache gekommen ist und was noch zu erklären bleibt, lässt sich ohnehin gar nicht außerhalb des wissenschaftlichen Bemühens um die Sache feststellen und ist allemal darin enthalten –, vielmehr um die von jedem Wissen unberührte, jedem Blödmann zu Gebote stehende Vorentscheidung, Wissenschaft für ein nie wirklich verifizierbares Gedankenkonstrukt zu halten. Eine gewisse Ironie liegt dabei in der Tatsache, dass die Wissenschafts- und Erkenntnis-Erklärer ihrerseits für ihr Generalurteil über die Unmöglichkeit objektiver Erkenntnis den Rang einer a priori geltenden unumstößlichen, also schon ziemlich „absoluten“ Wahrheit in Anspruch nehmen und wie selbstverständlich davon ausgehen, dass sie sowohl die Welt der zu erklärenden Gegenstände als auch die Leistungen wissenschaftlicher Verstandestätigkeit durchschaut und hinreichend begriffen haben, um die Möglichkeit der Erfassung der ersteren durch letztere in Abrede stellen zu können. Mit dem Gestus immanenter Kritik, der es ums bessere Gelingen von Wissenschaft und menschlichem Erkenntnisstreben zu tun wäre, verwerfen diese kritischen Theorien die Sache selbst, von der sie gleichzeitig praktisch einräumen, dass sie ein für allemal die Sache wissenschaftlicher Erkenntnis ist: Einsicht zu gewinnen in die objektiven Bestimmungen und sachlichen Notwendigkeiten des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes.
Dem Gang der Naturwissenschaften schaden sie damit nicht weiter – oder nur in einer Hinsicht: Den engagierten Wissenschaftlern reden sie ein falsches Verständnis ihrer eigenen Tätigkeit auf und ein Selbstbewusstsein ein, das eher die Aufstellung fragwürdiger Theorien im Sinne eigener weltanschaulicher Vorlieben und Mutmaßungen rechtfertigt als zu einer Kritik daran ermuntert: Wenn ohnehin alles letztlich nur Hypothese ist und bleibt, dann ist auch alles erlaubt! Zum Fehler des Pluralismus in den Wissenschaften von „Geist & Gesellschaft“ und zu deren Ethos disziplinierter Originalität steuert die Disziplin kritischer Selbstreflexion den groß angelegten Nachweis bei, dass Wissenschaft anders auch gar nicht geht und sich vor allem etwas anderes auch gar nicht vornehmen darf, weil das Abstandnehmen vom Anspruch auf Objektivität die erste Bedingung anerkennenswerter Wissenschaftlichkeit sei. Das nämlich will die Erkenntnistheorie, getrennt von allem „einzelwissenschaftlichen“ Bemühen, durch eingehende Begutachtung a priori des wissenschaftlichen Nachdenkens als solchen herausgefunden haben.
Zum großen Vorbild für diese erkenntnistheoretische
Gutachtertätigkeit ist Kants „Kritik der reinen Vernunft“
mit ihrem Programm geworden, die Wissenschaft ganz
allgemein durch eine vorhergehende Prüfung des
Vermögens oder Unvermögens der Vernunft
auf ein
sicheres Gleis zu setzen. Eine solche „Prüfung“ trennt,
tatsächlich vorhergehend
, also grundsätzlich, die
wissenschaftliche Erkenntnis von ihrem Inhalt und Objekt,
stellt sich über die zu prüfende Vernunft auf
der einen, die von vernünftiger Erkenntnis nicht berührte
Realität auf der anderen Seite und kann dann gar nichts
anderes zustandebringen als die Gedankenkonstruktion
eines „Vermögens“, das ein intellektuelles
Instrumentarium enthält, mit dem „die Vernunft“ auf eine
nur der begriffslosen Empfindung zugängliche Objektwelt
losgeht und sich diese zurechtlegt. Die dem forschenden
Subjekt geläufige Vorstellung – um mehr als eine
hoffnungsvolle Einbildung kann es sich der
Problemstellung zufolge schon gar nicht handeln –,
der menschliche Verstand bekäme gedanklich die Objektwelt
zu fassen, so wie sie selber ist, bekommt insofern Recht
und Unrecht zugleich, als nach
„transzendentalphilosophischer“ Lehre die Vernunft ihr
Instrumentarium schon in der Kenntnisnahme von der ihr
äußerlichen Welt strukturierend und gestalterisch
betätigt hat und folglich sich selbst in den Dingen
wiederentdeckt. Dass Kant mit diesem Zirkelschluss
erklären wollte, wie die Naturwissenschaften es
hinkriegen, sichere Erkenntnisse zu produzieren, ändert
nichts daran, dass von Erkenntnis schon seit der Frage
nach den „Bedingungen ihrer Möglichkeit“ nicht mehr die
Rede sein kann. Denn unter Absehung von der wirklichen
Erkenntnistätigkeit ein Vermögen zu suchen und
untersuchen zu wollen, das selber vorgibt, was an der
Welt und als was die Welt überhaupt zu begreifen sei, das
heißt schon: Man lässt die Leistung des
Verstandes nicht gelten; man postuliert
stattdessen einen Verstand, dessen
Leistungsfähigkeit gerade unabhängig vom Inhalt
seiner Leistung zu bestimmen wäre. So degradiert man das
Begreifen grundsätzlich, a priori, zur Verfertigung von
Gedankenkonstrukten ohne objektive Gültigkeit.
An Kants Vorstellung einer wissenschaftlich einwandfrei
zu begreifenden Welt für uns
, vernünftig
präformiert und deswegen diesseits der unerkennbaren,
jenseitigen Welt an sich
angesiedelt, haben seine
erkenntnistheoretischen Epigonen allerdings noch einiges
zu verändern gefunden: manche mit dem Ziel, die
Möglichkeit „exakten Wissens“ dadurch nachzuweisen, dass
sie es von vornherein vom Anspruch auf Sachhaltigkeit
entlasten; manche mehr mit dem umgekehrten Beweisziel,
dass es in der Wissenschaft schon um allgemeine Auskünfte
über die Welt, aber stets unter dem Vorbehalt jederzeitig
möglicher „Falsifizierung“ geht. Die einen möchten daran
festhalten, dass das Instrumentarium der Vernunft zwar
nie zur Sache, wohl aber zu eindeutigen Ergebnissen
führt, wenn es sachgerecht – sie nennen es „logisch“ –
betätigt wird; sie ermitteln resp. postulieren
Prinzipien des korrekten Schließens
, denen zufolge
es sich bei der Ermittlung notwendiger Sachzusammenhänge
nur um eine Kombinatorik von Aussagen
handeln
kann, deren Inhalt gleichgültig ist; im
Interesse dieser Kombinatorik formulieren sie oder
fordern die Formulierung von Kunstsprachen
, die
sich dadurch auszeichnen, dass sie vom normalsprachlichen
Bezug auf eine von der Sprache getrennt existierende
Objektwelt gereinigt sind; ihr Ideal wissenschaftlicher
Exaktheit
verlangt Zeichen
, die nichts
bedeuten
. Andere Erkenntnistheoretiker nehmen die
Idee eines vom erkennenden Subjekt mitgebrachten
„Apriori“, das schon die Wahrnehmung der Objektwelt
determiniert und von der Wissenschaft in dieser quasi
wiedergefunden wird, wie den zweifelsfreien Befund,
Erkenntnis bestände ohnehin in gar nichts anderem als im
Überstülpen von Deutungen über die Welt, und Objektivität
in der Wissenschaft wäre von vornherein nichts anderes
als eine Sache der Konvention unter Fachleuten, welche
Weltdeutung als intellektuelle Unternehmung ernst zu
nehmen ist – eine Entscheidung, die innerakademisch
verbindlich getroffen wird durch die Existenz einer
anerkannten Zunft. Das heißt dann Intersubjektivität
der wissenschaftlichen Methode
und ist die einzig
wahre Lesart von wissenschaftlicher Objektivität
,
deren Missverständnis im Sinne richtiger Erkenntnis die
Erkenntnistheorie den Fachwissenschaftlern immer noch
meint austreiben zu müssen.
Diese Verpflichtung verspüren moderne Erkenntnistheoretiker nicht einfach deswegen, weil sie ihren Kollegen zu einem angemessenen Selbstbewusstsein verhelfen wollen. Seit Sir Popper ihnen diesbezüglich die Augen geöffnet hat, halten viele Mitglieder der Zunft der Erkenntnistheoretiker den geistigen Kampf gegen das Bemühen um objektive Erkenntnis für ein Erfordernis der abendländischen Freiheit und einen Dienst, den sie der „offenen Gesellschaft“ demokratischer Observanz schulden. Urteile über was auch immer, die sich nicht gleich selber als bloße Hypothese zu erkennen geben, halten sie für eine versuchte Vergewaltigung des freien Denkens, für die Zumutung, nur so und nicht anders denken zu dürfen; was nicht nur beweist, dass wissenschaftliches Erklären ihre Sache nicht ist. Urteile, Schlüsse, Theorien kennen sie überhaupt nur als Weltanschauung, mit der denkende Menschen sich auf ein vorgegebenes Interesse festlegen resp. festlegen lassen; den Geltungsanspruch, der theoretischen Aussagen allemal innewohnt, verstehen sie unbesehen als Versuch, andere unwiderruflich auf die Anerkennung übergriffiger Ansprüche festzunageln; vor der Fremdbestimmung von Denken und Wollen durch unbefugte Autoritäten rettet daher allein die erklärte Unverbindlichkeit jeglicher Weltsicht, die dafür ausfallen darf, wie es ihrem Urheber gefällt, und sogar als Wissenschaft gelten darf, solange noch kein abweichender Fall die darin enthaltenen All-Aussagen entkräftet hat. Dass – genau umgekehrt – aus geschädigtem Interesse ein Bedarf an sachlicher Erklärung erwächst; dass richtiges Wissen ein unentbehrliches Mittel ist, nicht bloß Naturgegebenheiten brauchbar zuzurichten, sondern auch gegen Herrschaftsverhältnisse vorzugehen; dass auf jeden Fall ohne richtige Gedanken eine zu ihrem Schaden „fremdbestimmte“ und ausgenutzte Menschheit gegen übergriffige Machthaber keine Chance hat; kurzum: Notwendigkeit und Leistung objektiver Erkenntnisse für eine freie Gesellschaft: Das ist den für wissenschaftlichen Pluralismus und demokratische Herrschaft eifernden Erkenntnistheoretikern völlig fremd. Für sie ist Theorie a priori geistiges Herrschaftsmittel, und das so eindeutig und definitiv, dass Freiheit für sie mit der Negation objektiven Wissens zusammenfällt. Als elitäre Intellektuelle halten sie dabei jede Theorie, durch die sie ihre Gedankenfreiheit beschränkt sehen, so sehr für das alles entscheidende Unterdrückungsinstrument, dass sie gleich gar keine Herrschaft mehr, sondern nur noch Freiheit und „offene Gesellschaft“ entdecken, wenn weltanschaulich alles erlaubt, Objektivität verboten, stattdessen die nie entschiedene Konkurrenz unverbindlicher Weltdeutungen die gültige Norm für alles theoretische Bemühen ist. Vernünftig ist die Welt, wenn jeder sie auf seine Art vernünftig finden darf – und die darüber erhabene Herrschaft von wirklich sachlicher Kritik und den darin artikulierten Interessen unbehelligt bleibt.
Dem Sinn und Zweck demokratischer Geistesfreiheit kommen diese Geistestheoretiker damit schon ziemlich nahe. Was sie zusätzlich leisten, ist eine Ächtung der Vernunft, die über den akademischen Bereich hinaus populär geworden ist: Mittlerweile gilt das Bemühen um ein bisschen Vernunft und richtige Urteile im aufgeklärten Abendland ziemlich einhellig als Fehlgriff, mit dem die Menschheit sich Diktaturen, Krieg und Auschwitz eingebrockt hätte. In Ordnung wäre demnach die Welt, wenn Weltanschauungen aller Art untereinander und unter weltanschaulich neutraler Aufsicht koexistieren, keine richtige Erklärung irgendeinem gängigen weltanschaulichen Fimmel noch der realen Entscheidungsfreiheit der Machthaber in die Quere kommt, also „die Realität“ unbegriffen und unkritisiert das letzte Wort behält.
Keine Frage, die real existierenden Machtverhältnisse kommen ganz gut auch ohne wissenschaftstheoretische Apotheose zurecht. Aber ohne wissenschaftstheoretisch verabsolutierte Rechtfertigung seiner Unsachlichkeit kommt offenbar der wissenschaftliche Geist in seiner pluralistischen Sorge um das Gelingen der herrschenden Verhältnisse nicht so richtig mit sich ins Reine. Mit seinem philosophisch fundierten Kritikverbot behält er in seinem Reich das letzte Wort.