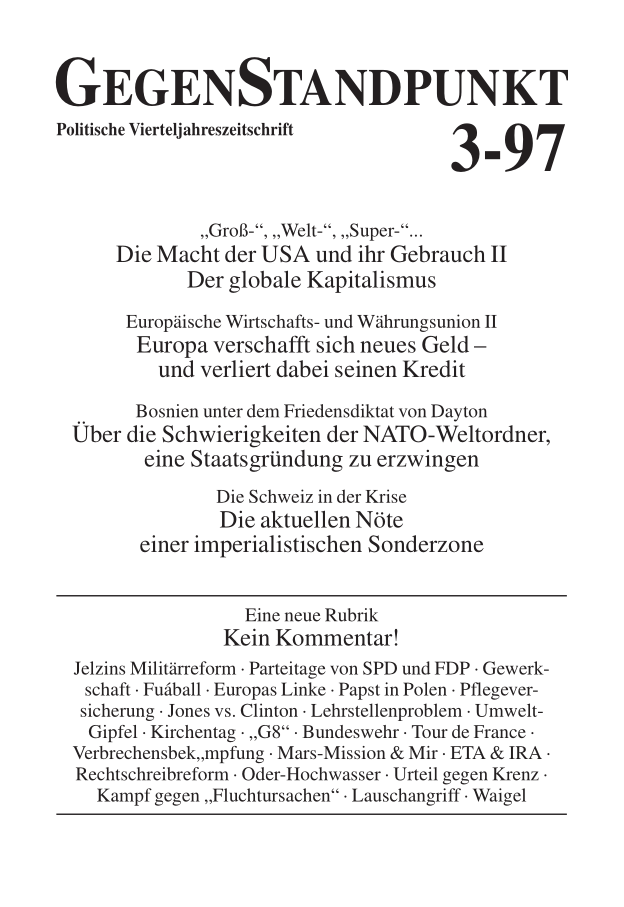Die Schweiz in der Krise
Die aktuellen Nöte einer imperialistischen Sonderzone
Die Schweiz leider darunter, dass ihre frühere Rolle als „neutraler“ Verhandlungsort überflüssig wurde und nun als politische Unzuverlässigkeit erscheint. Mit ihrer bisherigen Funktion … Kritik und wird durch die Affaire „Nazi-Gold“ politisch blamiert. Auch das europäische Projekt ist eine Bedrohung für die Schweiz.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Die Konsequenz der neuen Weltlage: Ein plötzlicher Verlust an internationalem Gewicht
- II. Die Affäre „Nazi-Gold“: Ein politischer Angriff auf die Sonderstellung der Schweiz
- III. Die ökonomische Bedrohung des Finanzplatzes Schweiz durch das Euro-Projekt
- IV. Die neue Frage: Was ist der Wirtschaftsstandort Schweiz in und mit Europa wert?
- V. Die neuen Lasten der nationalen Politisierung: „Die Schweiz am Ende – am Ende die Schweiz?“
Die Schweiz in der Krise
Die aktuellen Nöte einer
imperialistischen Sonderzone
Die Schweiz, jahrzehntelang ein „Hort der Stabilität“, der „internationalen Friedensdiplomatie“ und des „guten Geldes“, hat Schaden gelitten. Darin sind sich alle nationalen und internationalen Begutachter einig. Die Unwägbarkeiten der „neuen Weltordnung“, die problematische Weltmarktlage, das schwierige Verhältnis zur EU, die Unsicherheit des Euro-Projekts, vor allem und immer wieder aber die leidige Affäre um das „Nazi-Gold“ werden ins Feld geführt – wahlweise als Grund oder Ausdruck einer fundamentalen „Krise“ und einer zunehmenden „Perspektivlosigkeit“ der vormals so gefestigten Alpenrepublik. Woran und wodurch sie Schaden genommen hat, geht allerdings in dem Streit unter, ob mehr das Ausland – die Intransigenz der EU, die Rufmordkampagne der USA – für die mißliche Lage verantwortlich ist oder ob die Schweiz sich selber durch ihr allzulanges Abseitsstehen und die Vertuschung der dunklen Kapitel ihrer jüngeren Geschichte ins Abseits manövriert hat.
Worüber innerhalb und außerhalb der Schweizer Grenzen mit solchen Schuldzuweisungen ziemlich unsachgemäß räsonniert wird, ist die Tatsache, daß der bisherige Erfolgsweg dieser Nation zweifelhaft geworden ist. Die Schweiz mag sich ihre Stellung in der Welt als Ertrag ihrer klugen Politik zwischen den Großmächten, mithin als ihre eigene Leistung zugute halten. Sie bekommt zu spüren, daß der Sonderstatus des Landes als renommierter Finanzplatz, als Weltwirtschaftsstandort und als eine Hauptstätte der Weltdiplomatie nicht nationaler Anstrengung und Macht entspringt, sondern sich der imperialistischen Lage und den Berechnungen ihrer Macher, mithin der Konzession auswärtiger Mächte verdankt. Der internationale Charakter ihres so erfolgreichen „Sonderwegs“ macht der Schweiz jetzt zu schaffen.
I. Die Konsequenz der neuen Weltlage: Ein plötzlicher Verlust an internationalem Gewicht
Das betrifft zunächst die Teilhabe des Landes am Weltgeschehen, ihre Funktion als diplomatische Börse. Mit der Auflösung des Ostblocks hat sich auch der Bedarf an Weltdiplomatie gewandelt. Sicher, auch heute gibt es genügend Händel zu regeln, Frieden ist ja in der „neuen Weltordnung“ nicht eingekehrt, im Gegenteil: Allen voran Amerika sieht sich nach wie vor als Ordnungsstifter herausgefordert. Aber die einschlägigen weltumspannenden Aktivitäten haben nicht mehr den Charakter einer Diplomatie zwischen den Blöcken, mit der die beiden Vormächte vormals auf diversen Ost-West-Gipfeln und in laufenden Verhandlungen ihre weltkriegsträchtigen Gegensätze rund um den Globus anmeldeten, einschätzten und die Gegenseite für sich berechenbar zu machen versuchten. Das hat die Bedeutung der Schweiz als bevorzugter Ort für diesen diplomatischen Feindverkehr, der alle Staatenbeziehungen dominierte und die ganze Staatenwelt miteinschloß, also auch laufend in Genf versammelte, ziemlich relativiert.
Verloren hat die Schweiz damit nicht nur einiges an „pomp
and circumstances“ in Genf; Schaden gelitten hat nicht
nur die Einbildung, immerzu mit im Zentrum des
Weltgeschehens zu stehen. Entwertet worden ist die
internationale Stellung der Schweiz, die ihr nach dem
Zweiten Weltkrieg zugewachsen ist und die sie sich mit
dem Grundsatz der Neutralität
selber gesichert zu
haben meinte. Die damit bezeichnete Außenpolitik hat zwar
mit „Neutralität“ im eigentlichen Sinne des Wortes, mit
einem Verzicht auf Parteinahme in der globalen
Auseinandersetzung, wenig gemein. Auf den Versuch der
„Blockfreien“, durch eine Stellung zwischen den Blöcken
von beiden zu profitieren, hat sich die Schweiz nie
eingelassen. Die Schweiz war nach ökonomischer Verfassung
und politischer Ausrichtung ein streng zum Westen
gehöriges Land, entschieden antikommunistisch und
proamerikanisch. Aber sie stellte im Westen eine Ausnahme
dar, weil sie sich – obwohl zum Kern Europas gehörig –
nicht dem westlichen Bündnissystem angeschlossen und
insofern auch nicht darauf verpflichtet hatte, sich in
den Weltkonflikten als automatischer Parteigänger und
Mitmacher der westlichen Vormacht einzuordnen. Die
Schweiz hat sich von einem Anschluß an die westliche
Vormacht keinen Zuwachs an weltpolitischem Gewicht
versprochen – und das aus gutem Grund. Sie hat nämlich
durch den Krieg nicht wie alle anderen europäischen
Staaten an imperialistischer Bedeutung verloren, sondern
gewonnen. Über die Schweiz, schon vor dem Krieg
internationaler Versammlungsort und im Krieg auf keiner
Seite engagierte und von keiner zum Mitmachen gezwungene
diplomatische Kontaktstelle, sind mit der Ausweitung des
Krieges mehr und mehr unerläßliche Beziehungen zwischen
den kriegführenden Staaten abgewickelt worden. Dieser
politische Kriegsgewinn, die Stellung einer von den
Gewalthändeln getrennten treuhänderischen Vertretung für
die entscheidenden Mächte, hat sich nach dem Krieg nicht
verflüchtigt, sondern im Gegenteil eine ganz neue
Bedeutung gewonnen. Mit dem „Kalten Krieg“ wurde ja der
diplomatische Verkehr auf Grundlage bestrittener
Anerkennung der alles dominierende weltpolitische
Normalfall und Dauerzustand zwischen den beiden
Supermächten. Für diesen Verkehr bot sich die Schweiz als
passende Adresse an, und das Land hat sich ganz darauf
verlegt, außerhalb der UNO-Bühne in New York als Platz
für den allfälligen „Verhandlungspoker“ zwischen Ost und
West und für die Bemühungen um „Konfliktlösungen“ zur
Verfügung zu stehen. Kern und Grundlage der Schweizer
„Neutralität“ war also, daß das Land für die
Blöcke dadurch benutzbar war, daß es außerhalb
der westlichen Blockdisziplin stand. Deshalb hat auch
Amerika die Sonderstellung der Schweiz innerhalb des
Westens zugestanden und unterstützt. Und darüber hat sie
an Gewicht in der übrigen Welt gewonnen: Das Land hatte
keine nachkolonialen Gegensätze abzuwickeln, keine
Einflußzonen zu verteidigen; es stand im konfliktfreien
Verkehr mit aller Welt und war mit seinen guten
Beziehungen zu den entscheidenden Mächten, aber ohne
deren imperialistische Parteilichkeiten, Vorbehalte und
Ordnungsansprüche, eine bevorzugte Adresse gerade auch
für die Staaten der Dritten Welt.
Mit dem Ende des Ostblocks ist diese Funktion der Schweiz erledigt und damit ihre bisherige Stellung entwertet. Die Konkurrenz zweier feindlicher Supermächte gibt es nicht mehr; die USA und die NATO regeln ihre Konkurrenz in Weltaufsichtsdingen und ihre Beziehungen zu Rußland und anderen Nachfolgestaaten des Ostblocks anders – und eben großenteils auch anderswo. Was der Schweiz an Weltdiplomatie verblieben ist, hat nicht mehr den Stellenwert der alles entscheidenden Auseinandersetzungen; und für eine bedeutende Rolle in den neuen Auseinandersetzungen um Weltaufsicht und Einfluß fehlen ihr die Machtmittel.[1] Mit der weltpolitischen Funktion ist aber auch die „Neutralität“ selber fragwürdig geworden und erscheint als Mangel an weltpolitischer Beteiligung.[2]
Für die Schweiz steht der Nutzen der bisherigen Sonderstellung in Frage; für die entscheidende Adresse, die USA, ihre Legitimität. Was bisher konzediert war, wird ihr jetzt als unerlaubtes Abseitsstehen und Unzuverlässigkeit angelastet.
II. Die Affäre „Nazi-Gold“: Ein politischer Angriff auf die Sonderstellung der Schweiz
Seit einiger Zeit stehen die zwei nationalen Säulen der Schweiz am Pranger: das Ansehen ihrer Banken und ihre „Neutralität“. Die Banken und die Regierung hätten mit Hitler kollaboriert, dadurch „den Krieg verlängert“, sich an Nazi-/Raubgold und jüdischem Vermögen bereichert und das unrechtmäßig erworbene Gut nach dem Krieg stillschweigend behalten, lautet der Vorwurf. Hiesige Beobachter, selbstzufrieden, daß Deutschland seine Schuldigkeit in Sachen „Vergangenheitsbewältigung“ getan hat, wissen gleich Bescheid: Jetzt wird die Schweiz „von ihrer Vergangenheit eingeholt“! Eingeholt wird sie aber überhaupt nicht; höchste amerikanische Stellen haben die Vergangenheit aufgerührt. Sie haben neue Nachforschungen und Forderungen von jüdischen Organisationen auf Basis neuen Archivmaterials tatkräftig gefördert und ihnen den Charakter einer weltöffentlichen Kampagne zur „Aufklärung“ und „Wiedergutmachung“ von Schweizer Vergehen im Zweiten Weltkrieg verliehen. Indem die amerikanische Regierung als Parteigänger jüdischer Opfer vergangenen Unrechts auftritt, verwandelt sie den Streitfall in eine zwischenstaatliche Angelegenheit USA contra Schweiz.
Wie immer bei solchen Affären ist eine gehörige Portion Heuchelei im Spiel. Die Sache, die nach ständig neuen Enthüllungen schreit – das im Verlauf des Zweiten Weltkriegs in Schweizer Besitz gelangte „Nazi-Gold“ und die jüdischen und anderen Eigentumsansprüche auf diese Bestände –, ist nämlich allen, die es angeht, schon seit dem Krieg bekannt und nach Kriegsende zwischen Schweiz und Siegermächten in wechselseitigem Einvernehmen geregelt worden. Das nationalsozialistische Deutschland hat im Krieg über die Schweiz seinen kriegsnotwendigen Finanz- und Warenverkehr abgewickelt und zum Kauf von kriegswichtigen Gütern im Ausland private Goldbestände konfisziert, die Goldreserven Österreichs, Belgiens, Hollands, Italiens, Jugoslawiens, Albaniens und der Tschechoslowakei, später dann auch Zahngold der vergasten Juden eingeschmolzen und an die Schweiz verkauft. Gleichzeitig haben viele von den Nazis Verfolgte und viele Nazis selber ihr Vermögen in der Schweiz in Sicherheit gebracht.[3] Dieser Zustrom bescherte dem neutralen Land ordentliche Kriegsgewinne. Nach dem Krieg erhoben die Alliierten, allen voran die USA, zwar Anspruch auf die Kriegsbeute und unterbanden eine selbständige schweizerische Regelung der „Rückführungs“frage. Im Washingtoner Abkommen von 1946 verpflichtete sich die Schweiz zu Entschädigungszahlungen von insgesamt 500 Mio Franken in Gold; im Gegenzug erklärten allen voran die USA – wenn auch widerwillig – für sich und alle bei ihnen beheimateten natürlichen und juristischen Personen den Verzicht auf sämtliche Forderungen an die Schweiz aus den Goldgeschäften der Nationalbank erklärten. „Die Sieger des Zweiten Weltkriegs waren“ wegen des beginnenden Kalten Krieges „an einer starken neutralen Schweiz interessiert“, erfährt man. So verwandelte sich der zweifelhafte Kriegsgewinn in ordentliches Bankvermögen und einen Staatsschatz, der dem Schweizer Franken eine 150% Golddeckung sicherte.
Der damals erledigte Fall wird jetzt von amerikanischer Seite neu aufgerollt und die Schweizer Rolle zwischen den Fronten nach mehr als 50 Jahren dem einseitigen Blickwinkel des Siegerrechts unterworfen, nicht bloß propagandistisch, sondern mit Androhung von juristischen und politischen Konsequenzen.[4] Ein Ende der Affäre ist nicht abzusehen, im Gegenteil. Das „Nazi-Gold“ ist nämlich ein griffiges Kürzel dafür, was die USA heute an der Schweiz stört. Auf der Anklagebank steht der internationale Finanzplatz Schweiz und seine politische Rückendeckung.
Grundlage und Leistung der Schweiz in Sachen Reichtum ist ja eine Dienstleistung ganz besonderer Art: Mit ihren Banken, ihrem Geldwesen und ihrer Geldpolitik hat die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg Aufgaben eines internationalen Tresors zum Horten von Geld und zum Sichern seiner Funktionen übernommen und darauf ein florierendes Bankengeschäft gegründet. Der Franken war nach dem Krieg neben dem Dollar der einzig unbeschädigte, weltweit anerkannte und frei verfügbare Nationalkredit und hat deswegen für den sich entwickelnden internationalen Geschäftsverkehr Leistungen eines allgemein gültigen und verläßlichen Weltgeldes übernommen, zu der andere Nationalkredite erst einmal gar nicht fähig waren. Er hat dadurch[5] die Entwicklung eines internationalen Finanzwesens erst mit angestoßen, dann beflügelt und darüber seine Stellung im weltweiten Kapitalverkehr gefestigt und ausgebaut.
Und zwar nicht zuletzt im Interesse und im Dienste des offiziellen und inoffiziellen internationalen Zahlungs- und Geschäftsverkehrs auf höchster Ebene. Angesichts des öffentlichen Aufruhrs ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß die jetzt so inkriminierte Schweiz mit ihrem Nationalkredit nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle eines international anerkannten Treuhänders für die Sicherung des zwischenstaatlichen Geldverkehrs übernommen hat; mit der „Bank für internationalen Zahlungsausgleich“ hat sie zunächst als Mittler zwischen den noch nicht voll konvertiblen europäischen Währungen sowie zwischen ihnen und dem Dollar fungiert, dann als Clearingstelle und Verwaltungssitz des Bilanzausgleichs zwischen diesen Nationen, als eine Bank der Notenbanken mit Verbindung zu den internationalen Finanzmärkten; überdies hat sie die Aufgabe des Kassenwarts internationaler Organisationen übernommen. Daneben fungierten Schweizer Banken als hauptsächliche Finanz-Drehscheibe für die Abwicklung des problematischen Verkehrs mit dem Ostblock oder anderen geächteten Staaten; der Weg über die Schweiz ermöglichte denen, die aufgrund ihrer Feindschaft nicht direkt und offiziell miteinander ins Geschäft kommen konnten oder wollten, die unerläßlichen Geld- und Handelsbeziehungen getrennt von den politischen Gegensätzen zu erledigen. Auch Waffengeschäfte und andere politisch brisante Geschäftsaktivitäten wurden, soweit sie nicht zur offiziellen Außenpolitik eines Staates zählen sollten, durch Waffenhändler und andere international tätige Mafiosi im Dienste oder zumindest mit Duldung der für die Weltpolitik zuständigen Nationen gerne über die Schweiz abgewickelt bzw. verrechnet. Schließlich dienten die Schweizer Finanzinstitute als zuverlässige Hausbanken für hochherrschaftliche Konten. Mit ihrer Hilfe haben Führungsfiguren aus aller Herren Länder – Dritt-Welt-Potentaten waren ebenso darunter wie ein bayerisches Urgestein – die im Staatsdienst angeeigneten Vermögen gegen die Unsicherheit der politischen Verhältnisse in ihren Ländern und die Unwägbarkeiten ihrer politischen Karriere versichert.
All das beruhte auf der besonderen Stellung der Schweiz mit ihren von politischen Vorbehalten nicht belasteten Beziehungen zu aller Welt. Sie richtete sich im Status des diplomatischen und ökonomischen Maklers häuslich ein und lebte nicht schlecht davon; denn das hat ihr auch jede Menge Privatvermögen ins Land geschafft. Die andere Basis der florierenden Schweizer Bilanz war nämlich privates Geld aus aller Welt, das sich an diesem Finanzplatz ansammelte. Was es dort vornehmlich suchte und fand, war nicht die Aussicht auf besonders verlockende Geldgeschäfte, also das Spekulative am Kreditgewerbe, sondern dessen andere Seite: Sicherheit. Sicherheit einmal gegen die Gefährdungen, die ihm aus welt-, aber auch währungspolitischen Krisenlagen – Korea-, Berlin-, Kongo-, Kuba- und Pfundkrise usw. – erwuchsen. Sicherheit zum zweiten gegen staatliche Ansprüche und Behelligungen, die nicht ins Konzept der Vermehrung privater Vermögen passen, sowie gegen den hoheitlichen Umgang mit dem jeweiligen nationalen Geld, die seinen Wert unsicher machen. Dafür wissen kleinere und größere Geldbesitzer allerlei Gründe: Längst bevor das Vermögen halbseidenen Charakter annimmt, längst vor Krieg und internationalen Konflikten sind Steuer und Inflation Gründe für seine Auslagerung, also für das, was die betroffenen Nationen gerne Kapital- und Geldflucht nennen. Dafür war die Schweiz ein geeigneter Platz, weil sie das Geld politisch sicher gemacht hat: Solche Flüchtlinge waren herzlich willkommen, nach ihrer Herkunft wurde ebensowenig gefragt wie nach ihren Zukunftsplänen. Dafür diente nicht nur das Bankgeheimnis, das nicht darauf gerichtet ist, Geschäftsfreiheit und eigene hoheitliche Kontrollansprüche zur Deckung zu bringen, sondern auf größtmöglichen Schutz vor Kontrolle von auswärts;[6] die Schweiz insgesamt bot mit ihrer Sonderstellung weitreichende politische Garantien, Geld vor unliebsamer Bedrängnis durch das Ausland zu bewahren – sie selber trat dem Geld nicht zu nahe, sondern beschränkte sich bewußt auf die Rolle des ehrlichen Maklers für jede Art von Vermögen. Kein Wunder, daß sich auch Mafia- und Drogengelder bevorzugt in Zürich und Genf in ordentliche Vermögen verwandelt haben und verwandeln. Zu wieviel Prozent sich der Schweizer Reichtum aus verbrecherischen Quellen speist, mögen die entscheiden, die die Unterscheidung zwischen sauberem und schmutzigem Geld erfunden haben und sich durch die besagten Machenschaften an diesem Finanzplatz jedenfalls nicht haben davon abhalten lassen, internationale Staatsschatzfunktionen, also höchste Vertrauensangelegenheiten, an ihn zu delegieren.
Der Schweizer Franken brauchte als Anlage mit anderen Weltgeldern nicht ökonomisch, etwa über die Höhe der Zinsen zu konkurrieren; die Nachfrage nach ihm war erst recht unabhängig davon, wie es um die produktiven Leistungen der Nationalökonomie im Land des Franken bestellt war. In dieses Geld ging man nicht deswegen, weil es Beteiligung an den Resultaten einer florierenden Produktion im Land eröffnete – die Schweizer „Wirtschaftskraft“ reicht für die Bedienung einer solchen Masse an internationalem Kapital gar nicht aus –, sondern wegen seiner Eignung als Wertgarant und als Medium für internationale Anlagen, die die unterschiedlichen Bedingungen in aller Welt, die Schwankungen der nationalen Gelder, die differierenden Zinsniveaus, die internationalen Börsenkurse usw. vergleichen und ausnutzen. Das bescherte der Schweiz eine ständige weltweite Nachfrage, also automatischen Zufluß an internationalem Kredit und stiftete damit die ökonomische Verläßlichkeit des Wertaufbewahrungsmittels. Dieser Nationalkredit erfüllte insofern vorbildlich die Wünsche des modernen Schatzbildners: Das dem nationalen Geldkreislauf entzogene Kapital war in der „Alpenfestung“ sicherer als im Sparstrumpf aufgehoben und brauchte dabei nicht einmal auf seinen Anspruch auf Vermehrung zu verzichten. Von der Schweiz aus konnte an Geschäften in aller Welt partizipiert werden; denn wo sich soviel internationales Finanzkapital versammelt, da dient es auch und bedient sich der weltweiten Verwendung von Kredit.[7]
Der Schweizer Nationalkredit ist insoweit also das getreue Spiegelbild und die Alternative zum Dollar. In den Dollar geht alle Welt, weil sie die ökonomische Potenz des Weltmarktführers schätzt, weil hinter ihm die Macht der USA steht, auf die Bedingungen der Weltmarktsordnung entscheidenden Einfluß zu nehmen, und weil er mit den herrschaftlichen Garantien einer Weltmacht ausgestattet ist. Dagegen hat sich in der Schweiz soviel Geld angesammelt, weil seine Eigentümer dem Gegenteil, dem Entzug aus nationaler Macht, der strikten Zurückhaltung, was die – ansonsten für imperialistische Staaten charakteristische – politische Kontrolle der unter ihrer Hoheit ablaufenden Finanzgeschäfte angeht, etliche Vorteile abzugewinnen vermögen. Auch dieser Dienst der Schweiz fürs internationale Kapital war von den Weltmächten gewußt und geduldet, selbst wenn es deswegen manches auszusetzen gab.
Nicht bloß einen Finanzplatz zu haben, sondern internationaler Finanzplatz zu sein, das war also die entscheidende Grundlage des stetigen ökonomischen Erfolgs der Schweiz, und der Staatszweck ist ganz in seiner Pflege aufgegangen. Neben der politischen Ausnahmestellung war eine nur auf das Sicherheitsbedürfnis der internationalen Geldanleger ausgerichtete Geldpolitik der zweite politische Dienst, um den sich der Schweizer Staat bemüht hat. Die Währungspolitik stand ganz im Dienste der Stabilität des Franken. Daß er so stabil war und geblieben ist, war allerdings nicht ihre Leistung, sondern war der ständigen Nachfrage nach dem „safe haven“ geschuldet; die hat den Schweizer Währungshütern die Bequemlichkeit eines riesigen Gold- und Devisenschatzes beschert.[8]
Genau diese ökonomische Rolle, dem Geld aus aller Herren Länder Sicherheit zu bieten, und die untrennbar damit verbundene politische Stellung, also das, was die USA bisher geduldet und benutzt haben, ist es, was jetzt von ihnen zum Gegenstand der Kritik gemacht wird. Vorwürfe und einschlägige Begehren gegen die Schweiz von Seiten Amerikas sind zwar nicht neu. Schon früher haben die USA immer wieder moniert, daß Schweizer Banken Hilfestellung leisten bei der Hinterziehung von US-Steuergeldern; bei der Zurverfügungstellung von Riesensummen für unerlaubte Börsen-Insider-Geschäfte; bei der Geldwäsche von „unsauberen Einkünften“ aus Mafiaquellen und Drogen- und Waffenhandel; bei dem Ansammeln von unrechtmäßigen Vermögen von Drittweltpotentaten und Diktatoren, das denen nicht oder nicht mehr zusteht, weil die USA sie von vornherein als Feinde eingestuft oder irgendwann fallengelassen haben. Daß sie selbst den Diktatoren das Geld in die Tasche gesteckt haben, ist eine Ironie der Weltgeschichte, die deren Machern weniger Sorgen bereitet als der Umstand, daß diese Figuren, einmal von den USA abserviert, nicht mit der Privatisierung dieser Riesensummen belohnt werden dürfen. Aufgrund ständiger amerikanischer Beschwerden hat sich die Schweiz im Interesse einer weiteren „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ schon in den 70-er Jahren zum Abschluß eines Rechtshilfeabkommens mit den USA und zur Einschränkung des Bankgeheimnisses für Tochterfirmen amerikanischer Banken in der Schweiz bereitgefunden. Zufriedengestellt hat sie die USA damit nicht.[9] Neu ist aber der prinzipielle Charakter der Kampagne, mit der US-Stellen die Schweizer Staatsräson selber zum Vergehen erklären, und die Unerbittlichkeit, mit der sie der Affäre den Charakter einer Bloßstellung und Unterordnung der Schweiz verleihen.
Eine „starke neutrale Schweiz“ steht nämlich nicht mehr auf der Prioritätenliste der USA, und ein alternatives Refugium von Geld wollen sie nicht mehr (dulden).[10] Daß sich mit dem Ostblock auch die zwingenden politischen Gründe für diesen Status erledigt haben, das genügt für sich schon für die imperialistische Vormacht, bisherige Rücksichten fallen zu lassen und einen solchen Finanzplatz, an dem sie des öfteren Anstoß genommen hat, für nicht mehr tragbar zu befinden. Darüber hinaus hat sich bei der einzig verbliebenen Weltmacht mit der neuen Lage ein neuer Kontrollbedarf eingestellt – in politischen wie in Gelddingen.[11] Erstens sehen sich die USA mehr denn je dazu befähigt und befugt, in der internationalen Konkurrenz auf einen Amerika genehmen Gebrauch der weltweiten Konkurrenzbedingungen und -mittel achtzugeben. Ihre Schäden in der ökonomischen Konkurrenz erklären sie sich ja nicht zuletzt daraus, daß sie diese notwendige Aufsicht vernachlässigt haben. Daß sich Geld ihrer politischen Kontrolle entzieht, ist für sie gleichbedeutend damit, daß verbrecherische Kreise das Falsche damit anstellen, nämlich Amerika schädigen – wohingegen das Geld unter US-Aufsicht nicht etwa fremden Nationen Schaden zufügt, sondern den Amerika zustehenden Erfolg verbürgt.
Zweitens bezieht Amerika das weltweite Geschäftsleben jetzt verstärkt auf sein politisches Interesse an Beaufsichtigung der Staatenwelt und dringt auf entsprechende Korrekturen.[12] Ins Visier gerät damit die Eigenschaft des Geldes, daß sich mit ihm Machthaber erpressen, unliebsame Verhältnisse und Figuren materiell austrocknen und kontrollieren lassen. So drängt es sich den USA auf, daß sie in Sachen Geldaufsicht einiges haben schleifen lassen. Unrechtmäßig erworbenes – d.h. durch Amerika politisch nicht abgesegnetes – Geld darf nicht länger die Handlungsfreiheit eingeräumt bekommen, antiamerikanische politische Absichten zu verfolgen. Für den universellen Weltaufsichtsbedarf, der von der lateinamerikanischen Drogenmafia bis zum Irak reicht und nach der Austrocknung von deren Quellen verlangt, nimmt sich die Schweizer Rolle im internationalen Finanzwesen wie eine Gelegenheit für die Feinde Amerikas aus, sich dem verdienten Zugriff zu entziehen: wie eine Kumpanei mit weltpolitischen Störfällen, die deren erwünschte Erledigung hintertreibt. Daher gelten die bisherigen Rechnungen mit der neutralen Schweiz als falsche Konzession und das Land als unrechtmäßiger Nutznießer einer viel zu liberalen Organisation der Weltwirtschaft durch die USA. Entsprechend führen sie sich auf und demonstrieren den Willen und die Fähigkeit, die bisher gültigen Konditionen zu korrigieren.
Das Ergebnis ist durchschlagend: Das Verlangen eines weltöffentlichen Schuldbekenntnisses, in Zeiten der Not die Weltgemeinschaft aus schnödem Eigennutz an die Nazis verraten zu haben, ist an und für sich schon eine diplomatische Zumutung allerersten Ranges. Erst recht in diesem Fall. Es wird nicht nur der gute Ruf von ein paar Nobelbanken angekratzt und dem Selbstverständnis der Nation als wackeres demokratisches Bollwerk gegen den Faschismus das moralische Fundament entzogen. Durch die Einrichtung einer gewissen internationalen Kontrolle in dieser Angelegenheit ist ansatzweise das Bankgeheimnis gelüftet und die Stellung der Schweizer Banken unterminiert.[13] Dadurch daß Schweizer Regierung und Banken notgedrungen auf amerikanische Begehren eingehen, wird abgesehen von dem verschmerzbaren materiellen Schaden die Basis des Finanzplatzes Schweiz angegriffen, das Vertrauen der Geldanleger in die Sicherheit, die ihnen die Schweiz zu bieten vermag. Das „wichtigste Kapital“ der Schweiz, das „Vertrauen“, ist nämlich nichts, was die Schweiz aus eigener Macht zu garantieren vermag. Stellt die Supermacht das Einvernehmen infrage, steht es mit dem Vertrauen in die Unantastbarkeit des Finanzplatzes Schweiz nicht mehr zum besten.
Den Versuchen der Schweizer Regierung und ihrer Banken, durch eine Mischung aus Entgegenkommen und Hinhaltetaktik den Schaden abzuwenden, ist wenig Erfolg beschieden. Sich gegen das amerikanische Begehren zu verwahren und die „Diffamierungskampagne“ unschädlich zu machen, liegt ebensowenig in ihrer Macht, wie die Alternative, durch Zeichen des guten Willens das Einvernehmen Amerikas wiederzugewinnen und dabei sicherzustellen, daß die Schweizer Hoheit nicht beschädigt wird. Sie ist dem Gutdünken der US-Stellen ausgeliefert, wie weit sie die Affäre treiben wollen und wo das Interesse am Bankplatz Schweiz, den Amerika kontrollieren, aber nicht ruinieren will, Rücksicht geboten erscheinen läßt. Brauchbare Alternativen, wie der Verlegenheit zu begegnen sei, sind nicht in Sicht. Daher die angestrengten Bemühungen, den Schaden wenigstens zu begrenzen und die angegriffene Ehre der Schweiz hochzuhalten.[14]
III. Die ökonomische Bedrohung des Finanzplatzes Schweiz durch das Euro-Projekt
Auch ökonomisch ist der Schweiz eine neue „Herausforderung“ erwachsen, die für die Banken und Währungshüter nicht minder beunruhigend und bedrohlich ist. Mit dem Programm eines gemeinsamen Geldes der EU-Staaten kommt auf die Schweiz ja nicht einfach eine Erweiterung des internationalen Finanzgeschäfts zu, um das die Schweizer „Finanzdrehscheibe“ inzwischen mit allen möglichen „Off-shore-Plätzen“, „Steuerparadiesen“, vor allem aber mit den Bankplätzen in den führenden Weltmarktnationen konkurriert, an dem sie aber wie immer mitbeteiligt ist. Auf der Tagesordnung ist mit dem Euro das Programm eines neuen europäischen Kreditgeldes, das mit seiner Masse und der Wucht der Nationalökonomien, die sich seiner bedienen, gleichgewichtig neben den Dollar tritt. Damit werden zugleich entscheidende Grundlagen der Vorzugsstellung des Franken angegriffen.
Mit dem Projekt geht nämlich ein wesentlicher Teil der Geschäftsmittel verloren, die den Franken ausgezeichnet und begehrt gemacht haben. Die Gemeinschaftswährung macht ja nicht nur den zu einem Gutteil über die Schweiz als Devisensammelstelle abgewickelten Transfer zwischen den Euro-Staaten überflüssig. Der Euro beseitigt mit den unterschiedlichen Nationaluniformen des Reichtums auch den Vergleich der mehr oder weniger gefragten Gelder der EU-Staaten mit ihren national verschiedenen Konjunktur-, Inflations- und Zinsdaten und anderen Indices, die Anlageprofis zum ständigen Kalkulieren mit Anlagen in dem einen oder anderen Geld bewegen, und damit eine Hauptquelle des Schweizer Bankengeschäfts; das beruht nicht zuletzt darauf, daß der Franken Geldvermögen gegen die unterschiedlichen nationalen Bedingungen in Europa absichert und die Unterschiede auszunutzen erlaubt. Statt dessen wird ein einziges Geld zum Mittel und Zweck aller geschäftlichen Transaktionen und Kapitalanlagen in den führenden Nationen Europas. In den Schweizer Bilanzen mit ihren internationalen Einlagen steht mit einem Schlag statt der verschiedenen Posten eine riesige Masse von Euro-Konten, so daß sich dessen Bewegung für den Franken mit ganz anderer Wucht geltend macht. Und der Finanzplatz hat es künftig nicht mehr mit den finanz- und währungspolitischen Entscheidungen von mehreren nationalen Währungshütern zu tun, sondern sieht sich mit den versammelten Kreditansprüchen und -beschlüssen eines die Konkurrenz in Europa dominierenden Euro-Blocks konfrontiert. Das neue europäische Weltgeldprogramm greift also die Qualität des Schweizer Franken als eines bevorzugten internationalen Geschäftsmittels an und setzt ihn der unabsehbaren Bewährungsprobe aus, was er in Konkurrenz zu diesem neuen Gemeinschaftskredit taugt.[15]
Wenn die geübten Finanzberater angesichts einer
ungewissen Zukunft an der Währungsfront das Motto
verkünden: ‚Prepare for the worst and hope for the best‘,
geben sie aber noch einer anderen Hilflosigkeit gegenüber
den europäischen Fortschritten Ausdruck. Das Projekt, das
die Frankenhüter nicht mitbeschlossen haben, droht in
ihren Augen den Franken noch viel sicherer zu behelligen,
wenn es nicht zur Zufriedenheit seiner Macher
gelingt.[16]
Eine verläßliche Basis für eine bleibende Weltgeltung des
Finanzplatzes Schweiz ist es ja wirklich nicht, wenn die
EU das gewünschte Vertrauen in die Entschlossenheit und
Fähigkeit, eine gemeinsame und dabei schlagkräftige
Einheitswährung zustande zu bringen, nicht zu stiften
vermag oder der neue Kredit, dessen sich mehrere Nationen
bedienen, nicht die entsprechenden Dienste für das
Wachstum von Kapital leistet. Die Geltung des Franken
beruht schließlich auf der mit ihm gegebenen Möglichkeit,
sich überall anzulegen, wo es sich lohnt und besondere
Bonität
garantiert ist. Eine bevorzugte Leistung
Schweizer Banken ist es, den Großkunden ein sicheres
Geschäft mit den unterschiedlichen europäischen
Anlagegelegenheiten zu eröffnen, indem sie Beteiligungen
an allem bieten – deutsche Aktien, italienische
Staatspapiere, Francs-Beteiligungen usw. – und dadurch
die jeweils besonderen Risiken von Währungsschwankungen,
Zinsbewegungen usw. zu begrenzen ermöglichen. Gegen einen
Zinsabschlag versichern sie ihre Kundschaft im
internationalen Geschäft so gegen dessen Unsicherheiten.
Das können sie, weil und soweit die Konkurrenz der
Währungen zwar ein ständiges Auf und Ab und die sonstigen
Unterschiede produziert, auf die gesetzt werden kann und
gegen die sich versichert werden muß, aber nicht zu
unabsehbaren Bewegungen und Kreditschädigungen führt, die
unweigerlich die Einlagen und Geschäftsartikel der
Schweizer Banken, d.h. die „Versicherung“ selber in
Mitleidenschaft ziehen. Profitiert hat die Schweiz
insofern von dem bisherigen europäischen Währungssystem,
das diese Konkurrenz freigesetzt, zugleich aber mit
gemeinschaftlichen Vorkehrungen gegen seine
unvermeidlichen störenden Wirkungen versehen hat. Das hat
bisher dem Finanzplatz Schweiz einen von Konjunkturen
unabhängigen Zufluß von internationalem Kapital
gesichert. Und das wird auf die Dauer
untergraben, wenn das bisherige Währungsgefüge
samt seinen relativen Garantien nicht bloß wegzufallen
droht, sondern längst unsicher geworden bzw. teilweise
gekündigt ist; das wird behelligt, wenn die
Kreditbasis ausgerechnet in den wirtschaftlichen Zentren
Europas besonderen Risiken ausgesetzt ist oder allgemein
Schaden nimmt. Insofern steht, wenn schon sonst nichts,
zumindest eines fest: Die Unwägbarkeiten des
Euro(pa)-Projekts machen die Grundlagen des Schweizer
Finanzgeschäfts unsicher und gefährden damit
eben die Eigenschaft, die den Finanzplatz zu einem
bevorzugten Anlageobjekt des weltweit agierenden Kapitals
gemacht hat.
Das Euro-Projekt ändert also die bisherige Position des Franken in der Konkurrenz der Nationalkredite, und damit das, was sich die Nation als Leistung ihrer eigenständigen und besonders vertrauenserweckenden Finanzpolitik zugutegehalten hat, ohne daß die Schweiz selber irgendetwas geändert hätte und ohne daß sie Entscheidendes daran ändern könnte: Auf das Projekt Euro hat sie keinen Einfluß, und Kompensation ist nicht abzusehen.[17] Also muß sich das Land darauf einstellen, daß durch das Dollar-Konkurrenzprogramm der Nachbarn sowohl die internationale Nachfrage nach seinem Nationalkredit wie das bisherige Angebot für seine internationale Anlage entscheidend geschmälert wird.
IV. Die neue Frage: Was ist der Wirtschaftsstandort Schweiz in und mit Europa wert?
Für die Nation, der politisch wie ökonomisch die bisherigen Sicherheiten verloren gehen, steht deshalb eine Überprüfung und Neusortierung ihrer Reichtumsquellen an. Weil sie sich nicht mehr darauf verlassen kann, daß sich Kapital aus aller Welt wie selbstverständlich in ihren Banken sammelt und vermehrt, sieht sie sich verstärkt darauf verwiesen, daß ihre Unternehmen in aller Welt gutes Geld verdienen. Damit stellt sich dringlich die Frage, was die Schweiz als Wirtschaftsstandort taugt: Wie sich die nationale Geschäftswelt auf dem Weltmarkt zu bewähren, welche produktiven Quellen des Reichtums sie zu mobilisieren vermag. Also auch die Frage, was die Nation dafür tun kann, die internationalen Märkte mehr als bisher zum Mittel für die nationale Reichtumsbilanz zu machen. Kurz: Die Schweiz sieht sich zu standortpolitischen Anstrengungen genötigt, die dem nationalen Kapital weltweite Konkurrenzgelegenheiten und -erfolge eröffnen sollen.
Daß sich Schweizer Unternehmen international schon zu behaupten vermögen und an den Wachstumsfortschritten in Europa und anderswo partizipieren, war lange Zeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das Land mußte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erst ein zerstörtes Wirtschaftsleben wieder aufbauen, Weltmarktpositionen erobern und Kapital entsprechender Größe akkumulieren; von Anfang an waren Schweizer Großfirmen samt einer nicht geringen Rüstungsindustrie auf dem Weltmarkt heimisch – schon wieder so ähnlich, wenn auch in anderem Maßstab als die USA. Mit der Expansion des globalen Geschäfts hat sich auch das der Schweiz erfolgreich fortentwickelt – und mit ihm die Schweiz als Standort produktiven Kapitals. Dessen eine kapitalistische Eigenart liegt darin, nicht in erster Linie Markt, also Realisierungssphäre zu sein – der Schweizer Binnenmarkt ist nur ein Unterposten des Geschäfts, das von diesem Land ausgeht –, sondern Heimstatt von Kapital, das anderswo, weltweit tätig ist: Stammplatz einiger Schweizer Weltunternehmen, die von hier aus laufend ins übrige Europa und die USA expandiert haben und frühzeitig zu den führenden Multis bei Chemie-, Pharma-, Nahrungsmittelindustrie und Anlagenbau gehörten; und Standort ausländischer Konzerne, die über die Schweiz vornehmlich ihr Europageschäft tätigen.
Die zweite kapitalistische Besonderheit liegt, wie schon gesagt, darin, daß diese produktive Ausstattung des Landes – einschließlich der „anerkannt leistungsfähigen mittelständischen Industrieunternehmen“ – nicht die hauptsächliche Quelle für den Reichtum dieses Landes und seinen wachsenden Kredit war, sondern, umgekehrt, Nutznießer des Kredits, den der Finanzplatz Schweiz weltweit angezogen hat. Die Industrie mußte mit ihren produktiven Leistungen kein florierendes Kreditwesen begründen, mit ihren Unternehmungen nicht immer erst international Geld akkumulieren, also den Nationalkredit mit ihren Geschäftserfolgen laufend beglaubigen. Die heimischen Kapitalisten haben umgekehrt immer über ausreichende „internationale Liquidität“ verfügen können, um für das Weltgeschäft mit seinen Anforderungen gerüstet zu sein: Auswärtige Einlagen haben ständig im Land nach lohnenden Anlagen gesucht; und gleichzeitig standen die Banken mit wachsenden Mitteln für Kapitalexport bereit.[18] Das hat der produktiven Wirtschaft zu ihrer Konkurrenzfähigkeit und ihren globalen Konkurrenzerfolgen verholfen und dem Land ein Wachstum beschert, das sich durch die nationalen Grenzen des Arbeitskräftereservoirs nicht hat beschränken lassen; auch was eine flexibel handhabbare Reservearmee angeht, ist die Schweiz internationalisiert – mit all den nationalen Reglementierungen und Vorbehalten, die eine unverhältnismäßig große Zahl billiger „Fremdarbeiter“ aus den ärmeren Landstrichen des südlichen Europas eben mit sich bringt.
Wegen dieser Eigenart der Teilhabe am Weltgeschäft hat sich für die Schweiz die Alternative eines Beitritts zur EU nicht gestellt – jedenfalls nicht so, daß sie es als dringende Notwendigkeit oder gar Not empfunden hätte, sich den Zugang zu diesem Markt durch eine Mitgliedschaft in der EU zu sichern. Sie hat den zu erwartenden Nutzen einer Zugehörigkeit zur Europäischen Union gegen den Nachteil abgewogen, ihren eigenen ökonomischen Internationalismus aufgeben zu müssen, hat auf die durch Eigenständigkeit gesicherte Attraktivität des Franken und darauf gesetzt, daß ihre Unternehmen auf den auswärtigen Märkten, allen voran ihre Multis, auch so genügend Erfolg haben würden – zumal es ja auch gute, politische Gründe gab, ihre Sonderrolle nicht einengen zu lassen. Zu mehr als einer EFTA-Teilnahme – also einer Handels- und Zollunion in Konkurrenz zu den weitergehenden wirtschaftspolitischen Verpflichtungen im Rahmen einer EU – wollte sich die Schweiz nicht verpflichten. Dabei ist sie auch geblieben, als die EFTA sich aufzulösen und die EU sich auszuweiten begann.
Das neue Bedürfnis nach standortpolitischen Erfolgen sorgt dafür, daß die bisherige Internationalisierung Schweizer Geschäfte jetzt vorrangig als Fehlen eines nationalen Marktes, also als Zwang zur Kenntnis genommen wird, sich auf auswärtigen Märkten zu bewähren. Deshalb gewinnt das Vereinte Europa für die Schweiz eine neue Bedeutung – und wird prompt zum Problem, das zwar nicht ganz neu ist, sich aber jetzt erstmals wirklich als nationale Zwangslage geltend macht: Die EU, immer schon die vorrangige auswärtige Geschäftssphäre, hat sich inzwischen zum europäischen Wirtschaftsblock erweitert, der für den selbständigen Nachbarn ziemlich alternativlos geworden ist – alternativlos, was die Gelegenheiten in diesem großen Wirtschaftsraum angeht, alternativlos aber eben auch, was die Konditionen angeht. Die externe Stellung zur EU, gestern noch eher Garant als Hindernis eines andauernden Schweizer Wirtschaftswunders, ist kein Vorzug mehr, sondern eine einzige Gefahr: drohender Ausschluß von dringend benötigten Geschäften. Also ist die Schweiz darauf aus, sich verbesserten Zugang zu verschaffen – und sieht sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich den Ansprüchen der EU gemäß zu machen.
Anpassungsbedarf machen nicht nur die Schweizer Unternehmen geltend, die mit Verweis auf ihre Standortfreiheit bessere Konkurrenzbedingungen und Befreiung von Umweltauflagen und anderen staatlichen Reglementierungen verlangen. Umfassenden Anpassungsbedarf melden vor allem die Standortpolitiker der EU an, die mit der Schweiz über eine generelle Neuregelung der wechselseitigen Konzessionen und Bedingungen verhandeln. In diesen Verhandlungen über Bestimmungen des Kapitalverkehrs, Flugkonzessionen, Energie und Telekommunikation, Aufenthalts- und Zuzugsfreiheit und sonstige generelle Standortregelungen erfährt die Schweiz den Preis ihrer bisherigen Freiheit: Erstens ist ihre Entscheidungsfreiheit materiell untergraben, weil der Standort Schweiz von Novartis bis Schoggi, vom Rindfleisch bis zum High-Tech längst faktisch eingemeindet ist als gewichtiges Anhängsel des gesamteuropäischen Wirtschaftsraums, dessen entscheidende Konditionen anderswo entschieden werden. Zweitens verlangen die Verantwortlichen für diesen „Markt von 360 Millionen Bürgern“ von der Schweiz nicht nur „Marktöffnung“, sondern eine Ausrichtung der gesamten nationalen Verhältnisse an EU-Erfordernissen: nicht zuletzt „Öffnung“ des Schweizer Bankgeheimnisses – auf der deutschen Liste steht die Anpassung der Schweizer Banken- und Steuerhinterziehungsregelungen ganz oben – und, immer noch Hauptstreitgegenstand in den Verhandlungen der Schweiz mit Brüssel, eine neue „Öffnung“ des Landes für den Transitverkehr. Erpresserisch besteht die EU insbesondere in letzterem Punkt auf dem Recht, die Schweiz als ihr Durchgangsland zu nutzen. Damit durchkreuzt sie gründlich deren Berechnungen in einer entscheidenden Standortfrage, in der für das Alpenland von Haus aus keine neuen europäischen Perspektiven, sondern nur europäische Lasten zur Debatte stehen, die es zu tragen hat.[19]
Die EU leistet mit ihrer Intransigenz das Ihre, um die erfolgsgewohnte Schweiz spüren zu lassen, daß die Konkurrenzfähigkeit eines Standorts vor allem anderen an der Zulassung zur Konkurrenz, also an den Bedingungen hängt, die Nationen dafür setzen und anderen aufzunötigen imstande sind – und daß da im jetzigen Europa die Verhältnisse eindeutig sind. Darauf bedacht, sich den europäischen Markt als Profitquelle neu zu erschließen, erfährt die Schweiz ihre Ohnmacht gegenüber den Vorschriften und Regelungen, die für den Zugang zu diesem Markt gelten, der eben gar nicht bloß „Markt“ ist, und ihre begrenzte Macht, eigenen Standortinteressen in Europa politisch Geltung zu verschaffen.[20] Kein Wunder, daß im Land Bedenken aufkommen, was die wirtschaftspolitische Unabhängigkeit der Schweiz eigentlich noch wert ist, und sich die Frage nach dem künftigen Verhältnis zur EU in Form der Alternative „autonomer Nachvollzug“ von EU-Vorgaben oder lieber gleich „Beitritt“ stellt.
Allerdings steht bei der Abwägung mehr zur Debatte als die geschickteste Art, mit dem Anpassungszwang bei Normen, Wirtschaftsrecht und anderen Konkurrenzbedingungen bestmöglich fertig zu werden und Einfluß auf die einschlägigen europäischen Entscheidungen zu nehmen. Gesucht wird in Wahrheit nach einem neuen verläßlichen Sonderstatus, der für das Land beides sichert: neue Zulassungsgarantien zu den Geschäften, die der Wirtschaftsblock unter seiner Regie versammelt, und die Bewahrung des EU-externen Finanzplatzes. Denn sich anzuschließen, den eigenen Nationalkredit im Euro-Projekt aufgehen zu lassen und sich mit dem zu bescheiden, was man als dann gewöhnlicher kleinstaatlicher Teilnehmer der innereuropäischen Standortkonkurrenz an Euro-Reichtum zu akkumulieren vermag, daran ist nach wie vor nicht gedacht. Gedacht ist vielmehr daran, wie man die Alternative vermeiden kann, vor die man sich jetzt gestellt sieht: daß das Verlangen, die nationale Reichtumsbilanz durch die Benutzung Europas aufzubessern, die Aufgabe wirtschaftspolitischer Vorbehalte erzwingt und den Anschluß zweckmäßig erscheinen läßt; daß aber das Interesse, eine reichtumsförderliche Sonderstellung des Franken in allen Umbrüchen zu erhalten, Zurückhaltung gegenüber einem solchen Übergang gebietet. Daher stehen die Schweizer Zukunftsplaner vor der Entscheidung, wieviel ihnen die jeweilige Alternative wert ist – und hoffen darauf, daß ihnen diese Entscheidung erspart bleibt, zumindest leichter gemacht wird. Wenn man schon keine Macht hat, der EU eine passende Sonderstellung aufzunötigen, dann kann man immer noch darauf spekulieren, daß die EU sich „wegen ihrer zunehmenden internen Heterogenität“ von selber bereit finden könnte, „einen Sonderstatus der Schweiz weiterhin zu akzeptieren“ (NZZ, 5.4.97), und so der Schweiz die Gelegenheit bietet, sich anzubinden, ohne ihren bisherigen Weg ganz aufgeben zu müssen. Solche Hoffnungen richten sich auf den Finanzplatz, weil die EU damit befaßt ist,
„die Frage der Beziehungen zwischen den Staaten der Einheitswährung („in“) und den anderen EU-Staaten („out“) genau zu prüfen. Ein Drittland wie die Schweiz sollte diesen günstigen Augenblick nicht ungenutzt lassen, … um so mehr, als die Schweiz im monetären Bereich über einen entscheidenden komparativen Vorteil verfügt und eine Verantwortung besitzt, die weit über die Dimension ihres Staatsgebiets hinausgeht. Insofern wäre unser Land gewiß in der Lage, bei der Gestaltung dieser neuen politischen Landschaft mitzuwirken.“ („Die Schweiz und die WWU“ in: Die Volkswirtschaft 4/96)
Und solche Hoffnungen richten sich auf den Wirtschaftsstandort bzw. die Schweiz insgesamt:
„Es ist durchaus denkbar, daß die EU differenziertere Formen der Mitgliedschaft entwickeln wird, die es besser ermöglichen werden, die besonderen politischen Bedingungen der Schweiz aufzunehmen. Für eine solche Entwicklung spricht einerseits die Schwierigkeit der bestehenden Mitglieder, weitere Integrationsschritte für alle verbindlich zu definieren… Ein starker Druck wird sich auch aus der Ost- bzw. Mittelmeererweiterung ergeben. Die EU wird die Herausforderung der gleichzeitigen Erweiterung und Vertiefung nur mit einer größeren Flexibilität bezüglich der Mitgliedschaftsformen bewältigen können. In einem solchen Szenario wäre der Unterschied zwischen einer sich weiterentwickelnden bilateralen Beziehung und einer Mitgliedschaft nicht mehr unüberwindlich…“ (Hauser, S.18)
In der Hand hat die Schweiz das alles freilich nicht, wie diesen frommen Ratschlägen unschwer anzumerken ist.
V. Die neuen Lasten der nationalen Politisierung: „Die Schweiz am Ende – am Ende die Schweiz?“
Der Entscheidungsbedarf, den die neuen imperialistischen Verhältnisse stiften, verlangt, Rechenschaft abzulegen über den Stand der Nation und ihren künftigen Weg. Und Rechenschaft wird abgelegt, allerdings sehr sachfremd – so wie das Patrioten eben zu tun pflegen: Gestritten wird nicht über die wirtschaftlichen und politischen Interessen sowie die Lage, die Korrekturen am bisherigen Erfolgsweg gebieten. Die unhaltbar gewordene internationale Stellung der Schweiz wird wie eine falsche nationale Einstellung der Schweizer zu sich und ihren Aufgaben in der Welt verhandelt. Und die Tatsache, daß Amerika seinen politischen Angriff auf die Schweiz in Gewand einer rufschädigenden Moralkampagne vorträgt, ist bestens dazu geeignet, die Schweizer Gemüter darin zu bestätigen – und entsprechend aufzuwühlen. Sie halten nichts mehr auseinander; alles – die Zukunft des Finanzplatzes, die EU-Frage, die künftige politische Ausrichtung – wird jetzt wie ein Teil des durch Amerikas Attacken ans Tageslicht gebrachten Grundproblems behandelt, daß die Schweiz mit sich und der Welt moralisch nicht im Reinen ist. So geben die praktischen Erfordernisse und Schwierigkeiten einer Anpassung an die veränderten imperialistischen Gegebenheiten das Material für eine Krisendiagnose gehobener Art ab: Die nationale Identität der Schweiz steht auf dem Spiel. Wie der konstatierte Zwiespalt zu beheben sei, daran scheiden sich die Geister. Gestritten wird darüber, ob der Schweizer Art mehr Nationalismus oder mehr Internationalismus anstünde.
Damit fällt auseinander, was im politischen Leben dieses Landes unter den früheren Verhältnissen ziemlich problemlos zusammenging: der völkische Patriotismus mit seinem Bekenntnis zur eigenen, gegen die ganze Welt bewahrten und zu bewahrenden Schweizer Art auf der einen Seite; der Internationalismus der für das große Geld und die große Politik Zuständigen und der Intellektuellen mit dem gepflegten Selbstbewußtsein besonderer Weltoffenheit auf der anderen Seite. Die Sachwalter des großen Geldes und der internationalen Diplomatie haben den Massen die eigentlichen Quellen des Schweizer Erfolgs ja nie nachdrücklich ans Herz gelegt, geschweige denn richtig erklärt, sondern im Gegenteil den Glauben an die eigene Kraft, das patriotische Selbstbewußtsein des Volks mit seinen Vorbehalten gegen alles Fremde gepflegt. Eine irgendwie geartete Befassung mit den wirklichen internationalen Abhängigkeitsverhältnissen gehörte nicht gerade zum Kanon des offiziell gültigen Schweizer Selbstbilds – und mußte es auch nicht, solange sich die Pflege volkstümlicher Denk- und Aufführensweisen dank der nationalen Erfolge mit den internationalistischen Anforderungen der Schweizer Staatsräson von alleine vertrug. Jetzt ist das anders – und die nationale Öffentlichkeit gründlich gespalten.
Der eine Teil, repräsentiert durch den Nationalrat Christoph Blocher, steht fest auf dem Standpunkt, daß die nationalen Ehre nicht verloren ist – „Wir haben uns unserer Geschichte nicht zu schämen!“ (SZ 27.6.97) –, sondern durch Machenschaften des Auslands – jüdische, US- und andere Kreise – mit Füßen getreten wird. ‚In Treue fest!‘ heißt die Devise, wie wenn die Stellung der Schweiz in der Welt bloß an dem unerschütterlichen Willen ihrer Vertreter hinge, die neue Lage als eine Ansammlung von Anfeindungen und Anschlägen auf die Souveränität der Schweiz aufzufassen und entschieden zurückzuweisen:
„Wie kommt eigentlich ein fremder Staat dazu, über die 50 Jahre zurückliegende Vergangenheit eines anderen souveränen Staates zu Gericht zu sitzen? Warum verbittet sich der Bundesrat diese Art des Umgangs nicht ein für allemal?“ (NZZ 23.6.97)
Deswegen appelliert Blocher an den schon zu Hitlers Zeiten bewiesenen Durchhaltewillen gegen alle Anfechtungen durch Amerika und das EU-Europa nach dem altbewährten Schweizer Erfolgsrezept ‚Das gute Volk baut auf sich selbst allein; das trägt ihm den Respekt der Welt ein‘. Daß es nicht die Schweizer Eigenart war, die dem Land den „Respekt der Welt“ verschafft hat, sondern daß das auswärtige Interesse an einer Schweizer Sonderstellung dem „Schweizer Sonderweg“ Dauer und Erfolg beschert hat, kümmert ihn nicht. Mit seinem Aufruf zur „Rückbesinnung“ auf die Werte, die die Schweiz groß und anerkannt gemacht haben sollen, beharrt der aufgebrachte Nationalist einfach darauf, daß der Schweiz auch in der neuen Lage die alte Stellung gebührt. Für die Notwendigkeit, der Schweiz einen neuen anerkannten Platz im Weltmarkt und Weltgeschehen zu finden, sind solche Vorstöße wenig dienlich. Sie melden nur den nachdrücklichen Anspruch an, daß es ein angemessener Platz zu sein hat, soll er die Anerkennung der Schweiz finden. Das ist Volkes Stimme.
Für die Gegenpartei steht fest, daß die Schweiz ihre Ehre durch eigenes Verschulden verloren hat. Sie beschwört mit Berufung auf die moralischen Richterinstanzen Amerika, Juden, Weltöffentlichkeit die Schuld der Schweiz, möchte ihren Landsleuten eine Runde Schämen über ihr bisheriges Schweizerwesen verordnen – und geht mit gutem Beispiel voran:
„Wir … fühlen uns von keiner jüdischen Organisation unter Druck gesetzt, jedoch vom Verhalten der Schweizer Banken und des Schweizerischen Bundesrates diskreditiert… Die Behörden dürfen nicht mehr ihre Politik nach den Interessen der Banken ausrichten.“ (SZ 31.1.97)
Diese besseren Schweizer, die nicht die Schweiz, aber unbedingt deren „Mythos“ abschaffen wollen, lesen die Gleichung von Schweizer Eigenart und Weltgeltung umgekehrt: Nur wenn die Schweiz sich dazu bekennt, ihrer internationalen „Verantwortung“ zu Hitlers Zeit und eigentlich bis heute nicht nachgekommen zu sein, wird sie die Anerkennung der Staatenwelt finden. Die hat die Schweiz ihrer Meinung nach nämlich nie wirklich gehabt:
„Nicht einmal ihre Sauberkeit hat die Schweiz so beliebt gemacht, wie sie es gerne glaubte. Da lag immer die Frage in der Luft: Und wo lassen die ihren Schmutz?“ (Adolf Muschg „Die stickige Luft wird weggeweht“, Gespräch im Spiegel 12/97)
In der alten Sonderrolle als Finanzplatz und diplomatische Börse wollen sie kein bißchen seriösen Internationalismus, sondern nur Eigenbrötelei entdecken, und Leuten wie Blocher werfen sie – ausgerechnet – bornierten Verzicht auf die Teilnahme an den eigentlichen Weltgeschäften vor. Das Heil liegt für sie nämlich darin, endlich eine neue, die längst fällige Rolle in der Welt zu finden. Die amerikanische Kampagne – als Selbstreinigungsbegehren mißdeutet – wird zur Sache von Heimatkritikern, die aus dem Schattendasein des Nestbeschmutzers in die anerkannte Rolle des nationalen Besserwissers schlüpfen und tätige Reue empfehlen, wie wenn die Schweiz durch eine politmoralische Erneuerung im Geiste des Antifaschismus sich endlich Weltgeltung erobern würde. Deshalb sind sie zufrieden, daß es nicht mehr so weitergeht:
„Ich fühle mich befreit. Der Schweizer Sonderfall ist definitiv durchgefallen. Auch bei uns wird jetzt nach einem neuen Skript gespielt… Splendid war unsere Isolation schon lange nicht mehr. Doch erst nach 1989 wurde sie absurd. Da begann es vielen Schweizern zu dämmern, daß nicht die ganze Welt verkehrt sein könne, sondern daß sie selbst verkehrt sein müssen.“ (ebd.)
Anschluß an Europa und die Welt sucht die Schweiz, so gesehen, nicht, weil sich die politischen und ökonomischen Grundlagen und Berechnungen geändert haben, sondern um endlich ihre moralisch verwerfliche Enge abzustreifen und sich „frei“ – bekanntlich die hervorstechendste Eigenschaft im Lande Wilhelm Tells – „fühlen“ zu können: endlich beheimatet im Kreis der Mächtigen. „Raus aus der Isolation!“ – heißt die falsche Parole; Isolation war ja nicht gerade die Methode, der die Schweiz ihren Reichtum verdankt, und raus aus dem Nationalismus gehen solche Kritiker auch nicht. Sie propagieren das originelle Rezept, sich mit kollektiven Schuldbekenntnissen endlich von falscher weltpolitischer Enthaltsamkeit zu verabschieden. „Die Schweiz am Ende – Am Ende die Schweiz“ (Adolf Muschg, Buchtitel zur 700-Jahrfeier 1991), das ist die Stimme der nationalen Elite.[21]
Die Schweizer Bundesregierung mit ihrer Linie ‚Soviel schämen wie nötig, soviel Stolz wie möglich!‘ kann es keiner der beiden Seiten recht machen. Wenn sie in Blocher-Manier zum Nationalfeiertag bekanntgibt:
„Wir brauchen weder ausländische noch inländische Propheten. Die Leute haben nun zum Teil genug, vor allem wegen der unqualifizierten Angriffe und der Pauschalangriffe.“ (SZ 2.8.97),
bestärkt sie ihr Volk und stößt die große Koalition aus Amerika und Muschgs vor den Kopf. Kommt sie widerwillig den amerikanischen Begehren entgegen oder gibt den EU-Forderungen nach, bringt sie den Selbständigkeits-Nationalismus der gar nicht schweigenden Mehrheit gegen sich auf. So gibt es sie dann wirklich, die „Identitätskrise“ der Schweiz: als Zwiespalt zwischen Volk und Führung.[22]
Damit kommt noch eine letzte, überhaupt die
Errungenschaft der Schweizer „Willensnation“ etwas
durcheinander: ihre Konsensdemokratie
. Die zwei
jetzt erbittert streitenden Seiten des Schweizer
Nationalismus sind ja nicht bloß beliebige Deutungen
eines rechten schweizerischen Wegs, sie sind
konstituierende Elemente des Staatslebens bis in den
Staatsaufbau hinein.[23] Die Leistung der
vielgelobten Schweizer Demokratie mit ihren
„plebiszitären“ Besonderheiten besteht darin, den
innerschweizerischen Lokalpatriotismus ausgiebig zum Zuge
kommen zu lassen, gleichzeitig aber die erforderliche
Verläßlichkeit des Regierens zu garantieren, die in
Sachen Geld und Diplomatie erforderlich ist. Stabile
politische Verhältnisse durch die möglichst weitgehende
Ausschaltung jedes politischen Streits, das ist überhaupt
oberster Zweck der paar Schweizer Eigenarten bei der
Organisation des Staatsgeschäfts. Daß des öfteren die
Zustimmung des Volks in seiner doppelten
Eigenschaft als Schweizer und als Kantonsbürger eingeholt
wird, soll die politische Herrschaft mit ihren
Beschlüssen besonders unwidersprechlich machen –
legitimiert eben nicht nur durch das Kommando aus Bern,
sondern als festgestellter Mehrheitswille der
staatstragenden Kantone. Die dürfen darüber hinaus einen
größeren Teil des inneren Regierungsgeschäfts als sonst
üblich selber entscheiden und ausführen. Auf der anderen
Seite wird, als Ausgleich für den ins Recht gesetzten
Partikularismus, in besonders nachdrücklicher Weise auf
Einigkeit und Geschlossenheit in den höheren
Staatsregionen geachtet. Damit in der Konkurrenz der
regionalen und sonstigen Gesichtspunkte der Blick für das
insgesamt Notwendige nicht verloren geht, wird dafür
gesorgt, daß das dem Volks-„Souverän“ zur
geflissentlichen Entscheidung Vorgelegte den Willen aller
wirklich Zuständigen repräsentiert: Kantonsverwaltungen,
politische Parteien, Wirtschaftsverbände – einfach alle
Stellen im Staat setzen sich in „Vernehmlassungen“,
„Differenzbereinigungsverfahren“ und anderen Prozeduren
über die Vorlagen ins Benehmen und beim Volk entsprechend
für sie ein; das verschafft dem Volk Gewißheit, was
erwartet wird, soweit es die noch braucht; ein mit seinen
Herrschaften einverstandenes Volk hält sich ja ohnehin
ans Gewohnte, die eingespielten Wege der Macht, ist also
ein Hort des Konservativismus, was bekanntlich nichts
Schlechtes, sondern für eine Herrschaft das Allererste
ist. Vieles Entscheidende gelangt erst gar nicht zur
Abstimmung, und wo nötig, wird das vom Volk Beschlossene
durch die beauftragten Ausführungsorgane den
Erfordernissen noch einmal extra gemäß gemacht.
Die Vorsorge gegen politische „Verwerfungen“ reicht aber in dieser lebendigsten aller Demokratien noch weiter: Eine Opposition, die mit der Regierung um das beste Regieren oder auch bloß um die Ausführungskompetenz streitet, gibt es nicht. Statt dessen herrscht ein fest etablierter Klüngel der aufs Regieren abonnierten Institutionen. Mit den Wahlen entscheidet der mündige Stimmbürger nicht einmal das bißchen, was normalerweise mit Wahlen zu entscheiden ist, nämlich wer die Regierung stellt. Die sieben regierenden Bundesräte sind dank der „Zauberformel“ 2:2:2:1 seit Jahrzehnten zwischen den vier Hauptparteien unabhängig vom Wahlausgang fest ausgemacht, kein Kanton darf mehr als einen Bundesrat stellen, der Vorsitz wechselt jährlich. Diese Kumpanei der politischen Kräfte und nationalen Untereinheiten erspart dem Land die Aufregungen von heißen Wahlkämpfen und Regierungswechseln – solche Sternstunden demokratischer Kultur gelten in der Schweiz schon als ein Zuviel an Gefahr für verläßliches Regieren.
So kombiniert die Schweizer Demokratie weitgehende
Anerkennung kantonalen Eigensinns
und
Ausschaltung der politischen Konkurrenz auf
gesamtstaatlicher Ebene – und galt damit bis neulich
noch als ein Garant der Stabilität. Die Wahrheit ist
umgekehrt: Auch in der Schweiz wird die Herrschaft nicht
durch ihre Verfahren zusammengehalten. Diese
Spielart der politischen Willensbildung funktionierte
deswegen problemlos, weil der „Konsens“, den sie
angeblich laufend herstellt, vorab
gegeben war, weil die Nation keine grundlegenden
Streitfragen, keine entscheidenden nationalen
Kurskorrekturen zu beschließen hatte, weil also die
Schweiz so selbstverständlich im
internationalen Getriebe aufgehoben war, daß der
Patriotismus sich unbehelligt auf das Innenleben und
seine Eigenarten konzentrieren konnte. Das ist jetzt
anders, wo Neuorientierung ansteht – und zwar
aus einer unübersehbaren nationalen Not heraus.
Die nationalen Leitlinien sind nicht mehr sicher. Der
politische Konsens in den Führungsetagen hat gelitten.
Das Volk hält sich mehrheitlich an seinen überkommenen
Nationalstolz, der nicht mehr recht zur Lage paßt, und
versteht die Schweizer-Welt nicht mehr. Außerdem
beurteilt es die nationalen Entscheidungsfragen wie alles
mit seinem im Abstimmungsalltag eingeschliffenen mündigen
Bürgerverstand, also streng nach den gewohnten bornierten
Vor- und Nachlieben. Darüber wird es unzuverlässig und
unzufrieden mit seinen Mitgenossen in der
„Willensnation“.[24]
An diesem Zustand leiden jetzt alle in der Nation mindestens so sehr wie an den auswärtigen Herausforderungen. Klagen werden laut, daß die Schweiz „das Bild einer zersplitterten Nation ohne hinreichende Handlungsfähigkeit“ bietet, und die Frage steht im Raum, ob die Schweizer Demokratie überhaupt noch den „modernen Anforderungen“ an einen ordentlichen Staat mit einer unabhängigen, handlungsfähigen Führung genügt. Bloß: Auf diesem Weg sind die Schweizer Leiden an der neuen Lage sicher nicht zu kurieren. Denn an nationalem Willen fehlt es wirklich nicht.
[1] Inzwischen machen andere Staaten wie Deutschland mit seinem Drang nach mehr Gewicht in der UNO der Schweiz auch Konkurrenz, was den Sitz von UNO-Unterorganisationen angeht: Das Umweltsekretariat z.B. wurde nach Bonn vergeben.
[2] Deshalb ist die Schweiz, die vormals eine UNO-oder NATO-Mitgliedschaft als Beschränkung ihrer „Unabhängigkeit“ abgelehnt hatte, jetzt der „Partnerschaft für den Frieden“ beigetreten, hat sich den von Amerika durchgesetzten Boykottaktionen gegen Irak, Libyen und Serbien angeschlossen. Inzwischen beteiligt sie sich an NATO-Ordnungsaktionen wie in Bosnien, baut ein offizielles Blauhelm-Kontingent auf und sucht unter dem Firmenschild „differentielle Neutralität“ nach einer festen Mitmacherrolle in der Weltaufsichtskonkurrenz. Erklärtermaßen als Fortsetzung der früheren „Guten Dienste“ in der Kriegsdiplomatie wird inzwischen die Spezialisierung auf Lufttransporte für internationale Eingreiftruppen diskutiert. Eine „Armeereform 95“ ist ausdrücklich so angelegt, daß das Heer mit NATO-Verbänden kompatibler wird. Und für die Zukunft geht die Hoffnung auf Fortschritte hin zu einer „gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik“, der sich die Schweiz endgültig voll anschließen könnte.
[3] Auch die
europäischen Alliierten haben sich mit Goldverkäufen
bei der Schweiz Geld zur Kriegsfinanzierung beschafft.
Wegen solcher Dienste haben beide Seiten die Schweiz
unbehelligt gelassen. Hitler war der Meinung, daß
dieses Land als Schutzmacht und als internationaler
Knotenpunkt für diplomatische Aktivitäten, Spionage,
Devisengeschäfte und die Lieferung von Mangelwaren
(z.B. Rüstungsgüter und Rüstungsrohstoffe)
unvergleichlich wertvoller sei denn als Satellit.
(Henry Picker, Hitlers Tischgespräche, S. 420). Die
Alliierten beargwöhnten zwar das Land und schränkten
den Handel mit ihm stark ein, duldeten aber Schweizer
Geschäfte mit dem Gegner und bedienten sich selber des
Franken: Die Nachfrage nach Franken war weltweit
sehr groß, da er nach dem Kriegseintritt der USA noch
die einzige konvertible Währung war.
(NZZ 1.3.97)
Also konnte sich die Schweiz hinterher für die
„Kriegsverschonung“ bedanken – bei sich selbst: Um
ihrer besonderen Lage, in der sie an allen Grenzen von
Achsenmächten umringt war, gerecht zu werden, unternahm
die Schweiz alle Anstrengungen, den Status als
neutraler Staat inmitten kriegführender Parteien zu
bewahren. Eine militärische Besetzung durch die
Achsenmächte hätte die Schweiz vielleicht als Volk,
nicht aber als bedeutender internationaler Finanzplatz
überlebt… Es bedarf keiner besonderen Phantasie, um
sich vorzustellen, welches Schicksal die Schweiz
erwartete, hätte sie ihre Neutralitätspflichten
einseitig aufgekündigt und durch eine Parteinahme für
eine der beiden kriegführenden Seiten ersetzt. Es hätte
sie dasselbe Schicksal getroffen wie Libanon, das nach
dem Ausbruch des Bürgerkrieges 1975 seine frühere
Bedeutung als führender Finanzplatz des Nahen Ostens
bis zum heutigen Tage nicht wiedererlangt hat.
(NZZ 13.5.97)
[4] Präsident Clinton
hat deswegen eine Sonderkommission ernannt, die in den
amerikanischen Regierungsarchiven nach dem Verbleib des
‚Nazi-Goldes‘ forscht. Untermauert wurden die
Forderungen nach „Wiedergutmachung“ mit Drohungen
amerikanischer Stellen, wie der Stadtverwaltung New
York, sie und andere Kommunen würden ihre
Geschäftsverbindungen mit Schweizer Geldinstituten
beenden, falls kein „akzeptabler Fonds für die
Holocaust-Opfer“ zustandekäme. Die Revision des
Washingtoner-Abkommens von 1946 wird angedroht, weil
neue Dokumente über den Umfang der Schweizer
Goldgeschäfte mit Nazi-Deutschland aufgetaucht
seien.
(D’Amato, SZ 7.10.96) Der erste vorläufige
Bericht der „Eizenstat-Kommission“ liegt vor und die
US-Regierung hat die Abhaltung einer
„Raubgold-Konferenz“ zusammen mit Großbritannien noch
in diesem Jahr geplant, nach der endgültig über eine
eventuelle Neuverhandlung der alten Abmachungen
entschieden werden soll. Mit der Enthüllung von
Geheimverträgen der Schweiz mit Polen, in denen
jüdisch-polnische Vermögen auf Schweizer Konten gegen
von Polen konfisziertes Vermögen von Schweizer Bürgern
aufgerechnet wurden, kommen weitere Ansprüche in die
Welt.
[5] Die Schweiz hat in manchen Fällen ähnlich wie die USA mit ihrem Marshallplan durch Kredite an andere Staaten die erwünschte Zahlungsfähigkeit erst einmal selber hergestellt.
[6] Ironie der Geschichte: Diese Errungenschaft von 1934 war ursprünglich vor allem gegen das Ansinnen des nationalsozialistischen Staates gerichtet, die Vermögen deutscher Bürger im Ausland unter seine Fittiche zu nehmen.
[7] Die hohe
Plazierungskraft der schweizerischen Banken erklärt
sich … dadurch, daß sie große ausländische Vermögen
verwalten, deren Zinsen und Dividenden meist wieder
Anlage in Wertpapieren suchen. Daneben erhalten sie
Aufträge ihrer ausländischen Kundschaft zum Kauf von
Wertpapieren. In diesen Zahlen spiegelt sich das
Phänomen des schweizerischen Finanzplatzes und seiner
Drehscheibenfunktion deutlich wieder.
(Max Iklé: Die Schweiz als internationaler
Bank- und Finanzplatz, S.137)
[8] Bis heute ist sogar die Golddeckung des Schweizer Frankens formell nicht aufgegeben worden. Die Schweiz hat eben nie an Devisenmangel gelitten, sondern im Gegenteil bei größeren Währungsturbulenzen immer wieder mal Vorkehrungen getroffen und sogar zum Mittel der „Negativ“-Zinsen gegriffen, um bloß „spekulative Zuflüsse“ zu bremsen. Geschäftsgrundlage dieses Finanzplatzes war ja nicht der „run“ auf den Franken, den größere Verwerfungen an der Kredit- und Währungsfront erzeugten, sondern das garantierte stetige Interesse und die daraus resultierende Stabilität des Franken. Die wurde durch ein plötzliches „Auf und Ab“ an den Devisenbörsen nicht gefördert, sondern eher behelligt.
[9] Im Fall Marcos z.B.
forderte die Reagan-Administration ultimativ, unter
Androhung wirtschaftlicher Sanktionen, die Sperrung der
Konten und anschließend die Rückerstattung der von dem
Kleptokraten aus Manila gestohlenen Milliarden.
(Jean Ziegler, Die Schweiz wäscht weißer, S.152) Der
Streitfall ist bis heute nicht endgültig erledigt.
Erfahren hat man in dem Zusammenhang, daß der
amerikanische Geheimdienst wegen solcher und anderer
Fälle die Schweiz rundum überwacht, um die für das
amerikanische Interesse notwendigen Erkenntnisse zu
besorgen. Im ähnlich gelagerten Fall Mobutus hat die
Schweiz mit einem gewissen vorauseilenden Gehorsam
reagiert.
[10] Die inzwischen auch auf andere Länder ausgedehnte Kampagne „Amerika unterstützt die jüdischen Organisationen beim Aufdecken vergangener Verbrechen!“ trifft die Schweiz also in ihrem Kern und daher viel wuchtiger als andere Länder – und nicht bloß deswegen, weil sie aus naheliegenden Gründen die Hauptadresse für das Aufspüren dieser Altlasten des Zweiten Weltkriegs ist.
[11] Vgl. „Groß-“, „Welt-“, „Super-“… Die Macht der USA und ihr Gebrauch, Teil 2: Der globale Kapitalismus; in GegenStandpunkt 3-97, S.81! Die Beschwerde, daß die USA und Großbritannien die Frage des „Nazi-Goldes“ dazu benutzen, „die Schweiz als Weltfinanzzentrum zu zerstören“ (der vormalige Bundespräsident der Schweiz Delamuraz), also die als Retourkutsche gegen die nationale „Verunglimpfung“ beliebte Deutung der US-Kampagne als – heimtückische und höchst eigennützige – Schädigung eines unerwünschten ökonomischen Konkurrenten trifft die Sache nicht; diese Schädigung ist zwar Resultat, aber nicht schon der ganze Zweck der US-Aktion; der ist weiterreichender imperialistischer Natur.
[12] Der bei den Anklagen gegen die Schweiz federführende Vorsitzende des Bankenausschusses des Senats d’Amato ist auch für die Vorlage des Gesetzes zuständig, das Geschäfte mit dem Iran durch amerikanische und ausländische Firmen unter Vorbehalt stellt bzw. verbietet und mit Strafen bedroht.
[13] Infolge der Hartnäckigkeit der USA sind einige Absurditäten in die Welt gekommen: Amerikanische Senatshearings befassen sich mit den Gepflogenheiten Schweizer Banken vor mehr als 50 Jahren; eine internationale Untersuchungskommission im Auftrag der Schweizer Regierung unter Vorsitz des ehemaligen amerikanischen Notenbankchefs Volcker hat sich darangemacht, „nachrichtenlose“ Konten von Juden zu suchen; Schweizer Geldinstitute mit dem bestgehüteten Bankgeheimnis der Welt veröffentlichen weltweit Listen aller möglicher nachrichtenloser Konten, versprechen dem Staat New York Einsicht und jüdischen Organisationen Zutritt zu den Bankarchiven; gegen Schweizer Banken einschließlich der BIZ sind Milliardenklagen anhängig, dieselben Klagen werden aber mit der Begründung zurückgestellt, man solle die (Amerikas Kontrollbedürfnis dienliche) Zusammenarbeit mit den Banken in dieser Sache nicht untergraben; Schweizer Banken stiften einen Millionenfonds, die Schweizer Regierung verspricht, ihn aufzustocken, über die Verwendung aber will Amerika das entscheidende Sagen haben; in der Schweiz sammeln Schulklassen für die Opfer und macht sich Ende der 90er Jahre Antisemitismus und Antiamerikanismus breit; der Schweizer Botschafter in den USA redet von einem „Krieg gegen die Schweiz“ und muß gehen; die Schweizer Regierung setzt für Schweizer Imagepflege in Amerika auf die ehemalige US-Botschafterin, heuert den ehemaligen US-Botschafter in Deutschland Burt als Berater an und läßt sich von ihm in die Geheimnisse amerikanischer Politmoral einweihen…
[14] Wegen dieser Ohnmacht verstummen in der Schweiz, aber auch bei teilnahmsvollen auswärtigen Freunden des europäischen Finanzplatzes wie der FAZ die Klagen nicht, die Zuständigen machten entgegen ihrer früheren Art eine schlechte Figur, reagierten äußerst unprofessionell, ließen sich beim Aktenvernichten erwischen usw. Nicht zufällig schwankt die Kritik zwischen dem Vorwurf, Land und Banken leisteten sich zu viele Schuldbekenntnisse, und dem Ratschlag, statt der viel zu zögerlichen Schuldbekenntnisse endlich offene und tätige Reue zu zeigen und damit die Kritik zum Schweigen zu bringen.
[15] Die
volkswirtschaftlichen Berater, die sich über die
absehbaren und möglichen Wirkungen des Euro aus
Schweizer Sicht den Kopf zerbrechen und am liebsten
„mögliche Fälle“ durchspielen, prognostizieren im
besten Fall, daß …erhebliche Rückwirkungen auf den
Schweizer Franken zu erwarten sind. Die Zahl der
unabhängigen Anlagewährungen wird reduziert, was dazu
führt, daß Portfolio-Umschichtungen sich stärker auf
den Schweizer Franken auswirken werden… eine höhere
Volatilität gegenüber der europäischen
Referenzwährung…
Im schlimmsten Fall befürchten
sie, der Franken könnte in den nützlichen Funktionen
des Zahlens und Anlegens gleich ganz durch das neue
Europa-Geld ersetzt werden: Eine starke und stabile
Eurowährung wird … dazu führen, daß sich diese neue
Eurowährung als Transaktionswährung durchsetzt und den
Schweizer Franken verdrängt.
(Heinz Hauser: Der
Stellenwert der Europafrage für die Schweizerische
Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaft 1/1996, S. 21) Oder
überspitzt…, daß es zwar den Schweizerfranken gebe,
aber niemand damit bezahlen wolle. Die Schweiz befände
sich somit in einer Kanada vergleichbaren Situation, in
welcher der amerikanische Dollar innerhalb des Landes
eine zentrale Rolle im Zahlungsverkehr einnimmt und den
kanadischen Dollar verdrängt… Die Experten sind sich
zudem einig, daß sich der Euro … auch als
Handelswährung an der Börse etablieren wird.
(NZZ 9.4.97)
[16] Zwar wird
reichlich darüber spekuliert, daß der Franken wegen der
Unsicherheiten des europäischen Großvorhabens und der
möglichen oder zumindest übergangsweise absehbaren
Vorbehalte der Finanzmärkte gefragtes Objekt ist und
vielleicht sogar bleiben könnte; setzen will darauf
allerdings niemand. Dafür reicht die Erinnerung, daß
die Schweiz mit einer plötzlichen, rein „spekulativen“
Franken-Nachfrage und mit „Unsicherheit auf den
Finanzmärkten“ in Zeiten von Währungsturbulenzen noch
nie glücklich geworden ist, „denen sich der Schweizer
Franken nicht entziehen kann,“ und die tiefschürfende
Erkenntnis: Der Finanzplatz Schweiz ist keine
Euro-Insel.
(NZZ 9.4.97) Daher überbieten sich die
Beobachter, die die neue Lage nach Risiken und Chancen
für den Franken ausloten, darin, eine Stärkung des
Franken aufgrund von massenhaften Zuflüssen aus den
EU-Staaten als die allergrößte Gefahr zu besprechen.
[17] Kein Wunder, daß die Ausmalung verschiedener Euro-Szenarien – „WWU hard“, „WWU light“, „Verschiebung“ – mit lauter drohenden Wirkungen auf den Franken immer nur bei einer Gewißheit landen: daß „die meisten Faktoren, die den Kurs unserer Währung bestimmen, außerhalb unseres Einflußbereiches bleiben“. Ein ziemliches Armutsbekenntnis für die Propagandisten der Mär einer besonders gelungenen Schweizer Banken- und Währungspolitik, die den Franken stark und international besonders attraktiv gemacht habe. Auf die Abwägung, was die Schweizer Währungspolitik mit einer währungspolitischen „Ankoppelung“ oder „Abkoppelung“ alles richtig und falsch machen könne, verzichten die Berater deswegen natürlich nicht.
[18] Zwar werden immer wieder Klagen über den hohen Stand des Franken laut, der die Exportfähigkeit der Industrie schädige. Gleichzeitig wird zugestanden, daß „trotz wachsender Investitionen und steigenden Kreditbedarfs der Industrie die Zinsen gleichbleibend niedrig geblieben sind“ – beides nur Ausdruck dafür, daß immer ausreichend billiger Kredit zur Verfügung stand.
[19] Dem Bedürfnis, den wachsenden Verkehr in diesem europäischen Durchgangsland zu beschränken und durch Verlagerung auf die Schiene mit den umweltpolitischen Erfordernissen in Übereinstimmung zu bringen, nach Schweizer Art in Volksabstimmungen zur Vorgabe für die Regierung gemacht, hat die EU ihr gebieterisches Verlangen nach noch viel mehr Transitfreiheiten entgegengesetzt. Deshalb wird seit Jahren um eine Neuregelung gerungen – mit eindeutiger Tendenz: Die EU hat der Schweiz so ziemlich alle Einschränkungen abgehandelt, der Schwerverkehr über 26 t wird zugelassen, die von der Schweiz ursprünglich verlangten Transitgebühren sind entscheidend gedrückt worden, die neuen Tunnelprojekte müssen von der Schweiz selber finanziert werden, wieweit sie die Verlagerung auf die Schiene erreicht, ist ihre Sache – jedenfalls darf es zu keiner Umleitung des Transitverkehrs in EU-Länder, also insbesondere nach Österreich kommen – und ob ein solches Abkommen „referendumsfest ist, ist ein urschweizerisches Problem“.
[20] Nach der
Ablehnung des Beitritts zum „EWR“, also einer festen
institutionellen Anbindung an die EU, durch ein
Schweizer Volksvotum wurden von der Schweizer Regierung
prompt 27 „grundlegende Regelungen“ den EU-Bestimmungen
angeglichen; neue Gesetze werden frühzeitig daraufhin
überprüft, ob sie mit denen der EU vereinbar sind, um
sich keine Standortnachteile einzuhandeln. Die nach dem
negativen Ausgang des Volksentscheids von der Schweiz
beantragten „bilateralen Verhandlungen“ zwischen der EU
und der Schweiz wurden von Brüssel erst
hinausgeschoben, dann nur ein geringer Teil der
vorgeschlagenen Punkte überhaupt auf die Tagesordnung
gesetzt und alle Verhandlungsgegenstände zu einem
Gesamtpaket zusammengeschnürt. Einerseits wurden und
werden von EU-Seite immer wieder neue Forderungen –
„einzelner Länder“ – nachgeschoben, andererseits aber
alle Schweizer Versuche, wenigstens das schon
Ausgemachte abzuhaken, abschlägig beschieden und
gedroht: Es gibt keine Abtrennung des oder der
Verkehrsdossiers aus dem bilateralen Siebnerpaket … der
Elan werde mit der Zeit abnehmen.
(EU-Verhandlungsführer Kinnock) So übt der große
Wirtschaftsraum eine starke faktische Dominanz aus, der
sich auch die Schweiz nicht entziehen kann.
(Hauser, S.18) Die Unternehmer und Standortpolitiker,
die Europa für die Spitzenprodukte „made in Swiss“
nutzen wollen, beklagen sich, daß ihnen das Volk mit
seinem Votum eine bloß „symbolische Wahrung der
Souveränität mit hohem Preis“ eingebrockt hat:
Manches wäre leichter, wenn wir dem EWR zugestimmt
hätten. Heute müssen wir zwar EU-Bedingungen erfüllen,
sind aber nicht Partner, sondern nur ein Drittstaat,
der auf die Gunst der EU angewiesen ist.
(SZ 4.2.97)
[21] Über die
US-Kampagne gegen die Schweiz sind eidgenössische
Kritiker wieder zu gewissen Ehren gekommen, die schon
immer der sauberen Schweiz ihr schmutziges Spiegelbild
vorgehalten haben, damit sie sich auf ihr besseres
Selbst besinnt. Deren prominentester Vertreter ist Jean
Ziegler mit seinem Buch „Die Schweiz wäscht weißer –
Die Finanzdrehscheibe des internationalen Verbrechens“:
„Aber während (…) der Wasserkopf der Verwaltung des
Landes wächst, verliert der Staat dramatisch an
Autorität. Machtlose und konspirierende Richter, blinde
Polizisten, zwielichtige Staatsanwälte, gefällige
Beamten: Dieses Buch liefert dafür Beispiele en masse.
Was sind die tieferen Ursachen dieses schleichenden und
unaufhaltsamen Verfalls formell so bewundernswerter
Institutionen? Die Staatsgewalt der ältesten Demokratie
Europas ist im Innern faul… Der ungeheure
Reichtum und die weltweite Macht der gesellschaftlichen
Führungsschichten – der Bankemire, der Kapitäne der
multinationalen Industrieimperien, des internationalen
Handels, der Immobilienspekulanten, der Waffen- und
Devisenschieber – beruht im wesentlichen auf der
skrupellosen Ausbeutung der ärmsten Völker, der
Steuerflucht aus den europäischen Ländern, dem Hehlen
und Waschen der Beute der internationalen Drogenhändler
und auf der Kapitalflucht aus der Dritten Welt.
Die unmoralischen Finanzpraktiken, die unstillbare
Profitgier und die zu einer regelrechten Kunst
entwickelte Freibeuterei der Banken untergraben die
bürgerliche Gesellschaft. Gleich einem Schiff hat jedes
Land seine Wasserlinie. Sinkt die öffentliche Moral
unter diese Linie, geht das Schiff unter.“
(S.194 f.) Man sieht, hier
spricht ein Schweizer, dem die Ideale seines Landes die
Richtschnur für die Verurteilung der politischen
Verhältnisse vorgeben, denen diese Ideale die höheren
Weihen verleihen. Die Demokratie
, eine alte
Schweizer Erfindung und ein Synonym für intakte
öffentliche Moral und staatliches Durchgreifen, kann er
in den wirklichen demokratischen Verhältnissen der
Schweiz nicht wiederfinden. Statt ehrlichem
Geschäftsgeist, wirklich verdientem Reichtum und
protestantischer Ethik herrschen Bereicherungssucht und
Raffgier wie bei den „Emiren“ der berüchtigten Öl- und
Bananenstaaten; das ist Kapitalismus: Ich
halte die calvinistische Prädestinationslehre für eine
der Hauptquellen der helvetischen Lebenslüge und der
dazugehörigen Bankenpraxis.
(Ziegler in NZZ 9.4.97) Der Titel des
Buches sagt schon alles über die „tieferen Ursachen“,
die der Autor meint – lauter Verstöße gegen die
urschweizerischen Prinzipien ordentlicher Politik aus
niederen Motiven. Die Lektüre wäre also schnell rum,
gäb es da nicht noch die „Beispiele en masse“, die der
Enthüllungsjournalist zu bieten hat und die sein
eigentliches „Argument“ darstellen. Mit dem
aktenkundigen Blick hinter die „Fassade“ bebildert er
unermüdlich das vorweg feststehende moralische Urteil
eines bedauernswerten, in die Fänge des Verbrechens
geratenen Staatswesens. Die Diagnose ‚Verfall der
politischen Sitten‘ soll umso glaubwürdiger werden, je
öfter er enthüllt wird. Fakten öffnen aber keine Augen;
denn auch die Schweizer sind nicht blind, sondern
parteilich und stehen zu ihrem Staat – wie der
Parteigänger einer makelloseren Schweiz auch, über
dessen Nestbeschmutzung sie sich nicht minder empören
wie er über die nur scheinbar „saubere Schweiz“.
[22] Nach wie vor
bestehen Spannungen zwischen einer die Öffnung der
Schweiz nach außen befürwortenden Elite aus Wirtschaft
und Politik auf der einen Seite und größeren
Bevölkerungsteilen, die auf die strikte Wahrung der
nationalen Unabhängigkeit setzen, auf der anderen
Seite… Für viele Bürgerinnen und Bürger ist angesichts
der Wirkmächtigkeit dieses Geschichtsbildes nicht
nachvollziehbar, warum jetzt plötzlich zur Sicherung
und Wahrung des erreichten Wohlstandes gerade jene
Prinzipien aufgeweicht werden sollten, die bislang als
unverrückbare Pfeiler der nationalen Existenz
ausgewiesen wurden.
(Anton
Hauler: Die Schweizer Demokratie in den 90er Jahren,
1996)
[23] Dieser Doppelcharakter prägt auch das Militärwesen der Schweizer Republik: Auf der einen Seite ist das ganze Volk als eine Art riesengroße Heimwehr für den Dienst an der Heimatfront vorgesehen und wird laufend eingeübt, seine Alpenrepublik gegen übermächtige Eindringlinge zu verteidigen – unabhängig davon, daß der Kleinstaat dazu im Ernstfall gar nicht fähig ist. Auf der anderen Seite verfügt das Land über eine kleine, aber durchaus feine Militärmaschinerie und profiliert sich neben seinen „Guten Diensten“ als Rot-Kreuz-Zentrale mit ausgiebigen Waffenexporten sowie Beteiligungen an allen möglichen internationalen Ordnungsaktionen.
[24] Die Franzosen-Schweizer haben „für Europa“ plädiert, weil sie sich dadurch Befreiung von der ewigen Majorität der Deutschschweiz erhoffen. Die überwiegende Mehrheit der Deutsch-Schweizer hat „gegen Europa“ gestimmt, weil sie die Mehrheit im Lande sind und behalten wollen; außerdem repräsentieren sie bekanntlich mehr als alle anderen die Urschweizer Eigenständigkeit. Und die Tessiner haben sich zuletzt gegen eine allzu enge Anbindung an ihre ärmliche Volksverwandschaft in Italien entschieden, obwohl auch sie mehr Unabhängigkeit von Bern nicht verachtet hätten… So etwa haben die Entscheidungsgründe in dieser „Schicksalsfrage der Nation“ ausgesehen, über die sich bis heute keine Beruhigung eingestellt hat. Die verschiedenen Volksteile fühlen sich mit dem negativen Bescheid gegensätzlich in ihrem Schicksal betroffen, und die Bundesregierung sieht ihre Freiheit beschnitten, mit der EU frei zu verhandeln. Und ob sich überhaupt Schweizer Demokratie und EU miteinander vertragen, ob also Anpassung an den europäischen Standard oder Standhalten auch hier geboten ist, wird außerdem noch gefragt.