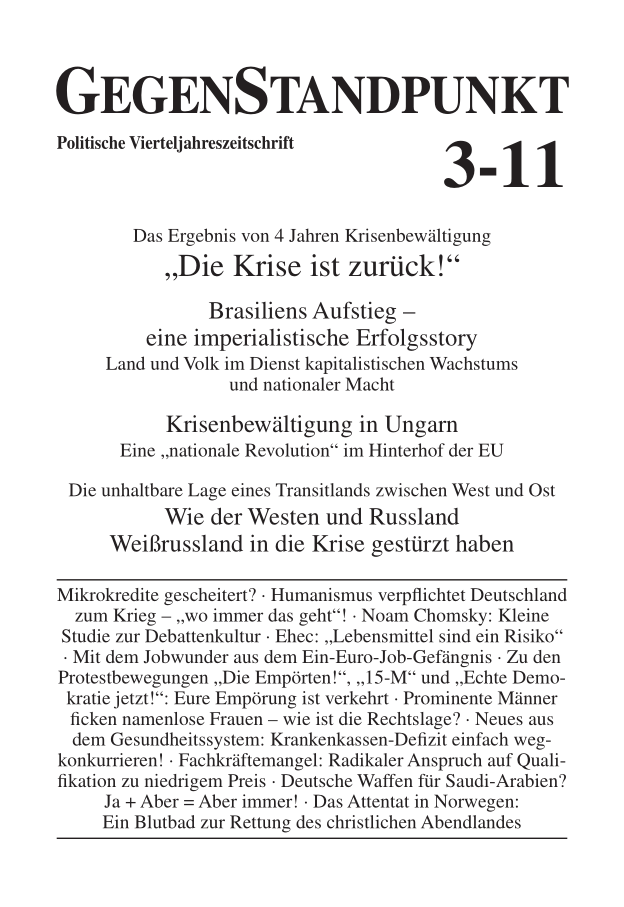Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Neues aus dem Gesundheitssystem:
Krankenkassen-Defizit einfach wegkonkurrieren!
Nachdem über circa ein Jahr hinweg Meldungen über den drohenden Konkurs zu lesen waren, ist es soweit: die City-BKK wird zum 1. Juli 2011 vom Bundesversicherungsamt geschlossen. Die breite Öffentlichkeit hätte von der ersten Pleite einer großen deutschen gesetzlichen Krankenkasse nur am Rande Notiz genommen, wenn es nicht ein paar Tage lang Aufregung über die Versuche der anderen Krankenkassen gegeben hätte, trotz bestehender Übernahmepflicht die Mitglieder der City-BKK bei ihren Wechselversuchen abzuwimmeln. Bei der Ursachenforschung für den Konkurs sind sich Öffentlichkeit und Politik schnell einig, dass es sich bei der „Pleite-Kasse“ um einen klaren Fall von Misswirtschaft handelt. Dabei ist der Grund für diesen Konkurs ziemlich banal: Die City-BKK ist daran gescheitert, dass im marktwirtschaftlichen Gesundheitssystem Finanzbedarf und Finanzierungsquelle der Krankenkassen ganz grundsätzlich nicht zusammenpassen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Der Konkurs der City-BKK: Ein klarer Fall von Missmanagement
- Die ewige „Finanzierungs-Lücke“ der Krankenkassen und ihr Grund
- Die Konkurrenz soll das Krankenkassen-Defizit beheben
- Das vorprogrammierte Ergebnis des Kassen-Wettbewerbs: Weniger Krankenkassen, steigende Zusatzbeiträge, garantiert lohnnebenkostenneutral!
Neues aus dem Gesundheitssystem:
Krankenkassen-Defizit einfach wegkonkurrieren!
Der Konkurs der City-BKK: Ein klarer Fall von Missmanagement
Nachdem über circa ein Jahr hinweg Meldungen über den drohenden Konkurs zu lesen waren, ist es soweit: die City-BKK wird zum 1. Juli 2011 vom Bundesversicherungsamt geschlossen. Die breite Öffentlichkeit hätte von der ersten Pleite einer großen deutschen gesetzlichen Krankenkasse nur am Rande Notiz genommen, wenn es nicht ein paar Tage lang Aufregung über die Versuche der anderen Krankenkassen gegeben hätte, trotz bestehender Übernahmepflicht die Mitglieder der City-BKK bei ihren Wechselversuchen abzuwimmeln. Bei der Ursachenforschung für den Konkurs sind sich Öffentlichkeit und Politik schnell einig, dass es sich bei der „Pleite-Kasse“ um einen klaren Fall von Misswirtschaft handelt. Dabei ist der Grund für diesen Konkurs ziemlich banal: Die City-BKK ist daran gescheitert, dass im marktwirtschaftlichen Gesundheitssystem Finanzbedarf und Finanzierungsquelle der Krankenkassen ganz grundsätzlich nicht zusammenpassen.
Die ewige „Finanzierungs-Lücke“ der Krankenkassen und ihr Grund
Zum einen sollen die Krankenkassen gewährleisten, dass hierzulande jeder – unabhängig von seinem Status im kapitalistischen Erwerbsleben, ob Arbeitnehmer, Rentner, Kind oder Arbeitsloser – im Rahmen des gesetzlichen Leistungskatalogs behandelt wird. Und der schließt im Wesentlichen den aktuellen Stand der Wissenschaft über die Krankheitsvorsorge, Therapie und Pflege ein. Was dafür an medizinischen Leistungen nötig ist, kaufen sich die Kassen bei einem Dienstleistungs-Gewerbe ein, das daran verdienen will und soll: Der honorige Stand der Ärzte und Apotheker kann auf einen ansehnlichen Gewinn seiner mittelständischen Unternehmen hoffen – und versucht zum Zwecke des Geldverdienens, so viel wie möglich vom fachlich Sinnvollen (und nicht nur davon) zu erbringen. Die Unternehmen der Pharma- und Geräteindustrie wollen mit ihren Innovationen bombige Umsatz- & Ertragszahlen erwirtschaften. Und Krankenhausträger – in zunehmendem Maße Unternehmensgruppen auf Aktienbasis – wollen auch ihre Rendite erwirtschaften und deshalb so viele diagnoseabhängige Fallpauschalen wie möglich abrechnen.
Als Quelle für diesen stetig wachsenden Finanzbedarf hat der Sozialstaat den Lohn der abhängig Beschäftigten festgelegt. Das hat allerdings den Haken, dass der dafür immerzu nicht ausreicht. Für die Unternehmer, die ihn zahlen, ist er eine Schmälerung ihres Gewinns, weswegen sie ihn knapp bemessen und permanent zu verringern versuchen. Letzteres ist ihnen in den letzten 20 Jahren mit tatkräftiger Unterstützung des modernen Sozialstaats so hervorragend gelungen, dass sie einen ganzen Niedriglohnsektor – inklusive Sozialversicherung – geschaffen haben. Höflich ausgedrückt und fein säuberlich dokumentiert fasst sich das dann in den offiziellen Statistiken als „stagnierende Einkommensentwicklung bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen“ zusammen. (Eine ausführliche Darlegung kann man in den „Anmerkungen zur politischen Ökonomie der Wachstumsbranche Volksgesundheit“ in GS 1-07 nachlesen.)
Als Vermittlungsinstanz zwischen Versorgungsauftrag für die Volksgesundheit, wachsendem Geldbedarf für die Gesundheitsbranche und beschränktem Geldaufkommen der Beitragszahler sind von der Politik seit jeher die gesetzlichen Krankenkassen vorgesehen. Über ein paar Jahrzehnte bundesdeutscher Sozialpolitik hinweg wurde die Unmöglichkeit dieses Auftrags möglich gemacht erstens durch Zusammenstreichen der medizinisch notwendigen Leistungen und zweitens durch eine stetige Erhöhung des Beitragssatzes, also einen steigenden Abzug vom Lohn. Diese Praxis befinden Standortpolitiker aller Parteien seit einiger Zeit für unhaltbar: Weil steigende Krankenkassen-Beiträge bisher über den Arbeitgeberanteil automatisch den Bruttolohn erhöht haben und das dem nationalen Kapitalstandort nicht weiter zumutbar ist, praktiziert die Gesundheitspolitik mittlerweile das Dogma, dass die Lohnnebenkosten nicht steigen dürfen.
Die Konkurrenz soll das Krankenkassen-Defizit beheben
Moderne Sozialpolitiker haben eine Lösung gefunden für das unlösbare Problem, dass Finanzierungsbedarf und Geldaufkommen für das Gesundheitswesen nicht zusammenpassen: Sie legen sich den Widerspruch als Frage eines „guten Wirtschaftens“ zurecht und definieren das als Programm der Krankenkassen, das sie in Konkurrenz gegeneinander an den Tag zu legen haben. So sind vor 20 Jahren eine Vielzahl von kleinen, „schlanken“ Betriebskrankenkassen gefördert worden, um den großen Kassen mit ihrer schwerfälligen „Monsterbürokratie“ mehr Kostenbewusstsein aufzuzwingen, was sich dann prompt einstellte: Das permanente Finanzierungsdefizit der Kassen ist dadurch, dass Konkurrenten ihnen mit niedrigen Beiträgen junge, gesunde Beitragszahler abwerben, weiter gestiegen.
Die Gesundheitspolitiker haben darin allerdings nur den Beleg dafür gesehen, dass sie ihr Vorhaben, mit Wettbewerb eine Kostensenkung herbeizuregulieren, umso entschlossener anpacken müssen, und bei der letzten Gesundheitsreform von 2007 in mehrfacher Hinsicht zu einem Befreiungsschlag ausgeholt. Damit der wirken und sich die Konkurrenz der Kassen entfalten konnte, mussten sie allerdings erstmal mit relativ altmodischen Maßnahmen die Finanzierung reorganisieren: Der Beitragssatz wurde für alle Kassen vereinheitlicht und auf aktuell 15,5 % des Bruttolohns erhöht. Das gesamte Beitragsaufkommen wurde in einem Gesundheitsfonds zusammengefasst, aus dem die Kassen ihr Geld pro Versichertem nach Kriterien wie Alter, Diagnosen, Länderausgleich etc. zugewiesen bekommen.
Das Kernstück der Reform war der neu ins Leben gerufene
Zusatzbeitrag, den eine Kasse erheben kann, wenn sie
ihren Finanzierungsbedarf nicht mit den Zuweisungen aus
dem Gesundheitsfonds decken kann. Der firmiert als
Dokument ihres „schlechten Wirtschaftens“, für
das sie mit dem Recht der Versicherten bestraft werden,
die Beitragserhöhung zum Anlass für den Wechsel zu einer
anderen Kasse ihrer Wahl zu nehmen. Dass der mögliche
Schwund von Beitragszahlern die entsprechende Kasse dann
in noch größere finanzielle Nöte bis zur Folge eines
Konkurses bringen kann, ist ein gewollter und im Falle
der City-BKK eingetretener Effekt. Die
Gesundheitspolitiker hatten nämlich mittlerweile die
Zersplitterung der Kassenlandschaft
(Ulla Schmidt, SPD) als Grund fürs ewige
Defizit ausgemacht und als Lösung eine Verringerung der
Anzahl der Kassen von derzeit 250 auf 50 ausgegeben –
durch Fusionen, aber eben auch Konkurse. Derzeit hört man
zwar von neuesten Meldungen des Bundesrechnungshofes,
nach denen der Einspareffekt durch Krankenkassenfusionen
nur minimal sein und überraschenderweise nichts
Wesentliches zur Lösung der Kassenfinanznöte beitragen
soll. Aber das ist eine andere Geschichte – und sicher
ein schöner Ansatzpunkt für die nächste innovative Idee
zur Reform des Gesundheitswesen. Einstweilen sehen die
Gesundheitspolitiker in den Kassenpleiten noch die
Wirksamkeit der von ihnen in der vorläufig letzten Reform
gestifteten Konkurrenz bestätigt – es ist ihnen gelungen,
eine erfolgreiche Scheidung zwischen effizienten und
ineffizienten Kassen zu vollziehen:
„Es gehört zum Wettbewerb, dass eine Kasse schließen muss, wenn sie ihre wirtschaftlichen Probleme nicht löst. Diesen Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen haben wir geschaffen. Der Wettbewerb über den Zusatzbeitrag funktioniert. Die Menschen reagieren selbst auf kleine Zusatzbeiträge sensibel. Weitere Insolvenzen kann man nie ausschließen, die Anzahl der Kassen wird sich weiter reduzieren.“ (Gesundheitsminister Bahr im FAZ-Interview, 21.5.)
Und weil die Gesundheitspolitiker bei ihrer wunderbaren, die Konkurrenz fördernden Reform von Anfang an Kassenpleiten einkalkuliert hatten, haben sie selbstverständlich auch dafür vorgesorgt. Ein neues bundesweites Konkursrecht für Krankenkasseninsolvenzen regelt die Bedingungen einer reibungslosen Abwicklung unter Aufrechterhaltung des Versorgungsauftrages: Die verbliebenen Kassen werden verpflichtet, die Versicherten der insolventen Kasse zu übernehmen, und in einen Ausfallfonds einzuzahlen, aus dem dann betroffene Ärzte, Krankenhäuser und Pharmakonzerne ihre Forderungen beglichen bekommen.
Das vorprogrammierte Ergebnis des Kassen-Wettbewerbs: Weniger Krankenkassen, steigende Zusatzbeiträge, garantiert lohnnebenkostenneutral!
Die Konkurrenz der Kassen nimmt dann ungefähr den vorgesehenen Verlauf. Die erste große Kasse ist pleite und wird abgewickelt, einige stehen kurz davor, die anderen fusionieren munter miteinander. Zahlreiche Kassen haben in den letzten zwei Jahren einen Zusatzbeitrag von 8 bis 15 Euro pro Monat eingeführt.
Darauf ist die ganze Reform ja auch berechnet. Das Angebot an die Versicherten, bei der Einführung eines Zusatzbeitrages in eine andere Kasse wechseln zu können, erledigt sich über kurz oder lang darüber, dass alle Kassen so ungefähr den gleichen „Zusatz“-Beitrag erheben. Damit ist dann der praktische Beweis erbracht, dass es zu Kassenbeiträgen in dieser Höhe einfache keine Alternative gibt.
Vor allem aber hat die Gesundheitspolitik dafür gesorgt, dass die Konkurrenz um die Zusatzbeiträge am Ende nicht einfach eine etwas komplizierte Methode der Beitragserhöhung ist, die wieder die Lohnnebenkosten steigert und damit das Wachstum mindert. Zusatzbeiträge werden direkt vom Netto-Lohn abgezogen, einen Arbeitgeberanteil gibt es nicht; alle Steigerungen wirken sich damit nicht mehr auf den Bruttolohn aus. Die Obergrenze für den Zusatzbeitrag wurde 2011 nach einer komplizierten Berechnungsformel auf ungefähr 2 % des Jahres-Einkommens heraufgesetzt, öffentlich diskutiert wird eine deutliche Erhöhung auf bis zu 70 Euro pro Monat in der nahen Zukunft.
Schöne Aussichten für den tagtäglichen Test, wie man mit dem Lohn oder der Rente auskommen soll, wenn allgemeiner Krankenkassenbeitrag, Zusatzbeitrag, Praxisgebühr, Rezeptgebühren und Zuzahlungen abgezogen worden sind.