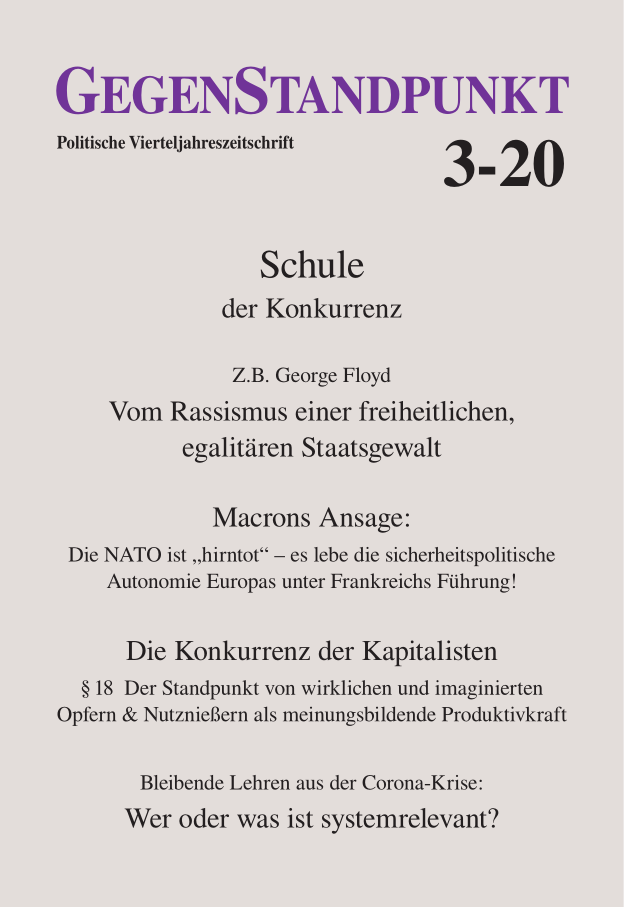Die Konkurrenz der Kapitalisten: Kapitel III
§ 18 Das Nebeneinander von Erfolg & Scheitern, der Standpunkt von wirklichen und imaginierten Opfern & Nutznießern als meinungsbildende Produktivkraft
Wachstum mit den Mitteln gesteigerter Kapitalproduktivität ist ein ewiger Kampf. Es braucht permanent neue Mittel, eine ständige Fortentwicklung der in Apparaten vergegenständlichten Produktivkräfte; Stillstand geht gar nicht. Es ist zugleich ein fortwährender Wegwerfprozess: von Reichtum, der sich nicht mehr als produktiv genug bewährt, wie von Arbeitskräften mit ihren beruflichen Fähigkeiten; von ganzen Industrien und Branchen. Das kapitalistische Geschäftsleben ist keine Perspektive für alle, die es betreiben; und schon gar keine Lebensstellung für die, die die Arbeit machen. Der Anerkennung des Marktes als Regulativ allen Wirtschaftens, der grundsätzlich positiven Stellung aller Beteiligten zum System der Konkurrenz schadet das nicht. Dass Produktion und Versorgung in der Marktwirtschaft als permanenter Existenzkampf der maßgeblichen Wirtschaftssubjekte ablaufen, sorgt für vielerlei Unzufriedenheit, begründet aber keine Kritik; weder an den Konkurrenten, jedenfalls soweit die sich an die Regeln des Systems halten; noch und schon gleich nicht an dem System der Regeln, das Fortschritte in der Produktivität der Arbeit nur als Mittel im Kampf um Sieg oder Niederlage zwischen kapitalistischen Firmen kennt, zulässt und verlangt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- 1. „Missmanagement“ ist populäre BWL
- 2. „Raffendes“ vs. „schaffendes“ Kapital ist nicht totzukriegendes Kulturgut
- 3. Was der Staat alles zulässt, gar unterstützt, darf gefragt werden
- 4. Dass die Arbeitsplätze woanders landen, ist zu beklagen
- 5. Ebenso zu beklagen: der Gesundheitszustand der Umwelt, deren Rettung aber erstens mit der Ökonomie kompatibel ist, zweitens mit der Technik, deren Fortschritt keiner aufhalten will
- Unterm Strich: Ethik des Kapitalismus
Die Konkurrenz der Kapitalisten
Kapitel III [1]
§ 18 Das Nebeneinander von Erfolg & Scheitern, der Standpunkt von wirklichen und imaginierten Opfern & Nutznießern als meinungsbildende Produktivkraft
Wachstum mit den Mitteln gesteigerter Kapitalproduktivität ist ein ewiger Kampf. Es braucht permanent neue Mittel, eine ständige Fortentwicklung der in Apparaten vergegenständlichten Produktivkräfte; Stillstand geht gar nicht. Es ist zugleich ein fortwährender Wegwerfprozess: von Reichtum, der sich nicht mehr als produktiv genug bewährt, wie von Arbeitskräften mit ihren beruflichen Fähigkeiten; von ganzen Industrien und Branchen. Denn alles zielt darauf ab, dass Konkurrenten scheitern; anders als mit Opfern funktioniert das Wachstum nicht. Die Klasse der Kapitalisten, die alle dasselbe wollen und zusammen „die Wirtschaft“ bilden, scheidet sich in Gewinner und Verlierer; und das nicht zufällig und schicksalhaft, sondern notwendigerweise, eben weil alle sich gleichermaßen um Erfolg auf dem Markt bemühen. Das kapitalistische Geschäftsleben ist keine Perspektive für alle, die es betreiben; und schon gar keine Lebensstellung für die, die die Arbeit machen.
Der Anerkennung des Marktes als Regulativ allen Wirtschaftens, der grundsätzlich positiven Stellung aller Beteiligten zum System der Konkurrenz schadet das nicht. Dass Produktion und Versorgung in der Marktwirtschaft als permanenter Existenzkampf der maßgeblichen Wirtschaftssubjekte ablaufen, sorgt für vielerlei Unzufriedenheit, begründet aber keine Kritik; weder an den Konkurrenten, jedenfalls soweit die sich an die Regeln des Systems halten; noch und schon gleich nicht an dem System der Regeln, das Fortschritte in der Produktivität der Arbeit nur als Mittel im Kampf um Sieg oder Niederlage zwischen kapitalistischen Firmen kennt, zulässt und verlangt. Deren Interesse und die daraus erwachsende wechselseitige Nötigung, mit immer neuen Errungenschaften gegen ihresgleichen vorzugehen, gelten als Chance und Sachzwang für tüchtige Unternehmer, sich in den „nun einmal“ herrschenden Verhältnissen, an lauter vorgegebenen Anforderungen zweckmäßigen Wirtschaftens zu bewähren. Das kapitalistische Hauen und Stechen will genommen werden und wird akzeptiert als Leistungsbeweis im Bemühen, objektive Herausforderungen zu meistern. Vom Konkurrenzkampf in all seiner Härte und Rücksichtslosigkeit, von Sieg und Niederlage, bleibt so, vom Ergebnis her betrachtet, als Bilanz am Ende ein Nebeneinander von Erfolg und Scheitern.
Für die Betroffenen ist das natürlich kein wertneutrales Fazit. Gewinner und Verlierer der Konkurrenz, bestätigt bzw. getroffen in ihrem existenziellen Interesse, verstehen sich als Nutznießer resp. Opfer des Systems, dessen Herrschaft sie nicht infrage stellen. Und mit diesem Standpunkt bleiben sie nicht unter sich. Zu den wirklichen Opfern – den in den Konkurs getriebenen Wettbewerbern, dazu den ohne eigenes Zutun Geschädigten, den Entlassenen sowie den strapazierten Weiterbeschäftigten – kommen haufenweise solche, die darunter leiden, dass nichts so bleibt, wie sie es sich für ihre wirtschaftliche Existenz und ihre bürgerliche Lebensführung überhaupt zurechtgelegt haben; die nennen die Nöte und Lebenskämpfe von gestern dann gerne „die gute alte Zeit“. Ebenso bleibt die Elite der wirklichen Nutznießer des verschärft vorangetriebenen Kapitalwachstums nicht unter sich: Wer bei jeder Änderung im Betrieb um seinen Arbeitsplatz und seinen Verdienst fürchten muss, kann es schon als Erfolg betrachten, wenn er weiterhin gebraucht und für aushaltbare Arbeitsdienste bezahlt wird; Menschen, die aus früheren und aktuellen schlechten Erfahrungen nichts weiter lernen als die Hoffnung auf eine bessere Zukunft – wenigstens „für die Kinder“ ... –, neigen dazu, vergleichsweise gut zu finden, was sich durchsetzt. Und auch wer von werbewirksam aufgehübschten oder auch echt neuen Produkten mangels Kaufkraft nichts hat, ist davon nicht selten schwer beeindruckt und setzt sich für sein Erwerbsleben neue Ziele, was schon fast so sinnstiftend ist wie eine wirkliche Verbesserung der eigenen Lebenslage.
Die einen wie die andern, wirkliche und eingebildete Opfer wie Nutznießer „der Entwicklung“, haben auch eine Vorstellung von den Gründen ihres Schicksals. Die einen wollen wissen, wer schuld ist, sei es am erlittenen Scheitern, sei es am Verlust der in der Rückschau idealisierten Arbeitsverhältnisse und Lebensgewohnheiten. Die andern verbuchen ihren Nutzen als ihren Erfolg und Erfolg als Verdienst, egal ob unmittelbar eigenes oder eines Kollektivs, dem sie sich zurechnen. Mit dieser moralischen Würdigung der fortgeschrittenen kapitalistischen Konkurrenz sind beide Seiten einander so nahe wie Täuschung und Enttäuschung und tragen mit diesem Standpunkt jeweils das Ihre bei zu einer nachhaltigen Urteilsbildung über den Lauf der Welt.
1. „Missmanagement“ ist populäre BWL
In dem Bewusstsein, alles richtig gemacht und ihren Erfolg verdient zu haben, finden sich die Gewinner der Konkurrenz bestätigt durch eine ganze Wissenschaft, die sich die Ermittlung von Erfolgsrezepten für kapitalistisches Wirtschaften und ihre Ableitung aus einem verkehrten Begriff von Wirtschaft überhaupt zu ihrem Erkenntnisinteresse, die Beratung der Unternehmerschaft und ihres Managements zu ihrem praktischen Anliegen macht. Ihr Ethos als hilfreiche praktische Wissenschaft und ihren Anspruch auf Wichtigkeit ihrer Erkenntnis bezieht die BWL nicht zuletzt aus der Tatsache, dass es den Betrieben keineswegs um die Überwindung naturgegebener Knappheit durch sachgerechten Einsatz von Ressourcen geht, wie jedes Lehrbuch erst einmal behauptet, sondern um ihr dauernd bestrittenes Überleben am Markt, um Erfolg oder Scheitern. Das steht zwar in Widerspruch zu dem Angebot, mit wissenschaftlichen Auskünften über richtiges betriebliches Wirtschaften jedem, der sich danach richtet, zum Gelingen seines Unternehmens zu verhelfen; aber das sehen die Fachvertreter nicht so eng. Sie interpretieren umgekehrt den Erfolg von Unternehmen, die sich gegen ihresgleichen durchsetzen, als gelungene Anwendung oder jedenfalls als Bestätigung ihrer allgemeingültigen Erfolgsrezepte. So bewegen sich Unternehmer und Gelehrte in einem gedanklichen Zirkel, der den erfolgreichen Konkurrenten eine wissenschaftlich beglaubigte richtige Betriebsführung attestiert und den Fachvertretern mit dem Schein der Realitätstüchtigkeit ihrer Theorien schmeichelt.
Dass Misserfolg in der Konkurrenz aus Managementfehlern folgt, Unternehmer nur scheitern, wenn sie etwas Entscheidendes falsch gemacht haben, ist damit natürlich auch schon bewiesen. Und diese Erkenntnis deckt sich mit dem, was die Praktiker der Marktwirtschaft und der allgemeine Verstand sich ohnehin über die Kunst erfolgreichen Wirtschaftens denken und schon immer gedacht haben. Gute Ergebnisse hält man da im Allgemeinen nicht für erklärungsbedürftig; die werden von den Machern in Angriff genommen und vom Publikum erwartet, denn dafür kriegen die Unternehmer und ihre Manager schließlich das viele Geld, das sie einstecken. Erfolg gehört zum Berufsbild des Kapitalisten; wer verliert, hat vor den Anforderungen seines Jobs versagt. Vor welchen Aufgaben, das ist für dieses Urteil nicht von Bedeutung. Im Lichte der feststehenden Gleichung, dass Erfolg Recht gibt und Misserfolg den Verlierer als Fehlbesetzung disqualifiziert, finden sich die Ursachen schon; da lässt sich alles als Missgriff zitieren, was die letztlich erfolglose Betriebsleitung getrieben und bislang als normales Geschäftsgebaren gegolten hat; umgekehrt setzt ausgebliebener Erfolg, erst der so richtig, Unzufriedenheit welcher Art auch immer mit dem Management des Unternehmens ins Recht.
Die ideologische Leistung dieser populären Quintessenz der Lehre vom richtigen Betriebswirtschaften ist ansehnlich. Aufs Korn genommen wird damit ja nicht weniger als der Umstand, dass eine normgerecht funktionierende kapitalistische Konkurrenz mit Notwendigkeit Verlierer schafft, Reichtum verschleudert, Existenzen vernichtet; der praktische Beweis also, dass allgemeines Wohlergehen, noch nicht einmal der Eigentümerklasse, jedenfalls nicht zu den Zwecken des unaufhaltsam fortschreitenden kapitalistischen Wachstums gehört. Mit dem Dogma, dass alle Übel nicht dem funktionierenden Kapitalismus zuzurechnen, sondern auf Fehler und Versäumnisse zurückzuführen sind, Misserfolg quasi per definitionem unkapitalistisch ist, sind die Verwüstungen, die das erbitterte Bemühen um immer höhere Kapitalproduktivität anrichtet, nicht bloß entschuldigt; sie sind, weil dem richtig praktizierten Kapitalismus wesensfremd, Zeugnisse für dessen Güte.
So bringt allein das Stichwort „Missmanagement“, bedarfsgerecht angebracht, die Welt der marktwirtschaftlichen Konkurrenz mit allen unausbleiblichen Schädigungen und Gemeinheiten ideell ganz gut in Ordnung.
2. „Raffendes“ vs. „schaffendes“ Kapital ist nicht totzukriegendes Kulturgut
Konkurrenzverlierer können sich nicht darauf herausreden, dass ihr Job so schwierig ist; die Gewinner sind der – paradoxe, aber schlagende – Beweis, dass „es“ geht, also auch beim Verlierer gegangen wäre. Das eine steht aber jedem Unternehmer klar vor Augen, und auch sonst ist es niemandem ein Geheimnis: Zu einer Niederlage am Markt gehört nicht nur der Betrieb, der sie kassiert – und der bessere, der gewinnt –, sondern immer auch und maßgeblich eine dritte Partei: die Hausbank – oder sonst eine Kreditinstanz –, die den Weiterbetrieb nicht mehr finanziert.
Solange der Laden läuft, ist das Abhängigkeitsverhältnis, das daran so überdeutlich wird, gut und richtig. Das Bankgeschäft ist nützlich und wichtig, ja systemnotwendig, weil die Unternehmen für die Steigerung der Produktivität ihres Kapitals Leihkapital brauchen. Dass es ihnen dabei auf einen konkurrenzentscheidenden Vorsprung, also die Ruinierung anderer ankommt, geht in Ordnung. Sobald jedoch der Kredit als Kampfmittel versagt, gerät nicht der – gescheiterte – Zweck des Verlierers in die Kritik; auch nicht der Kredit, der das Geschäft bis zum bitteren Ende finanziert hat. In ein schiefes Licht kommt vielmehr das Kalkül der Bank, die kein „gutes Geld dem schlechten hinterherwirft“, sondern den Schuldner fallen lässt, auf Rückzahlung besteht, das Unternehmen in den Konkurs treibt und womöglich ausschlachtet, um sich schadlos zu halten. Insofern ist die Unternehmenspleite Tat des Gläubigers, der die Firma finanziert hat; und mit seinen Geldforderungen ist er auch daran schuld.
Das ist jedenfalls der Standpunkt des gescheiterten Unternehmers. Und nicht nur der sieht das so, auch nicht nur die Belegschaft, die nie auf die Idee gekommen wäre, die Schulden ihres Arbeitgebers wegen der damit bewerkstelligten Wegrationalisierung von Lohneinkommen zu kritisieren, sich vielmehr noch viel mehr davon vorstellen kann, damit am Ende die nicht wegrationalisierten Arbeitsplätze übrig bleiben. Die Sichtweise ist durchaus populär. Aus den Tiefen des marktwirtschaftlichen Problembewusstseins taucht da eine Unterscheidung auf, die in der Welt der kapitalistischen Geldvermehrung ohne jede praktische Bedeutung ist – wie eine Ahnung davon, dass es sich doch auch bei der Marktwirtschaft irgendwie immer noch um eine Produktionsweise handelt und nicht bloß um einen immerwährenden Tauschhandel –: Da gibt es Firmen, die die Menschen mit Gütern und Arbeitsplätzen versorgen, auf der guten Seite und auf der anderen Geldinstitute, denen es nur ums Geld geht, und das so ausschließlich, dass sie für ihr Recht auf dessen Vermehrung sogar Güterproduktion und ehrliche Arbeit opfern. Dass es den ehrlichen Produzenten um genau dasselbe zu tun ist: dass sie die schönen Versorgungsgüter wegwerfen, wenn ihr Verkauf sich nicht mehr rentiert; dass sie es sind, die die lieben Arbeitsplätze im Ernstfall abschaffen, und zwar zu demselben Zweck, für den sie sie einrichten; dass keineswegs bloß der Gläubiger am Geschäft des Schuldners schmarotzt, sondern der mit fremdem Geld über seine Verhältnisse lebt, um Konkurrenten zu überflügeln: das alles ist zwar überhaupt nicht unbekannt. Im Konfliktfall neigt der Moralist der Marktwirtschaft aber doch automatisch und ganz heftig dazu, den kapitalistischen Produzenten für ein Versorgungsunternehmen zum Wohle der Menschheit zu halten und den Bankern eine Profitmacherei ohne erkennbare eigene Leistung nachzusagen und das Eintreiben von Schuldforderungen übel zu nehmen. Zur abendländischen Leitkultur gehört jedenfalls das Bild vom – nein, nicht mehr vom Juden, der dem unschuldig überschuldeten Bäuerlein die letzte Milchkuh wegnimmt, nach der moralischen Ächtung des Antisemitismus gehört sich das nicht mehr, wohl aber das von profitsüchtigen Drahtziehern, die brave Kreditnehmer und womöglich ganze Völker in die Schuldenfalle locken oder laufen lassen, um sie dann zu knechten und unbarmherzig auszusaugen.
Auf die Art schafft sich das systemtreu humane Rechtsempfinden ein Refugium für seine Restempörung über den Zweck des kapitalistischen Fortschritts, seine Methoden und seine Konsequenzen. Das nützt der Versöhnung mit der ansonsten und überhaupt uneingeschränkten Herrschaft dieses Fortschritts über Arbeit und Leben der Gesellschaft. Und alle Vorbehalte gegen pure Geldgeschäfte koexistieren am Ende ganz friedlich mit der Anerkennung der Banken und Sparkassen als Dienstleistungsgewerbe, das aus dem modernen Geschäftsleben einfach nicht wegzudenken ist.
3. Was der Staat alles zulässt, gar unterstützt, darf gefragt werden
Schäden an Reichtum und Überlebensmitteln, die aus dem Kapitalwachstum durch gesteigerte Kapitalproduktivität resultieren, sind als Folgen betriebswirtschaftlichen Versagens, also als systemfremd verbucht; soweit von anerkannten Institutionen der Marktwirtschaft herbeigeführt, werden sie – sofern nicht als letztlich unvermeidlich gebilligt – einer gleichfalls systemwidrigen Profitgier zur Last gelegt. Beide Entschuldigungen der Wirtschaftsweise, die solche Schäden dann doch beständig produziert, führen geradewegs zu der Frage nach der Verantwortung der höheren Instanzen, deren Beruf es doch ist, auf alles aufzupassen und Entgleisungen zu verhindern: Wo bleibt die ordnende Hand des Staates? Zu der Antwort, dass die schon immer mit am Werk ist – kein Kredit wird vergeben, ohne dass das Recht die Vollstreckung von Zahlungspflichten garantiert; kein Konkurs geht über die Bühne ohne den Segen der öffentlichen Gewalt ... –, führt diese Frage nicht. Schon die Fragestellung lebt von dem Vertrauen, dass die Staatsmacht dazu da ist, Schäden am gesellschaftlichen Leben abzuwenden: zu verbieten, was an bösen Absichten unterwegs ist – wobei ‚verbieten‘ mit ‚unterbinden‘ gleichgesetzt und der Verdacht auf Staatsversagen laut wird, wenn doch Übles passiert –; zu verhindern oder ungeschehen zu machen, dass Kapitalisten ohne böse Absicht Geschäfte in den Sand setzen.
Natürlich wird dieses Vertrauen dauernd enttäuscht – wie auch nicht! Quittiert wird diese unausbleibliche Erfahrung mit Beschwerden an die Adresse der verantwortlichen Staatsmacht, die stets demselben Muster folgen. Erstens wird erfolgreiches staatliches Eingreifen vermisst, Untätigkeit diagnostiziert, wo „Handeln!“ am Platz – gewesen – wäre; die vorwurfsvoll vorgetragene Fehlanzeige deckt schon mal ganz viel Unzufriedenheit ab und behält ihr Recht, auch wenn ungesagt bleibt, welche gute Tat man sich denn erwartet hätte. Natürlich tut eine Regierung selten nichts, gerade wenn in der Wirtschaft vieles schiefläuft; sie fördert geschäftlichen Erfolg, wo immer der ihr wichtig und womöglich in Gefahr ist. Deswegen lauten die Vorwürfe zweitens auf Fehlanreize, die die Politik mit ihren Hilfen setzt; irgendein Anliegen aus dem großen Nest einander feindlicher Partikularinteressen, die das marktwirtschaftliche Geschäftsleben ausmachen, kommt schließlich allemal zu kurz, wenn ein anderes gefördert wird; und wenn es schlicht um den Erfolg der ohnehin Erfolgreichen geht, wird um die Freiheit gefürchtet, die der Staat mit jedem Eingriff in die Anarchie des Marktes zerstört.
So wird alles, wofür die bürgerliche Ursachenforschung einen Schuldigen sucht, auf die öffentliche Gewalt geschoben. Und das ideologisch enorm Nützliche daran ist: Die hält das gut aus. Erstens überhaupt; schließlich hat sie das Monopol auf Ordnungsstiftung in der Gesellschaft, und die Betroffenen kennen sowieso keine andere Adresse für ihre Beschwerden, bestätigen mit denen also die Zuständigkeit der Zuständigen – es gibt ja sonst niemanden, der sich zu kümmern hat. Zweitens lebt die Politik im demokratischen Staat geradezu davon, dass zwischen Beschwerdeführern und kritisch angegangenen Verantwortlichen ein Dialog in Gang kommt – in der Praxis zwischen amtierenden Machthabern und opponierenden Volksvertretern –, der jede Kritik an fehlendem oder falschem Handeln mit der Frage nach machbaren Alternativen an die Kritiker zurückreicht und diese so auf den Standpunkt der Ordnungsgewalt verpflichtet. Deren Handeln erscheint so als Kompromiss, ausgehandelt zwischen den divergierenden gesellschaftlichen Interessen und Standpunkten, insofern als Konsens derer, die in Wahrheit nur zu gehorchen haben. Die Frage, was die Regierenden mal wieder alles falsch gemacht haben, ist deswegen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht: Richtig gestellt leistet sie nicht bloß die Versöhnung, sondern die Identifikation aller Betroffenen mit der hoheitlichen Macht, die sich stellvertretend für ihre konkurrierenden Kapitalisten für die von denen angerichteten Schäden und Gemeinheiten haftbar machen lässt.
4. Dass die Arbeitsplätze woanders landen, ist zu beklagen
Die Opfer an Reichtum und lohnabhängigen Existenzen, die die Konkurrenz um einen Vorsprung an Kapitalproduktivität schafft, ändern sich in der Sache gar nicht, in ihrer politischen Bedeutung und im Urteil der Allgemeinheit umso mehr, wenn der Blick über den nationalen Tellerrand hinaus offenbart, dass Arbeitsplätze ins Ausland abwandern. Für den Staat sind Arbeitsplätze die mit berechnender Rücksicht aufs lohnabhängige Volk gewählte Recheneinheit für Wirtschaftsmacht; selbstverständlich nur die rentablen; die andern kommen sowieso und können auch weg. Eine Bilanz, die für ihn negativ und für andere Länder positiv ausfällt, deutet also auf Verluste in der Konkurrenz der nationalen Kapitalstandorte um Anteile am Weltgeschäft, auf mangelnde Produktivität der nationalen Arbeit. Den Unternehmern ist eine solche Gesamtbilanz einerseits egal; sie interessiert das eigene Geschäft, das davon nicht direkt betroffen ist, womöglich sogar profitiert. Als Argument für Beschwerden über wirkliche oder angebliche Nachteile beim Geschäftemachen daheim taugt sie ihnen aber auch dann; und natürlich erst recht, wenn auswärtige Konkurrenten ihren Profit schmälern. Auf die Lohnabhängigen kommen mit jedem grenzüberschreitenden Leistungsvergleich Forderungen der Arbeitgeber zu, die das Lohn- und Leistungsniveau im nationalen Maßstab betreffen. Dabei kommt es gar nicht weiter darauf an, ob der Verlust von Arbeitsplätzen ans Ausland stattfindet oder droht: Auf jeden Fall gerät der Gelderwerb der Gesamtbelegschaft des Landes unter Druck.
Gerade für die derart Betroffenen enthält eine im internationalen Vergleich negative Arbeitsplatzbilanz jedoch noch eine ganz andere Botschaft. In so einer Abrechnung sieht es nämlich so aus, als wäre nicht das immer anspruchsvollere Profit- und Wachstumskalkül ihrer Chefs der Grund für das Prekäre ihrer Existenz und die daraus folgenden Drangsale in Sachen Lohn und Leistung, sondern das Ausland, in dem das Kapital womöglich schneller wächst; als wäre nicht die Konkurrenz der Kapitalisten mit ihren qualitativen Fortschritten die permanente Bedrohung ihrer abhängigen Existenz, sondern die womöglich gewachsene Anzahl der genauso Lohnabhängigen, die im Ausland unter demselben Druck in Dienst genommen werden. Dieses Quidproquo wirkt wie ein harter materieller Grund für einen entschiedenen Schulterschluss der aktuell oder perspektivisch Geschädigten mit der nationalen Unternehmerschaft, die auf Kosten des ‚Faktors Arbeit‘ die Konkurrenz im Ausland wie daheim vorantreibt, um sie zu gewinnen, sowie mit dem Staat, für den weltrekordmäßig rentabel gemachte Arbeitsplätze Wirtschaftsmacht bedeuten. So kommen in der Klage über Arbeitsplätze, die anderswo landen, alle drei Parteien überein. Die wirklich in ihrer Existenz Bedrohten und Geschädigten tragen ihr Schicksal mit umso entschlossenerem Patriotismus.
5. Ebenso zu beklagen: der Gesundheitszustand der Umwelt, deren Rettung aber erstens mit der Ökonomie kompatibel ist, zweitens mit der Technik, deren Fortschritt keiner aufhalten will
Mit dem permanent gesteigerten Wirtschaftswachstum kommen die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit unter die Räder. Das ist nicht schön und wirft für den bürgerlichen Verstand – wie alle Schäden, die die kapitalistische Wirtschaftsweise mit sich bringt – die Schuldfrage auf. Die wird – von Bürgerinitiativen, „grünen“ Parteien, in Manifesten besorgter Wissenschaftler, von problembewussten Bürgern überhaupt – einhellig klar beantwortet: Schuld ist die Rücksichtslosigkeit, mit der mit Luft und Wasser, Boden und Pflanzen, Ressourcen und Klima, mit dem „blauen Planeten“ überhaupt umgegangen wird. Klagen und Anklagen gelten, je lauter, desto eindeutiger, der Profitgier, die als das Krebsübel des modernen Kapitalismus verstanden – und schon damit säuberlich von der Marktwirtschaft als solcher unterschieden wird. Von Übel ist der verantwortungslose Umgang mit den Faktoren, von deren Bewirtschaftung „wir alle“ leben: die Untugend der Gedankenlosigkeit, des kurzsichtigen Egoismus, der maßlosen Geldgier, die auf nichts Rücksicht nimmt. Das große Bild, der Überblick über Jahrzehnte und Jahrhunderte, bringt es so richtig an den Tag: Der übergroße Störfaktor, der Naturzerstörer, ist – jenseits aller und in allen vergänglichen Wirtschaftssystemen – der Mensch.
Was da zu tun ist, steht mit der Diagnose fest. Erstens muss die Umwelt gerettet werden. Ob mehr aus Heimatliebe oder aus frommer Verantwortung für die Schöpfung, wegen der Enkel oder zwecks Erholung in der freien Natur, das bleibt jedem Einzelnen überlassen. Hauptsache ist zweitens, worauf es deswegen ankommt, und zwar für alle: Was nottut, ist Achtsamkeit, ein ökologisches Bewusstsein beim Wirtschaften, beim Profitmachen, überhaupt bei allem, womit der Mensch seinen viel zu großen Fußabdruck in der Natur hinterlässt: bei Konsum und Verkehr, Energieverbrauch und Müll, Ackerbau und Viehzucht. In der Pflicht ist jeder Einzelne in seiner Privatsphäre, aber natürlich auch das große Ganze; insbesondere die Wirtschaft. Hinter deren positive Leistungen will und kann niemand zurück; ein „Weiter so!“ geht aber auch nicht. Der Kapitalismus muss ökologischer werden: Ressourcen schonen, Schadstoffausstoß vermeiden, CO2 einsparen; sonst hat auch der keine Zukunft. Immerhin sind grüne Aktien und Öko-Anleihen da schon mal ein vielversprechender Anfang...
Unterscheidungsvermögen ist also nicht gerade die Stärke des zeitgemäßen Umweltbewusstseins. Das ist aber auch nicht nötig, um alles Schlechte zu beklagen. Und es wäre eher hinderlich für eine nachhaltige Lösung, die den Menschen nicht moralisch überfordert – und die, mit marktwirtschaftlichem Sachverstand betrachtet, eigentlich schon bei der Hand ist. Im Zuge ihres forcierten Wachstums wälzen die Kapitalisten nämlich ohnehin laufend alles um: Produktion und Konsumtion, Handel und Verkehr; sie kennen kein Problem, für das sich nicht mit den revolutionären Mitteln der Technik ein Ausweg finden ließe, ohne gleich alles umzuschmeißen, i.e. ihr Geschäft zu beschränken. Wenn überhaupt, dann kommt die fällige Rettung der Umwelt auch aus dieser Richtung: von den immer weiter entwickelten Produktivkräften ihres Kapitals; und wenn das Geld kostet, dann verheißt das ja die schöne Möglichkeit, auch damit Geld zu verdienen und Arbeitsplätze zu schaffen. Deswegen darf man Wissenschaft und Technik im Dienst des kapitalistischen Wachstums auch nicht aufhalten, was sowieso keiner will: Wer sonst, wenn nicht die neuesten Produktivkräfte, könnte in Ordnung bringen, was die soeben veralteten kaputtgemacht haben!
Unterm Strich: Ethik des Kapitalismus
Ein letztes Mal: Die Konkurrenz um Kapitalwachstum, ausgetragen mit dem Mittel gesteigerter Kapitalproduktivität, scheidet die ökonomisch herrschende Klasse in Gewinner und Verlierer, kostet Massen kapitalistischen Reichtums, ruiniert Menschen mit abhängiger Arbeit als einziger Erwerbsquelle, fügt der systematisch produzierten und reproduzierten Armut die Schädigung natürlicher Überlebensbedingungen, also eine Extraportion Verelendung hinzu.
Wie werden die Betroffenen damit fertig? Ideologisch und moralisch am Ende mit einer Haltung, die sich in einem einzigen Stichwort zusammenfassen lässt: So ist er eben – der Fortschritt.
Es handelt sich dabei um einen Prozess, der zwar lauter Aktivisten kennt, aber kein Subjekt, keinen Urheber, kein Ziel, mit dem er an ein Ende käme. Beschworen wird die Vorstellung, dass die Welt ganz grundsätzlich nicht so bleibt und bleiben kann, wie sie ist, und auch nicht so bleiben soll und darf, weil es für ihre Probleme, welche auch immer und woher auch immer sie kommen, stets bessere Lösungen gibt. Das ganz formelle Ideal stufenweiser Verbesserung trifft sich da mit der Idee eines Sachgesetzes ständiger, unaufhaltsamer Veränderung. Man muss nicht eigens für den Fortschritt sein, weil der sowieso kommt; es spricht aber alles dafür, weil das, was der Fortschritt bringt, allemal – inwiefern auch immer – das Bessere ist.
Um Anpassung, nicht als einmalige, sondern als immer neu zu erbringende Leistung, kommt der Erdenbürger daher nicht herum. Ob er sich affirmativ dazu stellt oder dem Versprechen andauernder Optimierung mit einer genauso generellen Skepsis begegnet, bleibt seiner Meinungsfreiheit überlassen. Widerstand wäre jedenfalls rückschrittlich: verkehrt und vergeblich. Vorauseilendes Dafürsein enthält andererseits das Risiko, dass man danebenhaut: Fortschritt heißt eben, dass nicht ein vorab definierter Zweck zu erreichen ist, sondern allein das Ergebnis darüber entscheidet, ob das Gewünschte wirklich das fällige Gute war, der nächste Punkt in der Tagesordnung des Prozesses, der die Welt in letzter Instanz beherrscht und immer besser macht. Was sich durchsetzt, beweist umgekehrt ebendas: dass es erstens der Feind des bisherigen Guten, also das Bessere ist und zweitens einfach an der Reihe war. Wer dabei nicht mitkommt, der geht nicht nur zugrunde, der geht zu Recht zugrunde, ins Unrecht gesetzt durch das überlegene Existenzrecht dessen, was sowieso nicht aufzuhalten ist. Die einzig passende Lebenseinstellung ist folglich eine gesunde Kombination aus Optimismus und Opportunismus.
Die Idee des Fortschritts spiegelt die Identität von Interesse und Sachzwang wider, die die Konkurrenz der Kapitalisten mit dem Mittel überlegener Kapitalproduktivität und um den entscheidenden Vorsprung in der Verfügung über dieses Mittel beherrscht. Sie idealisiert diesen Widerspruch zum Grundgesetz des Weltlaufs. So rechtfertigt der Kapitalismus mit der formalen Logik seines fortgeschrittenen Wachstums dessen Regime über Arbeit und Leben der Gesellschaft und alle seine Wirkungen sogar da, wo sie den Nutznießern selbst auf die Füße fallen; er versorgt seine Opfer mit der einzig zu ihm passenden Handlungsmaxime.
Ethik des Kapitalismus eben.
[1] Die §§ 13-17 des Kapitel III, Steigerung des Wachstums: die Produktivität des Kapitalismus, sind in GegenStandpunkt 1-19 erschienen. Die Übersicht der Paragraphen findet sich hier.