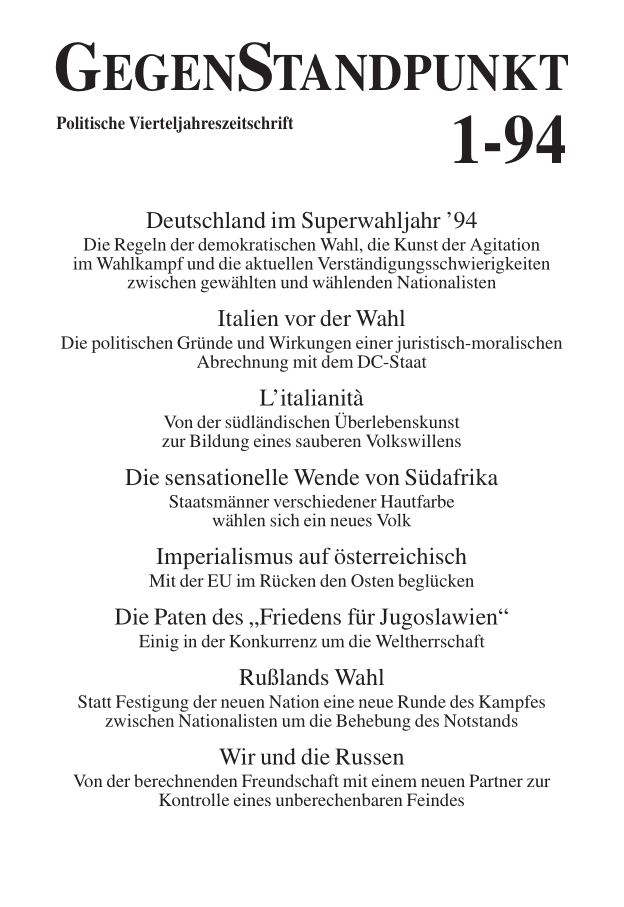Imperialismus auf österreichisch
Mit der EU im Rücken den Osten beglücken
Die neue Lage nach dem weltpolitischen Abgang der Sowjetunion stellt sich für Österreich als ein einziger Auftrag dar, an Macht hinzuzugewinnen. Es will in die EU und sich politisch aufwerten, indem es in seinen östlichen Nachbarländern mit der EU im Rücken Einfluss zu gewinnen sucht. Die gleichfalls erforderliche militärische Neuausrichtung steht außer Frage, strittig ist allein, ob unter Nato-Dach oder vorbildlich im Nato-Sinn außerhalb der Nato-Struktur.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Imperialismus auf österreichisch
Mit der EU im Rücken den Osten beglücken
Seit sich mit der Sowjetunion auch deren Militärbündnis, der Warschauer Pakt, aus der Weltgeschichte verabschiedet hat, sieht sich der Kleinstaat Österreich mit einer neuen „Lage“ konfrontiert. Ein Blick über die nördlichen und östlichen Grenzen ihres Territoriums zeigt österreichischen Außenpolitikern und Militärstrategen nunmehr anstatt Mitgliedern eines „monolithischen Blocks“ die drei für Einmischung aller Art sympathisch offenen Kleinstaaten Tschechien, Slowakei und Ungarn. Und im Süden haben sich mit Slowenien und Kroatien als erste brauchbare Ergebnisse des „Balkankrieges“ staatliche Neugründungen etabliert, von denen Österreich sogar mit Fug und Recht behaupten kann, an ihrem Zustandekommen nicht unwesentlich mit beteiligt gewesen zu sein.
Aus der vierten Himmelsrichtung sind zwar keine staatlichen Neugründungen zu vermelden, dennoch ist es auch hier mit der „gewohnten“ Staatenwelt aus der Zeit des „Kalten Krieges“ gründlich vorbei. Mit der Eröffnung des Binnenmarktes und dem Vertrag von Maastricht haben die EG-Staaten Fakten gesetzt, die eine Zwischenstellung nicht länger dulden: Entweder man ist mit von der Partie – oder draußen. Der EFTA, seit dem Ausscheren Großbritanniens ohnehin auf einen Verlegenheitsverein westlicher Nicht-NATO-Staaten reduziert, ist mit dem Ableben der Sowjetunion ihr letzter negativer Bestandsgrund, der Status der Neutralen als Staaten zwischen den Blöcken, verloren gegangen – nicht einmal als gemeinschaftliche Verhandlungsplattform zur Eingemeindung in die EU mochten sie ihre Mitgliedsstaaten mehr benutzen. Und Österreich will seither nur eines: ohne Wenn und Aber beim Club der Staaten mitmachen, der in Europa – und morgen in der ganzen Welt – das Sagen hat bzw. haben soll.
Der legendären österreichischen „Neutralität“ sind damit ihre Grundlagen restlos abhanden gekommen. Diese bis zu Beginn der 90er Jahre gültige weltpolitische Definition hatte Österreich eine zwar beschränkte, immerhin jedoch europa- und weltweit anerkannte und ausnutzbare Rolle im „internationalen politischen Geschehen“ zugemessen. Das haben sich viele gelehrige Bürger dieser Republik so zu Herzen genommen, daß sie die „Neutralität“ ihres Staates glatt für einen „Wert“ halten, von dem sie in Meinungsumfragen partout nicht lassen mögen, da sie meinen, an ihm hinge ein gutes Stück ihrer „nationalen Identität“.
Politiker und Leitartikler sind da weniger nostalgisch. Die Neutralität, die sich Österreich im Jahr 1955 mit dem Attribut „immerwährend“ in die Verfassung geschrieben hat, betrachten sie sehr sachgemäß als eine den Kräfteverhältnissen der Zeit geschuldete Konzession, mit der es nun vorbei ist. Wenn überhaupt etwas, dann gefällt ihnen am überkommen Titel der „Neutralität“ die Vorstellung, daß hier ein Staat unter seinesgleichen Gewichtigeres zu melden hätte, als er aufgrund eigener Mittel durchzusetzen in der Lage ist. Der nötige Halt zur Verwirklichung dieses erstrebenswerten Ideals, darin sind sich die maßgeblichen Instanzen des Landes einig, ist nur von und in der EU zu haben.
Die Einschätzung der neuen Lage durch verantwortliche Österreicher gliedert sich sauber in die beiden Abteilungen „Chancen“ und „Risiken“. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Chancen, durch aktive Teilnahme an der Neuordnung Europas an Macht zuzulegen, sind beachtlich und unbedingt wahrzunehmen. Das Risiko besteht darin, daß sich andere das nicht gefallen lassen.
Die neuen Nachbarn: Lauter Fälle für Einmischung und Aufsicht
In einer Grundsatzrede zur „Sicherheit in Europa. Ein Konzept für Österreich“ legt der österreichische Verteidigungsminister die regierungsamtliche Lagebeurteilung dar:
„Mit der Zersplitterung des bisher politisch weitgehend einheitlich agierenden ehemals kommunistischen Staatenverbundes in unterschiedliche Ziele verfolgende Nationalstaaten und als Konsequenz der Staatenteilungen in der nordöstlichen und südlichen Nachbarschaft erfährt Österreichs regionale Stellung in Mitteleuropa insgesamt eine nicht unbeträchtliche Veränderung.“ (Verteidigungsminister Werner Fasslabend in: Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ) 6/1993)
Auf die römische Weisheit des divide et impera! verstehen sich die Österreicher offenbar. Die „Staatenteilung“ in der „südlichen Nachbarschaft“, die als „Krieg auf dem Balkan“ für moralische Entrüstung über die angebliche Feigheit Europas vor überlegenem militärischen Zuschlagen sorgt, haben sie nach Kräften international propagiert und angestachelt. Den „nordöstlichen“ Fall, die Zerlegung der Tschechoslowakei, haben sie wohlwollend begrüßt und sich bescheiden als Reiseleiter nach Europa angeboten: „Beide neue Staaten können sich der Hilfe Österreichs bei ihrem Bestreben, Anschluß an Europa zu finden, sicher sein“ (Kanzler Vranitzky). Dieser „Lage“, an deren Herstellung sie redlich mitgearbeitet haben, entnehmen Österreichs Politiker nun ganz selbstverständlich eine „nicht unbeträchtliche“ Aufwertung ihres Staatswesens. Eine Aufwertung, die allerdings nur zählt, sofern und soweit man ihr durch ein „Hineinwirken“ in den neugeschaffenen „Raum“ gerecht zu werden vermag. Österreich hat sich da einiges vorgenommen:
„Österreichs hoher ökonomischer Entwicklungsstand sowie die politische Stabilität und die kulturelle Ausstrahlungskraft bewirken automatisch eine bestimmte Erwartungshaltung der ‚neuen‘ Nachbarstaaten gegenüber Österreich. (…) Daraus entsteht die Möglichkeit, daß Österreich politisch, kulturell und ökonomisch verstärkt in den ostmittel- und südosteuropäischen Raum hineinwirkt und dadurch auch seine vitalen sicherheitspolitischen Interessen – erstmals seit 1955 – aktiv bzw. präventiv in dieser Region zum Tragen bringt.“ (ebd.)
Wofür kulturelle Strahlkraft alles gut ist! Ganz offenkundig hat Österreich nicht vor, sich mit seinen neuen Nachbarn auf eine Stufe zu stellen, sondern will ihnen als eine Art regionaler Vormacht gegenübertreten. Ebenso offenkundig wird damit ein österreichischer Anspruch angemeldet, vorgetragen als die unwidersprechliche Gutheit, mit ihm bloß einer eigentümlichen Erwartungsautomatik der lieben Nachbarn gegenüber dem österreichischen „Entwicklungsstand“ zu entsprechen. Dieser Anspruch ist ziemlich hochgestochen: Er zielt nicht auf die eine Importbeschränkung oder die andere Kreditlinie, sondern auf den harten Kern jeder staatlichen Souveränität. Das „Hineinwirken in den Raum“ soll eine Sorte Abhängigkeit stiften, die es den dort beheimateten Staaten einleuchten läßt, daß sie sich bis hin zu ihrem Militärwesen an dem zu orientieren haben, was Österreich in den Kram paßt.
Fasslabends „Konzept für Österreich“ bescheidet sich freilich nicht damit, sich gegenüber dem „Umfeld“ im Norden, Osten und Süden als quasi natürlicher Vorgesetzter aufzubauen. Ein geopolitisches Bild – es wird übrigens auch in der österreichischen Bundeshymne besungen: „… liegst dem Erdteil Du inmitten…“ – macht deutlich, daß die österreichische Ostpolitik darauf abzielt, auf der gesamteuropäischen Staatenskala Rangplätze aufzuholen. Die angestrebte Endausbaustufe läßt an eine verkleinerte Kopie der deutschen Ost- und Europapolitik denken:
„Im Fall einer wirtschaftlichen und politischen Stabilisierung seines nordöstlichen, östlichen und südöstlichen Umfeldes würde sich für Österreich nicht nur die Chance umfassender Entwicklungsimpulse aus dieser Region ergeben. Die Konsequenz wäre eine Gewichtsverlagerung innerhalb der demokratischen Staatengemeinschaft Europas nach Osten und damit auch nach Österreich, also eine auch sicherheitspolitische Aufwertung Österreichs im gesamteuropäischen Kontext.“ (ebd.)
Ein Staat, der solches auf seine Fahnen schreibt, muß sich fragen lassen – und daher auch selbst fragen –, ob er denn über die Mittel verfügt, seine Ansprüche auch praktisch durchzusetzen. An dieser Frage blamiert sich so manches. Zum einen daran, daß es den staatlichen Neugeburten an allem möglichen mangeln mag, ganz sicher jedoch nicht an dem nationalen Selbstbewußtsein, sich von einem Staat von österreichischem Kleinkaliber nichts diktieren lassen zu müssen. Zum anderen und schwererwiegend an dem Umstand, daß österreichische Einmischungsambitionen von wuchtigen westlichen Staaten zunichte gemacht werden, die ja in Sachen Beaufsichtigung und Betreuung des Ostens auch nicht faul sind.
Ein schönes Beispiel für das Leiden an westlicher Konkurrenz gibt der Streit um den Bau eines grenznahen AKW im tschechischen Temelin. Da nützt es gar nichts, daß Österreich dieses AKW als „nationales Sicherheitsrisiko“ einstuft und den Nachbarn mit „Machbarkeitsstudien“ über den Umbau in ein süßes Gaskraftwerk nervt. Und es nützt auch nichts, wenn Österreichs Präsident prinzipiell wird und Prager Klarstellungen über das Selbstbestimmungsrecht eines Souveräns mit der Feststellung kontert, daß die Regelung der nationalen Energiewirtschaft die Kompetenz tschechischer Souveränität überschreite und daher „international“, also im Sinne Österreichs gelöst werden müsse. Nicht gangbar ist auch der Vorschlag der rechten Oppositionspartei FPÖ, „mit Prag endlich Klartext zu reden“ und im Falle des AKW-Weiterbaus „einen Wirtschaftsboykott zu verhängen“. All das nützt in diesem Fall vor allem deswegen nichts, weil die USA für den Ausbau von Temelin Staatskredit springen lassen, um ihrer AKW-Firma Westinghouse den Einstieg ins östliche Geschäft mit der Atomkraft zu ebnen.
Dieser Haken wird von Österreichs Zukunftsmachern nicht übersehen.
Fanatiker einer Weltmacht Europa
Für den Beitritt Österreichs zur EU wirbt heute nicht einmal mehr die dümmste Regierungspropaganda mit den Verlockungen wohlschmeckenden und preiswerten französischen Käses oder portugiesischen Rotweins. Diese verlogenen Vorteile für den König Kunden gelten den Staatsmännern, die sie dereinst in Umlauf gebracht haben, mittlerweile als kleinkrämerische Rechnungsweise, an der sich Staatsvorhaben der höheren Art auch nicht dem schönen Schein nach messen lassen dürfen. Und auch der grandiose Binnenmarkt mit seinen „300 Millionen Konsumenten“, der österreichischen Unternehmern ein Export-Eldorado in Aussicht stellt, so sie nur seinen Maßstäben gerecht zu werden verstehen, wurde, wie überhaupt alles Zivile, ins zweite Glied zurückgestuft. Was die Europäische Union, in sachgerechter Einschätzung des europäischen Rests auch kurz „Europa“ genannt, vor allem zu bieten hat, darüber sprechen österreichische Politiker beinahe Klartext: Es ist die Teilhabe an einer schon bestehenden und für enorm ausbaufähig befundenen Weltmacht, welche die Aufnahme in die EU so attraktiv wie alternativlos macht.
Als erste Etappe hat Österreich der EU die Wahrnehmung der einmaligen „Chance“ zugedacht, den Rest Europas ihrer uneingeschränkten Kontrolle zu unterwerfen, vom angestammten Kontinent also sozusagen endlich richtig Besitz zu ergreifen. Ist das erst geschafft, dann gibt es kein Halten mehr:
„Bei Wahrnehmung dieser ‚innereuropäischen‘ Chancen könnte Europa schließlich seine mit dem Ende des Kalten Krieges gewonnene instabile Rolle in der globalen Politik zu einer stabilen Subjektrolle entwickeln und zur internationalen Friedenssicherung auf der Grundlage europäischer Kultur- und Wertvorstellungen beitragen. Das Bestehen der insgesamt beispiellosen Chancenkonstellation müßte eigentlich Grund genug für die europäischen Staaten und Institutionen sein, ihre Fähigkeiten und Kräfte zum gegenseitigen Vorteil zu bündeln!“ (ebd.)
Der Mann hat offenbar mitbekommen, daß sich gerade bei den entscheidenden EU-Staaten die Zweifel am „gegenseitigen Vorteil“ ihres Projekts häufen – und beschwört zielsicher den einzigen guten Grund, den er kennt, weshalb souveräne Staaten ihre „Kräfte“ zu einer „stabilen Subjektrolle“ „bündeln“ sollten: zur Herstellung der Hegemonie über Europa mit darüber hinaus weisenden Perspektiven. Weil der österreichische Verteidigungsminister mit dieser Diagnose ganz richtig liegt, stellt sich für Österreich die Dringlichkeit einer EU-Mitgliedschaft in neuer Schärfe: Wer nicht zu den Aufsichtsmächten des neuen Europa zählt, findet sich unter den beaufsichtigten Nationen wieder, mit deren Souveränität es nicht weit her ist. Da es letztere Perspektive unbedingt zu vermeiden gilt, fällt die Antwort auf die heiße Frage, was denn aus Österreich nun werden soll, ganz eindeutig aus.
Aber nun ist Österreich, wenn keine gröbere Katastrophe dazwischenkommt, ab nächstem Jahr mit dabei, von der EU also nicht bloß abhängig, sondern in und mit ihr zu einigem berechtigt. Wozu alles, das muß sich erst noch herausstellen und ausgetestet werden. Angemeldet ist jedenfalls die Doppelrolle, sich in der EU als Spezialist für Ostbetreuung wichtig zu machen und im Osten als vorgeschobener Repräsentant der EU auf den Respekt zu dringen, den man als Österreich einzuklagen gar nicht in der Lage ist.
Schon seit dem „Fall Jugoslawien“ meldet sich Österreich als Scharfmacher eines „handlungsfähigen“ europäischen Gemeinschaftsimperialismus zu Wort, vor dem sich die tatsächlich praktizierte Ordnungspolitik der EU nur als Schlappe und Feigheit blamieren kann. Ob das Einbringen dieses Standpunkts in die EU die vermißte Einheit voranbringen wird, ist zweifelhaft. Das österreichische Interesse daran ist jedoch zweifelsfrei vorhanden. Die Sache mit dem „Neutralitätsvorbehalt“ ist abgehakt und vergessen, das demonstrative Einklinken in die „europäische Sicherheitsarchitektur“ samt gemeinschaftlichem Militärwesen ist fix geplant, auch wenn es das so noch gar nicht richtig gibt:
„Nach dem derzeitigen Stand der Dinge ist die Einbindung in die Europäische Union und die WEU das einzig konkrete – und umfassende – sicherheitspolitische Zukunftsangebot, mit dem Österreich heute konfrontiert ist.“ Und „auch im Verhältnis zur NATO, die ja ihrerseits in einer grundlegenden Debatte über ihre eigene Zukunft steht und außerdem bemüht ist, dem neuen Europa Instrumente der kooperativen Sicherheit zur Verfügung zu stellen, braucht es keine Berührungsängste zu geben.“ (Außenminister Alois Mock, in: profil 46/1993)
Ob die NATO – die, wenn es um die „Selbstbestimmung“ Europas geht, auch schon mal unter dem unfeinen Titel einer „aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangenen, weitgehend fremdbestimmten Sicherheitsordnung“ firmiert – sich ausgerechnet darum „bemüht“, sei dahingestellt. Österreich hält sich hier an die europäische Gewißheit, daß bei der „Stabilisierung“ der nach wie vor nuklear bewaffneten Erbmasse der Sowjetunion auf die amerikanische Führungsmacht nicht verzichtet werden kann, und möchte an der Wucht der maßgeblichen Militärmacht irgendwie teilhaben. In der Chefetage des „österreichischen Nachrichtenmagazins“ stellt man sich das so vor:
„Auf sich allein gestellt, wäre Österreich nie imstande, in einem Regionalkonflikt zu bestehen. Ein NATO-Beitritt brächte Österreich hingegen weitestgehenden Schutz. Er ist wahrscheinlich die einzige Chance, nicht in einen Lokalkrieg verwickelt zu werden. Nur größenwahnsinnige Abenteurer würden es wagen, gegen ein Land vorzugehen, hinter dem die größte Militärmacht der Welt steht.“ (profil-Leitartikel vom 8.11.1993)
Dem steht allerdings entgegen, daß von einer Einladung der NATO an Österreich nichts bekannt ist. Und von einem Abbau der „Berührungsängste“ durch Teilnahme an der NATO-„Partnership for Peace“ hält man wiederum in Österreich gar nichts. Dieses „Angebot“ wurde hier sehr sachgerecht weniger als eines zur Teilhabe an der NATO-Macht, als vielmehr eines zur Unterordnung unter ihr Regime aufgefaßt – und in dieser Eigenschaft als für die zu befriedenden Oststaaten genau passend begrüßt. Für einen europäischen Staat erster Klasse hingegen wäre diese Sorte „Kooperation“ geradezu entwürdigend. Da wartet man lieber ab, welche zielführenderen Perspektiven sich für ein vollwertiges EU- und WEU-Mitglied ergeben mögen.
Was aus dem Projekt einer europäischen Weltmacht wird, entzieht sich weitgehend der Einflußnahme durch österreichische Staatskunst. Deshalb hält man sich an die derzeit gültigen Vorgaben, ohne die Nation dadurch fahrlässig „einseitig festzulegen“, wie manche Euro-Skeptiker befürchten. Denn wie Europapolitiker jeder Nation wissen auch die österreichischen, daß sie diesen Staatenbund nur in dem Maße für sich funktionalisieren können, in dem sie sich durch eigene Potenz für ihn „unentbehrlich“ machen. Und wenn sich die Europäische Union letztendlich doch als eine kriegsträchtige Ansammlung konkurrierender Ordnungsmächte herausstellen sollte – ein „Risiko“, das wegen seiner unabwägbaren Folgen öffentlich derzeit nicht in Betracht gezogen wird –, dann ist es erstens kein großes Geheimnis, welche benachbarte Großmacht für diesen Fall wieder einmal als Bündnispartner feststeht, und zweitens ist militärische Leistungsfähigkeit dann erst recht gefragt. So oder so gilt es also, sich stark zu machen. Daran wird in Österreich gearbeitet.
„Kriege in Europa sind wieder führbar geworden“ oder: Ein Heer wird normal
Irgendwann, als Deutschland wieder ganz und die Sowjetunion zerlegt war, wurde auch in Österreich vierzehn Tage lang etwas von einer „Friedensdividende“ gemurmelt, die jetzt eigentlich fällig wäre. Die alte Ideologie, daß Rüstung, Militär und Kriegsplanung demokratischen Horten der Freiheit an sich wesensfremd wären, würden sie nicht durch die Bedrohung des „kommunistischen Systems“ zu dergleichen gezwungen, wurde kurz aufgewärmt – um sie alsgleich als „Friedensillusion“ wieder abzuräumen. Ohne großes Aufheben wurde sie durch die andere ersetzt, daß kriegerische „Konflikte“ jetzt deswegen auf der Tagesordnung stünden, weil sie jahrzehntelang vom Kommunismus perfide unterdrückt worden waren. Inzwischen ist die Ideologie beinahe bei der Wahrheit gelandet. Als wollte man im nachhinein der Selbstdefinition der Sowjetunion als „Friedensmacht“ recht geben, wird die Zeit des „Kalten Krieges“, der zumindest in Europa nie „heiß“ wurde, als eine Zeit des „aufoktroyierten“ Stillhaltens schlechtgemacht; echt freie Staaten hingegen haben es nun einmal so an sich, daß sie Krieg als „letztes Mittel“ der Politik gegenüber ihresgleichen stets in Erwägung ziehen. Als Staatskritik ist diese Entdeckung nicht gemeint – sondern als menschlicher, allzustaatlicher Umstand, dem es deswegen Rechnung zu tragen gilt. Daß in Österreichs Guter-Nachbarschafts-Politik ganz locker allerlei kriegerische Szenarien eine gewichtige Rolle spielen, läßt sich so ganz unspektakulär als überfällige Rückkehr zur Normalität deuten. Eine Deutung, die sich (nicht nur) im Falle Österreichs auf eine für tatenfreudige Staatsmänner tatsächlich unerfreuliche Beschränkung, den Einsatz ihrer bewaffneten Gewalt betreffend, berufen kann.
Denn so unangemessen es scheinen mag: Österreichs Heer war in seiner politischen Zwecksetzung und militärischen Konstruktion ganz und gar für den europäischen Weltkriegsfall gedacht und zugeschnitten – und gerade deswegen eine ziemlich matte Sache. Im de facto und völkerrechtlich per „Staatsvertrag“[1] entmilitarisierten westlichen Vorfeld der europäischen NATO-Front quälte sich Österreichs Militär jahrzehntelang mit einem unerfüllbaren und daher denkbar undankbaren Auftrag ab: Inmitten eines im Prinzip globalen Atomkriegsszenarios sollte das österreichische Bundesheer dafür taugen, das Fähnlein der Souveränität – im Idealfall noch mit ein wenig Alpenterritorium drumherum – eher symbolisch denn militärisch aussichtsreich hochzuhalten. Selbst das, und alles andere erst recht, lag in den Händen der NATO. Mit dem Entfall dieses häßlichen Kriegsbildes war für Österreichs Politiker nicht Abrüstung angesagt, sondern das Fitmachen ihrer bewaffneten Macht für nunmehr „bewältigbare“ Aufgaben. Und dieser Aufgaben gibt es viele.
- Seit der heftig gegeißelte menschenrechtswidrige „Eiserne Vorhang“ von der drüberen Seite abmontiert worden ist, gilt es, ihn von hier aus mindestens ebenso undurchdringlich wie das Original zu gestalten. Die Zeiten, als für das Projekt „Wir machen die DDR fertig“ massenhaft Ossis via Ungarn – Österreich wieder heim ins Reich geschleust wurden, sind schließlich endgültig vorbei. Jetzt macht das Bundesheer die Grenze dicht, damit kein Rumäne auf den Irrtum verfällt, er könnte den neuen Segnungen von Marktwirtschaft und Demokratie bei sich zu Hause dadurch entgehen, daß er in eines ihrer Musterländer, nach Österreich flüchtet.
- Österreich hat dafür geworben und gehetzt, und Genscher hat ihn in der EG durchgesetzt: den Beschluß, daß Jugoslawien in Stücke geschlagen gehört. Der Krieg, der sich im Sommer 1991 beim Verabschieden Sloweniens aus der jugoslawischen Souveränität an Österreichs Grenze abspielte, hat die sich zur Auflösung und Neugründung fremder Souveräne befugt wähnenden Politiker unangenehm daran erinnert, daß diese Befugnis die Verfügung über ein Kriegswesen voraussetzt, das dazu in der Lage ist, andere zum Stillhalten zu zwingen.
Dieses Ideal ist beim Auseinanderdividieren Jugoslawiens nicht aufgegangen. So „zeigen die Geschehnisse am Balkan“ nunmehr im dritten Jahr „mit erschreckender Deutlichkeit, daß Kriege in Europa wieder führbar geworden sind“. Und wenn sich österreichische Ostpolitiker vor die Landkarte stellen, dann sehen sie dort jede Menge roter Sternchen, von denen jedes einen weiteren Schauplatz kennzeichnet, an dem sie einen Krieg für potentiell „führbar“ erachten. In der Summe läppert sich so ein stattliches „Bedrohungsszenario“ zusammen. Für sich genommen sollen die einzelnen „Konflikte“ jedoch in die Rubrik „bewältigbar“ eingestuft werden können.
- Damit das wahr wird, wird das Bundesheer derzeit gründlich umgekrempelt: von der Vaterlandsverteidigung im großen Krieg zu einer mobilen und schlagkräftigen Einsatztruppe. Die Vollmobilisierung für den nationalen Ernstfall wurde um die Hälfte auf 120000 Mann heruntergestuft; dafür wird ein rund 15000 Mann starker Kampfverband aufgebaut, der jederzeit einsetzbar sein soll. Mobilität und Feuerkraft des Heeres werden auf den „Stand der Technik“ gebracht – beschafft werden Raketenwaffen aller Art, schweres Geschütz aus überflüssigen NATO-Beständen und eine gediegene „Radpanzerfamilie“; auch die nächste Fliegergeneration soll vom Feinsten sein –, und Fasslabend gibt sich zuversichtlich:
„Mit der Heeresreform, die nunmehr unmittelbar vor der Realisierung steht, wird Österreich einer der ersten Staaten sein, der umfassend auf die neue europäische Instabilität reagiert. Nach Beendigung des Kalten Krieges und einem geänderten Bedrohungsbild hat Österreich zum ersten Mal die Möglichkeit, tatsächlich aus eigener Kraft mit den real drohenden Gefährdungen fertig zu werden.“ (Der Verteidigungsminister in seinem Tagesbefehl zum Jahreswechsel 1992/93, in: ÖMZ 2/93)
- Das neue österreichische Bundesheer ist explizit nicht als Teil irgendeiner kollektiven Streitmacht konzipiert. Selbstverständlich aber soll es dafür taugen, im Falle des Falles als solcher zu wirken. Bei welchem Aufsichtsverein man sich jedoch wie und bei welcher Gelegenheit engagieren soll, ist derzeit offen.
Die UNO, traditioneller Auftraggeber für österreichische Blauhelmsoldaten, ist nämlich auch nicht mehr das, was sie einmal war. Anstatt, wie am Golan oder in Zypern, mit der offiziellen Billigung der betroffenen Staaten vorläufig stillgelegte Frontlinien zu beaufsichtigen, hat sich der Weltverein bei seinen letzten Einsätzen als übergeordneter Machtfaktor in laufenden Kriegen versucht. In Somalia war und in Jugoslawien ist Österreich nicht mit dabei. In Jugoslawien nicht, weil die offizielle österreichische Feindschaftserklärung gegen Serbien jeden Schein einer „neutralen“ Einmischung der „Weltgemeinschaft“ ad absurdum geführt hätte. Und in Somalia nicht, weil der österreichische Kanzler keinen „Handlungsbedarf“ entdecken konnte, sich in der Rolle des 38. Mitläufers eines von den USA angeforderten Befriedungseinsatzes zu bewähren. Wie es nach dem amerikanischen Frust über Somalia und dem ruhmlosen Wirken der UNO in Ex-Jugoslawien mit den Blauhelmeinsätzen weitergeht, ist überhaupt unklar. Sofern jedoch die USA und/oder die europäischen Mächte die UNO weiterhin für ihre Weltordnungsambitionen funktionalisieren möchten, hat Österreich jedenfalls reges Interesse angemeldet, bei künftigen Einsätzen mit von der Partie zu sein.
In der WEU will Österreich auf alle Fälle mitmischen. Es sieht die Notwendigkeit und in einem Beitritt die Chance, als Bestandteil einer „Festung Europa“, also mit einer fraglos überlegenen Militärmacht im Rücken, seine Ostambitionen gesichert abwickeln zu können.
[1] Im sogenannten „Staatsvertrag“ aus dem Jahr 1955 verpflichteten die alliierten Siegermächte, auf Wunsch und Druck der Sowjetunion, Österreich zu weitgehenden militärtechnischen und bündnispolitischen Beschränkungen. Dafür räumte die Rote Armee die von ihr eroberten Gebiete, und Österreich durfte sich ungeteilt und neutral ins westliche Lager einklinken. Seit dem Abgang der Sowjetunion behandelt Österreich dieses Vertragswerk als praktisch obsolet. Die Westmächte USA, Frankreich und Großbritannien haben dagegen offenbar keinen Einwand. Seither wird flott und offiziell das Gerät für moderne Kriegsführung beschafft. Einen matten Antrag Rußlands, als Rechtsnachfolger der Sowjetunion in den Staatsvertrag einzusteigen, beantwortete Wien mit einem klaren Njet.