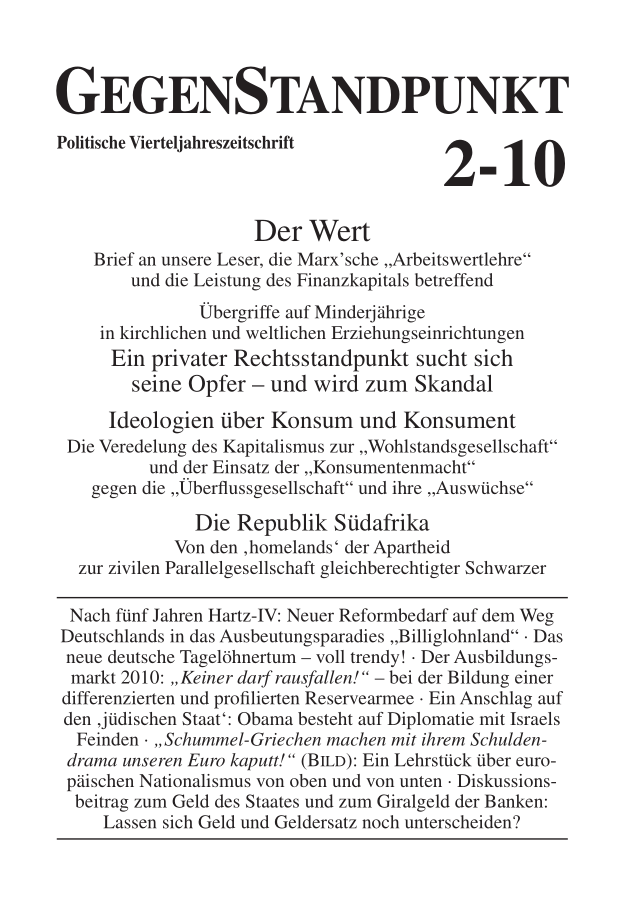Ideologien über Konsum und Konsument in der Marktwirtschaft
Die Veredelung des Kapitalismus zur „Wohlstandsgesellschaft“ und der Einsatz der „Konsumentenmacht“ gegen die „Überflussgesellschaft“ und ihre „Auswüchse“
Was über den Konsum vermeldet wird, ist so merkwürdig wie aufschlussreich: Des öfteren muss er z.B. „angekurbelt“ werden, wird also gefordert, damit das Wachstum vorankommt. Offenbar ist er er nicht Zweck, sondern Mittel, um Geschäfte in Gang zu bringen und zu halten. Als Anschub kommt denn auch eine Größe auf keinen Fall in Betracht: mehr Einkommen der arbeitenden Menschheit. Daneben hält sich vielmehr die umgekehrte Sicht: Unversehens finden sich Menschen, die nicht recht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, in einer „Überflussgesellschaft“ wieder. Der Konsument – in seinen Entscheidungen frei, aber durch sein Einkommen beschränkt – soll mit dem, was er sich privat leistet, überhaupt für alle möglichen Übel wie Umweltschäden usw. mitverantwortlich sein, mit seiner „Konsumentenmacht“ die aber auch korrigieren können – per Einkauf. Das ist theoretisch verkehrt und praktisch wirkungslos. Der
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Vorbemerkung zur objektiven Rolle des Konsums im Kapitalismus
- „Wohlstandsgesellschaft“: Funktionelle Notwendigkeiten als Ausweis guten Lebens
- „Der Kunde ist König“: alles im Griff
- Die „Überflussgesellschaft“ und ihre „Auswüchse“
- Die „Konsumentenmacht“ schlägt zurück
- Vom Lob der „Konsumgesellschaft“ zur Kritik des Konsumenten
Ideologien über Konsum und Konsument
in der Marktwirtschaft
Die Veredelung des Kapitalismus zur
„Wohlstandsgesellschaft“ und der Einsatz der
„Konsumentenmacht“ gegen die „Überflussgesellschaft“ und
ihre „Auswüchse“
Vorbemerkung zur objektiven Rolle des Konsums im Kapitalismus
Über den Konsum sind merkwürdige, aber aufschlussreiche Meldungen im Umlauf. Des öfteren muss er beispielsweise „angekurbelt“ werden. Konsum wird tatsächlich gefordert, damit das Wachstum in Gang kommt. Das sagt schon viel. Im Kapitalismus ist die Versorgung offenbar nicht Zweck, die Produktion das Mittel, um die gewünschten Güter des Bedarfs zu liefern. Umgekehrt, der konsumtive Bedarf ist das Mittel, um den Zweck Wachstum in den Unternehmen voranzubringen. Als Anschub kommt eine Größe deswegen auf keinen Fall in Betracht: das Einkommen der arbeitenden Menschheit, das über die Fähigkeit zum Konsumieren und den Umfang des Absatzes am Warenmarkt der Verbrauchsartikel entscheidet. Stattdessen werden lieber Konsumklima und Kauflaune gepflegt und der Verbraucher mit Optimismus statt Krisengerede versorgt, damit er seine Ersparnisse oder einen Kredit für zusätzliche Anschaffungen strapaziert. Das ist nämlich ein bilanzunschädlicher Beitrag des Konsums zum Wachstum. Der Grund für solche Merkwürdigkeiten liegt in der gültigen kapitalistischen Rechnungsweise der Unternehmen. Das Einkommen der Leute ist auf dem Markt als Realisierungsmittel für den Umsatz der Waren gefragt und kann in dieser Hinsicht gar nicht groß genug sein. Andererseits ist dasselbe Einkommen in der betrieblichen Bilanz Lohnkost, nötige Verausgabung für den Gewinn, die ihn zugleich schmälert und daher möglichst knapp bemessen wird. Dass die Beschäftigten mehr geldwerte Leistung abliefern als sie selber kosten, ist die Einstellungsvoraussetzung an jedem Arbeitsplatz. Der Konsum ist daher nicht nur eine beschränkte Größe, für den beanspruchten Warenumsatz immer zu klein dimensioniert. Er ist auch ein den Gewinn beschränkender Faktor, dessen Anhebung für mehr Umsatz nicht in Frage kommt. Voran kommt das Wachstum dennoch. Nicht nur, weil die Vorschüsse von Kapitalisten jenseits des Faktors Lohn sowie ihr eigener gehobener Konsum das Ihre zur Nachfrage beitragen. Mit dem Kredit machen sie sich auch noch von Schranken des Marktes frei, um ihr Wachstum zu finanzieren. Diese betriebliche Rechnung, der das Einkommen unterliegt, bestimmt überhaupt den gesamten Zweck kapitalistischen Wirtschaftens. Was, wie und wie viel produziert wird, entscheidet sich ebenso wie Qualität und Preis des Produkts an der Gewinnkalkulation. Die Kosten des Aufwands für jedes Produkt müssen einen Überschuss einspielen. In dieser Akkumulation von Geldreichtum ist die Versorgung der Beschäftigen ein Moment, das eingebannt bleibt in die engen Grenzen einer bloßen Reproduktion ihres Arbeitsvermögens. Auch ohne Marx-Lektüre hält sich diese Wirtschaft an das Prinzip, dass Arbeit nicht reich macht, sondern – bestenfalls – die Lebenshaltungskosten einbringt. Der Konsum ist in jeder Hinsicht abhängige Variable der kapitalistischen Produktion. Sie definiert nicht nur Umfang, Art und Preis der Güter, sondern auch das Einkommen der Verbraucher, das sie überhaupt nur zum Konsum befähigt.
*
Bei der Gestaltung seiner Konsumtion genießt der Mensch natürlich jede erdenkliche Freiheit. Er kann zwischen Waren derselben oder verschiedener Art wählen und sie nach Qualität oder Design vergleichen. Er ist sogar die alleinige Instanz, die über den Kaufakt entscheidet. Freilich unter den Vorgaben, die ihm auf der einen Seite durch eigene Notwendigkeiten und das Sortiment der Anbieter, auf der anderen Seite durch die Warenpreise und seinen Geldbeutel diktiert sind. Manche Alternative im Warenangebot gerät daher zu einer des Verzichts. Entweder der Urlaub, oder das neue Auto. Für größere Anschaffungen ist der Konsument so frei zu sparen: Verzicht heute für den Konsum von morgen. Wem das nicht schmeckt, kann seine Freiheit auch in umgekehrter Richtung in Anschlag bringen und mit einem Kredit einkaufen: Konsum heute, Verzicht morgen, denn zurück gezahlt werden muss ja auch. Und am Ende aller Rechnungen und Berechnungen steht eine für den Urheber dieses Rechnungswesens glückliche Fügung, die dem Konsumenten seine Freiheit wie sein Problem erhält: Das verausgabte Einkommen ist in die Kassen derer zurückgeflossen, die es so kleinlich bewirtschaften und für ihren Gewinn erneut vorschießen. Der Kreislauf kann von vorne beginnen, der des Kapitals wie der des Konsumenten, der sich mit seiner Arbeit von Neuem ein Einkommen verdienen muss, das ihn bestenfalls instand setzt, wieder in die Arbeit zu gehen, sich also zu reproduzieren.
*
Zur Privatsphäre von Konsum und Genuss denkt sich der Konsument natürlich auch noch sein Teil. Mit all seinem Vergleichen und Wählen in der Warenwelt entscheidet er eigentlich nur eines, nämlich sich. Das aber liest er in dichterischer Freiheit so, dass er es ist, der entscheidet. Ausgerechnet die abhängige Variable der ganzen kapitalistischen Produktion bildet sich ein, der Herr des Verfahrens zu sein, dem alles Wirtschaften dient. Bei diesem schlichten, aber falschen Selbstbewusstsein gewöhnlicher „Verbraucher“ hätte es vermutlich sein Bewenden, würden nicht Öffentlichkeit und wissenschaftliche Experten mit ihren mehr oder weniger elaborierten Beiträgen das Ihre zur phantasievollen Schönfärberei beisteuern und sie gehörig fortentwickeln. Dabei ist die ideologische Absicht so hart gesotten, dass sie sich auch von der jedermann zugänglichen gegenteiligen Erfahrung nicht bremsen lässt. Seit ein oder zwei Jahrzehnten widmen sich Journalisten wie Sozialwissenschaftler öffentlich einer wachsenden Kinderarmut im Land und zählen die steigende Zahl von Hartz IV-Empfängern zusammen. Die „Tafeln“ zur Armenspeisung begrüßen sie als innovative Wege im Kampf gegen das Verfallsdatum von Nahrungsmitteln. Genügend Hungerleider gibt es ja inzwischen in jeder Großstadt, die dankbar sind für diesen Akt großherziger Entsorgung von Produkten jenseits des Ablaufdatums. Und gleichzeitig halten dieselben Leute ihre Legende von der „Wohlstandsgesellschaft“ ungerührt in Kraft, in der wir alle leben und die Otto-Normalverbraucher sogar zum „König Kunden“ befördern soll.
Eine Kritik am Konsum gibt es aber auch noch. Allerdings nicht an seiner schäbigen Verfassung, sondern an einem Zuviel davon. Unversehens finden sich Menschen, die nicht recht wissen, wie sie mit ihrem Einkommen über die Runden kommen sollen, in einer „Überflussgesellschaft“ wieder. Und je nach moralischem Sensorium werden dem Überfluss auch noch Wirkungen zugeschrieben, die das Verantwortungsbewusstsein moderner Konsumenten auf den Plan rufen sollen. Dioxin in Lebensmitteln, durch Pestizide vergiftete Landarbeiter, Kinderarbeit in der Dritten Welt, Klimabelastungen durch den globalen Warentransport: Das sind Missstände, bei denen der Konsument sich besinnen soll. Leider nicht auf Zweck und Charakter einer Produktion, die so etwas hervorbringt, sondern auf sich und seine „Konsumentenmacht“. Weil er per Einkauf „am System“ beteiligt ist, soll er seinen Konsum für die Ursache dieser Übel halten und sie wiederum per Einkauf korrigieren. Das ist praktisch wirkungslos und theoretisch ebenso verfehlt wie die zitierten Varianten von Lob und Tadel an der „Konsumgesellschaft“. Das verdient eine Begründung.
„Wohlstandsgesellschaft“: Funktionelle Notwendigkeiten als Ausweis guten Lebens
Die Verfechter dieses Lobs attestieren dieser Wirtschaftsweise, dass es in ihr um die Herstellung nützlicher Güter für eine gediegene und genussvolle Lebensführung geht, um einen materiellen Reichtum eben, der den Namen Wohlstand verdient und im Prinzip allen Mitgliedern der Gesellschaft verfügbar gemacht wird. Das ergibt das Bild von der „Wohlstandsgesellschaft“. Das Geld und seine Vermehrung, um das sich die kapitalistische Konkurrenz wirklich dreht, nehmen die Schöpfer dieses Bildes nur verkehrt zur Kenntnis, nämlich so, dass Geld eben den materiellen Reichtum beziffert und den Zugang zu ihm eröffnet, also Mittel für die Herstellung und Verteilung der Produktionsergebnisse sei. Natürlich nur für die, die Geld haben. Wer keines hat, muss einen Unternehmer finden, den er mit seiner Arbeitskraft bereichert. Ob das gelingt, ist fraglich und hängt vom Gewinnkalkül der Firmen ab. Millionen Mitglieder der Wohlstandsgesellschaft sind ohne Arbeit und Einkommen. Wenn das gelingt, definiert der Betriebszweck Gewinn, was aus dem Bemühen Minderbemittelter um ihren Gelderwerb wird. Ein knapp kalkulierter Lohn nämlich, von dem der Mensch vielleicht leben kann, von dem aber niemand wirklich leben möchte. Der Seufzer jedenfalls, dass es die eigenen Kinder einmal besser haben mögen, ist in proletarischen Haushalten bis heute nicht ausgestorben. Geld ist eben nicht hilfreiches Mittel für den Zugang zu den schönen Dingen des Lebens, sondern Zweck kapitalistischen Wirtschaftens. Seine Vermehrung durch die Arbeit Eigentumsloser ist Ziel und Kriterium ihrer Benutzung, und mit dem Lohn werden sie auf die pure Erhaltung ihrer Lohnarbeiterexistenz festgelegt, also vom wachsenden Reichtum ausgeschlossen, den sie produzieren müssen. Das sieht man auch den Utensilien eines modernen Arbeitnehmerhaushaltes an, die für gewöhnlich als Beweisstücke für den Wohlstand des Normalverbrauchers aufmarschieren.
Unbestreitbar, dem modernen Arbeitnehmer steht heute eine Palette von Gütern zu Gebote, die es in den Anfängen der „Industriegesellschaft“ noch gar nicht gab, schon gar nicht für Arbeiter. Zu bestreiten ist allerdings, dass dieser Umstand den Ehrentitel „Wohlstandsgesellschaft“ rechtfertigt, mit dem sich der Kapitalismus seit mehr als einem halben Jahrhundert schmückt. Automobil, Gefrierschrank oder Plasmafernseher, die in Arbeiterhaushalten gesichtet werden, müssen als Beweisstücke herhalten. Als wäre eine mobile Arbeiterbevölkerung, die den räumlich wie zeitlich flexiblen Einsatz in „atmenden Unternehmen“ abzuleisten hat, ohne fahrbaren Untersatz zu haben. Das schmale Zeitfenster, das nach einem aufreibenden Arbeitstag für die Erledigung der Ernährungsfrage noch bleibt, verlangt zwecks Zeitersparnis nach Vorratshaltung, die ohne Kühl- und andere technische Geräte nicht auskommt. Dass die zu erbringende Leistung an einem modernen Arbeitsplatz seinen Inhaber schafft, ohne dass deswegen ein fürstliches Entgelt winkt, trifft sich hervorragend mit den Angeboten der Industrie für Unterhaltungselektronik. Der Fernseher füllt nämlich den marginalen Rest an Erholungszeit optimal, der nach Erledigung der Notwendigkeiten der Reproduktion für den nächsten Arbeitstag noch verbleibt. Erstens ist das Heimkino im Vergleich zu außerhäusigen kulturellen Großtaten zeitsparend. Zweitens überfordert der passive Konsum bewegter Bilder nicht den Restposten an Kondition und Aufmerksamkeit, den die Leistungsbeanspruchung am Arbeitsplatz allenfalls übrig lässt. Und drittens ist die Sache auch noch erheblich billiger als Bayreuth oder Berlinale und damit dem bescheidenen Salär eines Lohnempfängers angemessen. Die Größen Zeit, Leistung und Geld, aus denen die Zwänge des Lohnarbeiterdaseins komponiert sind, werden hier also von einer Branche geschäftstüchtig ins Visier genommen.
Falsch ist das Lob der Wohlstandsgesellschaft eben darin, dass es pure Notwendigkeiten für die Erfüllung von Funktionen eines Arbeitnehmerdaseins mit dem Siegel des guten Lebens versieht. Sicher, auch solche Güter, die einstmals zu den Luxusartikeln gehörten wie etwa der gute Lachs, haben heute ihren Weg in den Warenkorb gewöhnlicher Arbeitnehmer gefunden. Aber was beweist das schon? Eigentlich nur dies: Die Produktivität der Arbeit ist so gewaltig vorangekommen, dass ein Kilogramm Edelfisch in immer weniger Lohnminuten herzustellen geht und die Lebensmittelindustrie deswegen auch noch proletarische Einkommen für die Erzielung gewinnbringender Preise in diesem Warensegment ausnutzen kann. Nur eines leistet der Produktivitätszuwachs in dieser Gesellschaft nicht: Weniger Arbeitszeit für die Herstellung von immer mehr und neuen Produkten führt nicht zu einem Gewinn an freier Zeit für den Arbeiter bei gleichzeitig besserer Versorgung. Nach wie vor müssen moderne Arbeitnehmer um die vierzig Stunden Leistung pro Woche abliefern für einen Lohn, der für viele das Notwendige nicht einmal hergibt und ihre Einteilungskünste herausfordert. Der Vorteil gewachsener Produktivität liegt eben ganz einseitig auf Seiten nicht der arbeitenden, sondern der unternehmenden Menschheit. Kapitalistisches Wachstum und Wohlstand aller sind also nicht zu verwechseln.
„Der Kunde ist König“: alles im Griff
Davon wollen allerdings die Schönredner der besten aller Welten nichts wissen. Mit der Kunstfigur des Königs, die in jedem Kunden steckt, setzen sie auf die Legende von der „Wohlstandsgesellschaft“ noch eins drauf. Mit dem reichhaltigen Warenangebot des Kapitals soll sich der Mensch nicht nur gut bedient sehen, die herrschaftliche Metaphorik präsentiert den Kunden sogar als den eigentlichen Herrn der Produktion. Er bestimmt ihren Inhalt und ihre Richtung, das Was, Wie und Wieviel. Mit Anleihen bei der Volkswirtschaftslehre wird der Kaufakt als Abstimmungsverfahren gedeutet, bei dem die Kunden mit Hilfe ihrer Geldscheine Signale setzen und Weichen stellen für das in Zukunft Gewünschte an Produkten und Dienstleistungen.
Das geht dann doch an der Wirklichkeit vorbei. Zunächst greift die Metapher vom Herrn, der in jedem Kunden steckt, ganz grundsätzlich zu hoch, weil der Herr zuvor in der Rolle des Knechts tätig gewesen sein muss, der sich zum Diener für die Geldvermehrung anderer hergibt, weil er selber kein Geld hat, also welches verdienen muss. Erst dann kann er mit seinen Geldscheinen Kaufakte tätigen. Und die werden von Sachverständigen im Nachgang als Abstimmungsverfahren interpretiert, in denen sich Bedürfnisse zu Wort melden, um der Produktion ihre Zielgrößen vorzubuchstabieren. Dabei läuft die genannte Teilnahmebedingung dem behaupteten Zweck des Verfahrens zuwider. Nicht der Bedarf, sondern nur der kaufkräftige Bedarf zählt. Elementare Bedürfnisse wie das nach Wohnraum bleiben auf der Strecke, wo das Geld fehlt, und abwegigste Bedürfnisse wie das nach Genitalschmuck oder einem handgefertigten Maserati kommen zum Zug, sofern sie bei Kasse sind. Der Bedarf in der rein sachlichen Bedeutung des Wortes ist also nicht Ziel, sondern Mittel, und zwar für den gewinnbringenden Absatz des Warenangebots. Deswegen kommt es ja auf die einschränkende Bedingung – zahlungsfähig! – entscheidend an.
Einmal mit Kaufkraft ausgestattet, ist der Konsument dann tatsächlich eine Figur, die sich wie der King fühlen darf, weil sie von der Welt des großen Kommerzes wichtig genommen wird. Mit aufwändiger Werbung umschmeichelt die Geschäftswelt den Kunden, aber nicht, weil sie dessen Nutzen, sondern das an ihm Ausnutzbare im Blick hat, seine Kaufkraft nämlich. Dabei lässt sich dem Umstand, dass große Unternehmen, die schon über ihre enorm hohen Produktionskosten klagen, immer noch immense Summen für die Werbeindustrie übrig haben, einiges entnehmen. Erstens nämlich dieses: Für die Versilberung des reichhaltigen Warenangebots der diversen Anbieter ist die Kaufkraft der Kunden eine arg beschränkte Größe, die gar nicht für alle den verlangten Umsatz und Gewinn hergibt. Gerade deswegen tobt ja mit den Finessen der Werbung ein Kampf um diese Kaufkraft, um sie in die eigenen Kassen zu lenken. Auch nicht gerade ein Tatbestand, der die Legende von der Wohlstandsgesellschaft haltbarer macht: Gemessen am wachsenden Warenreichtum der Verbrauchsartikel ist die finanzielle Zugangsmacht in den Händen derer, die das alles in den Fabriken hergestellt haben, einfach zu bescheiden. Und der gewaltige Aufwand, der nicht nur mittels Werbung, sondern durch die Erfindung immer neuer Produkte und moderner Designs Moden bestimmen oder Trends setzen will, belegt ein Weiteres: Die Bedürfnisse sind gar nicht die autonome Größe, die der Produktion Art und Menge gewünschter Güter vorgibt, wie das in der Metapher vom König Kunden impliziert ist. Umgekehrt: Die Bedürfnisse sind ihrem Inhalt nach weitgehend durch das Universum einer Warenwelt bestimmt, mit der Unternehmen um die Kaufkraft potenzieller Kunden kämpfen. Die moderne Lebensmittelchemie bringt es mit Geschmacksverstärkern, Ersatzstoffen oder Light-Produkten zu innovativen Lebensmitteln, die IT-Branche mit Handy oder iPod zu physikalisch-technischen Neuheiten, von denen sich Verbraucher vorher nichts haben träumen lassen. Jetzt sind sie da, neu geweckte und definierte Bedürfnisse, leider nicht, um sie zu bedienen, sondern um sie zur Kasse zu bitten.
Hinsichtlich der Kasse hapert es natürlich beim großen Publikum. Aber auch das stürzt die Geschäftswelt nicht unbedingt in eine Verlegenheit. Eher schon den König Kunden, nicht weil er ignoriert, sondern weil er bedient wird. Mit einem Produkt nämlich, das genauso fadenscheinig wie seine Kaufkraft ist, für die es extra maßgeschneidert wird. Das führt beispielsweise in der Kunst des Automobilbaus zu der interessanten Frage: Wieviel Auto kann man für 3000 € bauen? Warum angesichts der breiten Palette von Kraftfahrzeugen mit allem Komfort und gediegener Sicherheitstechnik auch noch die 3000-€-Billig-Version her muss, ist kein Geheimnis. Hier wird bei Tata oder VW nicht aus dem Aufwand für die Herstellung eines nützlichen Dings der gewinnbringende Preis deduziert. Umgekehrt, aus dem am Markt anvisierten und abzuräumenden Kaufkraftniveau leiten Konzerne und ihre Ingenieure die unbedingt notwendigen und vor allen Dingen verzichtbaren Eigenschaften des Gebrauchswerts her, damit auch das große Kundensegment mit minderbemitteltem Lohneinkommen für den gewinnbringenden Verkauf der abgespeckten Billigkutschen ausgenutzt werden kann. Nur die Ideologie vom Kunden, der König ist, stellt die Welt auf den Kopf: Für jeden etwas dabei! Auch die Wünsche der kleinsten Leute werden, dem Markt sei Dank, in der großen Produktion erhört. Als wäre diesem Bedürfnis nicht anzusehen, dass es kein frei gewähltes, sondern wesentlich ein durch die kapitalistische Benutzung und Entlohnung geformtes darstellt.
Dabei gestehen die Erfinder der Kunstfigur „König Kunde“ am Ende auch noch unfreiwillig ein, was sie da für eine Lachnummer in die Welt gesetzt haben. Verbraucherzentralen und Kundenberatung geben in Testheften Tipps, wie sich Kunden vor dem offenbar allgegenwärtigen Ausschuss in den Angebotsregalen schützen können. Internet-Seiten zum Preisvergleich müssen sein, damit der König nicht von jedem Idioten über den Tisch gezogen wird. Eine Verpackungs- und Etikettierungsverordnung muss wenigstens im Kleingedruckten Hinweise geben, mit welchen chemischen oder gentechnischen Angriffen sein Organismus womöglich nach Verzehr konfrontiert werden könnte. Kurzum, der moderne Verbraucher sieht sich umstellt von einer Horde konkurrierender Geschäftsleute, die nicht nur über seinen Geldbeutel, sondern mit ihren diversen Produkten auch noch über seine Sicherheit und Gesundheit herfallen. Unternehmen, die um diese Art der aufklärenden Kundenbetreuung natürlich wissen, machen sie gleich zu einer neuen Verkaufsstrategie: „Ich bin doch nicht blöd!“ – so setzt sich ein Betrieb für Unterhaltungselektronik vom Rest der Konkurrenten ab mit dem interessanten Verweis, in diesem Unternehmen würde der Kunde nicht für dumm verkauft. Man kennt ja die Branche, in der man reüssieren will.
Die „Überflussgesellschaft“ und ihre „Auswüchse“
Es ist nicht beim Lob des Konsums geblieben. Auch eine Kritik daran ist unter modernen Bürgern verbreitet. Sie gilt leider nicht seiner schäbigen Verfassung, sondern einem angeblichen Zuviel davon: „Überflussgesellschaft“. Interessant ist, wo dieser Überfluss gesichtet wird. Nicht in den Etablissements von Boris Becker, Josef Ackermann und den anderen Reichen, sondern im Haushalt Normalsterblicher, denen im Namen wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit seit Jahrzehnten eine Lohnsenkung nach der anderen offeriert wird. Aber der aufgeklärte Konsument weiß die Kürzung seines Lebensstandards mit dem Zugewinn einer neuen Einsicht wegzustecken, die aufhorchen lässt: „Vieles braucht man einfach nicht!“ Nämlich ungefähr das, was einem genommen wird: Muss es wirklich ein eigenes Auto sein oder tut es nicht auch eine Fahrgemeinschaft? Ist die Urlaubsreise nicht auch durch den heimischen Balkon zu ersetzen? Selbst die Ernährungsgewohnheiten eines ganzen arbeitenden Volkes werden von solchen Erwägungen nicht verschont, und der Fleischverzehr in der Woche wird wieder zu einer verzichtbaren, weil überflüssigen Angelegenheit. Alle sachlichen Güter eines guten Lebens sind reichhaltig vorhanden, aber eben für das Gros nicht verfügbar, weil sie ihnen als Warenreichtum gegenüberstehen, von dem sie mangels Finanzkraft ausgeschlossen sind. Und in einer solchen Welt, die alle Mittel des Genusses bereitstellen könnte, wird die arbeitende Bevölkerung auf den harten Maßstab des existenziell Unverzichtbaren, des Brauchens eben, festgenagelt. Die allgemeine Akzeptanz, die diese Sicht der Dinge gefunden hat, belegt ein weiteres Mal, dass mehr als die pure Notwendigkeit in Versorgungsdingen nie vorgesehen und auch nie verlangt war. Wohlstand ist es jedenfalls nicht, der da einbehalten werden soll, wenn vermeintlicher Überfluss abgebaut wird.
Es ist nicht dabei geblieben, den angeblichen Überfluss im Warenkorb gewöhnlicher Konsumenten als verzichtbare Größe zu deklarieren. Diese Größe wird zusätzlich und sehr grundsätzlich für viele Übel in der Welt der Marktwirtschaft verantwortlich gemacht. Kommt nämlich ans Licht, dass die Fußbälle großer Sportartikelfirmen ein Produkt südostasiatischer Kinderarbeit sind, Pestizide in Bioprodukten nicht nur das Gemüse, sondern auch die Tagelöhner auf marokkanischen Plantagen und das Trinkwasser der Region ruinieren oder gar die CO2-Emission eines ausufernden Warentransports zu Land und zu Wasser den blauen Planeten und sein Klima erwärmt, dann entdecken normale und alternative Meinungsbildner Verantwortungslosigkeit und Ausbeutung. Zielsicher zunächst natürlich da, wo der betreffende Staat schon aus anderen Gründen in Misskredit geraten ist. Während die Menschenschinderei bei braven Zulieferern aus Asien oder Südamerika mit mildem Tadel davon kommt, sofern sie überhaupt Erwähnung findet, hat derselbe Vorgang bei Staaten wie China, Venezuela oder Sudan immer das Zeug zum Skandal. Damit ist die Liste der Verursacher aber nicht fertig: Wer – fragt man – ermöglicht den Menschenschindern und Umweltsündern denn ihre verantwortungslose Raffgier? Natürlich der Konsument, der ihnen die Produkte ihrer miesen Geschäftemacherei abkauft; genaugenommen insbesondere der arme Konsument, der sich gescheite Produkte mit ordentlicher Qualität nicht leisten kann und dennoch bedient werden will. Er muss sich nicht wundern, dass seine – auf anständige Weise gar nicht zu befriedigende – Nachfrage von unverantwortlichen Produzenten zu unverantwortlichen Geschäften genutzt wird.
Immer mehr, billiger, schneller, weiter – mit solchen Komparativen wird einem Übermaß an Produktion und Versorgung zur Last gelegt, was in Wirklichkeit aus ihrem Prinzip folgt. Kinderarbeit und Tagelöhner sind billig, Pestizide steigern den Ernteertrag und der weltumspannende Transport gefertigter Waren erschließt Märkte und Kaufkraft. Nun aber heißt es plötzlich Ausbeutung. Die findet zwar im täglichen Normalbetrieb längst statt, der unbeanstandet durchgeht und deswegen auch nicht so heißt. Hier aber ist das Unwort fällig, weil bei den zitierten Fällen die rechtlichen und moralischen Grenzen nach dem Geschmack des Publikums verletzt werden, innerhalb derer Ausbeutung gar nicht so heißt. Das, aber auch nur das, gilt als Skandal.
Die „Konsumentenmacht“ schlägt zurück
Die allgemeine Überraschung, mit der die Konsumenten von besagten Skandalen Kenntnis nehmen, ist eine einzige Widerlegung der gepflegten Vorstellung, der Kunde als König habe die Richtlinienkompetenz über das Treiben in den kapitalistischen Firmen. Nichts von dem, was ihn nun empört, hat er gewusst, geschweige denn bestellt. Als Marktteilnehmer ist er ganz die abhängige Variable, nicht nur im Hinblick auf das verfügbare Einkommen, das ihm die Firmenkalkulation lässt, sondern auch in Bezug auf Qualität und Herstellungsprozess der feilgebotenen Ware. Alles, was sich das Etikett „Auswuchs“ zuzieht, gehört natürlich für einen verantwortungsbewussten Verbraucher bekämpft. Das beginnt bei der eigenen Gesundheit, die man vor den Eskapaden der Lebensmittelindustrie schützen muss, macht aber auch vor dem ausgreifenden Schritt zur Verantwortung für den ganzen Rest der Welt nicht halt. Am Ende müssen auch noch Klima und Gerechtigkeit in der Dritten Welt durch ein verantwortungsbewusstes Verbraucherverhalten gerettet werden. Dazu besinnt er sich auf seine „Konsumentenmacht“. Was immer nach dem Urteil des Publikums in den Betrieben schief läuft, es wird repariert. Merkwürdigerweise nicht mit einer Veränderung der Produktion, sondern der Konsumtion. Ein ethisch wertvoller Einkaufszettel meidet die falschen Fünfziger und lässt sich auch beim Preis nicht lumpen, wenn er in die Kassen der Richtigen fließt.
Durchgesetzter Standard beim gehobenen Publikum ist selbstverständlich der Einkauf nur von Bioprodukten, weil diverse Skandale um BSE, Gammelfleisch und Salmonelleneier der großen Supermarktketten und Discounter bis heute nachwirken. Auch das gilt als Triumph gelebter Konsumentenmacht. Dass „gesunde Ernährung“ überhaupt zum speziellen Label der Lebensmittelproduktion werden konnte, spricht schon Bände. Die Selbstverständlichkeit, dass Nahrungsmittel der Gesundheit zu- statt abträglich sein sollten, ist im Kapitalismus offenbar keine. Aber gegen einen gewissen Aufpreis soll sie käuflich sein, in Biomärkten angeblich. Der Appell an Gesundheitsbewusstsein und Gewissen der Konsumenten leidet freilich schon daran, dass den meisten die nötige Kaufkraft dafür nicht zu Gebote steht. Ihr Lohneinkommen wird nämlich von eben der Sorte Unternehmertum so kärglich bestückt, das auf der anderen Seite den Markt mit wenig zuträglichen Lebensmitteln beliefert. Dennoch, das ethische Bewusstsein vom gesunden Leben und verantwortungsvollen Konsum, das auf die schäbigen Wirkungen der kapitalistischen Produktion antwortet, ist auch bei den Massen zunehmend angesagt. Es lässt sich im Gegenzug daher doch auch als Geschäftsmittel für eben diese Industrie ausnützen. Diesen Markt lassen sich die großen Supermarktketten jedenfalls nicht entgehen und staffieren ihre Verkaufsflächen mit Bioregalen in großem Stil aus. Ein ordentlicher Gewinn aus der beschränkten Kaufkraft der angesprochenen Klientel lässt sich selbst im Biosegment herauswirtschaften, wenn nur die Kosten entsprechend gesenkt werden. Also kaufen Bio-Produzenten neuerdings in der Ukraine Hühnerfutter auf, das sich mit seinem sensationell günstigen Preis wohltuend in der Bilanz und mit seinem Dioxin weniger zuträglich in Bio-Eiern bemerkbar macht. So kommt es auch, dass die größten Anbieter von Biogemüsen ihre Produkte von spottbilligen Tagelöhnern in Marokko fertigen lassen und mit dem enormen Wasserverbrauch ihrer Plantagen die ortsansässige Bevölkerung um bezahlbares Trinkwasser bringen.
Wer es etwa mit dem Klima hält – ein anderes Beispiel – und die Verbesserung seiner privaten CO2-Bilanz zum Dreh- und Angelpunkt verantwortungsvoller Konsumtion erhebt, verzehrt im Norden ab sofort keinen Spargel mehr aus mediterranen Ländern, weil der wegen seines langen Transportweges zuviel Kohlendioxyd auf dem Kerbholz hat. Stattdessen empfiehlt sich der Kauf beim heimischen Spargelbauern, der das Konsumentengewissen von jeder CO2-Belastung frei hält. Jedenfalls, was den Transport des Produktes angeht. Sein Geschäftsmodell jagt stattdessen Massen von osteuropäischen Wanderarbeitern mit ihren CO2-Schleudern über die Autobahnen, damit sie für einen Hungerlohn die Ernte einbringen. Ganz abgesehen davon, ob der Skandal nun mehr in den massiven Rückständen von Verbrennungsmotoren oder in der schlechten Behandlung der Humanressource anzusiedeln wäre: Es ist offenbar gar nicht so einfach, als Konsument eine geschäftliche Rechnung zu durchkreuzen, die man nicht angreifen will.
Manch einer sieht seinen Sinn für Gerechtigkeit herausgefordert, wenn er hinter den Logos der großen Kaffeeröster die Armut der südamerikanischen Plantagenarbeiter entdeckt, die ihre Kaffeebohnen für ein paar Pesos an die großen Aufkäufer abliefern. Bei „Fair Trade“ schlägt die Konsumentenmacht dann in aller Härte zu – und zahlt freiwillig ein, zwei Euro mehr für das Kilo, um dem Markt einmal zu zeigen, wie ein fairer Preis wirklich aussieht. Was solche Konsumenten einfach übersehen, ist die Tatsache, dass der Preis im gelobten „freien Spiel der Marktkräfte“ mit Fairness nicht vereinbar ist. Der Verkäufer will einen hohen, keinen fairen Preis erzielen. Ebenso wenig der Käufer, der an niedrigen statt fairen Preisen interessiert ist. Wer am längeren Hebel sitzt, setzt sich in diesem Kräftemessen durch. So werden Gewinne erzielt, oder auch Verluste. Preise sind eben nicht dazu da, einen Ausgleich herbeizuführen, der die gegensätzlichen Interessen der beiden Marktteilnehmer versöhnt und jedem seinen Erfolg verschafft. Es hilft nichts, hier mit gutem Beispiel voranzugehen, weil das Beispiel nicht auf die Sache passt, der man es vorhalten möchte. Es ist schon fast eine Ironie, den freiwilligen Verzicht Gutmeinender, die ein paar Euro mehr für ihren Kaffee hinblättern, als Exempel praktizierter Konsumentenmacht vorzustellen. Denn der als unfair gebrandmarkten Praxis der Großkonzerne wird ja kein Haar gekrümmt. Sie wird nicht ersetzt, sondern ergänzt, eben um ein Nischengeschäft, das auf der Spendenbereitschaft einiger Kunden aufbaut und damit entsteht und vergeht.
Solche Beispiele zeugen von einem Prinzip, und das besteht in dem Fehler, der der Idee der Konsumentenmacht innewohnt: Ohne den Kaufakt durch den Verbraucher kann der Unternehmer seinen Gewinn nicht einspielen; also hat er mit dem Kaufakt das Unternehmen in der Hand, weil man mit dem Wechsel des Anbieters eine Erpressung zum guten Benehmen auf den Weg bringt, die für den ganzen Rest der Branche erzieherische Wirkung entfaltet. Aus der Bedingung für den Unternehmenserfolg, dem Kauf der Ware, wird der Grund für die Unternehmensstrategie und ihre Beeinflussung. Eine Verwechslung, die sich rächt. Einem in Misskredit geratenen Unternehmen wird der Kaufakt ja nur dadurch verweigert, dass der Konsument ihn einem anderen Unternehmen zuspricht. Das mag eine Wirkung haben, aber keinesfalls die, welche die Konsumentenmacht von sich behauptet. Auf diese Weise kann der Umsatz des einen Betriebs leiden, der der anderen wächst aus demselben Grund. Mit diesem Wechsel der Kaufentscheidung hat sich der Konsument ja ganz innerhalb des Spielfeldes bewegt, das die vielen beklagten Auswüchse überhaupt erst hervorbringt. Dieselbe Geldrechnung, die der Grund für die hässlichen Folgen war, kann nicht zugleich das Heilmittel dagegen sein.
Dass die Freunde der Konsumentenmacht von diesem Widerspruch keine Kenntnis nehmen wollen, rührt daher, dass sie eben auch gar nicht im Geschäft, sondern im verantwortungslosen Geschäft ihren Feind wähnen. Für sie zerfällt die Welt des Kommerzes in gute und böse Unternehmen, in solche, die moralisch handeln, und andere, die es an dieser Gesinnung fehlen lassen. Gegen den Profit haben sie gar nichts einzuwenden, gegen die Profitgier aber sehr wohl. Und mit dieser Sicht der Dinge widerfährt der kapitalistischen Rechnungsweise in den Betrieben eine Ehrenrettung, die sie nicht verdient hat. Auf diese Weise wird nämlich nicht die Gewinnkalkulation, sondern eine überzogene oder verantwortungslose Stellung zu ihr für alle Übel verantwortlich gemacht. Man muss aber gar nicht als Unternehmer von bösen Absichten getragen sein, um die Hälfte der Belegschaft zu feuern oder schwarze Tagelöhner mit einem Billiglohn abzuspeisen. So etwas ist ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft, die hierzulande gilt. Mit der Kostensenkung, die solche Maßnahmen erzielen, setzt sich ein Unternehmen am Markt über die Preissenkung seiner Ware gegen Konkurrenten durch, um den Gewinn, mitunter sogar die Existenz der Firma zu sichern.
Der Wechsel, den der Konsument in Ausübung seiner Verbrauchermacht vollzieht, ist denn auch gar keiner zwischen zwei verschiedenen Unternehmensphilosophien. Er tauscht in Wahrheit nur seine eigene Enttäuschung gegen eine neue Hoffnung aus, der neue Anbieter möge sich besser benehmen als der alte. Mehr als die schlechte Erfahrung hat er ja gar nicht aufzubieten für seinen Boykott eines aufgeflogenen Missetäters. Und das ist das einzige, was das neu ins Herz geschlossene Unternehmen dem Missetäter voraus hat: Die schlechte Erfahrung will erst noch gemacht sein. Diese Moral moderner Konsumenten gegen die Auswüchse von Kommerz und Handel ist natürlich bei letzterem angekommen und prompt zu einem Geschäftsmodell für den Handel ausgebaut worden. Große Modemarken umwerben dieses spezielle Klientel damit, dass sie auf Kinderarbeit und Gifte in ihren Textilien garantiert verzichten. Fast-Food-Ketten locken mit dem Versprechen, gentechnisch veränderte Ingredienzien nicht in ihren Burgern zu verarbeiten. Was sie mit ihren Tellerwäschern machen, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Vom Lob der „Konsumgesellschaft“ zur Kritik des Konsumenten
Die Leistungsbilanz der Konsumentenmacht fällt bescheiden aus. Auf der Habenseite steht vor allem eines: die Wirkung, die die Idee auf das Selbstbewusstsein ihrer Träger entfaltet. Man hat Verantwortung gezeigt und sich nichts vorzuwerfen. Dass die angepeilten objektiven Wirkungen auf den Markt ausbleiben, ist mit dem Prinzip der Produktion verbürgt, das unangetastet bleibt. Die Rechnungsweise, die jeden Aufwand als Kost bilanziert, die sich durch einen Gewinn rechtfertigen muss, bleibt auch in der Biobranche und anderen ethisch angeleiteten Unternehmungen in Kraft. Die schlechte Behandlung von Mensch und Natur stirbt daher auch in den Branchen nicht aus, die elaborierte Konsumenten zu den Edelsegmenten auch moralisch inspirierter Produktion zählen. Man hat sich daran gewöhnt, dass die großen Skandale unserer Tage auch und gerade auf das Konto derer gehen, von denen man „so etwas nicht erwartet“ hätte.
Aus dieser Erfahrung wird allerdings kaum jemand klug. Dazu müsste man nämlich das Bild korrigieren, das sich der Mensch von der marktwirtschaftlichen Welt des Konsums gemacht hat. Der Kunde wird nicht nur im Prinzip gut bedient, er ist sogar die Instanz, die durch Einkaufsverhalten und Geldbeutel als ideeller Auftraggeber fungiert. Was auf dieser falschen, aber wohlmeinenden theoretischen Grundlage als Auswuchs oder Entgleisung entdeckt wird, ließe sich diesem Weltbild zufolge ja durch die Konsumentenmacht verantwortungsvoller Verbraucher durchaus wieder ins Lot bringen. Wo dieser Effekt aber angesichts der täglich wiederkehrenden Horrormeldungen ausbleibt, muss er wohl eindeutig auf das Konto des Bestellers gehen, der sich beim Einkauf immer noch und immer wieder danebenbenimmt, beim Blick in seinen Geldbeutel knausrig wird und damit den „schwarzen Schafen“ unter den vielen guten Anbietern überhaupt erst eine Gelegenheit für ihr schäbiges Geschäft bietet.
Die Probe auf diese Behauptung ist in jeder Tageszeitung leicht zu haben. Warum geht das Klima den Bach runter? Weil der Konsument zu bequem ist und sein Auto nicht in der Garage lassen und die Heizung nicht drosseln will. Warum leiden Menschen in der Dritten Welt Hunger? Weil die Bewohner der Nordhalbkugel den Hals nicht voll kriegen und im Wohlstand schwimmen, auch wenn die Verkäuferin bei Schlecker davon nichts merkt. Warum sterben Lebensmittelskandale nicht aus? Weil der Verbraucher geizig ist und sein Geld lieber in ein teures Auto investiert statt in gesunde Bio-Vollwertkost. Wer für fünf Euro ein Kilo Fleisch erwartet, hat ja geradezu Gammelfleisch bestellt.
Das ist sie, die schlechte Meinung vom Verbraucher, bei der die gute Meinung vom Kapitalismus als Dienst am Kunden notwendig landet. So kommt „König Kunde“ am Ende in den Genuss einer Doppelrolle. Als Konsument darf er dem Kapitalismus für eine Leistung danken, die gar nicht im Programm ist: Versorgung. Und die schädlichen Wirkungen, die das kapitalistische Wachstum tatsächlich auf Natur und Gesundheit hat, weil Gewinn statt Versorgung sein Ziel ist, darf der Konsument seiner mangelnden Verantwortung und Maßlosigkeit in Versorgungsdingen zurechnen.