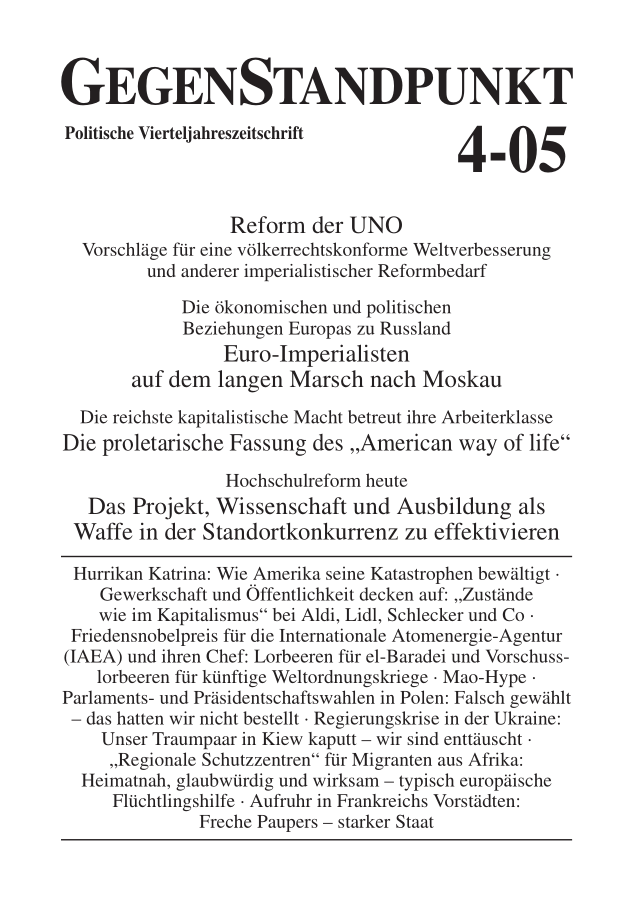Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Hurrikan Katrina:
Wie Amerika seine Katastrophen bewältigt
Was diesen Wirbelsturm von anderen unterscheidet, liegt darin, was er aufgewirbelt hat: Das Vorhandensein von jeder Menge Elend und Verwahrlosung in New Orleans und die Art, wie die Zuständigen unter den Augen der eigenen Bürger wie der ganzen Welt damit umgegangen sind. „Man kommt sich vor, als wäre man in Haiti oder Angola und nicht in den Vereinigten Staaten!“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Haiti in New Orleans
- Was über die Lage der Paupers zur Sprache kommt
- Bewältigung, Teil 1: Eine furchtbare Ausnahme von der guten Regel
- Bewältigung, Teil 2: Rassismus-Schelte statt Sozialkritik
- Bewältigung Teil 3: Das Versagen des obersten Führers
- Der tiefere Kern der Katastrophe: Die amerikanische Nation als eigentliches Opfer
- „Blame for the shame“ (The Economist, 10.9.)
- Das „größte Wiederaufbauprogramm der Geschichte“ (George W. Bush)
- Was bleibt ...
Hurrikan Katrina:
Wie Amerika seine Katastrophen
bewältigt
Haiti in New Orleans
Die Gewalt dieses Naturereignisses war gigantisch:
Heimatschutzminister Michael Chertoff bezeichnete
Katrina als größte Naturkatastrophe in der amerikanischen
Geschichte.
(Handelsblatt.com,
10.9.05) Aber das, was diesen Wirbelsturm
eigentlich von anderen unterscheidet, liegt nach
einhelliger Auffassung darin, was er aufgewirbelt hat:
Das Vorhandensein von jeder Menge Elend und Verwahrlosung
in New Orleans und die Art, wie die Zuständigen unter den
Augen der eigenen Bürger wie der ganzen Welt damit
umgegangen sind. Man kommt sich vor, als wäre man in
Haiti oder Angola und nicht in den Vereinigten
Staaten!
(Washington Post,
5.9.) Verhältnisse wie in der 3. Welt, wo arme,
schwache und korrupte Staaten das menschliche Elend in
normalen wie in Katastrophenzeiten verrotten lassen, weil
ihnen Mittel und Wille fehlen, sich um ihre Bürger zu
kümmern – und das in den USA, der reichsten und
mächtigsten Nation der Welt, die in Notfällen – wie
gerade aller Welt nach dem Tsunami demonstriert – mit
ihren Ressourcen an Menschen und Material vorbildlich für
Ordnung sorgen und Hilfe bringen kann. CNN-Moderatoren
bereiten den Zuschauer schonend auf den Schock vor, dem
er sich aussetzt: Wir müssen sie warnen, das sind
keine Bilder, wie wir sie aus einer amerikanischen
Großstadt zu sehen gewohnt sind.
(Spiegel, 5.9.) Solche Bilder
sind auch für Amerikaner schwer zu verkraften, die das
Elend in ihren Großstädten kennen und durch die
öffentliche Berichterstattung, durch Armuts-, Krankheits-
und Sterbestatistiken darüber eigentlich im Bild sein
müssten.
Es hat den Anschein, als erschrecke die Nation
tatsächlich einen Augenblick lang darüber, wie es in ihr
zugeht, und stelle sich ungewohnten Fragen: Die
Ereignisse in New Orleans waren nicht unvermeidbar – dies
war eine der am wenigsten natürlichen Naturkatastrophen
in der Geschichte Amerikas.
(Mike Davis, Soziologe und Historiker, SZ
5.9.) Eine soziale Katastrophe womöglich? Eine,
die sogar das System von freedom & democracy in
Misskredit bringen könnte?
Was über die Lage der Paupers zur Sprache kommt
„Gäbe es noch den Kalten Krieg, würde man die ganze Sache als raffinierte sowjetische Propaganda ansehen. Alle Zutaten waren in den Tagen, nachdem der Hurrikan Katrina New Orleans und die Umgebung getroffen hatte, vorhanden: Die Reichen, hauptsächlich Weiße ergriffen die Flucht, die Armen, überwiegend Schwarze verlassen und ausgesetzt; die Straßen in der Gewalt bewaffneter Banditen; die Regierung übernimmt nicht die Verantwortung und die Gesellschaft bricht auseinander. Das ist die Art von Bildern, die der KGB in Zeiten des Kalten Krieges ausmalte – von einem grausamen Amerika, der Heimat eines hasserzeugenden Kapitalismus, zerrissen durch die Trennung in Arm und Reich, gespalten durch die Rassengrenzen, regiert von einer herzlosen Regierung, im Griff der Gewalt in den Städten. Solch ein klischeehaftes Zerrbild war damals falsch und – als allgemeine Charakterisierung – bleibt es das heute. Aber die schrecklichen Folgen des Hurrikans stellen schmerzhafte Fragen über die amerikanische Gesellschaft und verletzen das Image von George W. Bush.“ (International Herald Tribune, 7.9.)
Nichts wird beschönigt bei dem Bericht darüber, wie die
Ereignisse abliefen: Die Katastrophenwarnung ist erfolgt;
die, die sich’s leisten können, bringen sich in
Sicherheit. Der arme, in New Orleans vorwiegend schwarze
Bodensatz der Bevölkerung muss sehen, wie er
zurechtkommt, auch wenn ihm dazu alle Mittel fehlen. Von
elenden und verwahrlosten Menschen gibt es jede Menge,
hier wie in ganz Amerika – Katrina unterstrich
das
Problem
einer wachsenden Anzahl von
Amerikanern, die in einem niemals endenden Zyklon der
Armut gefangen sind
(International Herald Tribune, 7.9.) Die
Dämme sind nicht ausgelegt für einen in diesem Ausmaß
zwar schon vor Jahren für möglich erachteten, von
offizieller Seite so aber nicht erwarteten Sturm – sie
brechen und die Fluten schließen die Zurückgebliebenen
ein. Das kann vorkommen, wenn haushaltsmäßige
Gesichtspunkte in die Katastrophenabwehr einfließen und
wenn dank einer Laune der Natur die Gegenden, wo die
Reichen wohnen, geschützt sind von natürlichen Dämmen,
geschaffen über die Jahrhunderte. Die anderen Bereiche,
die tiefer liegen, sind die der Ärmsten, überwiegend
Schwarzen.
(The Economist,
10.9.) Notfallpläne und Hilfsmaßnahmen unterliegen
denselben Interessensabwägungen. So kommt tagelang keiner
rein und keiner raus. Die aufgebrachten Massen retten
sich in die Sportarena, holen sich fürs Überleben Wasser
und Essen aus Supermärkten. Manche ergreifen die
Gelegenheit, sich fremdes Eigentum unter den Nagel zu
reißen. Manche überleben das alles nicht, die Leichen
liegen achtlos auf den Straßen. Es gibt Schießereien –
für Amerikaner ist Leben wie Überleben offensichtlich
sehr schnell gleichbedeutend mit Waffengebrauch. Nach
Tagen wendet sich der Präsident der Sache zu, überfliegt
das Katastrophengebiet und sinniert über die schönen
Zeiten, die er in The big Easy
verlebt hat.
Zuständigkeiten werden per Hickhack zwischen den lokalen,
föderalen und Bundesbehörden geklärt, so dass die Hilfe
schließlich irgendwie anläuft.
So sah es aus. Und wo sie Recht haben, die Berichterstatter, haben sie Recht. Trostloser (Katastrophen-)Alltag der kapitalistisch sortierten Gesellschaft, möchte man meinen.
Bewältigung, Teil 1: Eine furchtbare Ausnahme von der guten Regel
Wenn es das ist, was das amerikanische ökonomische
Modell hervorbringt
, fragt der Autor des obigen
Zitats rhetorisch. Aber das ist es natürlich nicht. Mit
Bedacht hat er sein zutreffendes Bild der Situation einem
imaginären KGB-Propagandisten in den Mund gelegt: So
würden nur Feinde der USA die schlimme Lage am Golf
deuten. Auch wenn er gar nicht abstreiten möchte, dass
man das, was man sieht, ungefähr so deuten muss, darf
doch keine generelle Verurteilung der amerikanischen
Gesellschaft daraus werden. Nicht einmal diese Bilder
können das grundsätzliche Ja zu Amerika erschüttern. Wo
sie das tun, liegt böse Absicht und mutwillige Verzerrung
vor. Das grundgute Land hat sich einen Vorwurf allerdings
schon verdient: Es hat sich von einer Seite gezeigt, dass
es fast aussehen könnte, als wäre an den Zerrbildern, die
seine Feinde zeichnen, etwas dran. Das muss korrigiert
werden. Schmerzhafte Fragen
, ja direkte Kritik tun
not, damit Amerika die blamable Ausnahme der Katastrophe
von New Orleans überwindet und sich der Welt wieder als
das zivilisatorische Vorbild zeigt, das es ist.
Wie also konnte es dazu kommen? Die Frage nach den Ursachen der Abweichung von dem, was Amerika geziemt hätte, macht, konsequent dem Gedanken der Ausnahme folgend, nicht die Prinzipien des amerikanischen Modells für das aufgedeckte Elend verantwortlich, sondern eine Verletzung derselben: die Rassendiskriminierung gegen Schwarze, ein Relikt aus der Vergangenheit, das trotz offizieller Anstrengungen vor allem im Süden der Vereinigten Staaten nicht verschwinden will.
Bewältigung, Teil 2: Rassismus-Schelte statt Sozialkritik
„Amerikas Rassenspaltung wurde wieder bloßgelegt. Fast alle der verzweifelt aussehenden Opfer waren schwarz… Viele Schwarze fühlen, dass – hätte es Weiße getroffen – die Regierung prompt gehandelt hätte, um sie zu retten… George Bush kümmert sich nicht um Schwarze.“ (The Economist, 10.9.)
Eigentlich sollten im Land der Freien nur die Resultate
der Konkurrenz als Unterscheidungsmerkmal gelten. Gleiche
Teilhabe an der Konkurrenz gewährt der Staat allen seinen
Gesellschaftsmitgliedern. Ungleichbehandlung verfälscht
den Wettstreit, auf dessen Resultate es ankommt. Das
heißt schon auch, dass Leute, die durch die Konkurrenz
aussortiert werden, es zu nichts gebracht haben,
deshalb auch für den Staat nichts wert sind und
entsprechend gleichgültig behandelt werden – aber eben
nicht, weil sie aus diesem oder jenem Farbtopf der Natur
stammen. Neben diesem amtlichen Maßstab herrscht aber
seit jeher eine Unterscheidung nach der Rasse, die
offiziell nicht gewollt, aber hartnäckig praktiziert
wird. Die Schwarzen gehören dieser Auffassung nach
irgendwie nicht dazu und haben eigentlich kein Recht,
teilzuhaben an den unbegrenzten Möglichkeiten, die das
Land denen bietet, die es auch wert sind. So tun sich
Schwarze ungleich schwerer in der Konkurrenz, und der
Pauperismus, den der Kapitalismus in Amerika produziert,
trifft, gemessen an der Verteilung der Hautfarben in der
Bevölkerung, nicht von ungefähr überwiegend
Schwarze
. Eigentlich ist an der Lage der
Sklaven-Nachfahren abzulesen, wie viel Armut die
Klassengesellschaft in Amerika schafft. Wenn aber statt
schwarzer Armer arme Schwarze als Skandal wahrgenommen
werden, ist die Katastrophenbewältigung einen Schritt
weiter. Soweit der Umgang mit den Armen in New Orleans
noch einen Gedanken an Sozialkritik nahelegt, ist der vom
Tisch, wenn Rassismuskritik an ihre Stelle tritt: Statt
einer Kritik der Armut bezichtigt Amerika sich einer
unfair ungleichen Verteilung der Armut unter den Rassen.
Die Verhältnisse am Mississippi zeugen in dieser Optik
nicht von den Resultaten der ausgiebigen Benutzung der
Möglichkeiten, die Amerika bietet
, sondern davon
dass Bürger einer bestimmten Hautfarbe von diesen
herrlichen Möglichkeiten ausgeschlossen
sind. Was
Hurrikan Katrina aufdeckt und zur Katastrophe werden
lässt, hat nichts zu tun mit dem, was das
amerikanische ökonomische Modell hervorbringt
,
sondern verdankt sich einem Verstoß gegen den guten Geist
der USA und gegen die Grundsätze ihres herrschenden
Rechts.
Dieser Selbstkritik kann der oberste Sachwalter der
gerechten Konkurrenz sich nur anschließen: Präsident Bush
gesteht zu, dass Rassismus, wenn auch nurlatent
,
den Umgang mit den Armen prägt. Es ist kein Ruhmesblatt
für god’s own country, dass knapp ein halbes
Jahrhundert, nachdem die letzten Reste hoheitlicher
Rassentrennung höchstrichterlich abgeschafft wurden,
immer noch Schwarze deshalb sterben müssen. Bush
verspricht, diese unamerikanische Hinterlassenschaft der
amerikanischen Vergangenheit weiterhin zu bekämpfen:
Diese Armut hat ihre Wurzel in der Geschichte der
Rassendiskriminierung, die viele Generationen von den
Möglichkeiten, die Amerika bietet, ausgeschlossen hat.
Wir haben die Pflicht, diese Armut mit mutigen Schritten
zu bekämpfen. … Lasst uns diese Hinterlassenschaft der
Ungleichheit beseitigen.
(Bush,
zit. nach New York Times, 16.09.). Er selbst hat
sich da nichts vorzuwerfen, was nicht nur die Hautfarbe
seiner Außenministerin beweist; den sehr amerikanischen,
politisch korrekten und wahrhaft absurden Verdacht, die
schlechte Organisation und lange Verzögerung der Hilfe
für New Orleans habe damit zu tun, dass vor allem
Schwarze betroffen waren, kann er nicht auf sich sitzen
lassen: Der Sturm hat nicht diskriminiert und das
Gleiche gilt für die Rettungsarbeiten
(Bush, zit. nach New York Times, 13.9.)
Damit grenzt er das Thema der öffentlichen Debatte wieder ein und lenkt es auf den Kern, den auch seine aufgeregten Kritiker anpeilen: Was Katrina an normalem Elend im Süden der USA aufgedeckt hat, sprechen ja auch Opposition und Medien nur einen Augenblick lang an, um sofort zum schlechten Handling der Katastrophe durch die Behörden überzugehen, das es zu verantworten hat, dass die Spaltung der Nation, das Leiden der Unterklasse und der Grad ihrer Verwahrlosung vor aller Welt so blamabel enthüllt wurde. Das ist der wahre Skandal – und die Verantwortung für ihn wird dem ebenso herzlosen wie inkompetenten Chef im Weißen Haus mit Begeisterung um die Ohren gehauen.
Bewältigung Teil 3: Das Versagen des obersten Führers
„Der Präsident der reichsten und mächtigsten Nation, die es jemals auf der Welt gab, schien nichts von dem, was vorging, zur Kenntnis zu nehmen.“ (New York Times, 5.9.)
Gebrieft wurde der oberste Chef ständig. Die Einschätzung
im Weißen Haus war die, dass es sich um eine zwar sehr
heftige, ansonsten aber für diese Breiten gängige
Katastrophe handelte, für die die üblichen Vorkehrungen
ausreichen. Bei den entsprechenden Maßnahmen gab es sonst
ja auch keinen Aufstand, wie die SZ im Licht der jetzigen
Aufregung kritisch anmerkt: Vor einem Jahr wurde New
Orleans vor dem Hurrikan Ivan evakuiert. Damals wurde die
ganze arme Bevölkerung der Stadt, die Alten, die ohne
Auto und viele Schwarze völlig allein gelassen.
(SZ, 5.9.) Unter denen gab es
folgerichtig Tote wie immer. Damit wird gerechnet, Opfer
sind als unumgängliche Folge einer Naturkatastrophe
abgebucht. Nicht anders haben die Verantwortlichen
Katrina zur Kenntnis genommen. Genau das wird dem Chef
aber jetzt als Versagen angerechnet. Er hat das,
was vorging
, nicht gerafft. Das Ausmaß der Not,
die Vielzahl der Toten und das Fehlen von Ruhe und
Ordnung setzen das souveräne ‚business as usual‘ des
Präsidenten ins Unrecht. Die Demonstration, dass sich die
Weltmacht vom Wetter nicht die Tagesordnung durcheinander
bringen lässt, steht als Zynismus und Unfähigkeit da:
Jetzt wäre nämlich beherztes Zupacken angesagt gewesen,
das rettet, was zu retten ist, sowie eine Demonstration
nationaler Solidarität mit den Unglücklichen. In echten
Katastrophen steht nämlich die Nation und ihr innerer
Zusammenhalt selbst auf dem Prüfstand.
Der tiefere Kern der Katastrophe: Die amerikanische Nation als eigentliches Opfer
„Katrina war der Anti-9/11. Am 11. September übernahm Rudy Giuliani die Kontrolle. Die Antwort der Stadtverwaltung war schnell und entschlossen. Arme und Reiche litten gleichermaßen. Amerikaner sind getroffen worden, aber sie fühlten sich einig und stark. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen wuchs. Letzte Woche übernahm im Gegensatz dazu niemand die Kontrolle. Autorität war kaum vorhanden und das Vorgehen war ineffektiv. Die Reichen flohen, während die Armen verlassen waren. Führer zögerten, während die Plünderer zuschlugen. Banditen trieben ihr Unwesen, während die Nation Scham fühlte. Das erste Gesetz des sozialen Zusammenhalts – dass in Zeiten der Krise die Schwachen geschützt werden müssen – wurde mit Füßen getreten. Die Armen in New Orleans zurückzulassen war moralisch gleich bedeutend damit, Verwundete auf dem Schlachtfeld zurückzulassen. Kein Wunder, dass das Vertrauen in die zivilen Institutionen sinkt. … Jeder Fehler der Institutionen und jedes Zeichen der Hilflosigkeit ist ein neuer Schlag gegen die nationale Moral.“ (New York Times, 4.9.)
Die Anschläge des 9/11 hatten nicht nur viele Todesopfer zur Folge, sie beschädigten auch das Vertrauen in Stärke und Unangreifbarkeit der Nation. Dieser Schaden aber wurde mehr als wettgemacht durch das Auftreten der Führer. Sie haben damals nämlich das merkwürdige Sondergesetz beachtet, das gebietet, in existenziellen Krisen – und offensichtlich nur in ihnen – Arme und Reiche nicht als unterschiedlich wertvolles Staatsmaterial, sondern gleichermaßen als Amerikaner zu behandeln. Sonst gilt, dass jeder seines Glückes Schmied und Armut der gerechte Lohn für Erfolglosigkeit ist; im Fall der Naturkatastrophe, wo Armut schnellen Tod bringt, und das massenhaft, wird den Armen zugebilligt, dass diese Konsequenz in ihrer gerechten Armut nicht eingeschlossen sein sollte; für diese Betroffenheit können sie nichts. Daher sind – siehe 9/11 – Katastrophen eigentlich Sternstunden der nationalen Solidarität und großartige Gelegenheiten für den Staat, sich als Existenzgrundlage aller, auch seiner miserabelsten Bürger zu beweisen. Wie eben im Krieg, wo ein Staat, der auf sich hält, sein Kanonenfutter nicht zurücklässt, sondern ohne Ansehen der Person seine Verletzten und Toten einsammelt. In Notzeiten haben die Armen nicht mehr als Versager zu gelten, sondern als ein Stück Amerika, das um jeden Preis zu retten ist – aber eine nicht nur unfähige, sondern unwürdige Führung hat kein Sensorium für dieses Gebot der nationalen Moral und lässt eine Spaltung der Nation ans Licht treten, die man in der Stunde der Not niemals hätte zulassen dürfen. Das schädigt, weit über die armen und schwarzen Flutopfer hinaus, das Ansehen Amerikas in der Welt: „Wir haben Menschen auf der ganzen Welt erzählt, wie man eine Demokratie und eine zivile Gesellschaft führt, und jetzt haben wir das blutige Innenleben unserer Gesellschaft vor der Welt enthüllt, die leidende Unterklasse, kaum des Lesens und Schreibens mächtig – ein weiterer schrecklicher Schlag gegen unsere Reputation.“ (International Herald Tribune, 7.9.) – eine einzige Schande für die Weltmacht, die bloß wegen Katrina natürlich nicht aufhören wird, der Welt zu sagen, wie man eine zivile Gesellschaft führt.
„Blame for the shame“ (The Economist, 10.9.)
Die Amerikaner schämen sich – dies die aktuelle Form
ihres ausgeprägten Nationalstolzes. Sie wollen
sich nämlich ganz unmittelbar, gefühlsmäßig und
schrankenlos mit ihrer Nation identifizieren, die in
jeder Hinsicht Spitze zu sein hat. Also leiden
sie unter den geradezu unamerikanischen Umtrieben ihres
Präsidenten und nehmen ihm das Versagen vor dem Bild
ihrer vorbildlichen Nation übel. Amerikas Image zählt
zu den Opfern.
(International
Herald Tribune, 7.9.) Als gute Patrioten haben sie
verstanden und demonstrieren ihre unverbrüchliche Einheit
mit ihrer Nation nun gegen den Präsidenten: Nicht nur
an den öffentlichen Gebäuden wehen die Fahnen dieser Tage
auf Halbmast, es scheint, als hätten die ‚Stars and
Stripes‘ ganz Boston erobert. … Auf Autoaufklebern ist
wieder zu lesen ‚United we stand‘ oder ‚God bless
Amerika‘. … Fast an jedem Einfamilienhaus in den
Vorstädten der Metropole ist das Sternenbanner
geflaggt.
(Stern.de,
8.9.) Hartgesotten wie sie sind, bringt die
Amerikaner eben kein noch so blutiges Innenleben
davon ab, mit der Hand auf dem Herzen auf die Fahne zu
schwören.
Das „größte Wiederaufbauprogramm der Geschichte“ (George W. Bush)
Natürlich muss der Präsident reagieren – spätestens
darauf: Seine Umfragewerte fallen dramatisch. Im
Interesse der Rettung seiner Popularität ist alles
doppelt und dreifach nötig, was zur Rettung der
Slumbewohner am Golf lange unterblieben war. Bush zeigt
den Aktivismus, der vermisst worden ist, und lässt sich
davon auch nicht abbringen, dass die Öffentlichkeit
seinen Eifer als Show denunziert. Mit einem artigen mea
culpa – Katrina deckte ernste Probleme unserer
Einsatzkräfte auf allen Verantwortungsebenen auf. Für den
Bereich, in dem die Bundesregierung ihren Pflichten nicht
gerecht wurde, übernehme ich die Verantwortung.
(zit. nach New York Times,
13.9.) – und einer Verbeugung vor dem Volk, das
seine Sache besser gemacht hat als er, versucht Bush
verlorenes Terrain wieder gut zu machen: Er lobte die
Hilfsbereitschaft der Amerikaner als ‚einfach
erstaunlich‘
(SZ, 6.9.).
Vor Ort bringt er endlich das Mittel zum Einsatz, das
fällig ist, wenn die Nation ohne Rücksicht auf Kosten mit
überlegenen Kräften Ehre einlegen will, das Militär. Auf
einmal sind ausreichend wassergängige Fahrzeuge da.
Martialisch dreinblickende Zivilgardisten,
Irak-Krieg-erprobt und erkenntlich schießbereit,
bekämpfen die Plünderer und halten die krakeelenden Leute
im Superdome in Schach. So bringen sie den Hungernden das
erste Lebensmittel der Nation – Ruhe und Ordnung. Unter
Beteiligung bekannter Stars geht das große Almosensammeln
los. Befreundete Staaten dürfen ihr Scherflein beitragen
– wobei manche Hungerhilfe wegen BSE-Gefahr
zurückgewiesen werden muss; Hilfsangebote missliebiger
Staaten werden gar nicht erst zur Kenntnis genommen –
soweit käme es noch, denen die Ehre zu erweisen, Amerika
helfen zu dürfen.
Die Umfragewerte rühren sich nicht. In Anbetracht dessen
und des biblischen Ausmaßes
der Schäden verkündet
der Präsident das größte Wiederaufbauprogramm der
Geschichte
in einem Umfang von 200 Mrd. Dollar. New
Orleans soll wieder auferstehen, mit ganz neuen Straßen
und auch neuen Hütten, weil die Leute da unten ja, wie
jeder sehen konnte, so arm sind. Das war’s dann.
Was bleibt,
wenn die nationale Empörung abebbt und der Alltag wieder einkehrt: Einerseits der hohe Benzinpreis, der die freie Fahrt des freien Amerikaners tatsächlich einschränkt. Dieser Schaden am American way of life zählt. Andererseits das Geschäft. Es geht weiter: Versicherungen besichtigen die Schäden, die der Sturm in ihren Bilanzen angerichtet hat – eindeutig nachteilig scheinen die aber gar nicht zu sein:
„Allerdings berichtet das ‚Wall Street Journal‘, dass die Aktienkurse britischer Versicherungskonzerne stiegen, weil sie nun mit höheren Versicherungsprämien und einem Anstieg von Neuversicherungen rechnen.“ (FAZ.net.de, 13.9.) Das angekündigte Aufbauprogramm zeigt auch schon erste Erfolge: „In der Erwartung, dass vor allem Baufirmen profitieren, stiegen die Aktien dieser Firmen bereits am vergangenen Freitag an der Wall Street. ‚Der Wiederaufbau in der Region am Golf von Mexiko könnte Tausende neue Arbeitsplätze bringen, was sich positiv auf Firmengewinne, die Wirtschaft insgesamt und die Märkte auswirken könnte‘, hieß es von der Investmentfirma FTN Financial. Bislang hatten sich bei Naturkatastrophen in den USA Schäden und Wachstumseffekte stets in etwa die Waage gehalten.“ (SZ, 5.9.)
Dank der Regierungsmilliarden und der niedrigen Löhne da
unten winken den Baukapitalisten satte Gewinne. Und ein
Skandal wird erst dann wieder daraus, wenn die kritische
Öffentlichkeit bei der Vergabe an Halliburton et al.
politische Vetternwirtschaft
entdeckt.