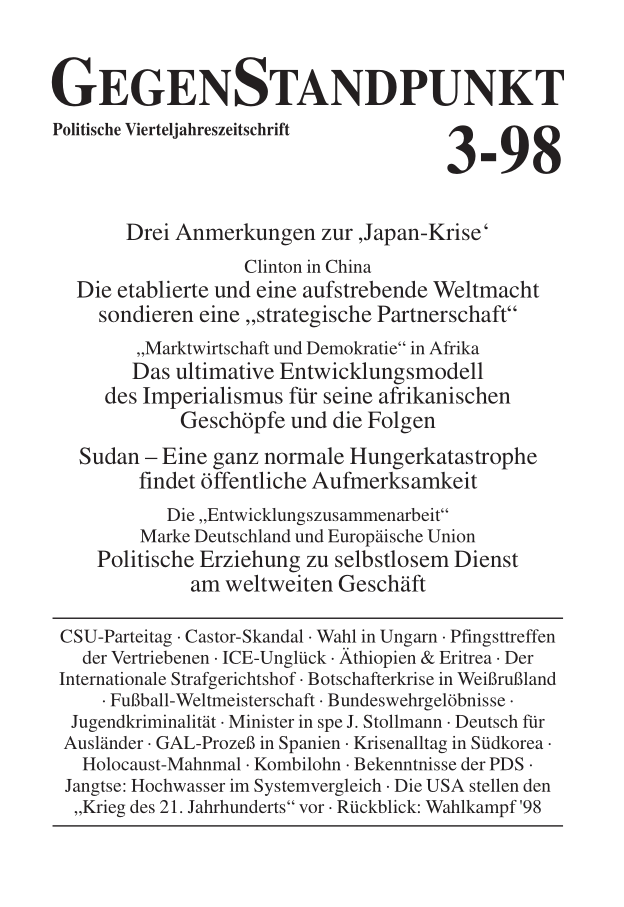Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die Debatte um das Holocaust-Mahnmal:
Denkmal für Deutschland – Opfer geehrt, Schuldfrage beendet
Die nationale Aufgabe von Denkmälern – Stolz auf die Nation – wird am Fall des geplanten Holocaust-Mahnmals heftig debattiert, und einem guten Ende zugeführt. Schließlich hat die deutsche Nation es mit 50 Jahren „Vergangenheitsbewältigung“ geschafft, aus ihrer Nationalideologie jedes Moment von nationaler Schmach zu tilgen. Aus der größten deutschen Schandtat wird auch mit der Geschichte um das Denkmal ein hemmungsloses Eigenlob verfertigt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Die Debatte um das Holocaust-Mahnmal
Denkmal für Deutschland – Opfer geehrt, Schuldfrage beendet
Ende Juli erhält die seit nunmehr zehn Jahren schwelende Debatte um die in Berlin geplante zentrale Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust neuen Zündstoff. Der in einer Bonner SPD-Regierung als Kulturbeauftragter vorgesehene Verleger Michael Naumann vergleicht den Entwurf des geplanten Monuments mit der Architektur von Hitlers Baumeister Albert Speer
. Überhaupt hält er es für fraglich, ob das Mahnmal als ästhetisches Werk die Grausamkeit des Völkermordes an den Juden widerspiegeln könne
(FAZ 22. Juli 98), was ihm im Gegenzug den Vorwurf einträgt, „sich auf Kosten der Toten zu profilieren“ (Lea Rosh, SZ 29. Juli 98). Einstige Befürworter des Mahnmalprojekts wie Günter Grass und Walter Jens haben inzwischen die Fronten gewechselt
, frühere Kritiker wie Ignaz Bubis desgleichen. Derweil droht das Mahnmal im Angesicht des zunehmend erbitterten Streites seines eigentlichen Sinnes
verlustig zu gehen. Der Kanzler, der das Denkmal dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden immerhin selbst versprochen hat, obwohl dieser ein solches damals noch gar nicht wollte, muß als oberster Bauherr ein Machtwort
sprechen, bevor über den „immer quälenderen Prozeß der Entscheidungsfindung“ dem „Ansehen Deutschlands in der Welt unermeßlicher Schaden“ zugefügt wird (SZ 4. August 98). Dann wird die Entscheidung vertagt, damit die Diskussion darüber nur ja nicht „in den Wahlkampf“ gerät. Höchste Zeit also für die Frage, um was es sich bei dem Projekt handelt.
Was ist ein Denkmal?
Denkmäler, so will es das Lexikon, dienen der Erinnerung an herausragende Persönlichkeiten oder wichtige geschichtliche Ereignisse. Damit alleine ist es freilich nicht getan, weswegen Denkmäler zu Ehren George Washingtons oder der Erstürmung der Bastille in Deutschland eher selten sind. Das Nationale wird die Denkmalskultur nicht los, denn die Denkmalswürdigkeit historischer Glanztaten oder bekannter Figuren bemißt sich an dem Ertrag an nationaler Ehre, den das Heimatland aus ihnen zu ziehen gedenkt. In ihren Helden und Heldentaten feiert die Nation zuallererst einmal sich selbst: In Gestalt ihrer Führer, Denker, historischen Leistungen
tun Nationen kund, welch ehrfurchtgebietende Erscheinungen sie sind. Auch Personen, die mit keiner anderen Leistung aufwarten können, als in einem der nationalen Kriege verheizt worden zu sein, die „Gefallenen“, erhalten noch in der hinterletzten ländlichen Gemeinde ein Denkmal, das den selbstlosen Patriotismus der braven kleinen Leute preist. Staatlich befohlenes Massenschlachten wird keineswegs schamhaft verschwiegen. Mit turmhohen Mahnmalen, möglichst am historischen Tatort errichtet, wird von Staats wegen daran erinnert. Schließlich zeugt die Größe der erbrachten Opfer auf die denkbar nachdrücklichste Weise von der Größe der nationalen Sache, der sie geopfert wurden.
Darüber, wem ein Denkmal gebührt und wem eher nicht, herrscht nicht unbedingt immer Konsens. Manche dieser steingewordenen Ruhmesblätter der Nation gelten geschichtskundigen Heimatliebhabern nicht als solche und gehörten für ihren Geschmack schleunigst demontiert, während andere von ihnen schmerzlich vermißt werden. Es ist allemal Interpretationssache, welche geschichtlichen Größen und Taten der Nation zur Ehre gereichen; und die Konjunkturen des Zeitgeistes spielen bei diesen Einschätzungen eine Rolle, die ebenso groß ist wie der Bedarf an historischer Genauigkeit gering. Bezeichnenderweise preist eines der beliebtesten Denkmäler deutscher Nationalgeschichte eine ziemlich lang verflossene Schlacht, von der nicht genau bekannt ist, wo sie eigentlich stattgefunden hat, sowie ihren germanischen Schlachtenführer, von dem niemand so genau weiß, wie er eigentlich geheißen hat. Solche Feinheiten tun gerechtermaßen da nichts zur Sache, wo die Nation mit sich und ihrer über die Zeitläufte hinweg unveränderlichen Ehrenhaftigkeit und folglich mit ihren Denkmälern im Reinen ist.
Denkmäler haben also die Aufgabe, ihren Betrachter mit Stolz zu erfüllen. Ihm soll die Geschichte seines Heimatlandes imponieren, dessen leibhaftige „kollektive Erinnerung“ ihm in sinnlich faßbarer Gestalt aus den marmornen Bildnissen entgegenglotzt. Aus Denkmälern hat er zu lernen, daß in ihnen das nationale „Wir“ auf seine Lebensgeschichte zurückblickt; daß er als Mitglied dieses Kollektivs, noch bevor er für oder gegen ein im Denkmal dargestelltes Ereignis Partei ergreift, schon längst Partei ist und nur richtig liegt, wenn er die Taten der für ihn zuständigen Staatsmacht als seine „zweite Natur“ akzeptiert. Als diese Unterrichtsstunde im nationalistischen Gemüt sind Denkmäler durch und durch staatliche Inszenierung, auch wenn sich mitunter ein Förderkreis findet, der die einschlägigen Instanzen auf ihr „Versäumnis“ aufmerksam macht, einen gewichtigen Punkt nationaler Geschichte noch nicht seiner Bedeutung entsprechend in ästhetischer Form gewürdigt zu haben. Mitunter wird dieser „Denkanstoß“ dann sogar von höchster Stelle aufgegriffen.
Was ist der Holocaust?
Zur Aufklärung der Sache, für die sich die eigentümliche Bezeichnung „Holocaust“, eigentlich „Brandopfer“, eingebürgert hat, erlauben wir uns, aus einem Buch aus unserem Verlag zu zitieren, das über sie folgende Auskunft gibt:
„JudenvernichtungZu den Pflichtübungen der Distanzierung vom Faschismus gehört das Aufsagen und Schreiben von Sätzen, die das Entsetzen formulieren, das rechtschaffene Menschen befällt, die mit den in den Konzentrationslagern vollbrachten Taten bekannt gemacht werden. Wenn die mehr oder weniger fingierte „Betroffenheit“ dann in der Phrase von den „unschuldigen Opfern“ gipfelt, denen Täter gegenüberstehen, die einen staunen lassen darüber, „wozu Menschen fähig sind“, ist die „Auseinandersetzung“ mit diesem Stück „Vergangenheit“ schon fast fertig. Der Würdigung von Leid und Grausamkeit ist nur noch der Wunsch nachzureichen, dergleichen dürfe nicht wieder geschehen.
Ob die humanistische Attitüde, die das Entsetzen kultiviert und den staatlich organisierten Massenmord mit dem Prädikat des „Unfaßbaren“ versieht, geeignet ist, ein derartiges Programm zu verhindern, ist zu bezweifeln. Leute, die sich für „unfähig“ hielten, das fünfte Gebot zu übertreten, hat es nämlich auch im Dritten Reich massenhaft gegeben. Ebenso haben es ziemlich viele Deutsche für geboten erachtet, auf die Juden loszugehen, wobei sie nicht an der Moral ihrer Volksgenossen gescheitert sind. Letztere hätten sich da schon Rechenschaft über den Willen ablegen müssen, der sich als Bestandteil der Staatsdoktrin angekündigt und im ganzen Reich breit gemacht hat. Denn nicht eine verborgene „Fähigkeit“ war am Werk, sondern ein durch bewährte Gesichtspunkte nationaler Moral begründeter Wille, als die Judenfrage endgelöst wurde. Diese „Anfänge“ sollte schon kennen, wer über die Konsequenzen erschrickt und dauernd „den Anfängen wehren“ möchte.
Leider bemühen Leute, die mit einigem Pathos zur Wachsamkeit mahnen, um eine Wiederholung des einmaligen Verbrechens zu unterbinden, lieber ihr Gewissen als ihren Verstand, wenn sie sich dem merkwürdigen Geschäft der „Bewältigung der Vergangenheit“ widmen. Ausgerechnet als Deutsche treibt es sie zu einer Distanzierung von den Untaten, die sie überhaupt nicht verstehen können, obwohl sie so viel aus ihnen lernen wollen. So werfen sie sich in die Pose von Menschen, denen erwiesenermaßen alles zuzutrauen ist, die sich deshalb selbst ständig vom Völkermord abhalten müssen. Dieses im Nachkriegsdeutschland so verbreitete Getue, als kollektive wie individuelle Scham inszeniert, ist insofern im besten Sinne des Wortes unverschämt zu nennen, als es von einem ausdrücklichen Bekenntnis zu dem politischen Verein lebt, der als Subjekt der Judenvernichtung feststeht. Die andere Hälfte der Veranstaltung ging und geht heute noch darin auf, dem Massenmord den Charakter einer politischen Tat abzusprechen. Insbesondere mit seichter Tiefenpsychologie haben es die Vergangenheitsbewältiger fertiggebracht, lauter Abweichungen vom gelungenen Zusammenwirken zwischen Staat und Volk auszumachen – und sich als Anwälte der deutschen Nation ein gutes Gewissen zu verschaffen.
Zur Beendigung der leidigen Schuldfrage und der unvermeidlichen Entschuldigungen sei daran erinnert, daß Staat und Volk im Nationalsozialismus intakt waren – und sie mußten es sein, um nicht nur den Krieg, sondern auch noch das Judenpogrom hinzukriegen. Der Staatschef und seine Partei verstanden sich aufs Führen, auf das geistige schon gleich. Für das gewöhnliche Führen konnten sie sich auf die Institutionen eines kompletten bürgerlichen Staatsapparats verlassen. An Personal für die Ausübung sämtlicher Ämter in der Hierarchie der öffentlichen Gewalt hat es nie gefehlt, der Wille zum Mitmachen war bei studierten wie einfachen Deutschen recht ausgeprägt. Der zum Mitmachen nicht minder – die Staatsangehörigen wußten nicht nur, was sie der Macht schuldig waren, sie akzeptierten nicht nur die von den Staatsorganen vorgeschriebenen Lebensbedingungen – sie hielten ihren Dienst auch für eine Pflicht, also für einen Beitrag zu einer guten Sache. Die hieß Deutschland, und der tätige Wille, sich für die anzustrengen, war der Normalfall. Die Führung konnte deswegen mit Fug und Recht behaupten: „Wir sind ein Volk!“
Daß diesem Gemeinwesen äußere Feinde nach seinem Wohlstand trachteten, ihm seine Rechte bestritten, war eine „Tatsache“, auf die Hitler beim geistigen Führen verwiesen hat. Fragen danach, warum ein braves Volk mit seinem Staat in so unverwüstlichen Gegensatz zu anderen Nationen gerät, kamen nicht auf – nur die Linke hatte ein paar falsche Antworten parat. Deswegen sind auch die Pflichten des Soldatenstandes treu und ehrenhaft erfüllt worden. Die Definition des inneren Feindes, die „den Juden“ betraf, hat ebenso verfangen. Aber nicht, weil der Führer eine „Tatsache“ anführen konnte und seine Deutschen unter allerlei jüdischen Werken Schaden genommen hätten. In diesem Fall von Führung ging es um die Schaffung von Tatsachen, von Konzentrationslagern und Leichen. Die Überzeugungskraft der einschlägigen Argumente hat mit den Juden nichts zu tun – weswegen es auch verwegen ist, Rassisten aller Art mit Befunden über ihre Opfer, die Objekte ihres Hasses zu kommen; der Erfolg der Lehre von geborenen Volksfeinden fällt ganz in die Moral, mit der sich das deutsche Volk ausgestattet hatte, längst bevor sie Hitler politisierte. Der „Wahn“ ist das zur Staatsdoktrin erhobene Bewußtsein, ein besonderes, dazu ein besonders gutes, womöglich auserwähltes Volk zu sein, dem andere Völker das Lebensrecht versauen. Dieses Selbstbewußtsein sucht sich das Opfer für seinen gerechten Kampf, was innerhalb des Staates allemal auf eine Klärung der Volkszugehörigkeit hinausläuft.
Bemerkenswert ist an der „Endlösung“ freilich, daß das deutsche Volk sich nicht nur seine eigene Meinung über die Juden zugelegt hat, die sich mit dem von der Führung verkündeten Rassismus deckte. Für das Vernichtungsprogramm haben sich auch prompt genügend Schergen gefunden, deren „Skrupellosigkeit“ nicht nur die Opfer zu spüren bekamen, sondern noch heute manchen betroffen macht. Wie der Ausdruck „skrupellos“ suggeriert, ist es aber bei diesen ausführenden Organen der völkischen Säuberung wohl auch nicht gewesen. Da hat es nicht an einer moralischen Hemmung gefehlt, die „dem Menschen“ gewöhnlich eignet; eher waren die Täter von ihrer gerechten Sache und ihrer Rassistenpflicht überzeugt. Der einschlägigen Literatur ist zu entnehmen, mit welchen Parolen gelegentliche Anflüge von Mitleid überwunden wurden. Nicht zu unterschätzen ist auch die im Krieg so wirksame Hilfe, die eine industrielle und „Anonymität“ gewährende Organisation dem Willen zum Töten beschert.
Wie im Krieg ist allerdings auch beim Massenmord an den Juden die Größe des Unternehmens weniger ein Beweis für den „Wahnsinn“ gewalttätiger Führungskräfte als ein Zeugnis dafür, wozu ein normales Volk bereit ist. Zumindest gelten den deutschen Vergangenheitsbewältigern die vielen „Zeugen“ der Judenvernichtung nicht als Mittäter. Dabei hat die Vollstreckung der Ideologie vom Deutschland zersetzenden Juden einen riesigen Aufwand von Fahndung, Kennzeichnung, Verhaftung, Transport etc. erfordert, der ebensowenig wie die öffentliche Propaganda zu übersehen war. Eine Generation, die sich 12 Jahre lang in treuer Gefolgschaft gegenüber dem Nazi-Staat bewährt hat, ist danach dazu übergegangen, wegen der Opfer, die sie – ganz Volk – ihrem Staat gebracht hat, sich als dessen Opfer hinzustellen. Als Berufungsinstanz der Nazis, als Quelle ihrer Macht, als Aktivisten der deutschen Sache waren sie unterwegs – und sie bestehen darauf, daß ihr Wille ein guter gewesen sei. Das ist übrigens das Peinliche an den lächerlichen Lügen – einerseits nichts mitbekommen, andererseits keine Gelegenheit zum Widerstand gefunden –, mit denen sich die nach der Niederlage beschuldigten Deutschen so forsch entschuldigen: Damit konfrontiert, welche mörderischen Großtaten ihr Volkstum – nein: nicht zugelassen, sondern – hervorgebracht hat, bekennen sie sich erst einmal zu sich selbst. Als Volk.“ (Konrad Hecker: Der Faschismus und seine demokratische Bewältigung. GegenStandpunkt Verlag 1996; S.141 ff.)
Für die Macher des neuen Staates deutscher Nation kam ein Bruch mit der nationalen Vergangenheit ohnehin nie in Frage. Die sahen sich gleich nach der Niederlage dazu berufen, die Rechtsnachfolge von Hitlers Staat anzutreten, und übernahmen lieber bekenntnishaft und mit der Wiedergutmachung auch materiell die ideelle Verantwortung für einen ganzen Völkermord, als auf die nationalen Rechte – insbesondere das auf „Wiedervereinigung“ – zu verzichten, die sich aus der Fortexistenz des politischen Subjekts Deutschland begründen. Der von den Siegermächten auferlegten Pflichtübung nationalen Schämens kamen sie nach, indem sie sich von den „Verfehlungen“ des Vorgängerstaates – dem offensivsten Teil seiner Säuberungspolitik, der Judenvernichtung – distanzierten und beschwörend verkündeten, sowas dürfe sich „nie mehr wiederholen“. Damit verliehen sie sich einen unendlich ehrenwerten Herrschaftsauftrag, an dem sie moralisch gemessen werden wollten und der bis heute die Bequemlichkeit an sich hat, daß er gar nicht zu verfehlen ist: ein neues Auschwitz zu verhindern. Für die Staatsräson der BRD folgt daraus in praktischer Hinsicht überhaupt nichts, weil, solange eine erneutes Judenmorden nicht auf dem imperialistisches Programm steht, der Verzicht darauf keinem nationalen Gewaltbedarf auch nur die geringste Schranke setzt. Ideologisch folgt aus Auschwitz aber enorm viel, nämlich eine pauschale Rechtfertigung, brauchbar für alle nationalen Vorhaben. Das Bekenntnis zur Schuld der Nazis war gleichbedeutend mit dem Dogma von der politischen Unschuld der BRD.
Seitdem mit der Revision des für die deutsche Nation schlimmsten Kriegsergebnisses, ihrer Aufteilung, jede wirkliche Betroffenheit durch das vergeigte Welteroberungsunternehmen der Nazis glücklich abgeschüttelt ist, gefällt sich Deutschland geradezu in einer moralisch-ästhetischen Betroffenheit durch die Größe der von den Nazis verübten Untaten. An die wird nicht mehr pflichtschuldigst erinnert, sondern im forschen Selbstbewußtsein, daß aus der Distanzierung von ihr nichts anderes zu folgen hat als der allseitige Respekt vor einer dermaßen geläuterten Nation. Als solche beansprucht Deutschland aus der Position des moralischen Richters die Interpretationshoheit über die „Verbrechen des NS-Staates“. Die übt es aus, indem es den Konzentrationslagern und Gaskammern eine Deutung verleiht, in der es als das politische Subjekt, das die Ausrottung des zum Feind des deutschen Volkes erklärten „internationalen Judentums“ betrieben hat, nicht mehr vorkommt; mit der es sich dafür umso mehr als das hochanständige Staatswesen in Szene setzt, das nachträglich die „menschlichen Schicksale“ nicht in Vergessenheit geraten läßt. Ein „Holocaust“ soll da auf seinem Boden passiert sein. Diese offiziell gültige Sprachregelung hält sich an die Opfer, an die Identifizierung mit ihren Leiden, sowie an den Abscheu vor einem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, das bis heute „unerklärlich“ sein soll. Sie legt den Opfern des deutsch-nationalen Rassismus eine quasi religiöse, in ihrem Glauben begründete Opferrolle bei, den Tätern anstelle ihrer wirklichen national-rassistischen Beweggründe eine völlig apolitische Grausamkeit; die zynische Metapher vom „Leidensweg des jüdischen Volkes“ entpolitisiert so Tat wie Täter, indem sie beides ins letztlich nur religiös-metaphysisch Faßbare verlegt. Nach 50 Jahren „Vergangenheitsbewältigung“ hat es Deutschland dahin gebracht, aus diesem Stück seiner Nationalideologie jedes Moment von nationaler Schmach zu tilgen und aus dem ihm zugrundeliegenden politischen Tatbestand ein hemmungsloses Eigenlob zu verfertigen.
Damit beantwortet sich die dritte Frage:
Was ist ein Denkmal für den Holocaust?
Das Rätsel, wie eine Nation einem historischen Ereignis ein Denkmal setzen kann, das als ihre größte nationale Schandtat in die Geschichte eingegangen ist, ist damit nämlich keines mehr: Das Denkmal wird nicht der nationalen Schande, sondern ihrer erfolgreichen Bewältigung gesetzt. Nach der Idee seiner Initiatoren, an der der Kanzler und mit ihm die deutsche Kulturnation Gefallen gefunden haben, wird durch den Bau einer zentralen Gedenkstätte an prominenter Stelle in der Hauptstadt von ganz Deutschland den Opfern die Ehre wiedergegeben
(Lea Rosh, Initiatorin des „Förderkreises Holocaust-Mahnmal“, in zahllosen Talkshows). Eine durch und durch edle Tat wird da auf den Weg gebracht, die selbstverständlich auf den verweist, der sie ins Werk setzt. Nämlich auf die Nation, die neulich für das Anfallen der Leichen gesorgt hat. Die leistet sich 50 Jahre „danach“ eine wahrlich souveräne Geste der Wiedergutmachung: Nicht etwa deswegen, weil sie einer an sie gerichteten Forderung auf Begleichung einer Schuld nachzukommen hätte, sondern aus freiem Entschluß, also einzig und allein, weil sie sich das schuldig ist, verneigt sie sich vor ihren Opfern. Mit diesem symbolischen Akt gibt sie ihnen zurück, was sie ihnen der hochmoralischen Einschätzung ihrer eigenen Taten zufolge genommen hat. Nämlich nicht bloß so banale Dinge wie Leben und Zahngold, sondern ihre Ehre. Dieses sittliche Verhältnis der Nation zu ihren Völkermordopfern wird repariert – durch die Nation selbst, die offensichtlich nach wie vor dafür zuständig ist, das hohe Gut der Ehre den Landesbewohnern – vergangenen wie gegenwärtigen, wirklichen wie nurmehr virtuellen – zuzuteilen, ihnen gegenüber ihre Anerkennung auszusprechen. Womit das Denkmal der Idee nach bereits steht: Mit ihm macht Deutschland klar, daß es seine Hoheit über Ehren-, Anerkennungs- und Opferfragen fraglos richtig zu gebrauchen weiß – nämlich andersherum als neulich, wo es ihm um die Eliminierung der falschen „Rasse“ ging. Und keine Stimme meldet sich, die im Namen der Opfer dankend darauf verzichtet, von dieser Nation geehrt zu werden.
Dagegen melden sich Stimmen zu Wort, die bezweifeln, ob es sich Deutschland mit diesem Projekt nicht zu einfach macht mit seiner Selbstdarstellung als unbedingt ehrwürdiges Staatswesen, ob es dafür nicht doch mehr an seinen Abstand zu den Untaten seines Rechtsvorgängers und damit an diese erinnern müßte. Selbst Kritiker des Projekts könnten es sich wunderschön vorstellen, so ein anti-heroisches Mahnmal, das zugleich die Aufgabe zu erfüllen hat, eine Wiederholung des Geschehens zu verhindern.
(Naumann im Spiegel Nr. 32) Sie zweifeln allerdings an dessen Gelingen: Die marmorne Erinnerung könnte zu einer permanenten Selbstentlastung und damit auch zum Vergessen führen: Da steht das Denkmal, damit ist die Sache in Ordnung. Die wahren Gedenkstätten sind die Lager.
(ders. in der SZ 22.7.) Ihr Einwand betrifft das Verfahren der nationalen Selbstdarstellung und geht an der Intention des geplanten Monuments ziemlich vorbei: Es „führt“ nicht, und schon gar nicht im Konjunktiv, zur Selbstentlastung, sondern ist das Dokument der gelungenen Selbstentlastung und der erfolgreichen Beilegung der nationalen Schmach, an der sie sich durch weitere Runden nationalen Schämens vor den „wahren Gedenkstätten“ weiterhin abarbeiten wollen.
Wie geht dann ein Denkmal über den Holocaust?
Seit das Projekt 1988 auf dem Weg gebracht worden ist, sind immer wieder Zweifel laut geworden, ob die Kunst dem Schrecken gerecht
werden kann, ob der sich mit ästhetischen Mitteln bewältigen
läßt. Kenner der kulturellen Landschaft vom Präsidenten der Berliner Akademie der Künste bis zu Schröders Kulturbeauftragten fragen sich, ob hier die Denkmalssprache
nicht versagen muß – eine Frage, die so gut zu beantworten ist, daß es gleich ebenso viele Antworten gibt wie Künstler, die ihren Entwurf eingereicht haben. Die Idee, die Untat zugleich mit ihrer nationalen Überwindung zur sinnlichen Anschauung zu bringen, stellt eine wahre Herausforderung an jeden Künstler dar, derer sich dementsprechend die Weltelite der Künstlerinnen und Künstler
nach vollzogener Auslobung angenommen hat. Vertreter eines Standes, der gerade eben noch nach Auschwitz
nicht einmal mehr dichten können wollte, fühlen sich offenbar durch den Völkermord überaus inspiriert.
Früh schon einigt man sich darauf, daß der Holocaust nur in seiner Undarstellbarkeit
darzustellen ist – das kennt man; darunter machen es Künstler sowieso nicht! Folglich müßte es schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich das bildhauernde Völkchen dazu nichts einfallen ließe. Das Ausmaß ihrer Inspirationen ist sowohl den Dimensionen wie der Formenvielfalt nach enorm. Schließlich haben sie auf dem ehemaligen Gestapogelände genug Platz, und dank einem Etat von über 30 Millionen muß der Künstler für einmal wenigstens nicht knausern. Die Bundesrepublik läßt sich eben nicht lumpen, wenn es gilt, der Größe ihrer Bewältigungsleistung einen würdigen Gedenkstein zu setzen. Und schon legen die Künstler los.
Wie zufällig verstreute
Wandscheiben, als Bild für das versprengte und ermordete Volk
; ein „begehbares Labyrinth“ aus Tausenden von Steinquadern, das ein Gefühl des Bedrohtseins
vermitteln soll (der heißeste Renner, aber leider mit Verkehrsproblemen
befrachtet); Stahlmasten, die in 39 Sprachen und obendrein in Leuchtschrift die Frage Warum
tragen – der Variationsbreite sind keine Grenzen gesetzt. Die Botschaft, die nicht ausbleiben kann, ähnelt sich bis zur Deckungsgleichheit: der Völkermord ist unbegreiflich
, eine wie zufällig
über die Welt hereingebrochen Bedrohung
, die nur noch die fassungslose Warum
-Frage zuläßt; eine Frage, bei der es darauf ankommt, sie hartnäckig zu stellen, weil ihre Beantwortung nicht zur Debatte steht. Der Deutung der mörderischen Tat als apolitischer Schicksalsschlag, den die deutsche Nation in vorbildlicher Weise bewältigt hat, wird jeder Entwurf ebenso sicher gerecht, wie es an jeder der künstlerischen Umsetzungen feuilletonistisch etwas auszusetzen gibt. Betonstelen mit den Namen der Opfer
– sehr individuell, sehr passend, ganz wie auf jedem Soldatenfriedhof. Andererseits: Macht das nicht individuelles Gedenken
geradezu wieder unmöglich
, eben weil es so furchtbar viele sind? Vielleicht dann doch lieber Stahlträger mit den spiegelverkehrt geschnittenen Namen der Vernichtungslager
, so daß sie, vom Sonnenlicht durchflutet, auf den Boden projiziert würden? Bringt das andererseits nicht wieder zuviel Licht
in eine dunkle Vergangenheit
? Sollte das Mahnmal wegen der Größe der Schande möglichst groß, oder wegen der Größe der Schande eher klein und bescheiden sein? Lauter Fragen, wer will sie entscheiden? Letztere wenigstens läßt sich eindeutig beantworten.
Die eigentliche Entscheidung liegt nämlich beim Auftraggeber. Wenn dieser einen Entwurf gebilligt, den Bau genehmigt und den Grundstein gelegt hat; wenn das Denkmal dann gebaut ist und endlich steht, dann ist es auch die Lösung
für die zur Anschauung gebrachte deutsche Vergangenheitsbewältigung. Egal wie die endgültige Gedenkstätte dann aussieht: Wenn es sie erst einmal gibt, dann ist sie – gleich all den anderen Denkmälern, die die deutsche Kulturlandschaft zieren – auch der Bedeutungsträger für genau die Bedeutung, für die der staatliche Auftraggeber sie haben wollte.
Nur leider ist die Entscheidung eben noch nicht gefallen. Der Bundestag hat sich noch immer nicht aus der „Denkpause“, die er sich 1995 verordnet hat, zurückgemeldet, überhaupt gilt es jetzt erst einmal die Bundestagswahlen abzuwarten. Solange tobt also weiterhin die Debatte durchs Feuilleton, und zwar schon lange nicht mehr nur um die angemessene ästhetische Gestalt der Gedenkstätte. Weil sich der Bundestag nicht entscheidet, mehren sich Zweifel an der Entscheidbarkeit
des ganzen Projekts. Zugleich mehrt sich die Zahl derer, die das Projekt wegen mangelnder Einigung bereits für unheilbar geschädigt erachten. Die tonnenschweren Stahl-und Betonkonstruktionen laufen Gefahr, zerredet
zu werden, der Ruhm, der auf die neue deutsche Nation fallen soll, mutiert deswegen am Ende gar zu einem Armutszeugnis für uns Deutsche
(Lea Rosh, SZ 25.8.98). Alternativvorschläge können nicht ausbleiben. Jeder Stand der intellektuellen Elite mischt sich seiner Profession gemäß ein. Museumsliebhaber plädieren für ein jüdisches Museum
, als besseren Ersatz; Peter Zadek will lieber ein „Jüdisches Theater“ und Walter Jens hält – wer hätte es gedacht – das niemals endende Gespräch darüber
für die angemessene Antwort
auf den Völkermord. Alles den Opfern zur Ehre
, versteht sich. Inzwischen bahnen sich aber bereits neue „Opfer“ an: Die Künstler fühlen sich durch die Hinhaltetaktik verhöhnt.
(Rosh, SZ 29.07.98) Manche ziehen sogar zur Schmach und Schande der Republik, die sich nicht einig werden kann, ihre Entwürfe zurück, weil sie sich außerstande sehen, die traumatische Zeit für alle, die sich seit Jahren um eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bemühen
(Manfred Gerz) noch länger zu durchleiden.
„Wir Deutsche“ machen es uns eben nicht leicht mit unserer Vergangenheitsbewältigung. Insofern steht das Mahnmal schon und tut seinen Dienst.