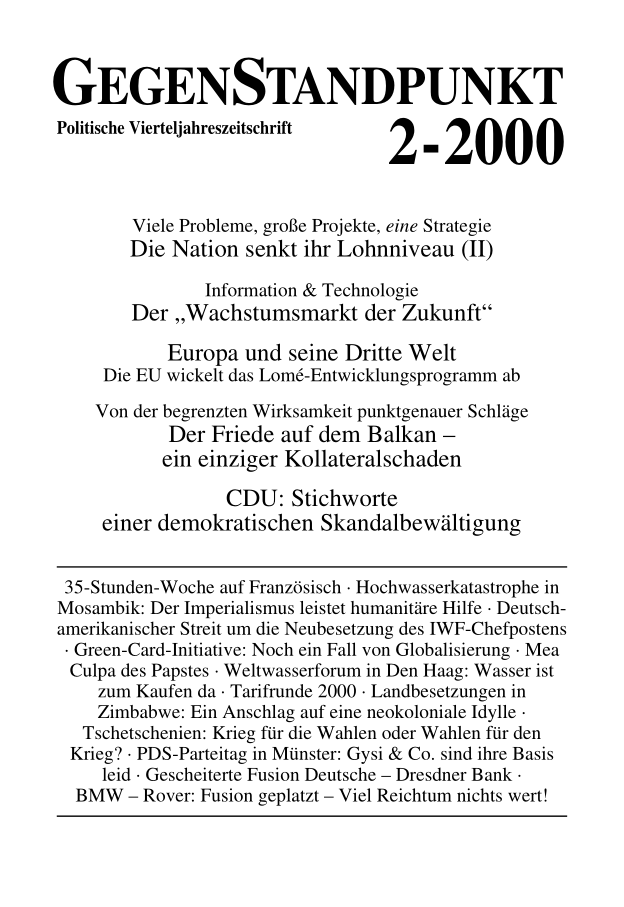Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Hochwasserkatastrophe in Mosambik:
Der Imperialismus leistet humanitäre Hilfe
Aufgrund einer Naturkatastrophe wird eine ganze Nation zum Fall auswärtiger humanitärer Hilfe – und keiner will merken, welche Brutalitäten in diesem Befund enthalten sind: Dass ein Hochwasser in Mosambik derart verheerende Schäden anrichtet, ist nämlich keine Laune der Natur, sondern liegt an der ruinösen Zurichtung der Lebensbedingungen im Land für den Weltmarkt. Ein maßgebliches Interesse scheint jedenfalls nicht tangiert, wenn eine ganze afrikanische Nation ersäuft; die Forderung nach Hilfe ist deswegen billig zu erfüllen: Der Imperialismus schickt seine Hubschrauber und verfrachtet die Geretteten zurück in genau das Elend, das sie gerade beinahe umgebracht hat.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Hochwasserkatastrophe in
Mosambik:
Der Imperialismus leistet humanitäre
Hilfe
Seit Ende Februar zeigt das Fernsehen Bilder einer
Flutkatastrophe in Afrika, am ärgsten getroffen ist das
Land Mosambik. Wochenlange Regenfälle haben den Süden
komplett unter Wasser gesetzt, Straßen und Hütten sind
weggespült, die Bewohner sind ertrunken oder sitzen in
Bäumen und warten auf Rettung. Bergungsmannschaften aus
der Republik Südafrika sind hoffnungslos überfordert,
westliche Kommentatoren sprechen von Schande
für
die zivilisierte Welt und fragen: Warum hilft denn da
keiner? Hier wären sie doch, die Mittel: Ein
Gebot der Menschlichkeit, einem fernen, armen
Land zur Seite zu stehen. Wenig später senden wir
– die USA, England, Deutschland – Soldaten, Hubschrauber
und Boote, fischen Tausende aus dem Wasser, bringen sie
in Lager, von wo sie nach einer warmen Suppe und dem
Sinken der Pegel den Heimweg antreten. Eine ganze Nation
als Fall für humanitäre Hilfe: Vor lauter
Rührung merkt keiner, was das heißt.
1. Die Bilder aus Afrika zeigen nämlich
nicht nur eine Naturkatastrophe, sondern dokumentieren
auch den ärgerlichen Grund, warum eine Laune der Natur
dort gleich derart verheerende Schäden
anrichtet. Denn ein wenig hängt es schon an den
Voraussetzungen, auf die ein mehrwöchiger Niederschlag
trifft, wie die Naturgewalten sich auswirken. Man
erfährt: Der Boden ist dank jahrelanger Dürre und
mangels landwirtschaftlicher Nutzung
so
ausgetrocknet, dass die Wassermengen nicht abfließen; die
Menschen, die versuchen, sich von Subsistenzwirtschaft
zu ernähren
, wohnen in Hütten, die den Fluten nicht
standhalten; irgendwelche Vorkehrungen wie Kanalisation
oder Schutzdeiche gibt es nicht; kurz: Über die Hälfte
der Bevölkerung lebt in Armut
und ist dem Klima
deshalb extra wehrlos ausgeliefert. Die Not, in die sie
durch die Katastrophe gerät, verweist auf die
katastrophalen Umstände, in denen sie längst lebt. Die
heißen auch in Mosambik marktwirtschaftliche
Orientierung
und sind nicht übermäßig natürlich
bedingt. Von der Wirtschaft (hauptsächlich Stromexport
nach und Warenumschlagplatz für Südafrika) profitiert
die Landbevölkerung fast nicht
(SZ), weil sie an ihr gar nicht
teilnimmt. Dass in ihrem Land kapitalistisch gerechnet
und für den Weltmarkt produziert wird, bekommt die
Mehrheit, wenn überhaupt, nur negativ mit.
Subsistenzwirtschaft heißt: Die Menschen sind,
von allen marktwirtschaftlich anerkannten Erwerbsquellen
getrennt, auf ein Leben von der Hand in den Mund
verwiesen. Mit dem Ruin der einst exportfähigen
Monokultur für Cashewkerne ist die letzte Gelegenheit zum
Geldverdienen entfallen, nun bleiben den Massen zwei
Existenzweisen des Pauperismus: In den Elendsquartieren
am Rande der Hauptstadt um die Abfälle vom Reichtum der
staatlichen Elite zu kämpfen oder auf dem Lande zu
schauen, was der Boden und ihrer bloßen Hände Arbeit
hergibt; in beiden Fällen und spätestens dann, wenn die
kläglichen Erträge der Subsistenz im Wasser versinken,
erhalten sie Bescheid, welches Interesse die politischen
Garanten der kapitalistischen „Orientierung“ schon zu
Normalzeiten an ihnen haben: Keines.
Der Staat, der in den 80er-Jahren eine
wirtschaftliche Liberalisierung einführte und die
Bevölkerung zur Privatinitiative ermutigte
(Spiegel), überlässt sein
Volk folgerichtig auch dann selbiger Tugend, wenn es über
keinerlei Mittel verfügt, gegen die Fluten initiativ zu
werden – er hat nämlich selbst keine. Die Bekämpfung
durchaus absehbarer Naturereignisse ist in seinem
Haushalt nicht vorgesehen; Mosambik besitzt keine
Hubschrauber; und die 9, die der gleichfalls betroffene
Nachbar Zimbabwe hat, sind im Bürgerkrieg im Kongo in der
Tat sachgerechter eingesetzt. Die Staatenführer des
südlichen Afrika handeln im Katastrophenfall, wie es der
politische Zweck ihrer Machtausübung gebietet: Auch ihnen
geht es um Herrschaft über Land und Leute; zur Masse
ihrer Menschen stehen sie aber nicht im Verhältnis einer
Obrigkeit zu einem Volk, für dessen Erhalt und
Benutzung sie etwas unternehmen. Irgendeine
Sozialfürsorge bei Hunger, Seuchen oder Unwetter gibt es
allenfalls als Restbestand der inzwischen abgeschlossenen
Etappe namens „Entwicklung“. Im Armenhaus
Mosambik
, wo der Schlamm rund 2 Mill. Tretminen an
die Oberfläche spült, die im Bürgerkrieg vergraben
wurden
(dpa), treffen die
Reporter aus dem Westen, der die antikommunistische
Partei in diesem Bürgerkrieg von außen aufgebaut und
ausgestattet hat, heute auf keine Nation, die im
Schulterschluss von Militär und Volk bürgerlichen
Gemeinsinn praktiziert (wie Deutschland im legendären
„Oderbruch“), sondern auf einen Präsidenten ohne Armee
und auf Leute ohne jedes Lebensmittel, die darum pur auf
Hilfe von auswärts verwiesen sind.
2. Der Ruf nach Hilfe für Mosambik sagt
nicht nur einiges über die Lebensverhältnisse der Leute,
von deren (natur) gegebener
Bedürftigkeit er wie selbstverständlich ausgeht. Er
kennzeichnet auch das mittlerweile erreichte Verhältnis
der auswärtigen Staatenwelt zu diesem Land. Dass
die Flut außer Vertretern der Welthungerhilfe und
Auslandskorrespondenten erst mal keinem auffällt, hat
einen banalen Grund: Ein in der Welt von Geschäft und
Gewalt maßgebliches Interesse ist nicht berührt, wenn
dort hinten ein Land absäuft; Weltmarkt und Imperialismus
haben es dahin gebracht, dass die Nation und ihre
Bewohner von unerheblichem Belang sind. Alle
landeskundigen Reportagen geben zu Protokoll, dass
Mosambik ökonomisch ruiniert und strategisch
bedeutungslos geworden ist. Die Rede vom beispiellosen
Wirtschaftsaufschwung
(Spiegel) in einem der ärmsten Länder
der Welt
(SZ), der jetzt
„in den Fluten ertränkt wird“, ist
einerseits absurd, andererseits bezeichnend für den Stand
der Nation: Wenig erstaunlich, dass eine Ökonomie nach 16
Jahren Krieg – von Null – nur wachsen kann; zugleich
basieren die sagenhaften weltweit höchsten
Wachstumsraten
fast ausschließlich darauf, dass
der Cabora-Bassa-Damm wieder Energie für die
Industriezentren Südafrikas produziert
. Das Lob von
IWF (ehrgeiziges Privatisierungsprogramm
) und USA
(Musterfall friedlicher Konfliktlösung
) bezeugt
darum weniger einen Nutzen Mosambiks aus seiner
Einordnung in Weltfinanzsystem und Weltfrieden, sondern
die Zufriedenheit der dafür zuständigen Institute mit
ihm: Der Staat macht keinen Ärger, bezahlt seine
Schulden; das ist geboten, damit hat es sich.
In der wohl wollenden Prüfung der Anfrage nach
Hilfe bezieht der Imperialismus sich also auf
sein eigenes Produkt: einen absolut mittellosen Staat
Mosambik. Auf der Grundlage, dass ein anderes Interesse
an diesem Gebilde und dessen Insassen nicht existiert,
umschreibt das Attribut humanitär treffend und
ohne jede Ironie den Witz der beispiellosen Hilfe
(SZ): Ohne jeden
Eigennutz im Auge fliegen Maschinen mit Soldaten, die
sonst ganz andere Verwendungszwecke kennen, von weit her
und retten – Menschen. Weil und nachdem sich
alle üblichen „niederen“ Berechnungen erübrigen, die
seine strategischen und/oder ökonomischen Interessen
sonst und anderswo gebieten, reduziert sich der
Imperialismus hier auf karitative Moral, die
(sogar) für nutzlose Neger etwas übrig hat.
Rettung aus höchster Not? Warum nicht! Ob der Aufruf des
ideellen Weltgewissens von den potenten Mächten erhört
wird, hängt in diesem Fall exklusiv an der Freiheit,
weniger höflich: an der Willkür auswärtiger
Barmherzigkeit.
3. Entsprechend sieht die Aktion aus. Der Ruf der Gewissenswürmer erfährt die passende Antwort. Gefragt war Hilfe: Nun findet sie statt. Ignorant gegen Gründe und Ausmaß der Katastrophe wurde darum gebeten, etwas zu tun: Diese maßlose Forderung ist mit 4 bis 10 Hubschraubern pro Land erfüllt. Weil Hilfe kein anderes Maß kennt, als dass sie passiert, ist es fast schon uninteressant, wie viele Opfer unsere Jungs dann retten. Es liegt in der Logik solcher Rotkreuz-Appelle an die Macht, dass dieselben, die eben „Schande!“ und „Zynismus!“ riefen, jetzt zufrieden sind: Hauptsache, die Bundeswehr ist da und legt Ehre ein für die von globaler Verantwortungsethik getriebene Nation. Imperialismus als gute Tat: Die wohlfeile Ausnahme von der Regel rechnen ihm Anhänger seiner eigentlich humanitären Mission hoch an, höchstens ein wenig spät sei sie gekommen. Kein Wunder, dass sie vom tatsächlichen Zynismus der menschenfreundlichen Aktion nichts mitbekommen wollen: Die geleistete Hilfe zur Selbsthilfe rettet Menschen vor dem Ertrinken, um sie, nach einem Zwischenstopp im Flüchtlingslager, in Stand zu setzen, in dieselben armseligen Umstände zurückzukehren, die sie gerade noch auf die Bäume gespült haben. Der Einsatz der Bundeswehr als Technisches Hilfswerk in Afrika ist gelungen; das private Spendengewissen wird noch ein paar Wochen mit Wasserleichen und der Wetterprognose für Mosambik gekitzelt, die neue Zyklone ankündigt; und in einem Jahr wird eine Sondersendung berichten, was aus den Menschen geworden ist. Die vom „Pariser Club“ beschlossene Stundung der Auslandschulden Mosambiks und der von Wieczorek-Zeul vor Ort verkündete Schuldenerlass über 60 Mill. DM legt ihre Nation auf eben diesen Stand von „Highly Indebted Poor Countries“ fest, denen der G-7-Gipfel letzten Sommer einen Teil ihrer uneinbringlichen Schulden gestrichen hat (siehe GegenStandpunkt 3-99, S.237): In seiner Eigenschaft als ökonomisch abgeschriebener Weltmarktteilnehmer, bei dem außer Armut nichts mehr wächst, erhält Mosambik den Auftrag, sein Geld nur noch zur Bekämpfung der Armut und anderer Katastrophen zu verwenden, deren fortgesetztes Eintreten man also unterstellt.
*
Die SZ bringt die Sache unter der beziehungsreichen
Überschrift Land in Sicht
auf den Punkt:
„Man kann sogar so weit gehen und sagen, dass die internationale Hilfsbereitschaft den Überlebenden der Flut vielleicht sogar ein besseres Leben ermöglichen kann, als sie es vorher hatten.“ (10.3.)
Das mag sogar stimmen: Ein besseres Leben, als vorübergehend zum Almosenempfänger imperialistischer Hilfsmoral erkoren zu werden, haben die überlebenden „Ärmsten der Armen“ vom weltweiten Kapitalismus in der Tat nicht zu erwarten.