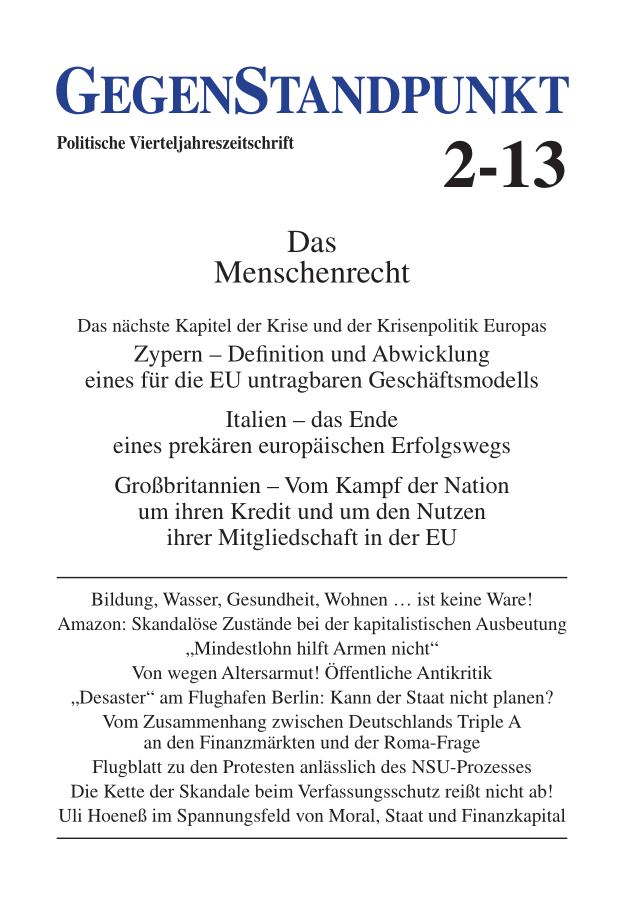Krise und Konkurrenz in Europa
Großbritannien – Vom Kampf der Nation um ihren Kredit und um den Nutzen ihrer Mitgliedschaft in der EU
Großbritannien sieht sich als Opfer: Die Krise begann auf der anderen Seite des Atlantik mit dem dortigen Immobiliencrash, aber „wir wurden von der Bankenkrise besonders hart getroffen wegen der bedeutenden Größe unseres Finanzsektors.“ (David Cameron) Die Sache ist etwas anders. England ist prominenter Mit-Verursacher der Weltfinanzkrise. Kein Wunder, dass das Land zu deren Hauptbetroffenen gehört – und deswegen auch zu den Hauptakteuren der Krisenkonkurrenz der Staaten. Das Programm der Regierung, ihren Finanzplatz zu retten, der von der Vermarktung von Euro- und Dollarvermögen und -schulden lebt, führt zur Zuspitzung der Gegensätze zwischen dem EU-Mitglied Großbritannien und den Staaten der Eurozone. Und die politischen Sachwalter einer souveränen europäischen Führungsmacht Großbritannien konfrontieren sich mehr und mehr mit der Grundsatzfrage, ob der nationale Nutzen einer EU-Mitgliedschaft noch den Schaden überwiegt, den die Führungsmächte des Euro ihrem externen britischen Partner zunehmend bereiten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Der Beitrag des internationalen Finanzzentrums London zur weltweiten Akkumulation des fiktiven Kapitals
- Neue Weichenstellungen der Staatsgewalt für den britischen Kapitalstandort
- Machtvolle Argumente für die Tauglichkeit der britischen Hauptstadt als finanzkapitalistische Drehscheibe
- Bewirtschaftung von Dollarvermögen aus aller Welt
- Zentralisierung der Eurokreditgeschäfte
- Umfang und Zentralisation des Kreditgeschäfts als Produkt und Motor finanzkapitalistischen Wachstums
- Britische Finanzmacht auf Basis des internationalen Finanzbooms, den die City vorantreibt
- Der Finanzstandort London als Aktivist und Opfer der weltweiten Überakkumulation – und seine Rettung durch den Staat und seine amerikanischen und europäischen Konkurrenzpartner
- Die zwei Fronten der nationalen Krisenbewältigung: Sicherung des Europakredits und Wiederherstellung von Wachstum am heimischen Standort
- Der eskalierende Streit zwischen Eurozone und Vereinigtem Königreich über die politische Neugestaltung der EU und wer sie bestimmt
- Die Eskalation des innenpolitischen Streits zwischen Regierung und Europagegnern
Krise und Konkurrenz in
Europa
Großbritannien – Vom Kampf der Nation
um ihren Kredit und um den Nutzen ihrer Mitgliedschaft in
der EU
Das ist die schlimmste Finanzkrise, die Großbritannien
je gesehen hat.
(Sir Mervyn
King, 6.10.2012) – meldet der Chef der englischen
Notenbank seit ihrem Ausbruch vor fast sechs Jahren stets
aufs Neue. Der Premierminister erklärt dem gemeinen Volk,
warum das so ist: Die Krise begann auf der anderen Seite
des Atlantik mit dem dortigen Immobiliencrash, aber
wir wurden von der Bankenkrise besonders hart
getroffen wegen der bedeutenden Größe unseres
Finanzsektors.
(David Cameron,
House of Commons, 13.05.2011) Ausgerechnet die
Nation, die in ihrer Hauptstadt die größte Konzentration
internationaler Banken und sonstiger Finanzspekulanten
beherbergt – ein Ansteckungsopfer der amerikanischen
Finanzmärkte? Die Sache ist etwas anders, als es die
nationale Sicht weismachen möchte. Neben den USA ist
England prominenter Mit-Verursacher der
Weltfinanzkrise. Kein Wunder, dass das Land deshalb auch
zu deren Hauptbetroffenen gehört – und deswegen
auch zu den Hauptakteuren der Krisenkonkurrenz
der Staaten.
Das Programm der Regierung, den britischen Finanzplatz, der von der Vermarktung von Euro- und Dollarvermögen und -schulden lebt, zu sichern und nationalen Kredit zu retten, führt unvermeidlich zur Zuspitzung der Gegensätze zwischen dem EU-Mitglied Großbritannien und den Staaten der Eurozone. Und die politischen Sachwalter einer souveränen europäischen Führungsmacht Großbritannien konfrontieren sich mehr und mehr mit der fundamentalen Frage, ob der nationale Nutzen einer Mitgliedschaft in der europäischen Union noch den Schaden überwiegt, den die Führungsmächte des Euro ihrem externen britischen Partner zunehmend bereiten.
Der Beitrag des internationalen Finanzzentrums London zur weltweiten Akkumulation des fiktiven Kapitals
Die City of London ist das internationale Finanzzentrum des globalen Kapitalismus.;[1] Im Unterschied zu den beiden anderen finanzkapitalistischen Zentren New York und Tokio, deren Geschäfte, vom Leihkapital bis hin zum Börsenhandel, in weit größerem Umfang auf der heimischen Wirtschaft beruhen, betreibt die City ihr Wachstum als Dienstleister und zugleich Ausnutzer des Weltfinanzgeschäfts im Allgemeinen und des €-Kreditgeschäfts im Besonderen. Was sich hier vermehrt, ist nicht in erster Linie der in dem heimischen Pfund Sterling denominierte Kredit, sondern Geldreichtum in fremder Währung, vornehmlich in den Weltgeldern Dollar und Euro.[2] Der Finanzplatz London bietet lohnende Anlage für die Geldvermögen, die in den entferntesten Winkeln des Globus geschaffen werden; und er bedient den weltweiten Kreditbedarf von Unternehmen aus aller Herren Länder ebenso wie den von Staaten. Der Geschäftsartikel, der hier produziert wird, ist der Finanzreichtum der Welt, und dessen Wachstum ist die Grundlage und der Motor für das Florieren der City.
Neue Weichenstellungen der Staatsgewalt für den britischen Kapitalstandort
Ein Platz zur Finanzierung von Weltmarktgeschäften war London, seitdem England zur ersten Heimat der modernen kapitalistischen Produktionsweise wurde. Sein heutiger Status als internationales Finanzzentrum allerdings ist weitgehend das Resultat einer großangelegten Reform des britischen Wirtschaftsstandorts in den 80er Jahren. An deren Beginn steht ein Konkurrenzkampf in Europa und auf den Weltmärkten, den Großbritannien teils verloren, teils verloren gegeben hat. Mit der Entscheidung, die Subventionierung der überkommenen Industrien aus dem Staatshaushalt zu streichen und die heimischen Bergbau-, Stahl-, Werft- und Automobilunternehmen abzuwickeln, zieht die Thatcher-Regierung die Konsequenz aus der Krise und der Konkurrenzniederlage, in die sich Großbritannien mit seinen klassischen Industriebranchen hineingewirtschaftet hat. Natürlich nur, um die Konkurrenz umso entschlossener neu zu betreiben. Die Regierung unternimmt, was in ihrer Macht steht, um die De-Industrialisierung durch den Aufbau neuer Industrien zu kompensieren: Um ausländische Multis wirbt sie mit dem Angebot besonders günstiger, also überdurchschnittlich profitabler Geschäftsbedingungen, damit sie auf der Insel investieren.[3] Sie führt damit nicht nur eine Renaissance der Automobilproduktion herbei, sondern auch einen Aufschwung der Informations- und Kommunikationstechnik, der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie, der Pharma- und Biotechnologie.[4])
Auch in der finanzkapitalistischen Abteilung der
Nationalökonomie entdeckt die britische Regierung einen
gewaltigen Reformbedarf. Für den anhaltenden
Niedergang des Pfund Sterling als Weltwährung
macht sie neben der ungenügenden Exportfähigkeit der
heimischen Industrieunternehmen die sinkende
Wettbewerbsfähigkeit der am Finanzplatz London ansässigen
Banken verantwortlich. Im Kampf um das Geschäft mit Geld
und Kredit verliert die City immer mehr Marktanteile an
die Finanzzentren der Weltwirtschaftsmächte USA und
Japan; ihr droht gar, als führender europäischer
Finanzplatz von dem aufstrebenden Finanzzentrum des
Exportweltmeisters Deutschland ersetzt zu werden.[5] Die Regierung
Thatcher ist entschlossen, verlorenes Kreditgeschäft für
den Londoner Finanzstandort zurückzuerobern und den
Abstieg ihrer Währung in der Konkurrenz der Weltgelder zu
beenden. Dafür will sie eine Errungenschaft des
weltweiten Kapitalismus nutzen: die fortschreitende
Entnationalisierung von Weltmarkt und Geldmarkt.
In ihrer Konkurrenz um die Aneignung der Erträge der
globalen Profitproduktion haben die Staaten das
finanzkapitalistische Geschäft weitgehend liberalisiert,
bestehende Hindernisse für das grenzüberschreitende
Geschäft mit Kredit und den globalen Handel mit Währungen
zunehmend abgebaut. Diese Internationalisierung
des Finanzkapitals soll jetzt zur neuen
Bereicherungsquelle Großbritanniens werden. Den Umstand,
dass sich schon lots of foreign money
hauptsächlich in der Nationaluniform von Dollars in der
City tummeln,[6] begreift die britische
Regierung als günstige Voraussetzung für ihr Vorhaben,
die wachsenden internationalen Kreditgeschäfte mit
staatlicher Hilfe zum Motor des britischen Wachstums zu
machen. Sie ist entschlossen, den Finanzgeschäften mit
der amerikanischen Währung am Finanzplatz London neue
Freiheiten zu eröffnen: Getrennt von der
Garantie, die dem Dollar durch die amerikanische
Notenbank und die dahinter stehende Geldmacht des
US-Staates zukommt, und damit getrennt von den daraus
resultierenden Auflagen und Beschränkungen soll
das Finanzkapital nur seinen Gewinnspekulationen folgend
seine Bereicherung in der weltweit anerkannten
Geldmaterie betreiben. Unter britischer Hoheit und der
Aufsicht der Bank of England sollen die Banken und
Investoren vor allem mit dem Dollar, aber auch den
anderen frei handelbaren Währungen mehr und lukrativere
Finanzgeschäfte veranstalten können als in den anderen
Zentren des globalen Kapitalismus. Das Projekt der
Thatcher-Regierung zur Eroberung von weltweitem
Finanzkapital durch die City auf Kosten von New York,
Tokio und Frankfurt spekuliert also auf das Interesse des
internationalen Finanzkapitals an einem Standort, der
gerade nicht der Jurisdiktion des US Federal
Reserve Systems und anderer Weltgeldnationen untersteht.
Es schmarotzt von der durchgesetzten Weltgeldrolle des
amerikanischen Geldes und der anderen weltweit
gehandelten Währungen und damit am Interesse der
Weltwirtschaftsmacht USA und der kapitalistischen
Hauptmächte Europas an einer erfolgreichen Benutzung
ihrer nationalen Gelder auch jenseits ihrer Geldhoheit.
Machtvolle Argumente für die Tauglichkeit der britischen Hauptstadt als finanzkapitalistische Drehscheibe
Bei ihrem Konkurrenzkampf um die Beheimatung des internationalen Finanzkapitals setzt die britische Regierung nicht nur auf besondere Gegebenheiten, die als exklusive Standortvorteile wirken – die geographische Lage Londons in den Zeitzonen zwischen Tokio und New York, die dem verflossenen Empire und dem erfolgreichen US-Imperialismus geschuldete Universalität der englischen Geschäftssprache und das angelsächsische „legal system“ als international durchgesetztes Vertragsrecht. Sie offeriert insbesondere einen Finanzplatz auf dem Boden einer Nation, die für verlässliche internationale Geschäfts- und Gewaltverhältnisse garantiert: Feste Bestandteile der „reason of state“ ist die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und damit im weltgrößten Binnenmarkt ebenso wie eine „special relationship“, in der die Nation mit der Weltwirtschafts- und Weltordnungsmacht USA verbunden ist, sowie die feste Verankerung in der NATO, in der Großbritannien den Status einer militärischen Führungsmacht Europas besitzt. Entscheidende Geschäftsbedingung für den programmierten Erfolg der City ist die auf diese Weise als imperialistisch unbedingt respektabel ausgewiesene Staatsgewalt, die über den Finanzplatz wacht und die geschäftsfördernden Freiheiten stiftet und garantiert, die das internationale Finanzkapital attrahieren sollen.
Mit ihrer legislativen Gewalt bereitet die Thatcher-Regierung den Boden für die Eroberung von weltweitem Finanzgeschäft durch die City auf Kosten von New York und Tokio. Sie stiftet eine neue kapitalmarktfreundliche Rechtsordnung, die im Vergleich zu den anderen Finanzplätzen Geschäftsperspektiven eröffnet, die das internationale Geldkapital einfach nicht ausschlagen können soll. Sie schafft alle Devisenverkehrskontrollen ab (1979) und verabschiedet den Financial Services Act (1986). Kern dieser Reformmaßnahmen sind die Liberalisierung des Börsenhandels, seine Öffnung für ausländische Direktinvestitionen und die Befreiung der neuen Abteilung finanzkapitalistischer Spekulation, des aufkommenden Derivategeschäfts, von bisherigen Verboten.[7] Sie wirft damit die althergebrachte rechtliche Organisation des Börsenhandels über den Haufen. Mit der hatte der Staat zwar für ein äußerst profitables Geschäft auf Seiten der „Broker und Jobber“ ebenso gesorgt wie für den Schutz der angestammten Londoner Finanzinstitute vor ausländischer Konkurrenz.[8] Das betrachtet die Regierung jetzt aber als entscheidendes Hindernis, das den Aktienhandel und den Kredit in der City verteuert und überhaupt den Wettbewerb verhindert, dessen Freisetzung das Wachstum der Finanzgeschäfte beleben soll. Also wird diese überkommene Geschäftsordnung des Finanzplatzes gründlich entsorgt. Seitdem haben alle Regierungen, ob konservativ oder New Labour, sich auf diese Staatsräson verpflichtet, in deren Zentrum der staatliche Dienst am Finanzkapital durch eine besonders finanzkapitalförderliche Rechtsordnung steht – einen ganzen Unterbau an sogenannten „Steueroasen“ im erweiterten britischen Hoheitsbereich eingeschlossen. Auf den britischen Staat ist also Verlass: Seine Rolle in der Weltmarktkonkurrenz, seine gefestigte Teilhabe an den Bündnissen des Westens und die politische ‚Zuverlässigkeit‘ seiner Regierungen stehen für die ökonomischen und politischen Sicherheiten ein, welche für die globale Gemeinschaft der Spekulanten ebenso zählen wie die Geschäftsfreiheit, wenn sie entscheiden, wo sie ihr riskantes Geschäft betreiben. So fungiert die Londoner City als ein besonders sicherer „Offshore“-Finanzmarkt unter der Regie einer führenden Kapitalnation.
Bewirtschaftung von Dollarvermögen aus aller Welt
Die staatliche Berechnung, das internationale Finanzkapital ganz neu zur Bereicherungsquelle der Nation zu machen, ist in den Jahrzehnten vor der Finanzkrise aufgegangen. Der Aufstieg der City beginnt mit dem Eurodollargeschäft. Sie nimmt die aus den Kriegs- und Rüstungskosten in den späten 60er Jahren, aus dem globalen Ölgeschäft und aus dem globalen Kapitalexport amerikanischer Unternehmen herrührende „Dollarschwemme“ als Gelegenheit, diese in London zu zentralisieren und in Liquidität für den Finanzmarkt zu transformieren. Zum Gelingen tragen die USA kräftig bei: durch Kapitalverkehrskontrollen, mit denen sie die Kapitalexporte eindämmen und Kreditgeschäfte von US-Banken mit Ausländern einschränken, also durch all die Maßnahmen, mit denen die USA die wachsenden Dollaransprüche gegen sich begrenzen und die drohende Inanspruchnahme ihrer Goldgarantie vermeiden wollen; außerdem durch die von der US-Notenbank verfügten Zinsobergrenzen für Dollardepositen; ferner durch das Kontrollregime der amerikanischen Weltordnungsmacht über Dollarvermögen, welche feindliche Staaten bei US-Banken halten – das alles fördert das Interesse der Dollarbesitzer in aller Welt an einem „Offshore“-Finanzplatz, an dem sie über ihre Geldvermögen geschäftlich frei disponieren bzw. für deren Schutz vor dem Zugriff der US-Staates sorgen können.[9] Einen solchen stellt der britische Staat bereit, der über die Bank of England auch gleich noch für niedrige „regulative Kosten“ sorgt. Mit dem Angebot lukrativer Zinsen für Dollardepositen bieten die Banken in London Dollarvermögen aus aller Welt Gelegenheit zur Anlage und machen sich darüber zum Zentrum für Finanzgeschäfte aller Art mit der Weltwährung. Sie machen sich zum Dollarschuldner der ganzen Welt, um darüber zum Generalgläubiger aufzusteigen. So werden sie zur ersten Adresse für Geldanleger wie Kreditnachfrager. Sie ziehen die Dollarüberschüsse von Ölscheichs und deutschen Exportunternehmern sowie Dollarreserven von Staaten auf sich, sie bedienen die Dollarforderungen amerikanischer Multis, kreditieren Unternehmen, die für ihre Weltmarktgeschäfte Dollars brauchen sowie Staaten mit ihrem Dollardevisenbedarf. Darüber ziehen sie auch Devisen- und Kreditgeschäfte in anderen Währungen nach London. Und sie nutzen die Geschäftsbedürfnisse von Gläubigern wie Schuldnern aus allen Ländern, um darauf ihr Geschäft mit fiktivem Kapital – mit der Schaffung und dem Handel von Wertpapieren – zu gründen. Die City wird zum globalen Vermarkter von internationalen finanzkapitalistischen Investments und Kreditgeschäften aller Art und Denomination und so zum größten Kapitalmarkt außerhalb der USA.[10]
Zentralisierung der Eurokreditgeschäfte
Kaum war die europäische Gemeinschaftswährung gegründet, erobert London auch das Eurokreditgeschäft für sich. Die City fungiert von Anfang an als der weltweit wichtigste Handelsplatz für die Abwicklung des Devisenverkehrs mit dem neuen Weltgeld, für die Vermarktung der auf Euro lautenden Staatsanleihen und Firmenkredite aller Art sowie insbesondere für das Geschäft mit den darauf gegründeten derivativen Finanzprodukten.[11] Dass der Finanzplatz zwar zum einheitlichen europäischen Binnenmarkt mit seinem freien Kapitalverkehr gehört, aber außerhalb der Eurozone liegt, betrachtet das europäische wie weltweite Finanzkapital nicht als nachteilige, sondern als eher günstige Bedingung. Denn damit ist garantiert, dass alles, was den Mitgliedern der Währungsunion bei der Bewirtschaftung ihres Eurokredits an Restriktionen einfällt – zuletzt eine Finanztransaktionssteuer und eine zentrale Bankenaufsicht –, für die City nicht gilt. Auch hier wirkt die Kombination aus Freiheit und Sicherheit, die London bietet, als entscheidender Standortvorteil. Die betrachten Geldkapitalisten als mindestens so attraktiv wie die konkurrenzlose Größe Londons gegenüber den Finanzzentren Frankfurt, Paris, Mailand oder Madrid in der Eurozone.[12]
Umfang und Zentralisation des Kreditgeschäfts als Produkt und Motor finanzkapitalistischen Wachstums
Denn Größe. diese entscheidende
Konkurrenzbedingung, hat sich die City im Gefolge ihres
jahrzehntelangen Aufschwungs erfolgreich erobert. Der mit
den Reformen freigesetzte finanzkapitalistische
Geschäftsverkehr bewirkt nicht nur sofort eine rapide
Explosion der Geschäfte in der City, die als Big
Bang
zu den Großtaten von Maggy Thatcher gezählt
wird; er begründet ein dauerhaftes exorbitantes Wachstum
am Finanzplatz London. Die umfassende Deregulierung des
Börsengeschäfts auf der Insel sorgt mit den vermehrten
Umsätzen im Handel mit Wertpapieren aller Art
auch für eine Zentralisation internationalen
Finanzkapitals in London.[13] Sie fördert eine neue
Kapitalgröße der am Londoner Finanzplatz tätigen
ausländischen, aber auch der heimischen Banken. Aus den
vielen im internationalen Maßstab kleinen Londoner und
Schottischen „Clearingbanken“, die bis in die 70-er Jahre
das inländische Kreditgeschäft mit Privatkunden und
kleinen Unternehmen betreiben, entwickeln sich in den
80-er Jahren große, im ganzen Spektrum der
finanzkapitalistischen Bereicherung engagierte britische
Universalbanken. Durch Übernahmen und Fusionen auf dem
heimischen und internationalen Markt entstehen vier
global player
: HSBC, Barclays, Lloyds Banking
Group und die Royal Bank of Scotland, die nach der
Übernahme der niederländischen Großbank ABN Amro
kurzzeitig zur weltgrößten Bank avanciert – bis zu ihrem
abrupten Bankrott in der Finanzkrise.[14]
Und Größe durch Zentralisation des Kapitals wirkt als mächtiger Hebel zur Beschleunigung seines Wachstums: ein kapitalistisches Gesetz, das generell für jedes Geschäft gilt, in der Sphäre des Finanzkapitals aber von ganz besonderer Bedeutung ist. Da ist das Unternehmenskapital ja bloß die Grundlage, die – in ihrem relativen Umfang vorgeschriebene – Sicherheit für das eigentliche Geschäft, das mit fremdem – geliehenem oder überhaupt nur deponiertem – Geld betrieben wird. Dessen Umfang übersteigt die Summe des Eigenkapitals um ein Vielfaches; in entsprechender Größenordnung kann das Geschäftsvolumen im Verhältnis zu dem Eigenkapital wachsen, mit dem ein Finanzunternehmen operiert. Die Beschaffung von Einlagen fällt einer Bank leicht, die ihren Kontoinhabern, Sparern und Geldanlegern schon allein mit ihrer Größe Sicherheit für jederzeitigen Zugriff auf das deponierte Geldvermögen bietet. Größe erzeugt Vertrauen in die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Bank; und darauf kommt es an für ein Unternehmen, das für einen Reichtum haftet, den es verliehen und dessen kapitalistisches Schicksal es nicht mehr in der Hand hat: Größere und vielfältigere Leihgeschäfte verbürgen die Fähigkeit des Kreditinstituts, immer liquide zu sein, also im Bedarfsfall Forderungen zu Geld zu machen und Verbindlichkeiten zu erfüllen. Auf der anderen Seite wächst mit der Masse des mobilisierbaren Kredits die Macht einer Bank, nicht bloß mehr Kreditwünsche zu erfüllen, sondern immer größere ‚Engagements‘ zu managen, die für kleinere Geldhäuser existenzgefährdend – und deswegen auch verboten – wären.
Mit einem hinreichenden derartigen Machtzuwachs ist ein entscheidender qualitativer Fortschritt verbunden: Die maßgeblichen Träger eines modernen Kreditwesens bedienen nicht bloß fremde Geldbedürfnisse, sondern sind die entscheidenden Schaltstellen, die Ermöglicher, Arrangeure, insofern die Urheber und eigentlichen Herren kapitalistischer Geschäftstätigkeit überhaupt. In dieser Eigenschaft treten sie der ganzen Gemeinde von Geldbesitzern und -anlegern, von Investoren mit jedem Grad spekulativer Risikobereitschaft, als Anbieter von Geschäftsgelegenheiten gegenüber, als Konstrukteure und Schöpfer von Schuldverhältnissen, die dann auch nicht mehr so, sondern Investments heißen. Und passend zu diesem Angebot fürs bessere Publikum schöpfen und vergeben sie nicht mehr bloß Kredite für Industrie, Handel und Staatshaushalte, sondern lenken fremdes Geld ebenso wie selbstgeschaffene Finanzmittel gerne in raffiniertere „Risiken“, die Spekulationsgeschäfte aller Art zum Inhalt haben. So eröffnet sich das Kreditgewerbe mit der Zentralisation des Geldkapitals und der Vervielfachung seines Geschäftsvolumens eine ganz neue Welt des Geldverdienens: das vom profanen Leihgeschäft mit der „Realwirtschaft“ zunehmend emanzipierte Investmentbanking. Das fängt an mit der Börseneinführung von Unternehmen, finanziert Mergers & Aquisitions und mobilisiert Milliardenkredite für die Vermarktung der Schulden ganzer Staaten, geht weiter mit dem Versicherungs- und Rückversicherungswesen bei Geld-, Aktien- und Devisengeschäften und hört bei der abgeleiteten Spekulation auf die dort geschaffenen Wertpapiere im Derivatehandel noch lange nicht auf. Richtig Geld gemacht wird mit der Kreation und dem Vertrieb „innovativer Finanzprodukte“ verschiedenster Art.[15]
Da setzt die City Maßstäbe: Neben der Wall Street sind
die am Finanzplatz London tätigen Investmentbanken
führend in der Technik, immer neue Gattungen von fiktivem
Kapital – „Derivate“ aller Art – „abzuleiten“ und sich
immer neue spekulative Geschäftsfelder zu erfinden. So
treibt die hier versammelte Finanzindustrie mit ihren
Produktinnovationen ihre verselbständigte Akkumulation in
die Höhe.[16]
Die Potenz des Finanzkapitals zur Ausdehnung seines
Geschäfts wächst im Maße seines Wachstums – ein
virtuous circle
, den die Bewunderer des
Finanzplatzes London ebenso treffend wie begriffslos
anführen, wenn sie von der in der City konzentrierten
critical mass
schwärmen, die einmal erreicht,
ihren eigenen Wachstums- und Konkurrenzerfolg gleichsam
automatisch garantiert.[17]
Britische Finanzmacht auf Basis des internationalen Finanzbooms, den die City vorantreibt
Auf diese Logik finanzkapitalistischer
Akkumulation setzen die britischen Regierungen seit
Margaret Thatcher – und die setzten sie
erfolgreich frei. Damit erobern sie
Großbritannien die Rolle in der Weltmarktkonkurrenz, auf
die sie es abgesehen haben: Die Londoner City fungiert in
wachsendem Maße als Umschlagplatz, Makler und Produzent
des globalen Finanzkapitals und mehrt damit den
Nationalreichtum. Die Wirtschaftsexperten
beziffern den Beitrag des finanzkapitalistischen
„Dienstleistungssektors“ auf ein Drittel des jährlichen
Wachstums des britischen Bruttoinlandsprodukts in den 15
Boomjahren vor der Finanzkrise; der Export von
Finanzdienstleistungen erwirtschaftet einen steigenden
Überschuss.[18] Was sich wie ein bloß
rechnerischer Beitrag zu den nationalen Bilanzen
ausnimmt, ist seiner Qualität nach viel mehr: Der Staat
selbst profitiert von dem dadurch befeuerten längsten
Aufschwung der britischen Wirtschaftsgeschichte
nicht
nur durch steigende Einnahmen von Steuern und Gebühren.
Sein nationales Geld, das Pfund Sterling wird
in Wert gesetzt durch die Masse an Geschäften,
die am Londoner Finanzplatz und von ihm aus und nicht
zuletzt von seinen Banken getätigt werden. Dollar und
Eurogeschäfte der Banken ersetzen nicht die Geschäfte mit
dem Pfund, sondern lassen diese mitwachsen; immerhin ein
Drittel des akkumulierten Geschäftsvolumens der City
lautet auf Pfund, so dass der Staat nicht nur über das
finanzkapitalistische Wachstum in auswärtigem Weltgeld
auf seinem Standort, sondern auch über das in seinem
eigenen Nationalkredit an Kreditwürdigkeit
gewinnt. Die lange Phase des sinkenden Wechselkurses,
Indikator der Konkurrenzniederlagen der britischen
Industrie und des Niedergangs als Handelsnation, ist
damit vorbei. Das Pfund Sterling behauptet sich in der
Währungskonkurrenz mit den Weltgeldern Dollar, Euro und
Yen [19] es
wird beglaubigt durch die kapitalistische Instanz, die
mit ihren Geschäften über den Wert und die Gültigkeit
eines Nationalkredits als Repräsentant von Geldreichtum
entscheiden: das internationale Finanzkapital. Das mehrt
die Finanzmacht und Verschuldungsfähigkeit der
Nation – eine Potenz, die es nicht zuletzt dem britischen
Imperialismus ermöglicht, „über seine Verhältnisse“ zu
leben, sich einen gewaltigen Rüstungshaushalt zu leisten
und eine weltweit tätige Armee.
Soweit der Dienst des Finanzkapitals, den sich der britische Staat mit der radikalen Förderung von dessen Akkumulation gesichert hat.
Der Finanzstandort London als Aktivist und Opfer der weltweiten Überakkumulation – und seine Rettung durch den Staat und seine amerikanischen und europäischen Konkurrenzpartner
Großbritannien hat als Besitzer eines Weltfinanzzentrums, als Urheber und Manager der in London beheimateten Kreditindustrie das Finanzgeschäft in immer neue Höhen getrieben. Wie hoch, das zeigt sich in der Krise, wenn sich die Banken nichts mehr leihen und die spekulative Gleichung von Schulden und Geldkapital kündigen. Der Zusammenbruch der Kette von aufeinander gegründeten Kapitalanlagen und Kreditschulden demonstriert die Dimensionen der Akkumulation, zu der sie es gebracht haben und die sich jetzt als Überakkumulation erweist. Massen uneinbringlicher Forderungen stehen ebensolchen Massen nicht mehr bedienbarer Schulden gegenüber – und das nicht nur in den Büchern der Londoner Banken, sondern weltweit. Die City hat sich jahrelang als produktives internationales Finanzzentrum bewährt, jetzt betätigt sie sich als Schaltstelle für die Verallgemeinerung der Finanzkrise. So wie die Londoner Banken den Kredit global vermarktet haben, sorgen sie jetzt in der Krise auch für dessen weltweite Entwertung. Wenn reihum gezahlt werden muss und nicht gezahlt werden kann, dann sind davon alle getroffen, die ihr Vermögen in London angelegt, sich dort finanziert und mit Dollar, Euro und Pfund spekuliert haben, nicht zuletzt die Banken, Unternehmen und Staaten der Eurozone. Daran, dass sich die staatliche Bankenrettung im Euro-Raum zur Staatsschuldenkrise ausgewachsen hat und etlichen Euro-Ländern der Staatsbankrott droht, hat der Londoner Finanzplatz maßgeblich mitgewirkt. Schließlich sind es die dortigen Banken, die schon seit der Gründung der Währungsunion auf großer Stufenleiter die Staatsanleihen aus der Eurozone vermarktet und den heutigen Pleitestaaten die Aufblähung ihrer Staatsschulden finanziert haben. Die City hat sich um die Akkumulation der Euroschulden verdient gemacht, jetzt wird sie zum Exekutor der von ihr vorangetriebenen Überakkumulation des Eurokredits. Der Londoner Finanzmarkt wirkt maßgeblich mit an der Entscheidung über die Kreditwürdigkeit ganzer Staaten, sortiert die guten und die schlechten Schuldner in der Eurozone und entzieht Irland, Portugal und Griechenland den Kredit, den er Deutschland nach wie vor uneingeschränkt zubilligt. Dass der Aktivist der Krise von dem, was er anrichtet, auch selbst betroffen wird, liegt in der Natur der Sache. Der Täter ist dann auch das Opfer! An vorderster Stelle trifft die krisenhafte Entwertung die City selbst, also auch und insbesondere die britischen Banken.
Die Londoner Banken müssen deshalb vom Staat, der sein
nationales Wachstum auf diesen Finanzsektor gegründet
hat, gerettet werden. Der entschiedene
Verfechter des laissez faire
für
Finanzkapitalisten, die politische Gewalt, die deren
freiem Unternehmertum mit der ganzen Wucht gesetzlich
verfügter Deregulierung Bahn gebrochen hat, ist jetzt, wo
die Betätigung der finanzkapitalistischen Freiheiten das
Überleben ihres Finanzplatzes aufs Spiel setzt, in der
Rolle des Garanten gefordert. Sie muss
materielle Sicherheit stiften, damit die sich
entwertenden Bankvermögen in Wert bleiben, und
Garantien und Mittel für die Liquidität
der Bankenwelt bereit stellen, die diese selbst nicht
mehr zustande bringt.
Das macht die britische Regierung. Sie schöpft
hoheitlich Massen von Kredit und kreditiert damit die Not
leidenden Banken: Sie verstaatlicht angesichts
eines Bank-run und des drohenden Zusammenbruchs weiterer
Geldinstitute und damit des ganzen Finanzsystems die
bankrotten Großbanken Northern Rock und Royal Bank of
Scotland (RBS), macht also die „taxpayer“ zum größten
Anteilseigner des fallierenden Bankkapitals. Eine weitere
Großbank, Lloyds TSB, zwingt sie zur Übernahme
des zahlungsunfähigen Bank- und Versicherungskonzerns
Halifax Bank of Scotland (HBOS) und übernimmt einen
großen Aktienanteil in staatlichen Besitz. Auf Anweisung
der Regierung kauft die Bank of England mit immer mehr
neuen Pfund Sterling die nicht mehr marktfähigen
Wertpapiere der Banken und die neu geschaffenen
Schuldpapiere des Staates unbegrenzt auf. Mit
Quantitative Easing
– eine moderne Chiffre für
Geldschöpfung in großem Stil durch die Notenbank –
garantiert sie die staatliche
Verschuldung.[20]
Die Regierung muss also zur Bekämpfung der Finanzkrise auf die staatliche Macht, Zahlungsfähigkeit zu schaffen, als letzte und ersatzweise Garantie zurückgreifen – und das kann sie auch, sowohl formell wie materiell. Denn erstens ist der britische Staat autonomer politischer Herr über das Pfund, im Unterschied zu den Euro-Staaten, die mit einem gemeinsamen Geld unter der Regie der EZB wirtschaften. Er kann daher seinen Nationalkredit frei nach seinen eigenen politischen Bedürfnissen schöpfen und bewirtschaften. Er unterliegt nicht den Restriktionen und verpflichtenden Konditionen des gemeinsamen Euro-Staatsschuldenmanagements, auf das sich die Euro-Länder verpflichtet haben bzw. von den Euro-Gläubigermächten, allen voran Deutschland, haben verpflichten lassen müssen. Er ist deshalb nicht in der Not, für die Mobilisierung des zur Bankenrettung nötigen Staatskredits auf die umstrittenen, also unsicheren Kreditgarantien einer EZB zurückgreifen zu müssen, sich nur nach den restriktiven Regeln eines Euro-Rettungsfonds Kredit besorgen zu können und sich den daran geknüpften Bedingungen und Konsequenzen unterwerfen zu müssen. Und weil zweitens das Pfund Sterling die Qualität eines anerkannten Weltgeldes besitzt, verfügt die Regierung auch über die Finanzmacht, sich bei den Märkten in eigenem Geld zu verschulden und dafür ihre Zentralbank selbstverständlich in Anspruch zu nehmen. Diese Freiheit, die sich Großbritannien dank seines Nichtbeitritts zum Euro-Verbund formell bewahrt und mit der Stärkung seines Pfundes durch dessen massenhafte finanzkapitalistische Verwendung als Geschäftsmittel auch materiell erobert hat, bringt die Regierung mit ihren entschlossenen Rettungsmaßnahmen in Anschlag, wenn sie sich mit der Aufblähung der Staatsschuld und der Strapazierung ihrer Währung haftbar macht für die Verluste des Finanzkapitals. Die Regierung brüstet sich auch demonstrativ in Abgrenzung von den Eurostaaten mit dieser ihrer Freiheit und Potenz zur Geldschöpfung, die sie als britischen Konkurrenzvorteil beim Ringen um das Vertrauen in ihre Krisenbewältigung präsentiert.
Die ganze Wahrheit ist das nicht! Der britische Staat ist mit seiner Geldschöpfung überfordert – eine Konsequenz nicht nur der schieren Größe des entwerteten finanzkapitalistischen Reichtums aus Vermögen und Schulden, den die Banken der City zustande gebracht haben, sondern der Währungsnatur der zu rettenden „assets“, von denen weit mehr als die Hälfte fremdes Geld repräsentieren. Das stellt die Bank of England vor die Notwendigkeit, riesige Fremdwährungssummen – vorwiegend Dollars, aber auch Euros – zu beschaffen. Das geht zwar prinzipiell mit der Bereitstellung von eigener frisch geschaffener Währung – schließlich verfügt der Staat mit dem Pfund Sterling über ein akzeptiertes Weltgeld, die Masse an Geschäften in fremder Währung sind ja durchaus ein Ausweis, was die internationale Finanzwelt dem Staat mit seinem Pfund an Sicherheit zutraut. Aber diese Masse und der damit erforderliche Umfang an staatlicher Verschuldung zur Aufrechterhaltung ihrer Kapitalqualität machen die Sache prekär: Der Gebrauch des Pfund Sterling durch die Finanzwelt, der die Währung in Wert setzt und als Weltgeld beglaubigt, steht in keinem Verhältnis zur Masse der entwerteten Dollar- und Euro-Vermögen, die der Staat mit der Geldschöpfung von Pfund Sterling sichern muss. So gefährdet die Rettung seines internationalen Finanzplatzes, für die der Staat auf die Potenz seiner Währung zurückgreift, deren praktische Anerkennung als Weltgeld durch die private Geschäftswelt.
Der „Test“, wie weit „die Märkte“ noch mitgehen bzw. wann sie anfangen, gegen das Pfund Sterling zu spekulieren, bleibt der Regierung jedoch erst einmal erspart. Die einschlägigen Staaten, in deren Geld die gefährdeten Vermögen des Finanzplatzes existieren und deren Staatsschulden dort platziert sind, haben selber ein Interesse daran, dass der britische Staat als Garant des Finanzplatzes und damit auch ihrer auswärts getätigten Kreditgeschäfte fungiert und funktionsfähig bleibt. Sie werden deshalb vorsorglich gegen jedes finanzkapitalistische Misstrauen als Garanten der internationalen Kreditwürdigkeit des britischen Staats tätig.
Die amerikanische Geld- und Weltmacht, die den Kampf gegen den Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems anführt, hat schon wegen der Rettung ihrer Wall Street ein Eigeninteresse an der Rettung der City durch den britischen Staat, mit dem sie sich zugleich eine scharfe Konkurrenz um den Kredit der Welt und die Vorherrschaft der Finanzplätze liefert. Die USA überlassen Großbritanniens staatliche Kreditfähigkeit nicht dem Urteil der finanzkapitalistischen Spekulanten, sondern stützen mit ihrem politischen Kredit das Pfund Sterling: Sie sorgen mit für die Aufrechterhaltung der Dollarliquidität in der City und verbürgen dadurch die Glaubwürdigkeit des britischen Garantieversprechens für den Finanzplatz London. Die Federal Reserve schließt im Herbst 2008 ein Währungs-Swap-Abkommen mit der Bank of England, gewährt ihr damit den jederzeitigen Umtausch von Pfund Sterling in Dollar, um mit der so geborgten Liquidität den Zusammenbruch des Zahlungsverkehrs in der City abzuwenden.[21] Und indem die Eurozone ihrerseits ihre Banken stützt und rettet und – ebenfalls – durch ein Abkommen mit der amerikanischen Notenbank die Sicherung der Dollarvermögen ihrer Banken betreibt, tragen auch die Staaten des kriselnden Euro maßgeblich zur Sicherung des Londoner Bankenplatzes bei, der zu einem Gutteil aus Dependancen europäischer Finanzinstitute besteht und auch über britische Banken die Masse des Eurokreditgeschäfts abwickelt.[22]
So stützen die selber von der Krise betroffenen
politischen Konkurrenten direkt und indirekt den
britischen Kredit und unterstützen damit auch
die Bemühungen der britischen Regierung, ‚ihren‘
Finanzplatz zu retten und ihren Nationalkredit in Wert zu
halten. Mit Erfolg. Trotz der massenhaften Schöpfung von
Staatskredit behauptet sich das Pfund Sterling in der
Währungskonkurrenz, allerdings – wie kundige Sachwalter
der finanzkapitalistischen Rechnungen zu Protokoll geben
– weniger aus einem positiven Grund: Finanzkapital, das
nach Sicherheiten sucht und dem Dollar misstraut bzw. aus
dem Euro flieht, geht in das Pfund Sterling als safe
haven
, oder besser: als least ugly currency
(The Financial Times,
2.12.2011) .
Die zwei Fronten der nationalen Krisenbewältigung: Sicherung des Europakredits und Wiederherstellung von Wachstum am heimischen Standort
Vorbei ist die Krise am Londoner Finanzplatz damit
nämlich nicht. Der Staat ist nach den Kriterien, die das
Finanzkapital bei seiner Suche nach sicheren Anlagen in
der Krise verschärft an die staatliche Kreditwürdigkeit
anlegt, weit überschuldet; das Pfund ist
angesichts der nach wie vor prekären Lage des
internationalen Finanzkapitals und damit der City alles
andere als ein „safe haven“. Zumal es an nationalem
Wachstum und an verlässlichen nationalen
Wachstumsaussichten fehlt, von denen
Finanzkapitalisten ihre Bewertung von Staatsschulden
abhängig machen. Denn mit dem Einbruch der Bankgeschäfte,
der mit der Rettung der Banken einhergehenden Entwertung
bisheriger Vermögenstitel, der Kontraktion des Kredits
und der Zurückhaltung der Banken bei der Kreditierung
fehlt auch das unverzichtbare Wachstumsmittel
für Industrie- und Handelsunternehmen. Auch deren
Geschäft bricht ein.[23] Damit schwindet zugleich
gesellschaftliche Zahlungsfähigkeit. Schrumpfende
Verdienste und Einkommen des Finanzsektors, Lohnsenkungen
und Entlassungen in allen Wirtschaftsbranchen, erschwerte
Kreditmöglichkeiten auch für die Masse der Konsumenten
und Hausbesitzer, im Gefolge davon verminderte
geschäftliche Nachfrage – das sind die Elemente einer
double-dip recession
, einer mittlerweile sechs
Jahre anhaltenden allgemeinen Wirtschaftskrise.
Daher ringt die britische Regierung um eine umfassende Neubelebung des nationalen Wachstums.
Der Kampf um den Finanzplatz – und die Konkurrenz mit der Eurozone
Das betrifft zunächst und in erster Linie dessen elementare Grundlage, die Geschäfte der City. Der Staat, sein Nationalkredit, seine Verschuldungsfreiheit und sein ganzer nationaler Kapitalismus hängen daran, dass die internationale Banken- und Spekulantenwelt ihre Geschäfte an seinem Finanzplatz verlässlich und erfolgreich betreibt. London braucht unbedingt ein potentes, geschäftsfähiges Finanzkapital, und es braucht den bleibenden Zuspruch des internationalen Finanzkapitals. Dafür sieht es sich in erster Linie auf das Euro-Kapital und auf die Euro-Staaten als dessen politische Hüter verwiesen. Zu denen gerät die britische Regierung damit in ein widersprüchliches Verhältnis.
Was die Potenz des Finanzkapitals angeht, London wieder zum Zentrum erfolgreicher Geschäfte zu machen, so ist der Euro-Kredit dafür alles andere als eine sichere Bank. Zwar werden immer noch und wieder massenhaft Finanzgeschäfte in Euro getätigt, die EZB hält die Banken liquide und kauft Staatsschulden auch der minder kreditfähigen Staaten der Euro-Zone auf. Aber es herrschen bei den berufenen Agenturen erklärte Zweifel, wie weit und ob überhaupt die Finanzgeschäfte, die so in Gang, die Vermögen, die so in Wert gehalten werden, eine verlässliche finanzkapitalistische Akkumulation und ein allgemeines Wirtschaftswachstum in Bewegung setzen und die staatliche Schuldenwirtschaft wieder auf eine haltbare ökonomische Grundlage stellen. Die Entwertung akkumulierter Vermögenstitel ist nur gestoppt, keineswegs bewältigt; die ausgeuferten Staatsschulden etlicher Euro-Länder werden mehr durch die Euro-Notenbank als durch das berechnende Interesse von Investoren in Wert gehalten; das dafür geschaffene Geld rettet Schuldforderungen, stiftet aber sonst kein Geschäft und schon gar keinen Aufschwung. Und vor allem: Die Gefahr eines Auseinanderbrechens der ganzen Währungsunion mit unabsehbaren, absehbarerweise aber verheerenden Folgen für die Finanzwelt ist noch überhaupt nicht ausgeräumt.
Das alles liegt außerhalb der Verantwortung der
britischen Regierung; und die verbucht ihre
Unzuständigkeit offiziell und ziemlich ostentativ als
Plus und praktische Bestätigung ihres weisen Beschlusses,
ihr Pfund nicht gegen den Euro eingetauscht zu haben.
Nach der Devise: Das ist nicht unsere Krise!
beharrt sie darauf, dass Großbritannien als
außenstehendes Land gegenüber dem Euro keinerlei
Stützungs- und Rettungspflichten zu übernehmen hat, und
lehnt jegliche Mithaftung für gefährdete Euro-Kredite und
jede Beteiligung an einem gesamteuropäischen Schulden-
und Bankenregime strikt ab:
„Wir halten uns fern von solchen Maßnahmen wie Bail-out Fonds, die wir nicht leiden können… Auf dem Eurogipfel haben wir sichergestellt, dass die zentralen Teile der Bankenunion von der Europäischen Zentralbank nur für die Mitglieder der Eurozone gelten und nicht für uns. Wir werden nicht griechische oder portugiesische Banken stützen, und unsere Banken werden von der Bank of England reguliert, nicht von der EZB.“ (David Cameron, The Sunday Telegraph, 1.07.2012)
Die trotzige Unabhängigkeitserklärung gegenüber der
Euro-Zone ändert allerdings überhaupt nichts an
Großbritanniens Abhängigkeit von Wert und Tauglichkeit
des in Euro existierenden und mit dem Euro operierenden
Finanzkapitals; und deswegen ist sie auch nicht das
letzte Wort aus London. Die Regierung weiß um die
Abhängigkeit ihres Finanzplatzes von einer erfolgreichen
Sanierung des Kreditwesens und der Konsolidierung der
Staatsbilanzen im Euro-Raum. Von daher hat sie ein
existentielles Interesse an einer erfolgreichen
Eurorettung, und so gesehen ist die Krise des
Euro eben doch auch unsere Krise
. Deswegen bleibt
es auch nicht bei der Absage, sich materiell mitzuständig
zu machen für die Lasten der Krisenbewältigung auf dem
Kontinent. London sieht sich aufgerufen und
selbstverständlich berechtigt, sich nachhaltig in die
Krisenpolitik und die Diskussionen der
Euro-Macher über die geeigneten Maßnahmen
einzumischen, auch wenn bzw. gerade weil
Großbritannien selbst kein Mitglied der Währungsunion
ist. Im Sinne ihres Interesses an einer nachhaltigen
Konsolidierung der Euro-Finanzgeschäfte tritt die
Regierung für eine verlässliche, also möglichst
weitreichende Bewirtschaftung des gefährdeten
Euro-Kreditwesens durch dessen Hüter ein und dringt auf
ein gemeinschaftliches Finanzregime in der Euro-Zone. Von
deren Mitgliedern verlangt sie volle gemeinschaftliche
Haftungsübernahme für die Euro-Staatsschulden: Von
Deutschland fordert sie, was dieser Staat entschieden
ablehnt, nämlich mit Eurobonds für die Pleitekandidaten
zu haften; von den bankrotten Staaten, wogegen die sich
sträuben, nämlich die Unterordnung unter eine scharfe
Finanzaufsicht; und von allen gemeinsam, was
Großbritannien für sich selbst niemals akzeptieren würde:
„Ich plädiere seit einem Jahr dafür, dass die Eurozone der unerbittlichen Logik der Währungsunion folgen und die fiskalische Integration vorantreiben sollte… Die Lösung in der Eurozone muss nicht heißen, dass sich die Länder gleich zu den ‚Vereinigten Staaten der Eurozone‘ zusammenschließen, aber eine wirksame Lösung müsste die meisten Mechanismen, nach denen andere Währungen funktionieren, in irgendeiner Form beinhalten: größere Unterstützung der schwächeren Volkswirtschaften durch die stärkeren, um ihnen bei der Anpassung zu helfen; mehr Zusammenlegung von Ressourcen, sei es durch gemeinsame Eurobonds oder andere Instrumente; ein gemeinsames Sicherheitsnetz des Bankensystems in Form einer Banken-Union – und als Folge davon eine viel engere gemeinsame fiskal- und finanzpolitische Aufsicht… Auch wenn Großbritannien der Eurozone nicht angehört, hat es ein großes Interesse am Ausgang dieses Prozesses. Die Regierung weiß, dass das Wohl unseres größten Exportmarktes in unserem eigenen Interesse liegt. Ein unzureichendes Ergebnis würde für uns enorme Risiken bedeuten. Deshalb werden wir einer weiteren politischen Integration der Euroländer, wenn sie für die Lösung erforderlich ist, nicht im Wege stehen.“ (Finanzminister George Osborne, FAZ, 16.06.2012)
Der Regierung in London ist also klar, dass die Zukunft ihres nationalen Finanzgewerbes entscheidend von der kapitalistischen Potenz des Euro-Kreditgeschäfts und dieses von politischen Eingriffen der Euro-Staaten abhängt, die dieses Geschäft auf eine neue sichere Basis stellen. Und eben deswegen ist die gepriesene Unabhängigkeit ihres Landes vom Euro und vom Euro-Regime auch und vor allem ein Risiko und schon mehr als das. Denn an den Konditionen, mit denen die nationalen Organisatoren, Hüter und Nutznießer des Kreditwesens die Potenz des Euro zu sichern gedenken, hängen die Freiheit wie die Bereitschaft der Agenturen des Kreditgewerbes, sich an diesem oder jenem Finanzplatz zu engagieren. Und deswegen steht mit allem, was die Euro-Staaten unter deutscher Führung zur Wiederherstellung der Geschäftsfähigkeit des Finanzkapitals an gemeinsamem Vorgehen ins Auge fassen, ausstreiten und in die Wege leiten – und womit sie insoweit dem Verlangen Großbritanniens entsprechen –, der Zuspruch des Finanzkapitals der Euro-Zone zum Finanzplatz London in Frage. Und da kollidiert das britische Interesse, möglichst erfolgreich europäisches Finanzkapital an sich zu ziehen, ganz massiv mit dem Konkurrenzinteresse der maßgeblichen Euro-Krisenpolitiker.Denn so viel ist klar, das befürchtet die britische Regierung nicht zu Unrecht, dass sich die Euro-Mächte auf Bedingungen für ihre Währungszone einigen, die das Euro-Finanzgeschäft in der City angreifen, beschränken oder uninteressant machen:
„Es könnte dazu kommen, dass der Euroraum Entscheidungen zum Schutz der Finanzstabilität trifft, die für andere EU-Länder schädlich wären. Und ein Land wie Großbritannien mit seinem großen Finanzsektor könnte Maßnahmen zum Schutz der Steuerzahler und der Finanzstabilität beschließen wollen, hieran aber durch Regeln gehindert werden, die für den Euroraum aufgestellt wurden… Die Regeln, die für den gemeinsamen Markt gelten, müssen weiterhin von allen 27 Mitgliedern der Union gemeinsam aufgestellt werden.“ (George Osborne, FAZ, 16.06.2012)
Der Status des Euro-Außenseiters ist eben kein Schutz und kein Vorteil, wenn damit die politische Unzuständigkeit für die Regeln verbunden ist, nach denen das Euro-Finanzgeschäft in Zukunft funktionieren soll. Denn was die Euro-Mächte ohne Großbritannien an Regelungen beschließen, das schädigt britische Interessen nicht bloß möglicherweise, sondern das zielt auf die Schädigung des Außenseiters ab. Die verfolgen nämlich mit ihren Beschlüssen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit der Banken im Euro-Raum und mit der über die Krise hinausweisenden Perspektive eines verbindlichen politischen Regimes der Kreditbewirtschaftung den Zweck, sich verlässlicher als bisher der Dienste des Finanzkapitals zu versichern – und das meint auch, dessen Geschäfte mit dem Euro im Euro-Raum zu verankern und damit ihrer politischen Verfügungsmacht und ihrem ökonomischen Nutzenkalkül zuzuordnen. Bei der Konstruktion eines dauerhaft tragfähigen Finanzregimes über den Euro geht es ihnen ausdrücklich und nicht zuletzt ums Wegnehmen von Finanzgeschäft, das bisher in London beheimatet war, zukünftig aber unter ihrer Hoheit und damit zu ihrer Bereicherung stattfinden soll.[24]) Schließlich hat Deutschland nicht die Commerzbank und Frankreich nicht BNP Paribas mit Milliarden aus dem Staatshaushalt gerettet, damit diese dann mit ihren Finanzgeschäften nach London gehen bzw. dort bleiben. Die beschlossene Einführung einer Finanztransaktionssteuer, die Pläne zur zwangsweisen Verlagerung des Euro-Clearings weg aus der City in die Eurozone und der Kampf zur „Austrocknung der Steueroasen“ sind ein direkter Angriff auf das Zentrum der britischen Volkswirtschaft.
Die britische Regierung lässt umgekehrt keine Zweifel an ihrer Entschlossenheit, sich das Geschäft am Londoner Finanzplatz nicht durch Brüssel wegnehmen zu lassen.[25]) So eskalieren beide Seiten wegen der Internationalisierung ihrer finanzkapitalistischen Reichtumsquelle die politische Krisenkonkurrenz um die nationale Attraktion des Finanzgeschäfts – wobei Großbritannien eher am kürzeren Hebel sitzt, eben weil es über die Konditionen der Euro-Rettung nicht mitzubestimmen hat. [26]
Der Kampf um Haushaltssolidität und Wachstum – und einen dafür funktionalen EU-Binnenmarkt
Umso wichtiger ist für die britische Regierung im Konkurrenzkampf um ihren Kredit die Stiftung finanzkapitalistischen Vertrauens in die Wachstumspotenzen ihres Standorts und die Geschäftstauglichkeit ihrer staatlichen Finanzhoheit. Wie andere Staaten auch macht sie sich deshalb da, wo es ganz in ihre Macht fällt, im Innern, an dem widersprüchlichen Programm zu schaffen, auf der einen Seite die durch ihre Bankenrettung ausgeuferte staatliche Schuldenwirtschaft zu konsolidieren und auf der anderen Seite den Wirtschaftsstandort aufzurüsten und das auf breiter Front eingebrochene nationale Wachstum wieder in Gang zu bringen.
Die erste Hälfte dieses Programms, die Konsolidierung ihres Haushalts durch eine radikale staatliche ‚Sparpolitik‘ verfolgt sie ganz gemäß der wirtschaftspolitischen Vernunft einer Nation. Die unterscheidet produktive und unproduktive Kosten, solche, die für ein lohnendes kapitalistisches Getriebe nützlich und notwendig sind, und solche, die sich nur als staatliche Belastung erweisen, an denen also zu sparen ist: Kosten, die für das Volk – und zwar in der Krise vermehrt – anfallen, zu senken und den Staatshaushalt zu entlasten, das geht immer und liegt ohnehin in der Logik eines ordentlichen Sozialstaats. Das ist erst recht ein unabweislicher Sachzwang für einen Staat, der sich wegen seiner gefährdeten Banken in eine Staatsschuldenkrise hineingewirtschaftet hat. Also sind rigorose Einschnitte an der richtigen Stelle fällig: bei den mit der anschwellenden Zahl von Arbeitslosen und Armen „ausufernden Sozialleistungen“. Die bekämpft die Regierung mit der progressiven Kürzung der sozialen „Entitlements“.
Die andere Hälfte ihres Sanierungsprogramms, die Förderung des nationalen Wachstums, bedarf ganz anderer staatlicher Anstrengungen. Da muss ein in der internationalen Konkurrenz zurückgefallener Standort und sein wegen der Krise nicht mehr lohnendes, also brachliegendes kapitalistisches Geschäftsleben mit staatlicher Förderung wieder konkurrenzfähig und wachstumsfähig werden. Dass Großbritannien das braucht und sich in der internationalen Konkurrenz neu und ganz anders aufstellen muss, das ist denn auch Konsens bei den für die Nation Verantwortlichen. Alle Parteien wollen ein Ende der „De-Industrialisierung“, die das angestrebte realwirtschaftliche Wachstum blockiert, und stattdessen eine ‚zukunftsweisende‘, also im Weltmaßstab konkurrenzfähige „Re-Industrialisierung“ auf der Insel. Dass für den Aufbau von dauerhaft Gewinn versprechenden „Zukunftsindustrien“ viel neuer Staatskredit mobilisiert werden muss, davon geht die Regierung aus; zugleich beklagt sie mit Verweis auf die schwierige Haushaltslage und auf den Sachzwang zur Haushaltskonsolidierung fehlende Mittel. So kommt in den Abwägungen und Haushaltsvorbehalten zum Tragen, dass in der Krise wachsende Staatsschulden nicht als Mittel für kapitalistische Geschäfte fungieren und durch deren Gelingen gerechtfertigt werden. Die Aussicht darauf, dass sich der Einsatz des ohnehin gefährdeten Staatskredits lohnt, ist prekär; es ist zweifelhaft, ob die zusätzlichen Staatsschulden durch künftige Wachstumserfolge gerechtfertigt werden können oder der Staat nicht nur noch mehr unproduktive Schulden akkumuliert. Umso mehr verlegt sich die Regierung darauf, die Konkurrenzbedingung für die Industrie zu stiften, die nicht nur den Staat nichts kostet, sondern mit dem Sparprogramm zur Haushaltssanierung zusammenfällt: Sie streicht staatliche Leistungen und Beschäftigung, verschärft damit zugleich den Zwang, Arbeit um jeden Preis anzunehmen, verbilligt so systematisch die Arbeiterklasse. Die Verarmung des Volkes soll die Anwendung von Arbeitskräften rentabler machen, die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Unternehmen im Kampf um Marktanteile steigern und damit neues Wachstum „kreieren“.[27]
Für das Programm, seiner Nationalökonomie mit staatlicher
Standortförderung neue Geschäftserfolge zu eröffnen,
braucht Großbritannien den europäischen
Binnenmarkt, und die Regierung setzt deswegen
auch auf ihn.[28]) Für sie steht insofern der
Zugang zum einheitlichen Markt der EU im Zentrum des
Interesses
. Mit ihren internen Maßnahmen will sie den
britischen Wirtschaftsstandort nicht nur für ausländische
Kapitalinvestitionen, die im vergangenen Jahrzehnt
zunehmend in die EU-Mitglieder Süd- und Osteuropas
gegangen sind, wieder attraktiv machen. In erster Linie
sollen die auf der Insel produzierenden heimischen und
internationalen Unternehmen befähigt werden, mit
billigeren Belegschaften den Konkurrenzkampf auf dem
Binnenmarkt zu führen und dort Marktanteile auf Kosten
ihrer europäischen Wettbewerber erobern. Dafür will die
Exportnation Großbritannien ihre Mitgliedschaft in der EU
produktiv machen. Sie setzt einerseits darauf, die
Freiheiten der Konkurrenz, die der gemeinsame Markt den
beteiligten Staaten eröffnet, als sichere supranationale
Wachstumssphäre für das neu konkurrenzfähig gemachte
britische Geschäft zu nutzen. Und im Sinne solcher
Freiheiten tritt Premier Cameron dann auch für einen
Ausbau der EU und den Abbau von Schranken der
‚Gemeinsamkeit‘ ein, wo er Chancen für die Eröffnung
neuer Geschäftsgelegenheiten für Großbritannien sieht:
„Mein erstes Prinzip ist Wettbewerb… Im Zentrum der Europäischen Union muss, so wie es gegenwärtig ist, der Binnenmarkt stehen. Großbritannien ist im Herzen des einheitlichen Marktes, und es muss da bleiben. Aber wenn der Binnenmarkt bei Dienstleistungen, Energie und digitalen Geschäften nicht verwirklicht ist – denjenigen Branchen, die die Motoren einer modernen Wirtschaft sind –, dann ist er nicht der ganze Erfolg, der er sein könnte. Unsere Mission muss die Vollendung des einheitlichen Marktes sein… Wir vertrauen auf unser gemeinsames Interesse an offenen Märkten und an der Herstellung einer starken ökonomischen Basis in ganz Europa.“ (David Cameron, Grundsatzrede zur britischen Mitgliedschaft in der EU, 23.01.2013)
Auf der anderen Seite besteht die Cameron-Regierung darauf, dass Bedingungen und Bestimmungen, die für die Konkurrenz auf diesem Markt gelten und sie regeln, für Großbritannien nicht (mehr) gelten sollen, weil sie den Staat bei der Organisation des nationalen Geschäftslebens untragbar beschränken. Angesichts der Krise und für eine erfolgreiche Krisenbewältigung gelten ihr die Gemeinschaftsregelungen mehr denn je als störende Hindernisse. Und das betrifft vor allem, aber bei weitem nicht nur die Vorschriften der EU zum Umgang mit dem Produktionsfaktor Arbeit im einheitlichen Binnenmarkt. Die verbindlichen Mindeststandards für Arbeitszeiten und Beschäftigungsmodalitäten in Europa sind für die Regierung zunehmend ein Ärgernis, weil ein unzulässiger Eingriff in die nationale Gestaltung der heimischen Ausbeutungsbedingungen. Deswegen verlangt sie für sich mehr Freiheiten in der Arbeits- und Sozialpolitik, also das Sonderrecht, ihre Arbeiterklasse ganz nach dem eigenen Konkurrenzkalkül zu behandeln. Da ist Abbau von europäischen Verbindlichkeiten erforderlich, für die sich die Verantwortlichen in London stark machen. Es gehört eben zu den Gepflogenheiten der innereuropäischen Konkurrenz, die ja nicht nur Großbritannien als notorischen Kritiker der Abgabe von Souveränitätsrechten an Brüssel auszeichnen, einerseits weitreichende Fortschritte bei der „Integration“ der Eurostaaten an national interessierender Stelle zu fordern und sich gleichzeitig vorzubehalten, wieweit die Verpflichtungen für die eigene Nation gehen und gelten sollen.
Dabei geht es London erklärtermaßen um mehr: um die Stellung Großbritanniens zur und in der EU überhaupt. Cameron formuliert den doppelten Anspruch der Briten an Europa gleich als höchste Prinzipienfrage: Mit dem Hebel der britischen EU-Mitgliedschaft den gemeinsamen europäischen Binnenmarkt als frei verfügbaren Markt für Großbritannien voranbringen und sich zugleich alle nationalen Freiheiten zur Standortkonkurrenz nach eigenem Bedarf sichern bzw. zurückerobern, das ist eine conditio sine qua non britischer Souveränität:
„Mein drittes Prinzip ist, dass Souveränität auch wieder zurück in die Mitgliedsstaaten fließen muss, nicht nur von ihnen weg… Wir nehmen gerade eine kritische Bilanzierung unserer an die EU übertragenen Kompetenzen vor, um eine objektive Analyse zu erhalten, wo die EU uns hilft und wo sie uns behindert. Wir sollten nicht dem Trugschluss verfallen, ein funktionierender Binnenmarkt erfordere die Harmonisierung von allem. Wir können nicht alles angleichen und nach einem exakt ebenen Spielfeld streben. Zum Beispiel ist es weder richtig noch notwendig, dass der einheitliche Markt oder die volle Mitgliedschaft in der EU erfordert, dass die Arbeitszeiten von Ärzten in britischen Krankenhäusern in Brüssel festgelegt werden…In der gleichen Weise müssen wir viele Gebiete der EU-Gesetzgebung überprüfen einschließlich der Umwelt- und Sozialpolitik.“ (David Cameron, Grundsatzrede zur britischen Mitgliedschaft in der EU, 23.01.2013)
Beides, ein Mehr an Binnenmarkt und ein Mehr an Souveränität, will Großbritannien – und in diesem Sinne fordert die Cameron-Regierung eine fundamentale Reform der Europäischen Union und der britischen Mitgliedschaft in ihr. So führt der politische Kampf im Inneren um die Konkurrenzfähigkeit des Kapitalstandorts schnurstracks zum politischen Konkurrenzkampf um die Ausgestaltung des ‚gemeinsamen Europas‘.
Der eskalierende Streit zwischen Eurozone und Vereinigtem Königreich über die politische Neugestaltung der EU und wer sie bestimmt
Großbritannien trifft dabei auf die nicht minder grundsätzlich agierenden Mächte Deutschland und Frankreich, die zwar so erbittert wie noch nie um die Führung in der EU und um die Ausgestaltung jedes einzelnen Fortschritts – von der Haushaltsdisziplin über den Euro-Rettungsfonds bis zur Bankenunion – konkurrieren, aber sich in einem einig sind: Die Zukunft Europas muss ein neues Regime von Kooperation und Kontrolle bringen, das unvereinbar ist mit Sonderrechten für ein Land, das nichts mit dem Euro zu tun haben, aber von Europa „parasitär“ profitieren will.
Bis dato war die Opt-out-Regelung, die Befreiung von bestimmten Gemeinschaftsregeln, eine der Kompromissformeln, mit denen die EU ihren Fortschritt gegen die Widerstände einzelner Mitgliedstaaten bewerkstelligt hat, ohne das prinzipielle Verhältnis eines Staatenbündnisses gleichberechtigter Mitglieder aufzukündigen. Für Großbritannien war diese Klausel der bevorzugte Vertragsmodus, mit dem ungeliebten Widerspruch des Europaprojekts umzugehen, Nutzen aus dem Fortschritt der europäischen Integration nur um den Preis der Abgabe von Souveränität an die supranationalen EU-Institutionen ziehen zu können. Die britischen Regierungen haben nolens volens den Integrationsschritten des Staatenbündnisses und der Übertragung von Souveränitätsrechten an Brüssel zugestimmt, haben aber für das Vereinigte Königreich weitreichende Ausstiegsklauseln und Sonderrechte erstritten: bei der Sozialunion, der Innen- und Justizpolitik und natürlich bei der Währungsunion. Die wurden dem Außenseiter bislang von den anderen Europäern ebenso nolens volens zugestanden, weil sie das Vereinigte Königreich als mächtigen und ökonomisch potenten Partner wollten, den das europäische Staatenbündnis für seinen Erfolg in der Welt braucht.
Mit der Krise in der Eurozone und den von Deutschland und Frankreich durchgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wird die bisherige Position des Vereinigten Königreichs in der europäischen Union unhaltbar. Die Euromächte verweigern den Briten die bisher akzeptierte Art der Teilhabe an der gemeinsamen Sache, legen sie damit auf ihre Randständigkeit in Europa fest. Das wird auf dem Eurogipfel 2011 manifest. Dort wird das Vereinigte Königreich damit konfrontiert, dass es nicht mehr an europäischen Regelungen mitwirken kann, aus denen es sich dann ausklinkt, sondern dass die Eurostaaten gegen seine Einwände und an den existierenden Unionsverträgen vorbei ihre Fortschritte beschließen. Der Versuch der britischen Regierung, sich in den Verhandlungen über den Fiskalpakt eine neue Opt-out-Regelung – die Autonomie ihrer Haushaltsführung – zu sichern und ihre Zustimmung zum Fiskalpakt als neuem europäischem Recht von der Zusicherung abhängig zu machen, dass bei zukünftigen EU-Kapitalmarktregelungen die Interessen des britischen Finanzstandorts besonders berücksichtigt werden, scheitert am Widerstand der Eurostaaten. Das britische Veto ignorieren die anderen Europäer schlichtweg. Sie setzen das neue supranationale Haushaltsregime außerhalb der EU-Rechtsordnung in Kraft und schalten damit britische Mitsprache ebenso demonstrativ wie effektiv aus.[29]
Die kompromisslose Haltung der führenden Euromächte Deutschland und Frankreich gegenüber britischen Einwänden bei Eurorettung und Fiskalunion offenbart, wie ausgrenzend das erreichte Stadium des Europa-Fortschritts ist: Bei der Rettung des europäischen Geldes geht es um die Substanz und Zukunft des europäischen Gemeinschaftswerkes – und da lassen sich die bestimmenden Agenten der Eurozone von den anderen Mitgliedern der EU nicht mehr reinreden. Sie etablieren eine neue Scheidelinie in Europa, indem sie alle Nicht-Euro-Staaten förmlich aus den maßgeblichen Abteilungen des institutionalisierten europäischen Entscheidungsprozesses ausschließen. Noch vor 10 Jahren hat sich Großbritannien unter der Blair-Regierung als dritte europäische Führungsmacht definiert, die sich „im Herzen Europas verankern“ will. Jetzt sieht es sich mit einer Art Neugründung Europas konfrontiert, die nicht nur für die bankrotten Staaten der Eurozone, sondern auch für eine veritable EU-Macht die Alternative ‚Unterwerfung oder Ausgrenzung‘ aufwirft.
Beide Seiten dieser Alternative weist die britische Regierung zurück. Sie verlangt von der EU, dass die sich im britischen Sinne ändern muss:
„Für uns außerhalb der Eurozone gibt es nicht zu wenig, sondern bei weitem zu viel Europa. Zu viel Kosten, zu viel Bürokratie, zu viel Einmischung in Angelegenheiten, die dem Nationalstaat oder der Zivilgesellschaft oder den Bürgern zustehen. Ganze Abteilungen von Gesetzgebung, die sich auf soziale Fragen, Arbeitszeiten und Innenpolitik erstrecken, gehören abgeschafft… Es ist lebenswichtig für unser Land, unsere Beziehung mit Europa zu korrigieren.“ (David Cameron, The Sunday Telegraph, 01.07.2012)
Wo die EU-Führungsmächte ihr supranationales Bündnis
durch die Übertragung von Souveränität der
Mitgliedsstaaten an Brüssel vorantreiben, setzt die
britische Regierung ihre Forderung nach Repatriierung
von Souveränitätsrechten
dagegen. Sie besteht auf der
Neuordnung ihrer Mitgliedschaft und kündigt an,
in Zukunft gegen jede weitere Abgabe von nationalen
Rechten an Brüssel ebenso entschlossen zu kämpfen wie für
die Rückholung solcher Rechte, die das Parlament von
Westminster fahrlässig an Brüssel abgetreten hat.[30] Dann, aber auch
nur dann kann sich die Regierung eine dauerhafte
Mitgliedschaft in einer Europäischen Union vorstellen.
Das stellt David Cameron in seiner Grundsatzrede zu
Europa noch einmal mit Nachdruck gegenüber seinen
europäischen Partnern klar: Er verlangt eine
Neuverhandlung der europäischen Verträge und die
Revision der Mitgliedsbedingungen für mein Land
,
droht, ohne eine flexiblere, anpassungsfähigere und
offenere EU wird Großbritannien in Richtung Ausstieg
treiben
, und kündigt an, im Jahr 2017 das Volk in
einem Drinnen oder Draußen-Referendum
über die
britische EU-Mitgliedschaft entscheiden zu lassen. (The
Guardian, 23.01.2013)
Die Zurückweisung des britischen Interesses erfolgt
postwendend: Europa muss so genommen werden wie es
ist. Europa ist nicht verhandelbar.
(Francois Hollande, SZ, 24.01.2013) Für
den deutschen Außenminister kommen Rosinenpickerei
und eine Europäische Union à la carte
nicht in
Frage. Wenn die Briten allerdings die Absage an ihren
EU-Revisionsantrag zum Anlass nehmen, mit dem Austritt zu
drohen, dann müssen sie sich von der deutschen Kanzlerin
sagen lassen, dass sie damit nicht nur Europa, sondern
vor allem sich selbst schaden:
„Ich will ein starkes Vereinigtes Königreich in der EU…Ich denke auch, es ist gut für das Vereinigte Königreich, ein Teil von Europa zu sein. Wenn du in einer Welt mit sieben Milliarden Menschen lebst, und du bist alleine in der Welt, denke ich nicht, dass das gut für das Vereinigte Königreich ist. Deshalb werde ich alles tun, um das Vereinigte Königreich als guten Partner in der EU zu halten; deshalb komme ich nach London, und ich bitte die Einwohner dieser wunderbaren Insel darüber nachzudenken, dass sie auf sich alleingestellt in dieser Welt nicht glücklich werden.“ (Angela Merkel, The Guardian, 08.10.2012)
Auch so kann man drohen – nämlich in Form einer Werbung um das britische Volk, das sich einmal überlegen möge, wie klein und allein es in einer Welt dasteht, in der es nur an der Seite von Merkel & Co. glücklich werden kann.
So führen die drei entscheidenden Mächte in der EU, Deutschland und Frankreich auf der einen, Großbritannien auf der anderen Seite, einen Kampf um die Bedingungen der Mitgliedschaft in Europa, der an die Frage der Mitgliedschaft selbst rührt und die grundsätzliche Frage aufwirft: Sind die Briten noch bereit, bei diesem Europa zu den von Deutschland und Frankreich maßgeblich bestimmten Bedingungen mitzumachen bzw. sind die anderen Europäer zu neuen Bedingungen bereit, um Großbritannien in Europa zu halten? Und das ist letztlich nichts anderes als die Entscheidungsfrage, wer im gemeinsamen Europa das bestimmende Subjekt ist.
Die Eskalation des innenpolitischen Streits zwischen Regierung und Europagegnern
Das Projekt von Regierungschef Cameron, für eine
anders geartete, flexiblere und weniger belastende
Position von Großbritannien in der EU zu arbeiten
,
wird von der immer größeren Zahl der
Euroskeptiker in den Reihen der konservativen
Regierungspartei [31] abgelehnt, von den
Vertretern der UKIP (United Kingdom Independent Party)
ganz zu schweigen, deren programmatisches Ziel für die
einzig richtige Korrektur unserer Beziehung mit
Europa
seit je der EU-Austritt ist. Diese
fundamentale Opposition gegen die Mitgliedschaft in
Europa ignoriert jedes Moment von kollektivem
Machtzuwachs, das in der Teilhabe an dem supranationalen
Staatenbündnis liegt; sie entdeckt an der Europäischen
Union nichts als eine Beschränkung der
Souveränität – also eine Gefahr für das höchste
aller Güter, das Recht to be British
. So gesehen
ist der europäische „Kontinent“ ein einziger Angriff auf
das britische Inselvolk: Die Eurozone will „unser“ Pfund
Sterling abschaffen, Brüssel schreibt „unseren“ Ärzten
die Arbeitszeiten vor, der Binnenmarkt erlaubt Massen von
Osteuropäern den Zutritt ins Vereinigte Königreich, wo
sie dann „unsere“ Arbeitsplätze wegnehmen. Wie wenig
berechnend eine Opposition ist, die an der
EU-Mitgliedschaft nichts anderes wahrnimmt als
Souveränitätsverlust, bekommt die konservativ-liberale
Regierung zu spüren, wenn sie begründet, warum
Großbritannien auf Europa eigentlich nicht verzichten
kann:
Als Handelsnation braucht Britannien den freien Zugang
zu den europäischen Märkten und ein Mitspracherecht bei
der Festlegung der Regeln für diese Märkte. Der
Binnenmarkt steht im Mittelpunkt unserer Entscheidung für
die EU. Es macht aber auch Sinn, mit unseren Nachbarn zu
kooperieren, um unseren Einfluss in der Welt zu
vergrößern und unsere Werte Freiheit und Demokratie in
die Welt zu projektieren… Europa zu verlassen, wäre nicht
im besten Interesse unseres Landes.
(David Cameron, The Sunday Telegraph,
01.07.2012)
Der Versuch, den aufgeregten Nationalismus auf eine
nationale Vorteils- und Nachteilsrechnung hinsichtlich
der britischen Europamitgliedschaft zu verpflichten,
prallt einfach ab.[32] Die Euroskeptiker wollen
den Exit
aus Europa und fordern dafür ein
Referendum. Die Ankündigung von Regierungschef
Cameron, das Volk über die EU-Mitgliedschaft nach
Aushandlung eines neuen EU-Vertrags, aber spätestens 2017
abstimmen zu lassen, feiern sie als ihren Erfolg. Die
Regierung mag mit dem Referendum die doppelte Berechnung
verfolgen, nämlich die Partner in Europa zu
Zugeständnissen zu zwingen, weil ansonsten das Volksvotum
für ein „Out“ droht, und das Volk mit vorzeigbaren
Verhandlungserfolgen hinter sich zu bringen, damit es für
ein „In“ votiert und den ewigen innenpolitischen Streit
über die EU-Mitgliedschaft definitiv beendet. Die
Euroskeptiker jedenfalls sehen das Referendum als die
historische Chance für ihr Vereinigtes Königreich,
endlich seine nationale Selbstbestimmung
zurückzugewinnen. Sie bauen auf die verbreitete
Europagegnerschaft im Volk, für die alle
Parteien bestens gesorgt haben.[33] Die Europagegner rechnen
darauf, dass sich die britischen Bürger von ihrer
ureigenen Herrschaft noch die härtesten Arbeits- und
Lebensverhältnisse aufdrücken lassen – aber wenn man
ihnen mitteilt, dass die „Bürokraten in Brüssel“ mehr
verdienen als ihr Premierminister, sie dann endgültig
lieber früher als später die Mitgliedschaft ihres
Vereinigten Königreichs im Club der Europäer kündigen
würden.
[1] Unbestritten ist
London der wichtigste Finanzplatz Europas und
zweifelsohne ist es neben New York und Tokio eines der
globalen Finanzzentren. Wird nach dem Kriterium der
Größe, also der Marktkapitalisierung, geurteilt, liegt
London weltweit nur auf dem dritten Platz, weit
abgeschlagen hinter New York und auch noch deutlich
hinter Tokio. Doch während die anderen beiden
Finanzzentren ihre Bedeutung aus ihrer starken
inländischen Volkswirtschaft ziehen und vorrangig den
einheimischen Markt bedienen, dominiert London im
internationalen Finanzgeschäft. So hatten im März 2004
287 ausländische Banken in London eine Niederlassung –
so viel wie an keinem anderen Finanzplatz. London ist
der größte internationale Versicherungsmarkt mit einem
Gross Premium Income von 25 Milliarden Pfund in 2003.
Auch fällt in etwa die Hälfte des Handels mit
ausländischen Aktien auf London zurück. Dreiviertel der
europäischen Hedgefonds wählen London als Firmensitz,
und auch das Investmentbanking ist neben New York fast
ausschließlich an der Themse zu finden.
(Frach, Lotte: Finanzaufsicht in
Deutschland und Großbritannien, Wiesbaden 2008, S.
37). Im vergangenen Jahrzehnt haben nicht nur
die Anzahl der internationalen Banken, sondern auch der
Umfang und das Spektrum der Kreditgeschäfte zugenommen:
London ist der weltgrößte Devisenmarkt. Die
täglichen Umsätze (500 Milliarden Dollar) sind größer
als die von New York und Tokio zusammen. In London
werden mehr US-Dollars gehandelt als in New York und
mehr Euros als in allen anderen europäischen
Hauptstädten zusammen. In London sind mehr ausländische
Banken – über 500 – als irgendwo sonst auf der Welt
(New York hat gerade die Hälfte). Für viele dieser
Banken ist London nicht bloß ihr europäisches
Headquarter, sondern die Basis für ihr globales
Geschäft außerhalb ihres Heimatmarktes. In London
werden mehr Eurobonds gehandelt als irgendwo sonst,
ebenso mehr Derivate. London ist das weltgrößte Zentrum
für Funds Management. Hier wird mehr Geldanlage
verwaltet als in den nächsten zehn europäischen Zentren
zusammen; hier wird die Hälfte des gesamten
Wertpapiervermögens der europäischen institutionellen
Anleger (5500 Milliarden Dollar) gemanaged. London
beheimatet den weltgrößten Versicherungs- und
Rückversicherungsmarkt (Lloyds of London), und damit
eng verbunden den größten Shipping Market (Baltic
Exchange). London ist auch der Standort für einige der
weltgrößten Rohstoffbörsen (London Metal Exchange).
(Stoakes, Christopher: All you
need to know about the City, London 2010, S.
57).
[2] Von den insgesamt knapp 7800 Milliarden Pfund Sterling, auf die Ende 2012 die Vermögenswerte am Bankplatz London hochgerechnet werden, lauten 4100 Milliarden auf fremde Währungen. Darin sind Derivativpositionen in Höhe von 4600 Milliarden Pfund noch nicht mit einberechnet; bei ihrer Berücksichtigung liegt der Anteil des Fremdwährungsgeschäft auf dem britischen Finanzmarkt noch deutlich höher, da deren Kontraktwährung überwiegend Euro und Dollar sind; rund 80 Prozent der Derivatgeschäfte lauten auf fremde Währung (Bank of England, Bankstats).
[3] Von der anderen
Hälfte des Einsatzes der staatlichen Gewalt zur
Modernisierung des Standorts – der Zerschlagung der
Gewerkschaftsmacht und Herstellung einer billigen und
flexiblen Arbeiterklasse – ist hier nicht die Rede.
Nachzulesen ist darüber in einer früheren Ausgabe
dieser Zeitschrift unter dem Titel: Großbritannien,
der Pionier moderner Sozialreformen – Lehrstück über
das Patentrezept, Lohn und Sozialhaushalt als Waffe in
der Standortkonkurrenz in Anschlag zu bringen
(GegenStandpunkt 1-05).
[4] Durch ausländische Kapitalinvestitionen ist Großbritannien wieder der viertgrößte europäische Auto-Produktionsstandort: die US-Konzerne General Motors und Ford ebenso wie die japanischen Multis haben Fabriken auf der Insel, die deutschen Automobilunternehmen BMW (Mini und Rolls-Royce Motor Cars) und VW (Bentley) sowie der indische Tata-Konzern (Jaguar und Land Rover) haben ehemals britische Hersteller übernommen. In anderen Branchen sind britische Unternehmen zu „global players“ gewachsen: u.a. Vodafone (Telekommunikation), BAE Systems und Rolls-Royce (Rüstung und Luftfahrt), GlaxoSmithKline und AstraZeneca (Pharma), BP und Shell (Öl).
[5] Noch Ende der 60er Jahre beträgt der Umfang des Pfund Sterling an den staatlichen Devisenreserven aller Länder 20 Prozent. In den 70er Jahren sinken die absoluten Größen deutlich und der relative Anteil pendelt sich in der Folge zwischen ein bis drei Prozent ein; die Bedeutung des Pfund Sterling für das Weltgeschäft schwindet. 1976 erleidet die Nation eine Zahlungsbilanzkrise und ist zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit auf einen großen IWF-Hilfskredit angewiesen. Das Pfund Sterling verliert bis in die 80er Jahre hinein deutlich an Wert gegenüber dem Dollar und der Deutschen Mark. Die britische Ökonomie bringt in dieser Zeit zudem zweistellige Inflationsraten zustande, die weit über denen ihrer maßgeblichen Konkurrenten liegen.
[6] Einer der
auffälligsten Trends in der Periode zwischen 1962 und
1979 … war der starke Anstieg der Vermögenspositionen
in fremder Währung bei heimischen und ausländischen
Banken mit Sitz im Vereinigten Königreich. 1979 hielten
Geld- und Finanzinstitutionen Vermögenswerte in fremder
Währung in Höhe von 172 Mrd. Pfund Sterling – mehr als
die Hälfte ihrer gesamten Vermögenspositionen.
(The Evolution of the UK Banking
System, in: Quarterly Bulletin Q4, 2010, S. 322)
[7] 1986 war das
Kredit-Handelsvolumen in London ein Dreizehntel von New
York und ein Fünftel von Tokio. Frankfurt und Paris
entwickelten sich zu ernsthaften Alternativen, und
London erschien muffig und alt. Es war Zeit für Wandel.
Die Regierung von Margaret Thatcher beschloss den
Financial Services Act von 1986, der gegenüber der City
vier Prinzipien verfolgte: 1. Internationalisierung,
die ausländischen Finanzunternehmen gestattet, auf dem
Londoner Finanzmarkt zu konkurrieren; 2. Deregulierung
der festen Kommissionssätze für Aktienhändler; 3.
Erlaubnis des Eigenhandels, um die Trennung von Brokern
und Jobbern zu beseitigen; 4. Öffnung des Eigentums an
den Unternehmen der Londoner Börse für Outsider, um
Übernahmen und Fusionen zu ermöglichen… Der Financial
Services Act zielte in erster Linie auf die Förderung
des Wettbewerbs im Börsenhandel …, aber er beseitigte
auch die Zuständigkeit der Gerichte für den
Derivatehandel, der als spekulativ und damit durch den
Gaming Act von 1845 als ‚Wettspiel‘ verboten war… Dies
war die schnellste und umfassendste regulative Reform
eines Marktes und das überzeugendste Beispiel einer
Deregulierung, die zum Vorteil der heimischen
Finanzindustrie entworfen wurde.
(http://thefinanser.co.uk/fsclub/2011/12/)
[8] Dabei handelt es sich um historische Besonderheiten des Börsengeschäfts in der City: „Broker waren Makler, die lediglich Kundenaufträge ausführten und selbst keine Aktien erwerben durften. Jobber hingegen durften als Großhändler Wertpapiere halten. Jedoch war es Jobbern nur gestattet, mit anderen Jobbern oder mit Brokern Transaktionen abzuschließen, nicht aber mit der Allgemeinheit. Mit dem Erstarken der institutionellen Investoren am Finanzplatz London nahm die Kritik am Single Capacity Trading zu: Die Jobber-Firmen waren unzureichend mit Kapital und Wertpapierbeständen ausgestattet und konnten so die Nachfrage der institutionellen Investoren nach großen Aktienblöcken nicht befriedigen. Zahlreiche Fusionen unter den Jobber-Firmen folgten, die ein Oligopol entstehen ließen, welches einen effektiven Wettbewerb verhinderte. Die Broker sorgten mit ihren Mindestmargen, die im Vergleich zu andren Börsen als überhöht galten, für Unmut am Londoner Finanzplatz. Das Single Capacity Trading wurde somit nicht mehr den Bedürfnissen der Finanzplatzakteure gerecht und galt zunehmend als monopolistische Praktik der Londoner Börse… Gegen den Widerstand der Börsenhändler wurde die Trennung zwischen Jobbern und Brokern aufgehoben, die festen Kommissionssätze abgeschafft und die Mitgliedschaft in der LSE (London Stock Exchange) für in- und ausländische Finanzinstitute geöffnet.“ (Frach, a.a.O. S. 40f)
[9] Die Politik der
USA in den späten 60er Jahren beruhte beträchtlich auf
Rüstungsausgaben, im Besonderen darauf, den
Vietnamkrieg durch das Drucken von Dollars zu
finanzieren. Das US-Zahlungsbilanzdefizit wuchs von 1,9
Billionen Dollar 1965 auf 10,6 Billionen 1971… In
dieser Zeit errichteten die USA eine Reihe von
Kapitalverkehrsbeschränkungen, die dazu führten, dass
Dollarguthaben in Banken außerhalb der USA gehalten
wurden. 1964 führten die USA die ‘Interest Equalisation
Tax‘ ein, um Ausländer daran zu hindern, sich Geld auf
dem amerikanischen Markt zu leihen. Das ‚Foreign Credit
Restraint Program‘ von 1965 beschränkte amerikanische
Banken, an Ausländer zu verleihen. Schließlich verbot
das ‚Foreign Investment Program‘ von 1968
US-Unternehmen, mit heimischen Dollars ihre
Auslandsinvestitionen zu finanzieren. Diese Maßnahmen
begünstigten die Entstehung eines Offshore-Marktes für
Dollar, der als Eurodollarmarkt bekannt wurde… Die
Überschüsse der Ölförderstaaten und die kurzfristigen
Depositen multinationaler Unternehmen befeuerten die
Entwicklung des Eurodollarmarktes… In den 70ern wuchs
er jährlich um 25 %, zwischen 1971 und 1984 von 85 Mrd.
auf 2200 Mrd. Dollar. 1988 betrug das Volumen des
Eurodollarmarktes 4 Billionen Dollar, das den
heimischen Depositenmarkt in den USA um 1 Billion
Dollar übertraf.
(Patel,
Hitesh: The Historical Development of the Euro Dollar
Market, http://www.amazines.com/article) Neben
den regulativen Beschränkungen der USA für den freien
Gebrauch des Dollar sind es die politischen
Befürchtungen der ausländischen Dollarbesitzer, die zum
Wachstum des Eurodollarmarktes beitragen: Der
politische Faktor, der das frühe Wachstum des
Eurodollarmarktes beförderte, war ein überraschender –
der Kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR. Die
Sowjets fürchteten, die USA könnten die Dollars
konfiszieren, die sie in amerikanische Banken deponiert
hatten. Deshalb wurden sowjetische Dollars in
europäischen Banken angelegt, die den Vorteil hatten,
außerhalb der Jurisdiktion Amerikas zu sein… Arabische
OPEC-Mitglieder akkumulierten riesigen Reichtum im
Gefolge der Ölschocks 1973-1974 und 1979-1980, wollten
aber ihre Gelder wegen der Gefahr möglicher
Konfiszierung nicht in amerikanischen Banken
deponieren. Stattdessen legten sie es bei Eurobanken
an.
(Krugman/Obstfeld:
International Economics, Boston 2009, S. 601f)
[10] Das liberale
Aufsichtsregime (light touch regulation
) in
Großbritannien „überzeugt“ auch weiterhin viele
Aktiengesellschaften und Investoren insbesondere aus
Schwellenländern wie Russland oder den nah- und
mittelöstlichen Ölstaaten, den Finanzplatz New York zu
verlassen und in London an die Börse zu gehen oder dort
ihr Funds Management betreiben zu lassen. Zumal der
amerikanische Staat seinen Teil zum Standortwechsel
beiträgt: mit einer verschärften Börsengesetzgebung
(Sarbanes-Oxley Act von 2002), deren strenge und damit
teure Bedingungen viele internationale
Aktiengesellschaften nicht erfüllen können oder wollen,
und mit seinem weltweiten „War on Terror“ und der
„Festungsmentalität“ zuhause, die ausländisches Kapital
diskriminiert und in seiner Freiheit auf dem US-Markt
beschränkt.
[11] So wird zum
Beispiel die Masse der deutschen Staatsschuldtitel in
der City gehandelt: London bleibt das Zentrum des
Handels mit Bundesanleihen. Denn dort dürften im
vergangenen Jahr mehr als 3 Billionen Euro oder 57
Prozent umgesetzt worden sein.
(FAZ, 3.05.2013)
[12] Nach der
Attraktion eines Großteils des internationalen
Finanzgeschäfts mit Dollar und Euro kämpft die
britische Regierung jetzt darum, den Handel mit dem
zukünftigen chinesischen Weltgeld in die City zu holen:
Die Londoner City positioniert sich als zweites
großes Zentrum nach Hongkong für den Devisenhandel der
chinesischen Offshore-Währung Renminbi. Zwei
chinesische Banken haben sich in der Londoner City um
die Bank von England niedergelassen, um in Kürze dort
den Devisenhandel in Renminbi aufzunehmen… Das
britische Schatzamt hat zehn Banken und einige
Unternehmen eingeladen, um die Ausweitung des Handels
mit Renminbi in London zu forcieren. Zu dem Kreis
gehören die Bank of China, Barclays, Citi, die China
Construction Bank (CCB), die Deutsche Bank, HSBC, die
Industrial and Commercial Bank of China, JP Morgan, RBS
und Standard Chartered Bank. Auch Vertreter der
Finanzabteilungen großer deutscher Konzerne werden
teilnehmen… Diese Woche hat die erste chinesische Bank,
die CCB, in London eine in Renminbi denominierte
Anleihe, eine sogenannte Dim-Sum-Anleihe, von
umgerechnet 100 Millionen Pfund aufgelegt.
(FAZ, 1.12.2012)
[13] Seit dem Big
Bang waren ausländische Investitionen in
Mitgliedsfirmen zugelassen, was zu zahlreichen
Zusammenschlüssen der Jobber-Firmen mit finanzstarken,
oft ausländischen Finanzinstituten führte. Der Big Bang
erhöhte die Attraktivität des Londoner Finanzplatzes
für Pensionsfonds und andere institutionelle
Investoren. Große Wertpapierfirmen aus den USA und
Japan verstärkten ihre Präsenz in London.
(Frach, a.a.0., S. 40f)
Seitdem gehören immer mehr ausländische Finanzinstitute
zu den maßgeblichen Akteuren; neben den entstehenden
vier britischen Großbanken dominieren internationale
Banken wie Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America,
Nomura, Deutsche Bank, UBS und die US-Investmentbanken
Lehman Brothers (bis zu ihrem Crash in der
Finanzkrise), J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs und
Morgan Stanley, die Finanzgeschäfte der City. Die
heimischen und ausländischen Banken, die sich seit dem
„Big Bang“ in die Börsenhandlungskapitale einkaufen
(1986 erwerben Londoner Merchant-Banken Anteile an elf
Broker- und drei Jobber-Firmen; 65 ausländische
Finanzinstitute kaufen 90 Broker- und 15 Jobberfirmen),
erwerben damit den ihnen bisher verschlossenen Zugang
zu einem finanzkapitalistischen Geschäftszweig, den sie
in der Folge mit zuschüssigem Kapital aufmotzen, den
neusten Standards elektronischen Handels unterwerfen
und so für die eigene Offensive in Sachen
‚market-making‘ und Eigenhandel präparieren. Das lässt
die Börsenumsätze explodieren: Eine Hauptwirkung war
eine Welle neuer Technologie. Die London Stock Exchange
wandelte sich schlagartig vom Parketthandel zu einem
vollständig automatisierten System (program trading).
Das führte zu ‚algorithmic trading‘ und heutigen Tags
zum ‚high frequency trading‘. Zusammen mit längeren
Handelszeiten um zweieinhalb Stunden morgens und zwei
Stunden abends stieg das Handelsvolumen 1986 rasant um
72 % und 1987 um 57 %. Der Big Bang ermöglichte, dass
London der Wall Street beim automatisierten
Börsenhandel mit immer komplexeren Instrumenten folgte
– den als ‚exotics‘ bezeichneten neuen derivativen
Produkten; seit den frühen 2000-er Jahren ist die City
darin führend.
(http://thefinanser.co.uk/fsclub/2011/12)
[14] Das
Privatkundengeschäft im Vereinigten Königreich ist
höchst konzentriert: Von den 16 Clearingbanken aus den
60er Jahren, gehören heute 15 den vier großen UK
Bankengruppen: RBS, Barclays, HSBC und LBG. Diese
Banken vereinen zusammen mit Nationwide (Bausparkasse)
und Santander fast 80 % des privaten Kreditgeschäfts im
Vereinigten Königreich auf sich… Im Zuge ihres
Wachstums haben die Clearingbanken ihr Geschäftsfeld
ausgeweitet. Die größten Banken sind genuin
‚universale‘ Banken geworden, deren Aktivitäten die
Produktion von Wertpapieren und den Handel mit ihnen,
das Fonds Management, den Derivatehandel sowie das
Versicherungsgeschäft umfassen. Die Expansion dieser
Banken fiel zusammen mit dem signifikanten Wachstum der
Wertpapiermärkte sowie der Märkte für Devisen und für
Derivate.
(The Evolution of
the UK Banking System, a.a.O., S. 323f)
[15] Die
Entwicklung von Universalbanken spiegelt sich in der
Zunahme der Gewinne der Banken, die nicht aus dem
Leihgeschäft stammen. Heute tragen die Einnahmen, die
nicht aus Zinsen resultieren (non-interest income),
mehr als 60 Prozent zu den Bankverdiensten bei, während
sie vor drei Jahrzehnten nur einen sehr kleinen Anteil
ausmachten.
(The Evolution of
the UK Banking System, a.a.O., S. 324)
[16] Das englische Wirtschaftsmagazin The Economist vom 7.01.2012 berichtet in seinem Briefing über die dominierende Position der Finanzindustrie der City in dieser Sphäre des spekulativen Geschäfts: Londons globaler Marktanteil beträgt bei den Over-the-Counter-Derivatives 46 %, bei Hedge Fund Assets 19 % und bei Private Equity Funds 21 %.
[17] Finanzhandel
erzeugt Liquidität, die wiederum mehr Finanzgeschäft
attrahiert – in einem wirkungsvollen Zirkel.
(The Economist, London as a
financial centre, 22.12.2011) Bei einem
internationalen Finanzzentrum zählt Größe: Je größer
der Markt, umso leichter findet man die Anlage, die man
will, umso breiter ist das Angebot, umso größer die
Aufträge, und umso niedriger die Kosten pro Order. Die
größten Märkte ziehen die meisten Kunden an. Das Ganze
verewigt sich selbst. Es ist unwahrscheinlich, dass
London, New York und Tokyo in dem nächsten oder den
nächsten beiden Jahrzehnten Konkurrenz bekommen – und
wenn, dann wird es China sein.
(Stoakes; a.a.O., S. 14)
[18] Der
Exportüberschuss bei Finanzdienstleistungen und
Versicherungen betrug 2,6 % des Bruttoinlandsprodukts
in den ersten drei Quartalen 2011. Zählt man noch die
Exporte verwandter Leistungen wie juristische Dienste,
Buchführung und Beratung dazu, steigt der
Handelsüberschuss auf 3 % des BIP. Ein
Industriecluster, das Auslandseinnahmen in solcher
Größenordnung generiert, ist beneidenswert. Kein
anderes Land, noch nicht einmal Amerika, erreicht
annähernd Großbritanniens Handelsbilanz bei
Finanzdienstleistungen.
(The
Economist, Briefing: Britain‘s Financial Industry,
7.01.2012)
[19] Zur Illustration die Verhältnisse der Weltgelder: Der Anteil des Pfund Sterling an den globalen Währungstransaktionen beträgt 12,9 %, verglichen mit Dollar 84,9 %, Euro 39,1 % und Yen 19 % (2010); sein Anteil an den von den Notenbanken gehaltenen Devisenreserven ist 3,8 %, verglichen mit 0,1 % Schweizer Franken, 3,4 % Yen, 25,1 % Euro und 61,9 % Dollar (2011).
[20] Die Staatsschuld
explodiert im Zeitraum von nur zwei Jahren nach
Ausbruch der Finanzkrise von 60 % auf über 80 % des
Bruttoinlandsprodukts. Das ist die Quittung, die der
Crash dem Staat für sein Projekt präsentiert, sich
einen Finanzsektor der Extraklasse gezüchtet zu haben,
dessen Bilanzen mehr als fünfmal so groß wie das
jährliche Einkommen seiner gesamten Nationalökonomie
sind: Die Bilanzen der Banken im Vereinigten
Königreich betragen heute mehr als 500 % des jährlichen
Bruttoinlandsprodukts, wobei ein Großteil dieses
Wachstums in der letzten Dekade erfolgte. Drei der vier
größten Banken haben jede für sich Vermögenswerte, die
das jährliche Bruttoinlandsprodukt übertreffen. In
Relation zu der Größe der nationalen Wirtschaft ist das
Bankensystem des Vereinigten Königreich das zweitgrößte
unter den G20-Staaten direkt nach der Schweiz; und es
ist in Relation mehr als fünfmal so groß wie das
US-Bankensystem.
(The
Evolution of the UK Banking System, a.a.O., S.
324)Garantiert wird die Staatsschuld durch die
Bank of England, die mittlerweile 30 % aller
Staatsschuldtitel im Wert von 375 Milliarden Pfund
Sterling hält (The Economist, 14.07.2012).
[21] Die auf dem
Höhepunkt der Finanzkrise von der US Notenbank Fed
auswärtigen Notenbanken eingeräumten Reciprocal
Currency Arrangements
ermöglichen sogenannte Swaps,
um die Dollarklemme in auswärtigen Märkten zu
bekämpfen: Der unmittelbare Zweck der Swaps zielte
auf die Spannungen in den Märkten, die sich mit Dollars
finanzieren… Im Prinzip hätten die auswärtigen
Notenbanken die Banken unter ihrer Jurisdiktion mit
Dollars versorgen können, ohne dafür die Fed zu
bemühen. Sie hätten Dollars aus ihren Devisenreserven
verwenden können oder auf dem offenen Markt erwerben
können. Allerdings waren deren Devisenreserven beim
Ausbruch der Krise kleiner als die Summen, die sie sich
nach der Einräumung der Swap-Kreditlinien liehen, so
dass ihre Reserven nicht ausreichend gewesen wären.
Oder, wenn die auswärtigen Notenbanken gezwungen
gewesen wären, ihre eigenen Währungen auf dem offenen
Markt zu verkaufen, um dort Dollars zu kaufen, dann
hätte eben diese Währungstransaktion die privaten
Währungsgeschäfte verdrängt und es den privaten Banken
erst recht schwer gemacht, an die nötigen Dollars zu
kommen.…Die Swaps beinhalteten zwei Transaktionen. Zu
Beginn verkaufte die auswärtige Notenbank eine
definierte Menge ihrer Währung an die Fed im Tausch
gegen Dollar zum aktuellen Wechselkurs. Zeitgleich
vereinbarten Fed und auswärtige Notenbank die
Verpflichtung, ihre Währung an einem zukünftigen Termin
zu demselben Wechselkurs zurückzukaufen… Bei der
Beendigung des Swaps zahlte die auswärtige Notenbank
der Fed einen Zinsbetrag, der den Zinsen entsprach, die
die Notenbanken mit ihren Dollarverleihungen an die
Banken verdient hatten. Im Dezember 2010 waren die
laufenden Swaps auf über 580 Mrd. Dollar gestiegen, was
über 25 % der Vermögenswerte der Fed entsprach.
(The Federal Reserve’s Foreign
Exchange Swap Lines; in: Current Issues in Economics
and Finance, 4/2010, S. 2ff) Als die Bank of
England im September 2008 die Swap-Linie der Fed in
Anspruch nimmt, verfügt sie über Devisenreserven von 6
Mrd. Dollar. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität in
den heimischen Märkten, die sich mit Dollars
(re)finanzieren, sind ganz andere Summen nötig: die BoE
muss sich 86 Mrd. Dollar von der amerikanischen
Notenbank leihen. Zu Beginn 2010 entspannt sich die
Dollarklemme und das Swap-Geschäft wird gegen
Überweisung von bei der Bank of England verbuchten
Zinsen an die amerikanische Notenbank beendet. (The
Bank‘s Balance Sheet; in: Quarterly Bulletin Q1/2010,
S. 38)
[22] Schon im Dezember 2007 tätigt die Europäische Zentralbank eine entsprechende Swap-Vereinbarung mit der US-Notenbank Fed zur Sicherung der Dollarliquidität in der Eurozone in der Größenordnung von 320 Mrd. Dollar, die ebenfalls Anfang 2010 beendet wird.
[23] Der Verkauf
britischer Waren leidet nicht nur unter dem knappen
heimischen Kredit, sondern auch unter der Kontraktion
der Zahlungsfähigkeit auf dem Kontinent.
Staatsschuldenkrise und Austeritätspolitik der
Eurostaaten tragen ihren Teil bei zum Einbruch der
„Realwirtschaft“ auf den britischen Inseln: Die
Weltwirtschaft, besonders die Eurozone, war in den
vergangenen zwei Jahren viel schwächer als erwartet.
Wenn einige unserer großen Handelspartner wie Irland,
Spanien und Italien leiden, kaufen sie weniger von uns.
Das schädigt unser Wachstum und macht es schwerer,
unsere Schulden loszuwerden.
(David Cameron, Parteitagsrede,
10.10.2012)
[24] Die
beängstigendste Gefahr für den Londoner Finanzdistrikt
geht von den vielen neuen Regelungen aus, die Brüssel
entwirft. Viele dieser Regelungen schädigen das
Finanzkapital in ganz Europa, nicht nur in der City;
aber weil die City das Zentrum ist, wird sie am meisten
leiden. Am schädlichsten ist die vorgeschlagene
Finanztransaktionssteuer, mit der die EU 55 Mrd. €
einnehmen will, wovon 60-70 % in Großbritannien
eingesammelt würden… Selbst die Europäische Kommission
geht bei ihrer Folgenabschätzung davon aus, dass
dadurch 90 % von manchen Finanztransaktionsgeschäften
schlicht aus der EU wegverlagert würden, mit dem
Verlust von mehreren Hunderttausend Arbeitsplätzen.
Eine andere europäische Bedrohung für London kommt von
Vorschlägen, Clearinghäuser, die auf Euro denominierte
Derivate abrechnen, zu verpflichten, ihr Geschäft in
einem Land zu betreiben, das den Euro als Währung hat.
Zusammen mit der Regel, die den Handel mit
Over-the-Counter-Derivaten auf Clearinghäuser und
Börsen festlegt, würde diese Regulierung einen Markt,
den Großbritannien dominiert, bedrohen, zum Vorteil von
Paris oder Frankfurt.
(The
Economist, Briefing: Britain’s Financial Industry,
7.01.2012) Deutschland und zehn weitere
EU-Staaten wollen die Steuer auf Umsätze mit
Finanzprodukten möglichst bald einführen. Um ein
Ausweichen auf andere Handelsplätze zu verhindern, die
diese Steuer nicht kennen (was bisher die Regel ist),
will man die Steuerpflicht extrem weit ausgestalten. So
sollen alle Produkte besteuert werden, die einen
eindeutigen Bezug zu einem teilnehmenden Staat haben,
unabhängig davon, wo sie gehandelt werden. Wenn eine
deutsche Aktie oder eine Option auf diese in London
gehandelt würde, müssten die Briten diese Steuer
erheben und das Aufkommen weiterleiten
(FAZ, 22.04.2013) Frankreichs
Notenbankchef und EZB-Direktoriumsmitglied Noyer
verlangt, der City überhaupt den Großteil
ihres Eurogeschäfts wegzunehmen: „Wenn
Großbritannien der Gemeinschaftswährung schon nicht
beitrete, solle London auch nicht mehr der führende
Handelsplatz für Euro-Finanzgeschäfte sein. ‚Wir sind
nicht dagegen, dass Geschäfte in London getätigt
werden, aber der Großteil der Geschäfte sollte unter
unserer Kontrolle sein‘, ergänzte der wichtige
Eurobanker im Gespräch mit der Financial
Times. Das sei eine Konsequenz aus der
britischen Entscheidung, außerhalb der Währungsunion zu
bleiben.“ (SZ, 3.12.2012)
[25] Die britische
Regierung hat beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen
die geplante Finanztransaktionssteuer eingelegt. Sie
befürchtet negative Auswirkungen auf den Finanzplatz
London, wie Schatzkanzler George Osborne
berichtete…Frankreichs Finanzminister Moscovici
betonte: ‚Wir werden unsere Vorbereitungen nicht
einstellen oder verlangsamen.‘… Der britische
Unternehmerverband CBI unterstützte die Regierung in
London und erklärte, die Steuer würde über die
teilnehmenden Länder hinaus Wirkung entfalten und
Wachstum, Beschäftigung und Investitionen in
Großbritannien beschädigen.
(FAZ, 22.04.2013)
[26] Das Finanzkapital hat Großbritanniens Abhängigkeit von den Fortschritten der Euro-Zone in Richtung Fiskalpakt und Bankenunion und Beschädigung durch sie als Datum auch entsprechend gewürdigt und den Staat für minder kreditwürdig eingestuft. Die Ratingagenturen haben ihm seine Rating-Höchstnote entzogen.
[27] Die Regierung aus
Konservativen und Liberalen setzt seit 2010 ein
drastisches Sparprogramm durch: Ihr Emergency
Budget
umfasst die Erhöhung der Mehrwertsteuer von
17,5 % auf 20 %, die Entlassung von einer halben
Million Angestellten im öffentlichen Dienst und das
Einfrieren der Löhne der Staatsangestellten, die
Erhöhung der Beiträge und die Senkung der Auszahlungen
in der Rentenversicherung sowie die vorgezogene
Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre, einschneidende
Reduzierungen der sozialstaatlichen Leistung für
Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Behinderte, die
Senkung der staatlichen Ausgaben für Bildung sowie die
Verdreifachung der Studiengebühren auf 9000 £ im Jahr.
Selbst die Streitkräfte müssen an Personal und
Militärgerät sparen. Die Regierung lässt sich weder
durch die Proteste der Gewerkschaften noch durch die
von der Labour-Opposition angeprangerten
kontraproduktiven Wirkungen ihrer Austeritätspolitik
auf das Wachstum beirren. Sie betrachtet ihr
Sparprogramm als „alternativlos“- für die
Kreditwürdigkeit des Landes vor dem spekulativen Urteil
des internationalen Finanzkapitals. Das würdigt zwar
den entschlossenen Willen des britischen
Staates zur Haushaltssanierung, traut ihm aber
angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise und
stagnierender Steuereinnahmen die Fähigkeit
nicht mehr zu, seinen gewaltigen Schuldenberg wie
geplant abzutragen – auch das einer der Gründe, ihm
erstmals die Rating-Höchstnote zu entziehen.
[28] Großbritannien ist bei aller Schrumpfung seiner Fertigungsbasis noch immer die sechstgrößte Industrie- und Handelsnation, die von ihren Exporten rund 40 Prozent im europäischen Binnenmarkt absetzt.
[29] Seine Ausmischung
aus den Angelegenheiten der Eurozone wird dem
britischen Regierungschef von seinem französischen
Kollegen unverblümt mitgeteilt: Sie haben eine gute
Gelegenheit verpasst, den Mund zu halten. Wir haben es
satt, dass Sie uns ständig kritisieren und sagen, was
wir tun sollen. Sie sagen, Sie hassen den Euro, und
jetzt mischen Sie sich in unsere Sitzungen ein.
(Der damalige Staatspräsident
Sarkozy an Premierminister Cameron auf dem Eurogipfel
im Dezember 2011)
[30] Um zukünftigen
Souveränitätsabtretungen einen Riegel vorzuschieben,
hat die Regierung 2011 ein Referendum Lock
gesetzlich verabschiedet. Diese Sperre
schreibt
ab sofort eine Volksabstimmung bei jeder Übertragung
von Befugnissen von Westminster nach Brüssel
verbindlich vor. (The Economist, 23.06.2012) Bei den
Rechten, die Westminster in der Vergangenheit schon an
Brüssel abgegeben hat, startet die Regierung eine
großangelegte Rückrufaktion: Mit dem ‚Review of the
Balance of Competences‘ will die Londoner Regierung
(angeblich ergebnisoffen) durchforsten, welche
Zuständigkeiten weiterhin nach Brüssel gehören und
welche man wieder auf der nationalen Ebene sehen
möchte… Der beabsichtigte – und bereits angekündigte –
Ausstieg aus der innen- und justizpolitischen
Zusammenarbeit gilt als Sonderfall, weil der Vertrag
von Lissabon den Briten dieses Recht zugesteht. Auf
allen anderen Gebieten ist dergleichen nicht geregelt.
London müsste also einen schwierigen
Verhandlungsprozess beginnen, von dem es heißt, er
werde in Brüssel auf ‚wenig Sympathie‘ stoßen. Je
magerer das Ergebnis dieser ‚Neuverhandlungen‘
ausfalle, desto größer sei die Gefahr, dass sich die
Briten von der EU abwendeten… Am Ende führe dann kein
Weg mehr an einem ‚In/Out-Referendum‘ vorbei, das heute
noch zu Gunsten der EU ausgehen würde, in einigen
Jahren aber wohl zu ihren Ungunsten.
(FAZ, 06.11.2012)
[31] Im Februar
vergangenen Jahres stellten sich Abgeordnete aus
Camerons Partei erstmals offen gegen ihren Anführer,
indem sie (vergeblich) in einem Änderungsantrag im
Unterhaus eine Volksabstimmung über den EU-Austritt
verlangten. Später gründeten EU-Gegner und -Skeptiker
eine eigene Gruppierung innerhalb der konservativen
Parlamentsfraktion; sie zählte bald mehr als 100
Abgeordnete. Und im vergangenen Oktober, nach einer
EU-Austrittsdebatte im Parlament, die durch ein
Volksbegehren erzwungen wurde (mit 100 000
Unterschriften), demonstrierten die Antieuropäer einen
machtvollen Aufstand: 81 Abgeordnete in der
konservativen Fraktion stimmten damals für die
Forderung, sofort eine Volksabstimmung über den
EU-Austritt abzuhalten – und stellten sich damit offen
gegen ihren Premierminister.
(FAZ, 04.07.2012)
[32] Bei Nationalisten
vom Schlage der Euroskeptiker verfängt auch die Warnung
der Obama-Administration nicht, mit einem Ausstieg aus
Europa verliere die special relationship
zwischen beiden Ländern ihren Wert für die Weltmacht –
eine Warnung, die der konservativ-liberalen Regierung
zu denken gibt, ob der Rückgewinn an Souveränität den
Verlust an weltpolitischem Einfluss wettmacht, den ein
Großbritannien ohne seine Sonderstellung bei den USA
erleidet.
[33] „Eine am
Sonntag in der Zeitung The Observer
veröffentlichte repräsentative Umfrage ergab, dass
bei einem Referendum eine Mehrheit der Briten gegen
einen Verbleib ihres Landes in der Europäischen Union
stimmen würde. Demnach würden 34 Prozent auf jeden Fall
für einen Austritt stimmen und 22 wahrscheinlich. Nur
elf Prozent wären dagegen mit Sicherheit für den
Verbleib im Staatenbund, 19 Prozent vermutlich. 14
Prozent der Befragten waren unschlüssig. Bei den
Wählern von Camerons Konservativer Partei war der
Anteil der Austrittsbefürworter mit 68 Prozent am
höchsten, gefolgt von denen der oppositionellen
Labour-Partei mit 44 Prozent und denen der an der
Regierung beteiligten Liberaldemokraten mit 39
Prozent.“ (SZ, 19.11.2012)Die oppositionelle
Labour Party trägt ihren Teil bei zur euroskeptischen
Wählerschaft. Zwar ist ihr Führer gegen das
angekündigte Referendum, weil es Jahre der
Unsicherheit und große Risiken für die Wirtschaft
bringt
(Ed Miliband, BBC,
23.01.2013); aber er steht dem konservativen
Premier in nichts nach, wenn es um Stimmungsmache für
die Behauptung der „nationalen Interessen“ gegen die
aufgeblähte und unfähige Bürokratie in Brüssel und die
viel zu großen Beitragszahlungen zum EU-Haushalt geht:
Bei der Abstimmung zu Camerons Verhandlungslinie im
Brüsseler Haushaltspoker hat Labour-Chef Ed Miliband
den Regierungschef in der vorigen Woche zum ersten Mal
auf der europakritischen Spur überholt.
(FAZ, 06.12.2012)