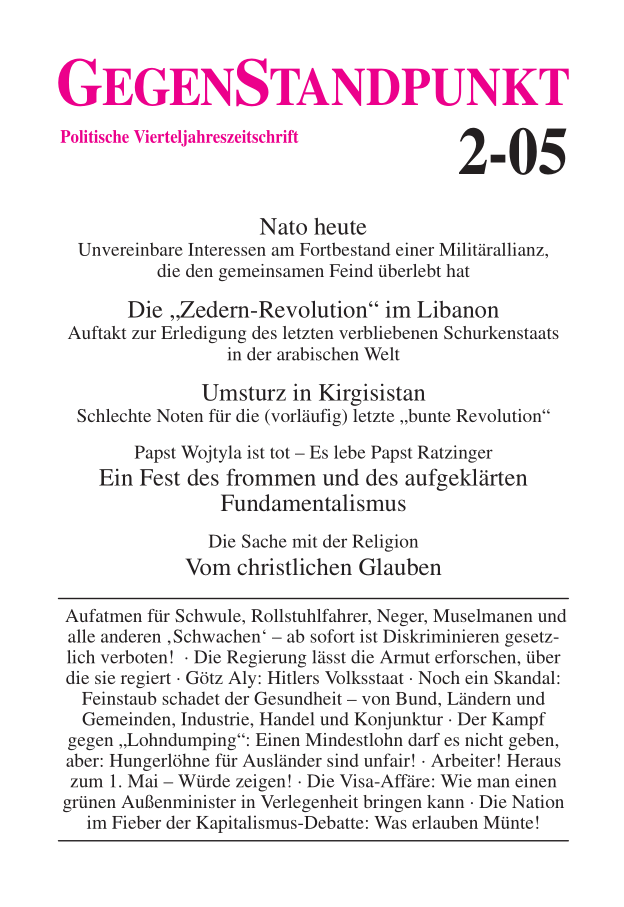Die Sache mit der Religion
Beliebt ist die Idee, das menschliche Leben wäre selber ein abgründiger Widerspruch zwischen einem Erdendasein, in dem „letztlich“ kein wirklicher frei gesetzter Lebenszweck aufgehen kann, vielmehr Unberechenbarkeit und Ungerechtigkeit walten, und einem tieferen, zwar verborgenen, dafür ganz unverwüstlichen Sinn: einem ‚Wozu‘ von so absoluter Gültigkeit, dass Verstand und Realität davor glatt kapitulieren müssen, der Mensch aber glücklich und zufrieden sein kann.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Die Sache mit der Religion
Zwei Jahrhunderte nach einer historischen Episode namens ‚Aufklärung‘ steht eine Geisteshaltung namens ‚Religion‘ hoch im Kurs. An ein ‚Jenseits‘ zu glauben, gilt mitten in der allermodernsten ‚Wissensgesellschaft‘ keineswegs als Schande. Rechtfertigen muss sich eher, wer allen Ernstes ‚gar nichts‘ ist, weder Christ noch Moslem und noch nicht einmal in seinem tiefsten Innern ‚irgendwie‘ für irgendwas Transzendentes zu haben.
Dabei ist es wirklich nicht mehr so wie in den ganz alten Zeiten, als praktisch alle Welt davon ausging, dass Wetter und Krankheiten von himmlischen oder höllischen Geistern gemacht werden, dass hinter jedem größeren Stern ein Gott oder gleich überm Sternenzelt ein ew’ger Vater wohnt, der die – deswegen so genannten – Geschicke der Menschen lenkt, und dass es fürs gemeinschaftliche Überleben und das individuelle Lebensglück entscheidend darauf ankommt, wessen Stammes Gottheit die stärkste ist oder dass man im eschatologischen Endkampf die richtige Partei erwischt. Dass alles, was in der Natur passiert, Ursachen hat, die die Naturwissenschaft ganz ordentlich erklärt und die moderne Technik für menschliche Zwecke auszunutzen versteht, ist auch Leuten vertraut, die kein „Naturgesetz“ hersagen könnten. Und was die Menschenwelt im engeren Sinn betrifft, so ist auch da allgemein geläufig, dass die meist ohnehin ziemlich stereotypen „Schicksale“ mehr mit den Konjunkturen so rätselhafter, aber gar nicht metaphysischer Sachen wie eines „Arbeitsmarktes“ und die herrschenden Lebensbedingungen mehr mit Lebenshaltungskosten zu tun haben als mit den Verfügungen eines Weltenlenkers, der gutes Benehmen mit einem wachsenden Bruttosozialprodukt belohnt oder als Prüfung für die Seinen eine Absatzstockung, einen Krieg oder eine neue Sozialgesetzgebung schickt. Dem religiösen Bewusstsein scheint das aber nicht allzu viel ausgemacht zu haben. Dessen Besitzer haben immer noch ein paar Warum-Fragen in petto – meist solche nach dem Muster: ‚Warum nur…?‘, ‚Warum gerade ich …?‘, wenn’s ganz dick kommt auch die große Unsinnsfrage, die erst irgendwie alles auf einem Haufen denkt, um sich dann nach der Beschaffenheit eines doch irgendwie davon getrennt existierenden Grundes zu erkundigen: ‚Warum existiert überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?‘ –, mit deren Hilfe sie sich der Unerklärbarkeit des Daseins versichern und damit die Leerstelle für ihre Irrationalismen schaffen, jenes „Refugium der Unwissenheit“, als welches ein paar schlaue Denker den Gottesglauben schon vor Jahrhunderten durchschaut haben. Und vor allem verfügen sie über die eine ganz große Frage, die eigentlich keine ehrliche Frage ist, sondern das verkehrte, aber unverwüstliche Bedürfnis nach einer garantiert rundum zufrieden stellenden Antwort artikuliert: Wozu das alles?
Denn so viel ist klar: Mit der Auskunft: Du bist auf Erden, um das Kapital deiner Firma, die Einkünfte des Einzelhandels und die Macht deiner politischen Herrschaft zu mehren!
wäre diese Frage, die so manchen Zeitgenossen umtreibt, zwar sachlich richtig und in den meisten Fällen auch ziemlich erschöpfend beantwortet; zufrieden wäre damit aber weder ein Arbeitnehmer, der sich zweckmäßig benutzen lässt, solange es sich für die Firma rechnet, noch der Firmenbesitzer, auch wenn der vielleicht ziemlich stolz auf sein Lebenswerk ist, weder ein ‚Verbraucher‘, der sich gönnt, was er sich leisten kann, noch sein Kaufmann, und der durchschnittliche Steuerzahler so wenig wie sein Kanzler, obwohl der immerhin die Chance hat, mit seiner Macht über einen großen Standort in die Geschichtsbücher einzugehen. Gefordert ist ein ganz eigenes, der eigenen Persönlichkeit voll entsprechendes Weiß-Warum – aber auch wieder nicht im Sinne der einzig rationalen Antwort, die sich einem Menschen auf die Frage nach seinem subjektiven Lebensziel allenfalls geben ließe: Das musst du schon selber wissen, was du dir vornimmst!
Denn dass es mit der eigenen Lebensplanung allemal nicht weit her ist, weder, was ihre „realitätsgerechten“ Ziele, noch erst recht, was die erzielten Ergebnisse betrifft, das ist dann doch auch wieder jedem bekannt; ein ‚Wozu‘, für das sich der ganze Aufwand wirklich lohnt, ist schwerlich in Sicht und noch schwieriger zu erreichen; dazu läuft das Leben wieder viel zu „fremdbestimmt“ ab. Nur ziehen ganz viele Leute daraus nicht den praktischen Schluss, den verschiedenen, weiß Gott weder gleichartigen noch gleichgewichtigen Fremdbestimmungen, den Zwängen und Determinanten der eigenen Lebensführung und des gesellschaftlichen Lebensprozesses überhaupt theoretisch auf den Grund zu gehen, also vor allem natürliche Gegebenheiten von feindlichen Interessen und quasi sachlich vorgegebenen sozialen Zielsetzungen zu unterscheiden, um gegen letztere, gegen das eindeutige Wozu, das moderne Kapitalstandorte ihren Insassen tatsächlich aufherrschen, womöglich praktisch etwas Zielführendes zu unternehmen. Sie neigen im Gegenteil sehr dazu, ganz entschieden gar nichts auseinander zu halten und sich stattdessen ihr Dasein als eine „in letzter Instanz“ ganz grundsätzlich nicht bloß unerklärbare, sondern unverfügbare Angelegenheit vorzustellen; dies freilich ohne die tief empfundene Wozu-„Frage“, die Forderung nach einem befriedigenden inneren Ziel dieses auf kein frei gewähltes Ziel festzulegenden Daseins, aufzugeben; geschweige denn, dass sie auf die Widersprüchlichkeit und auf den schlechten kompensatorischen Gehalt dieser Forderung einen kritischen Gedanken verschwenden würden.
Viel beliebter ist jedenfalls die Idee, das menschliche Leben wäre selber ein abgründiger Widerspruch zwischen einem Erdendasein, in dem „letztlich“ kein wirklicher frei gesetzter Lebenszweck aufgehen kann, vielmehr Unberechenbarkeit und Ungerechtigkeit walten, und einem tieferen, zwar verborgenen, dafür ganz unverwüstlichen Sinn: einem ‚Wozu‘ von so absoluter Gültigkeit, dass Verstand und Realität davor glatt kapitulieren müssen, der Mensch aber glücklich und zufrieden sein kann. Allgemein geläufig ist dieser tiefe Gedanke in der Form, dass der Mensch sich sein ganzes Leben ziemlich pauschal und in höchst verschwommener Form vor sein inneres Auge stellt und mehr oder weniger erschrocken darüber das Urteil fällt: Das kann doch nicht alles – gewesen – sein!
Oft genug folgt aus dieser Entdeckung nicht mehr als eine ‚Midlife Crisis‘; und die bewältigt der moderne Bürger in der Regel so, dass er sich mal was extra leistet, sich dadurch ein Gefühl freier Selbstbestimmung verschafft – und dann wieder zur Tagesordnung übergeht. Es geht aber auch ernster. Dann werden nüchterne Zeitgenossen von einer „Grenzerfahrung“ überfallen; insbesondere von dem Gedanken, dass – wie der Psalmist sagt – das Leben ein End’ hat, und ich davon muss!
Und dann begnügen sie sich ungern mit dem Befund, dass es genau so ist – der Widerspruch, dass Menschen Lebewesen mit Verfallsdatum, zugleich aber mit einem Bewusstsein sind, so dass sie nicht umhin können, zwischen sich und der Objektwelt zu unterscheiden; dass sie daher über die Schranken ihrer unmittelbaren physischen Existenz hinaus ein ideelles und aktives Verhältnis zur Welt eingehen, das mit ihrer physischen Existenz dann aber doch sein Ende findet; dass sie also eine Vorstellung von der eigenen Endlichkeit haben: der Widerspruch ist genauso wenig aufzulösen wie die Trauer über das Verschwinden geschätzter Mitmenschen; er ist tatsächlich im Preis mit drin, nachdem die Primaten es zur Errungenschaft eines Selbstbewusstseins gebracht haben. Damit mögen Menschen sich aber partout nicht abfinden, die sich – gleichviel ob aus guten oder schlechten Gründen – mit ihrem absolvierten und absehbaren Lebenslauf nicht zufrieden geben, ebenso entschieden aber an der stark empfundenen Vorstellung eines abgrundtiefen Rechts auf Zufriedenheit mit ihrem Dasein festhalten. Da wirkt das memento mori
als kräftiger Stachel für das alberne Bedürfnis, das eigene Ende irgendwie zu überdauern.
Die Nachfrage hat sich auch in diesem Punkt längst verschiedene Angebote geschaffen. Manche, die es schon zu Lebzeiten zu öffentlichem Ansehen gebracht haben, freuen sich darauf, in ihren historischen Werken zu überleben – dass sie nichts davon haben, erleben sie dann ja nicht mehr. Andere begnügen sich notgedrungen mit der Tröstung durch das Andenken, das ihnen die lieben Nächsten bewahren – und abstrahieren ein wenig von dessen überaus kurzer Verfallsfrist. Beliebt ist der Wahn, in den eigenen Kindern weiterzuleben, irgendwie – ohne den wäre die betrüblich geringe Geburtenrate noch viel niedriger. Ein paar reiche Amis und ehrgeizige Mediziner setzen mittlerweile auch schon auf die Möglichkeit, das Gen fürs Altern zu entdecken und abzuschalten, so dass nicht mehr bloß ein paar Hela-Krebszellen in der Petri-Schale ihre Unsterblichkeit genießen, sondern ausgewachsene Krebspatienten in einer gemütlichen Intensivstation… Religiöse Menschen haben schon Recht, wenn sie das alles für lächerliche Ersatzlösungen halten. Sie lösen die tiefe „Erkenntnis“, dass jenes Leben, das ein Erdenbürger zwischen Geburt und Tod verbringt, unmöglich alles sein kann, auf jeden Fall sehr viel radikaler ein, wenn sie postulieren und sich deswegen gläubig sagen lassen, dass die wahre, endgültige, wirklich unverwüstliche Lebenszufriedenheit, die für alles entschädigt, was „das Leben“ den Menschen an Leid und Ungerechtigkeit antut, allein in der Negation alles Irdischen, „im Jenseits“, dort aber ganz sicher zu haben ist. So bringen sie die Verrücktheit des Verlangens nach totaler Kompensation auf den Punkt: Ein diesem absoluten Bedürfnis genügendes Lebensziel kann überhaupt nur ein solches sein, das nicht der endliche Erdenwurm selber sich setzt, sondern das ihm gesetzt ist; eine tiefere Bedeutung, die seinem Leben zukommt, ohne dass er selber ihr Urheber wäre; ein Daseinszweck, den eine höhere Instanz mit ihm verfolgt und dem er als treuer Knecht dient, auch wenn er ihn nicht wirklich begreift.
Denn das gehört zu einem solchen großartigen Oberzweck jenseits aller wirklichen Zwecke ganz wesentlich dazu: dass mehr als seine abstrakte Funktion, nämlich die der absoluten Befriedigung eines tief empfundenen Anrechts auf totale Entschädigung für ertragenes Leid und Wiedergutmachung erlittener Ungerechtigkeiten, nicht davon auszusagen ist. Ausmalen lässt er sich schon; Paradiese – einschließlich gerechter Höllenqualen für die Bösen – hat die fromme Menschheit sich schon viele vorgestellt. Auch solche Wunschbilder kommen aber nicht aus ohne ihr eigenes Dementi: Der ganze Reiz eines absoluten ‚Wozu‘ liegt ja gerade darin, weder erklärbar noch verfügbar zu sein; der postulierte Lebenssinn zeichnet sich dadurch aus, dass er grundsätzlich nicht fassbar ist. Deswegen besteht er für manche grüblerisch veranlagten Leute auch darin, dass sie ihn vermissen, also die Forderung danach nicht aufgeben, aber die dadurch aufgerissene große Leerstelle nicht gefüllt kriegen und die Fehlanzeige mit Verzweiflung quittieren, so gut sie es verstehen. Andere, die es mehr mit dem Meditieren halten, sind gute Kandidaten für die dialektische Kunst, sich so tief in die große Leerstelle zu versenken, bis ihnen klar wird, dass sie ihr eigener Inhalt ist. Das Christentum hingegen lehrt seine Sinnsucher, an die Stelle, wo ihnen aufgeht, dass ihnen jeder befriedigende Lebensinhalt abgeht, in Gedanken eine Art Person hinzutun, einen Allmächtigen und Allwissenden, der die Menschheitsgeschichte im Allgemeinen und jede individuelle Lebensgeschichte im Besonderen nach einem Drehbuch dirigiert, das im Wesentlichen von Schuld, Sühne und Vergebung handelt. Wenn die Adressaten mit dieser Botschaft nicht zurecht kommen, brauchen sie sich daraus nichts zu machen: Ein bisschen negative Dialektik, Anwesenheit des Herrn in seiner Abwesenheit, Gottesferne und Verzweiflung als Königsweg zur Erlösung und dergleichen mehr, das gehört bedarfsweise zum Glauben an den lieben Gott allemal dazu. Für schlichtere Gemüter tut’s aber auch die Vorstellung, dass mit dem Tod unmöglich einfach Schluss sein kann – bei dem Leben, das einem bis dahin beschieden ist! –, sondern hintennach der Herr Jesus wartet.
Auf den lassen Christen jedenfalls nichts kommen. Da können sie sehr unangenehm werden. Denn sie haben nicht bloß eine Weltanschauung zu verteidigen: Ihre Selbstachtung hängt von der Achtung auch anderer vor ihrem allerhöchsten Herrn ab.
Vom christlichen Glauben
1. Gott Vater
Wer mit einem Christen darüber Streit führt, ob es Gott auch wirklich gibt; wer gar nach Beweisen seiner Existenz verlangt und sich dann über die aufgeführten Argumente empört, dem ist nicht zu helfen. Er verwechselt nämlich Glauben mit Wissen, legt ausgerechnet an ein Bekenntnis die Maßstäbe der Erkenntnis an und feiert den höchst billigen Triumph, in jedem Hinweis auf Gott, den der Christ geltend macht, die Erneuerung des „bloßen“ Bekenntnisses zu entdecken. Statt sich Klarheit darüber zu verschaffen, worin der Glaube besteht, gibt er sich mit der ziemlich einfältigen Auskunft zufrieden, dass die Anerkennung eines höchsten Wesens mit Wissen nichts zu tun hat.
Wenn ein Christ umgekehrt Gründe für die Existenz des Höchsten sucht, so findet er sie noch allemal durch die Indienstnahme seines Verstandes für seine Glaubensgewissheit. Einmal kann er sich – weil er es so will – die „natürliche Ordnung“ nicht ohne ein sie ein erschaffendes und erhaltendes Subjekt vorstellen; ein anderes Mal benötigt er dasselbe Subjekt für eine plausible Vorstellung vom Anfang der Geschichte; vielleicht entdeckt er auch in seinem und seiner Nächsten Treiben keinen Sinn und Zweck, und weil es einen geben muss, kommt ihm Gott gerade recht. Ein Christ vermag eine solche Notwendigkeit sogar seiner eigenen Person zu entnehmen und von seinem Glauben an Gott direkt auf dessen Existenz zu schließen. Und moderne Christen bringen diesen „Schluss“ auch schon ganz funktionell zuwege: Dann führen sie die Leistung ihres Glaubens – Trost, Hilfe, Orientierung, Schutz vor Verzweiflung etc. – als Argument ins Feld, melden also ganz schlicht ihr Bedürfnis nach Gott an und melden einen Treffer, weil dieser es erfüllt. Damit kommen sie der Sache schon ziemlich nahe, obgleich sie sich dem Verdacht aussetzen, einen „reinen“ Glauben nicht zu haben, sondern stattdessen recht konjunkturgebunden auf die schützende Hand des Höchsten zu spekulieren.
Was Leute mit einem echten, das ganze Leben lang gepflegten Glauben mit den „schlechten Christen“, denen ihr Herrgott nur gelegentlich einfällt, gemeinsam zustande bringen, ist die Mobilisierung ihrer Einbildungskraft einzig und allein zu dem Zweck, in der Vorstellung eines höchsten Schöpfers und Richters zu einem äußerst schlechten Urteil über sich selbst zu gelangen. Während Gott allmächtig und allwissend ist, ewig und allgegenwärtig den Lauf der Welt bestimmt, beschließt der Christ mit der Entscheidung, an diesen Gott zu glauben und im Verhältnis der freiwilligen Knechtschaft zu ihm zu stehen, einiges über sich. Er legt sich seine Sterblichkeit zur Last, hält sich für ebenso ohnmächtig wie unwissend und bezichtigt sich allen Ernstes, nur ein Mensch zu sein. Dieses „nur“ stellt keinen tatsächlichen Defekt, auch keine Wissenslücke und schon gar nicht die wirkliche Ohnmacht eines Individuums vor den sehr handgreiflichen Mächten dieser Welt fest, sondern eine sehr absolute Verdammung der eigenen Menschennatur wird da vollzogen, die ganz allein aus dem Verhältnis zu Gott stammt. Wer bemerkt, dass er etwas nicht weiß oder kann, wird in rationeller Weise selbstkritisch und sucht die Mängel zu beheben, die ihn stören. Wer seine Misserfolge seiner Unfähigkeit zuschreibt und sich ihrer schämt, läuft mit einem schlechten Gewissen, einem Minderwertigkeitskomplex oder Schlimmerem herum. Wer aber seine Menschennatur verdammt und deren Streben für vergeblich hält, weil er ohnehin nur als Geschöpf und Werkzeug Gottes eine Daseinsberechtigung besitzt, dem ist die Selbstbezichtigung als Sünder als ein Weg eingefallen, mit seinem schlechten Gewissen zu leben. Alles, was er tut und lässt, alles, was um ihn herum angestellt wird, löst sich entweder in eitel Menschenwerk auf – und des Menschen Dichten und Trachten ist nach Mose I 8,21 böse von Jugend auf – oder hat seinen Sinn in Gottes unergründlichem Ratschluss. Gewöhnlich beides.
Geht es einem Sünder gut, so betet er zu Gott und dankt ihm für die unverdiente Gnade, für den so göttlichen Lohn; geht es ihm dreckig, so weiß er dieses als gerechte Strafe für seine menschliche Nichtsnutzigkeit zu würdigen und darum zu bitten, dass trotz allem auch ihm ein kleines Stückchen vom riesigen Kuchen der göttlichen Liebe zuteil werde. In jedem Wechselfall des Lebens deutet er das, was er mitmacht, sehr selbstsicher aus dem Verhältnis zu Gott, das er sich eingerichtet hat.
Diese Selbstsicherheit, jene Wirkung, die Christen dem Glauben so standhaft zuschreiben – Trost, Mut und Kraft statt Verzweiflung und Zorn über die irdischen Brüder, die ihm manches einbrocken – ist auch schon der Schlüssel zur Selbstgerechtigkeit, deren Gläubige fähig sind. Im Unterschied zum selbstkritischen Individuum, das nach Gründen seines Scheiterns bei sich ebenso sucht wie um sich herum; im Unterschied auch zum psychologisch mit sich verfahrenden Typen, der sich für eine Flasche hält, verfährt ein Christ sehr gründlich. Seine Selbstbezichtigung will er als allen übrigen Leuten ebenso anstehende Gesinnung verstanden wissen; für diese Haltung geht er missionarisch hausieren. Und sooft er auf taube Ohren trifft, kann er sich der Genugtuung freuen, die Sündernatur, die allen zueigen ist, zumindest exklusiv zu bekennen. Durch seine Selbsterniedrigung weiß er sich auszuzeichnen, und aus Altem wie Neuem Testamente sind ihm die Geschichten vertraut, in denen die Gottlosen das eine oder andere Ungemach härter und viel gerechter trifft als die Kinder Gottes. Christen, amtierende wie Amateure, verfügen als Anhänger des rechten Glaubens über das gesamte Repertoire jener niedlichen Gehässigkeiten, die vom blanken Neid bis zur Schadenfreude reichen: Sie müssen sich lediglich die Mühe machen, ihrem gläubigen Gottes- und Menschenbild entsprechende Übersetzungen anzufertigen – und schon hat Gottes Gerechtigkeit mit gutem Grund zugeschlagen.
Christen, amtierende wie Amateure, verfügen aus demselben Grunde über jenes sagenhafte Verständnis und Mitleid für alle geschundenen Kreaturen daheim und in der Ferne, also über die Gefühle, die ihnen die lästige Frage nach dem Grund von Not, Elend und Gewalt ersparen. Sie leiden selbst dann noch mit, wenn ihnen gerade einmal größere Schicksalsschläge nicht beschieden sind. Nie würden sie sich anmaßen, „aus eigener Kraft“ die sehr weltlichen, ökonomischen wie politischen Ursachen klarzustellen, wenn ihnen etwas nicht passt. Der Glaube an ihren Herrn, der keines Beweises bedarf und auch keine Widerlegung zulässt, ersetzt ihnen das Wissen wie den Willen, die vonnöten sind, den Machern dieser Welt auf die Finger zu hauen. Dass sie als sündige Menschen nur Ausschuss zustande bringen, als gläubige Sünder aber auf keinen Fall etwas verkehrt machen können, solange sie sich nicht die Frechheit herausnehmen, höchstpersönlich und wegen ihrer menschlichen Anliegen etwas am Weltenlauf ändern zu wollen, ist Christen eine Selbstverständlichkeit. Eher bereichern sie die anderen aufgeherrschten Opfer um ihr eigenes, als dass sie ihren grenzenlosen Opportunismus gegenüber der weltlichen Macht aufgeben, über die sie in Röm. 13,1 die passende Lektion empfangen: Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit, ohne die von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.
Und wenn demokratisch erzogene Christen in den Zentren des Imperialismus ihr Gewissen damit beruhigen, dass sie die „Theologie der Befreiung“ aus fernen Ländern per edition suhrkamp bewundern, so ändert das gar nichts.
Mit dem Entschluss, an Gott zu glauben, hat ein Christ seinen Verstand jedoch keineswegs aufgegeben; vielmehr beschäftigt er ihn damit, seiner gläubigen Weltsicht zu dienen. Deswegen sind all die alten und neuen aufklärerischen Versuche vergeblich, einem Christen die Widersprüche im Glauben vorzurechnen, um die Absurdität seines Gottes- und Menschenbildes herauszustellen. Der Verstand der Gotteskinder lässt sich nicht für die Widerlegung des Herrn Zebaoth bemühen, weil er von Anfang an damit beschäftigt ist, gerade das „Unglaubliche“ fassbar zu machen. Wer also daherkommt und meint, Gott hätte sich in Myriaden von Sündern nicht gerade ein feines Ebenbild auf die Erde gesetzt; die Menschen seien nie so, wie er sie haben will, so dass der Höchste nie zufrieden mit ihnen ist, sie strafen und zurechtbiegen muss; die Menschen würden die gottgegebene Vernunft immer wieder für sich einsetzen statt für ein gottgefälliges Leben, ihren Geist also als Mittel der Sünde missbrauchen etc. etc. – der rennt beim gläubigen Menschen offene Türen ein. Mit Zweifeln dieses Kalibers ist nämlich der Glaube von Anfang an befasst, und die gläubige Phantasie hat in der heiligen Schrift die Antwort auf solche Fragen längst zur Hand. Schon im ersten Buch Moses wird die Sache mit dem „Baum der Erkenntnis“, von dem der Mensch nicht essen soll, klargestellt. In Mose I. 6,6 reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen.
Und überhaupt gehört der gläubige Umgang mit den Zweifeln zum Glauben vom ersten Tage an, da ein verständiger Mensch eben seinen Entschluss, mit Nicht-Wissen seine Lage zu deuten, rechtfertigen muss.
2. Gott Sohn: Die Offenbarung
Der Verstand eines gläubigen Menschen hat mehr zu leisten als der eines Heiden. Einerseits wird er genauso für die Abwicklung der irdischen Geschäfte benötigt wie der jedes anderen, der arbeiten muss und sich einteilen, heiraten und wählen, bisweilen auch Krieg führen darf. Andererseits hat er die zusätzliche Aufgabe zu bewältigen, all die mittelprächtigen Erfahrungen des irdischen Daseins als Werk und Willen Gottes zu deuten. Und so sehr die Mühen seiner irdischen Wanderung bei einem Christen das Verlangen nach dem absoluten Geist wach halten, bei dem er trotz allem gut aufgehoben ist, so heftig beuteln sie ihn auch mit Zweifeln an der Sicherheit seines Glaubens. Da vergeht mancher Tag, an dem einem Sünderlein statt eines Bekenntnisses die Frage einfällt, ob ihn Gott nicht vergessen habe; oder schlimmer noch: er gerät angesichts der Ungerechtigkeiten, die gerade rechtschaffenen Menschen wie ihm angetan werden, in Versuchung zu lästern. Da trifft es sich gut, dass schon die Vorfahren moderner Christen dasselbe Problem hatten und seine Lösung dazu: Gott antwortet auf die quälenden Fragen der zweifelnden Geschöpfe mit der Einlösung eines Versprechens, dass er sich offenbaren werde, wenn es an der Zeit sei. Der Glaube erfährt eine nicht zu unterschätzende Unterstützung vom zweifelnden Verstand, der die Logik von Gott, dem Herrn, und Mensch, dem Knecht, fortspinnt und mit der neutestamentlich mehrfach verbürgten christlichen Offenbarung alle Bedenken bezüglich der Existenz und des Wirkens Gottes zerstreut: Also hat Gott uns seinen eingeborenen Sohn gesandt…
Leben und Lehre Jesu sind zwar für die Stabilisierung der Glaubensgewissheit eine prächtige Sache, weisen aber einen nicht zu übersehenden Mangel auf: Man muss an sie glauben, an die Werke des Gottessohnes, der in Menschengestalt die christliche Entsagung und ihr Gelingen vorführt! So angenehm es für ein christliches Gemüt auch sein mag, den „abstrakten Gott“ – den es sich nicht vorstellen kann und von dem es sich keine Gipsabdrücke machen darf – um eine Figur ergänzen zu können, die seiner Anschauung zugänglich ist und eine detaillierte Biographie aufweist, so unleugbar sind doch die zusätzlichen Anstrengungen, die dem Gläubigen aus der Geburt, den Teach-ins, den Wundern und der Passion Christi erwachsen. Die Evangelien sind nämlich via et ratione ausgetüftelt und bieten deswegen dem Verstand des Gläubigen auch manchen Stolperstein:
- Als Erlöser der Menschen, der ihnen zeigt, wie sich die schlechte Menschennatur besiegen lässt durch die freiwillige Annahme der Knechtsgestalt, ist Gottes Sohn ein Mensch. Nur als solcher vermag er die Leiden auf sich zu nehmen, die als Vorbild der Selbstverleugnung dienen können, die sonst so schnell niemand zuwege bringt.
- Dies hat als erstes Konsequenzen für die Vorstellung, die sich die Gläubigen von der Geburt Christi zu machen haben: Das irdische Dasein von Jesus fängt gleich mit einem Wunder an, das die Theologen zu ihren schönsten Geheimnissen zählen.
- Die nächste Konsequenz prüft den Verstand als Mittel des Glaubens nicht minder hart: Dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern mit der Allmacht Gottes ausgestattet, will auch bezeugt sein. Schließlich steht er seinen Mann für das anbrechende Reich Gottes, für die Bezwingung der Sünde und für die Erlösung von ihr. Also tut Jesus gelegentlich ein Wunder zum Beweis der Allmacht Gottes
- und wird prompt vom Zweifler im Gläubigen missverstanden. Der nämlich hält die Wunder gern für einen guten Grund zu glauben – und so sind sie überhaupt nicht gemeint. Wunder setzen Naturgesetze außer Kraft, sind also Kritik des Menschengeistes, der sich einbildet, sich ein bisschen auszukennen in der Welt und davon profitieren zu können. Da ist es schon eine Ungeheuerlichkeit, wenn Menschen auf Wunder scharf sind zum Beweis dafür, dass Jesus glaubwürdig ist, also überzeugt sein wollen. Das musste der Herr klarstellen:
Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht
(Joh. 4,48), weist er die nur bedingt Gläubigen, die Rationalisten unter den Gotteskindern, zurecht. - In seiner Passion führt er, ganz Mensch, den anderen Menschen den rechten Umgang mit ihrer Endlichkeit vor: Selbstverleugnung ist der Weg zur Erlösung; so geht die Überwindung des Fleisches durch den Geist! Freilich versetzt Gottes Sohn den Gläubigen als verständigen Leuten damit den nächsten Schock: Statt eines Sieges über die Endlichkeit bemerken sie zunächst einmal eine Niederlage, Gottes Sohn ist tot – und das darf er nicht sein. Also geht’s in die Verlängerung, in der auferstanden wird:
Tod, wo ist dein Stachel, Hölle wo ist dein Sieg!
- Der Glaube an die Auferstehung gehört also auch noch dazu, will man der göttlichen Liebe teilhaftig werden, was bei den berechnenden Kreaturen, für die Jesus das alles durchsteht, zu allerlei irrigen Vorstellungen über das Leben nach dem Tode führt. Immer wieder vergessen sie, dass – Auferstehung des Fleisches hin oder her – der gläubige Geist auf seine Kosten kommt und der Himmel kein Erholungscenter mit freiem Eintritt ist. Immer wieder lassen sich Christen, ungeübt in der Logik der Heilsgeschichte, von ihrer materialistischen Phantasie leiten und malen sich das ewige Leben als Ansammlung sämtlicher irdischer Genüsse abzüglich des hienieden dazugehörigen Ärgers aus…
Die Evangelien als Zeugnisse der Offenbarung tun auf jeden Fall gut daran, nicht nur das zu berichten, was zu glauben ist an Taten und Leiden Christi; sie stellen in kundiger Weise, stets der Widerspenstigkeit des menschlichen Verstandes eingedenk, auch die Fehler klar, die man im Kampf zwischen Glauben und Zweifel so machen kann. Da gilt es mancher Versuchung standzuhalten, mit der kleingläubigen Beweissucht fertig zu werden usw., denn: Die Passion Christi hat als vorgemachte Selbstaufgabe ohne die Spur jeder Berechnung geglaubt zu werden, und nur das gläubige Schaf Gottes ist in der Lage, eine korrekte Interpretation des Weltgeschehens und seiner Stellung in ihm vorzunehmen, also ein christliches Leben zu führen.
Dieses spielt sich zuallererst im
3. Geist der Gemeinde
ab. Den Gläubigen und nur ihnen erscheint der Geist des Herrn. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen…
, da ist auch der Herr präsent. Das ist ausnahmsweise kein Wunder, sondern sehr (tauto-)logisch. Diejenigen, die sich unter Berufung auf die Offenbarung der Bewahrung des Glaubens annehmen, stehen für die Präsenz und die Lehre Gottes, des Vaters und des Sohnes gerade, sind also vom Heiligen Geist erfüllt. Dessen Niederkunft, das Zeichen der Vollzugsmeldung, ist zwar auch wieder an die Vorraussetzung des Glaubens geknüpft, aber wen stört das schon? Die Existenz der gläubigen Zeugen beweist den Glauben und tradiert den Beweis Gottes in der Welt und für sie. Das war von Anfang an klar, dass sich der Glaube selbst beweist und seine Anhänger feierlich erklären, dass der Menschengeist das Ganze ohnehin nicht fasst.
Auf diesem Widerspruch sollte man auch nicht übermäßig herumhacken. Denn Menschen sind es schon, die unter Aufbietung ihres Geistes ihren Gottesdienst abwickeln. Sicher, argumentiert und überzeugt durch richtige Gedanken über die Welt wird nicht in der Kirche, sondern die gläubige Einstellung wird gefeiert und besungen, weil jeder froh ist, dass er seinen Glauben hat. Aber selbst zum gemeinschaftlichen Genuss des Glaubens an die Dreifaltigkeit, zur selbstgerechten Demonstration, dass man im richtigen Verein ist, bedarf es einiger Verrenkungen geistiger Art. Christen müssen ja bei der Feier der Einsicht, dass ihre Menschennatur nicht viel wert ist, sogar aufpassen, dass ihr Bekenntnis nicht allzu sehr mit dem kontrastiert, was sie außerhalb des Gottesdienstes tun, und vor allem die Sünderhaltung ohne den offensichtlichen Wunsch, sich in aller Demut auszuzeichnen, vorführen – auch dazu hat schon Jesus kundig Stellung genommen! Wenn sie daran denken, dann dürfen sie sich auch kräftig im Gebet erniedrigen, in der Predigt beschimpfen und trösten lassen sowie am Gesang erbauen. In der Exekution der Sakramente laufen sie dann zu ihrer höchsten Form auf. Sie werden der Gnade Gottes teilhaftig – und müssen schon wieder höllisch aufpassen, dass sie sich nicht einbilden, sie könnten sich qua Teilnahme an dem Hokuspokus irgendetwas verschaffen. Wo sie sich einbilden, dass sie sich das nicht einbilden, da hebt ein fröhlich Taufen von Babies an, aber nicht von unschuldigen Kindern, denn die „Erbschaft“, die sie übernommen haben, können sie nicht ausschlagen. Da wird aus dem Verhältnis der Geschlechter ein Gottesdienst, und nur so steht ein Christ zu dieser peinlichen Sache des Fleisches. In der Beichte erreichen Christen die Spitze ihrer Heuchelei, indem sie durch Reue und Buße ihre bösen Taten auf innerliche Weise ungeschehen machen, was freilich nur die Leistung Christi ist. Sonst wäre man ja auch nicht im Abendmahl der unio mystica fähig, durch die man den Geist des Herrn auf sehr natürliche Weise Einzug bei sich halten lässt.
So sind gläubige Christen das lange schöne Kirchenjahr über mit dem Repetitorium von Leben und Lehre Christi beschäftigt und reden sich an dessen Vorbild die Verachtung des Materiellen, Weltlichen und Natürlichen ein, dass einem schlecht davon werden kann. Selbstverständlich werden auch Christen die Welt, und was sie in ihr tun nicht los. Aber dazu reicht ihr Geist schon aus, dass sie von ihrem stinknormalen Leben abstrahieren, es als bloße Durchgangsstufe und Bewährung im Glauben auffassen und alles ein bisschen anders betrachten.
4. Das Gottesreich auf Erden
Es wäre freilich eine Verharmlosung des christlichen Glaubens, wollte man ihn auf eine etwas abwegig geratene Privatmeinung herunterbringen, die sich manche Leute über die Jahrhunderte immer mal wieder zugelegt haben – Leute, die ansonsten im Leben dasselbe tun und lassen wie alle anderen. Wie jede andere Marke moralischer Weltanschauung stellt sich der Glaube nicht als zusätzlicher theoretischer Luxus neben das praktische Werkeltagsgetriebe, das unter Umgehung von Bewusstsein und Willen der Beteiligten den ehernen Diktaten von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen gehorcht. Die An- und Einsichten dienen den jeweiligen Zeitgenossen stets als Leitfaden ihres Benehmens; sie sind je nach ihrem Gehalt gute Gründe für alle möglichen Varianten des Mitmachens und Aufbegehrens, der Veränderung der vorgefundenen sozialen Umstände und der Unterwerfung unter sie. Und die christliche Lehre hat mit ihren Auskünften über Gott und die Welt nie Zweifel daran gelassen, dass sie eine Anleitung für den Lebenswandel des Menschen
, also aller, darstellt. Wer das Neue Testament in den alten Sprachen studiert, lernt von Jesus sämtliche Imperativformen des Verbalsystems, weil Gottes Sohn nicht nur einzustecken wusste, sondern auch auszuteilen – nämlich lauter Verhaltensmaßregeln im Fach christliche Rechtschaffenheit
.
Die Kunst, andere Leute Mores zu lehren, wollte er mit seinem Abschied – er wurde schließlich von seinem Vater erwartet – nicht aussterben lassen. Die Verkündung, Bewahrung und Auslegung des Glaubens hat er deswegen auch noch befohlen. Diese Tätigkeiten, in denen er sich verzehrt hat, sollten in seinem Auftrag von den Aposteln fortgeführt werden – sonst wäre sein Leben und Sterben umsonst gewesen. Das hat seinen Vertrauten, die als seine Weggefährten alle Standardsituationen gläubigen Irrens durchlebt hatten und für die Erfüllung dieses Auftrags qualifiziert waren, sofort eingeleuchtet. Genauso wie deren Schülern, die bis auf den heutigen Tag nicht ausgestorben sind. Wenn die sich in der „Nachfolge Christi“ üben, den Herrn Jesus als Gründer der Kirche hochleben lassen und sich auch schon mal zu wüsten Titeln für ihren Verein hinreißen lassen, so ist das menschlich verständlich. Sie leben in ihm und für ihn, und von ihm, so gut es ihm geht. Deswegen kommt ihnen die Kirche nicht nur wie das „heilige Volk Gottes“ vor, sondern auch noch wie die „Braut Christi“ und sein „Leib“ – als eine dem Wechselwirken von Hirt und Herde nachempfundene Sozialstruktur sowieso.
Mit dem Gebot, überall und immerzu „Zeugnis abzulegen“, mit der pfingstlichen Ermunterung „Gehet hin in alle Welt…“ hat die Glaubensbotschaft schlicht die Gründung und Erhaltung einer Organisation zum Bestandteil des Glaubens gemacht. Diese Organisation will mit ihren Jenseits-bezogenen Auskünften, über ein richtiges Leben im vergeblichen und falschen, im Diesseits bestehen und wirken. Also muss sie sich so aufstellen, dass immer mehr „Menschen“ den Weg zu ihr finden. Erfolgreiche Mission ist unbedingt erforderlich, soll das christliche Wort Gottes nicht den Weg alles Irdischen erleiden und von „der Geschichte“ im Archiv abgelegt werden. Die Kinder Gottes hatten zu allen Zeiten eine Menge zu tun, um der Kirche den Zulauf zu verschaffen, der allein den Bestand des Glaubens und Dienstes an Gott sichert, der die Menschheit rettet.
Dabei standen sie stets in Konkurrenz zu ähnlich gestrickten Bewegungen, die mit ihrem alternativen Gottesgedanken ebenfalls den Drang und Zwang zum Wachstum verspürten. Die anstehenden Auseinandersetzungen wurden, vertrauenswürdigen Berichten zufolge, nicht nur im Ringen um die schönste Auslegung von Gottes Wort und Willen absolviert. Aber was blieb ihnen anderes übrig, wollten sie das Vermächtnis des Herrn nicht verraten! Zumal die Konkurrenz um den ideologischen Ausschuss sowie – notgedrungen – um den materiellen Überschuss, den die früheren Gesellschaften und Staaten so hergaben, mit erheblichen Mangelerscheinungen fertig zu werden hatte. Für die Predigt weltlicher Entsagung mag der Zustand von Gemeinwesen, für die das moderne Dogma von der Knappheit der Güter seine Berechtigung gehabt hätte, gar nicht so ungünstig gewesen sein – dem Wachstum einer Organisation, die sich im Auftrag des Herrn breit zu machen versucht, ist die Armut an Produktivkräften weniger zuträglich.
So gerieten die Gemeinden Christi – dessen Reich eigentlich nicht von dieser Welt ist – den weltlichen Mächten auch noch ins Gehege. Gerne berichten moderne Kirchenvorstände noch heute von den Verfolgungen, die Christen erdulden mussten, weil schon früher die amtierenden weltlichen Herren „Parallelgesellschaften“ nicht leiden mochten. Die machten ihnen die Loyalität ihrer Untertanen und die uneingeschränkten materiellen Dienste ihres Menschenmaterials streitig. Nicht so gerne erinnern die Glaubenslehrer an die Konsequenzen, die die Kirchengeschichte ebenfalls offenbart: Wo es ging, wurde sich auch mit der einen oder anderen Regierung arrangiert und mit ihren Kriegen Frieden gemacht. Es soll sogar ein paar lächerliche Jahrhunderte lang dazu gekommen sein, dass die Kirche – wo es ging, und nur zur Erhaltung der Präsenz Gottes auf Erden – selbst die weltliche Verantwortung in ihre Hände genommen hat. Schließlich war mit dem Glauben als veritabler „Staatsreligion“ die Ausbreitung der frohen Botschaft viel effektiver zu gestalten. Und jeder miles Christi konnte für eines der konkurrierenden Gottesreiche auf Erden nicht nur beten, sondern auch kämpfen und sterben.
Die Zeiten, in denen der Missionsgedanke auf solch rohe Weise verwirklicht wurde, sind Gott sei Dank vorbei. In einem schmerzhaften Lernprozess, wie ihn nur verlorene Kriege anzustoßen vermögen, ist die Kirche nicht nur durch Spaltungen geschwächt worden, sondern auch ihrer eigentlichen Aufgaben inne geworden. In der Ära des Kolonialismus, in der mächtige Gemeinwesen ihr Territorium vergrößerten und Natur wie Menschen in entlegenen Gegenden zum Material ihrer Bereicherung erniedrigten, haben die organisierten Christen die Eingeborenen fremder Klimate mit Würde ausgestattet. Sie konnten die Seele mancher bis dato abergläubischer und ratloser Wilden gewinnen, ihnen das Selbstbewusstsein eines freien Dieners des einzig wahren Gottes vermitteln, also die Schar der Gläubigen mehren. Ihre Pionierrolle auf dem Feld der damals noch verpönten Entwicklungshilfe, auch das entschlossene Auftreten als NGO der Nation, aus der sie kamen, hat den Missionaren und damit der christlichen Kirche mehr Anerkennung eingetragen als die Kreuzzüge.
Diese untrüglichen Zeichen der Läuterung sind auch auf dem zweiten Feld kirchlichen Wirkens zu vermerken: dem der Betreuung und Aufmunterung der Mitglieder, die auf die Konsequenzen gespannt sind, die ihr Entschluss zum Glauben an die Dreifaltigkeit nach sich zieht. Nach einer Periode des erbitterten Kampfes um die Selbstbehauptung der Kirche(n), in der das Innenleben der Gemeinde stark vom Sicherheitsdenken geprägt war – hier waren Ketzer und Abtrünnige zu verfolgen, dort musste die aufkommende Wissenschaft in die Schranken gewiesen werden, die Inquisition erforderte die Aufbietung aller Kräfte etc. –, knüpften die nun für eine neuzeitliche Kirche Verantwortlichen entschlossen an alle Traditionen an, die sich seit der Gründung finden lassen.
Solcher Halt ist auch dringend erforderlich, wenn es um die hohe Aufgabe der christlichen Seelsorge geht. Zunächst einmal geht es darum, Gottes Wort so wortgetreu wie möglich zu verkünden, damit die Erdenbürger in der Suche nach einem Halt im Leben erfahren, was sie mit ihrer Überzeugung, Geschöpf und Werkzeug des Höchsten zu sein, „konsequenterweise“ noch alles glauben. Mit der wiederholten Rezitation der Heiligen Schrift ist es allerdings nicht getan; die bildet die unverzichtbare Grundlage aller kirchlichen Fortbildung, bedarf aber der Auslegung; denn die Geschichten und Gleichnisse haben schließlich eine Bedeutung, die sich nicht gleich jedem Leser bzw. Hörer erschließt. Noch komplizierter wird die Ausübung des damit begründeten kirchlichen Lehramts dadurch, dass die in ihrer Bedeutung richtig verstandene Bibel eine Bedeutung für das Leben hat – also muss auch die den Gläubigen beigebracht werden. Seelsorge ist Dienst an den Brüdern und Schwestern
, und die melden sich in der Gemeinde, weil sie der Orientierung bedürfen in ihrem irdischen Dasein, in dem sie oft genug nicht wissen, was sie tun und was sie lassen sollen. Die Unterscheidung zwischen Sünden und guten Werken, die Aufklärung über die Folgen der einen wie der anderen für das Verhältnis zum Höchsten richtet sich auf die Besserung des Menschengeschlechts; einer, der unter anderem der Meinung ist, dass – „ein“! – Gott wohl Regie führt bei den Wundern und Zufällen des Lebens, diese Meinung aber für ziemlich folgenlos hält, ist kein Christ.
Christen bekennen sich zu Gott, nehmen die biblisch verbürgte Offenbarung ernst, deren Sinn sie in der Gemeinde von christlichen Lehrern – die haben den Glauben zum Beruf gemacht – erfahren, und streben mitten im weltlichen Leben nach Bewährung im Glauben. Den ersten Schritt dahin haben sie getan, indem sie die Kirche als Norm ihres Glaubens anerkennen, also hingehen und zuhören; den zweiten tun sie, wenn sie den Lehren der Schrift und ihrer Dolmetscher die wichtige Konsequenz entnehmen, dass sich ihre Verantwortung vor Gott in lauter Pflichten gegenüber der Kirche übersetzt. Dann sind sie drittens damit beschäftigt, die mehr oder minder unterhaltsamen Rituale der Glaubensgemeinschaft regelgerecht zu absolvieren und Zeit, Geld und Kraft dem Gemeindeleben zu opfern, so dass die Kirche ihren Aufgaben gewachsen ist und wächst.
*
Dieses Programm ist von den Aposteln auf Geheiß Jesu initiiert und von ihren Erben über die Jahrhunderte verfolgt worden. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Idee einer wohlorganisierten Glaubensgemeinschaft gut ankommt, auf ein Publikum trifft, das bereit ist, mit seinem Glauben ernst zu machen und ihn in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu „leben“. Aber eben auch, dass unter denen, die sich zur Anleitung und Führung von Gotteskindern berufen wissen, erhebliche Differenzen aufkommen. Der Kirchen gibt es viele, und alle haben ihre Schismen durchgemacht, weswegen hinreichend Leichen ihren Weg pflastern. Für die an den Spaltungen maßgeblich Beteiligten sind die jeweiligen Konkurrenten schuld; parteiübergreifende Erklärungen landen zielsicher bei der Entdeckung, dass auch die edelste Sache zuschanden wird, weil ihre Betreiber fehlbare Menschen sind, die ihre Defekte nicht los werden. Das ist zwar ein zutiefst religiöser Erklärungsansatz, der schon wieder viel Anklang findet. Er krankt aber ein bisschen daran, dass er im Projekt selbst – das wird ausnahmsweise gut geheißen und nicht dem bösen Trachten der Sünder zugeschlagen – gar keine Gründe für Streit und Streitbarkeit wahrnehmen will.
Dabei ist schon die Grundlegung des Glaubens, dessen gemeinsamer „Besitz“ den organisierten Zusammenhalt einer Kirche stiftet, erst einmal für die Stiftung von lauter Kontroversen gut. Der Missbrauch des Verstandes zur Konstruktion von nicht zu bestreitenden Notwendigkeiten, die schließlich zu einem Ungetüm namens Glaubenswahrheit
führt, ist schließlich nicht mit einer argumentierenden Beweisführung zu verwechseln. Deren Richtigkeit ginge zu überprüfen und abzuhaken; wenn unrichtig, wäre sie zu verwerfen. Wo jedoch die zum Glauben entschlossene Phantasie zu ihrem Recht kommt und den Inhalt des zu Glaubenden erzeugt, „folgt“ noch aus dem schönsten Anfang ganz verschiedenes Zeug. Anlässlich der jüngsten weltpolitischen Großaffären – der leidige Krieg gegen den „islamischen Fundamentalismus“! – haben wohlmeinende Durchblicker die Vermeidung eines „Krieges der Religionen“ vorgeschlagen: Die Weltreligionen – Christenheit, Judentum und Islam – möchten doch im Auge behalten, dass sie in „Abraham“ einen gemeinsamen Ausgangspunkt ihrer Doxa haben; mit dieser Gründungslegende im Gepäck bräuchten sie doch nun wirklich nicht aufeinander loszugehen! Leider haben sie übersehen, dass die zum Frieden ermahnten Konfessionen mit der Begegnung zwischen Gott und Abraham gar nicht dasselbe feiern. Die einen freuen sich über die Auserwählung des Volkes Israel, die andern über den „Alten Bund“ – und jeder gewiefte Mullah hält es für ein Unding, dass Gott mit einem Sterblichen Verträge schließt! In jeder „Konsequenz“, die Glaubensstifter aus der einzig wirklichen Gemeinsamkeit – Gott der Herr! – ziehen, tun sich wunderbare Unterschiede auf; in jedem „also“, das Glaubenslehrer an die abstrakteste aller Glaubensgewissheiten knüpfen – damit sie ihren Anhängern beibringen, was für eine Rolle Gott in ihrem Leben zu spielen hat –, lauern die Einheit der Gemeinde zersetzende Alternativen. Man denke nur an so „konkrete“ Elemente religiöser Unterweisung wie die Qualitäten des Jenseits und die entsprechende Zugangsberechtigung, die auf Erden besorgt werden muss! Solche Differenzen taugen eifrigen Gläubigen allemal zur entschiedenen Distanzierung von den anderen, die sich Irrlehren verschrieben haben; und Kirchenführern sowieso, weil jede Abweichung in der Lehre, einmal auf Zustimmung gestoßen, die Gemeinde schwächt.
Deren Einheit und Größe spielt daher auch bei dem Werk der frommen Phantasie zu allen Zeiten ihre Rolle. Korrekturen an überkommenen Lehrmeinungen, Ergänzungen bezüglich der Bedeutung eines Bibelwortes, schon gleich Fortentwicklungen in der Abteilung „Bedeutung für ein gottgefälliges Leben“ – diese Daueraufgaben des seelsorgerischen Lehramts werden allemal berechnend erledigt. Genau so wie die Produkte gläubiger Erfindungsgabe stets die Gestalt einer glaubensimmanenten Notwendigkeit annehmen, lassen sich auch aktuelle, als dringlich empfundene Rücksichten auf die Erfolgsbilanz der Gemeinde, auf die innenpolitische Lage der Nationen, in denen die Kirche wirkt, auf die weltpolitischen Konjunkturen etc. als schlüssige Konsequenzen in der Glaubenslehre unterbringen. Wofür sich die Kirche entscheidet und wozu sie deswegen ihre Mitglieder in den mannigfachen Konflikten des politischen und wirtschaftlichen Lebens anhält, das hat seinen Grund jedenfalls in dem, was bekennenden Gotteskindern aufgetragen ist.[1]
So eindeutig die Verwandlung „kirchenpolitischer“ Entscheidungen in glaubensbedingte Ratschlüsse darauf abzielt, der Organisation des gottesfürchtigen Volkes ihren Bestand und Erfolg zu sichern, so leicht schlagen solche „Weichenstellungen“ um in Dissens und eine Störung des Zusammenhalts der Gemeinde. Zu den Streitfragen um Verständnis und Auslegung der Schrift kommen die Auseinandersetzungen hinzu, die sich um die Übereinstimmung zwischen gläubiger Prinzipientreue und politischer Parteinahme drehen. Denn wenn sich das bibelfeste Gewissen meldet, gerät es ganz rasch in Widerspruch zu dem nicht minder christlichen Gewissensgebot, der Sache der Gemeinde zu dienen. Sobald sich christlicher Eifer zu Wort meldet und der einen der beiden Pflichten den Vorrang gibt, stehen sich unversehens Parteien gegenüber, die einander des Verrats bezichtigen – am gemeinsamen Fundus an Lehren, denen ja lauter Direktiven für den kurzen Aufenthalt auf Erden einbeschrieben sind, andererseits an der Einheit der Christen, die allein den Willen Gottes auf Erden stark macht…
Diejenigen, die sich seit Jesu Abschied zum Missionieren und zum Lehramt berufen wussten, sind mit diesem Problem von Anfang an und bis auf den heutigen Tag konfrontiert. Und schon die ersten Nachfolger Christi haben in Anlehnung an seine Worte und Führungsqualitäten den einzig richtigen Beschluss gefasst. Dass sich mit Hilfe der menschlichen Vernunft, die auf eigene Rechnung urteilt und andere überzeugt, „Glaubenswahrheiten“ überprüfen, womöglich beweisen lassen könnten, kam ihnen sowieso abwegig vor; denn was von der Intelligenz der Erdenwürmer zu halten sei, das ist mit dem (Entschluss zum) Glauben entschieden und selbst fester Bestandteil ihrer Lehre. Dass aus dem Schatz biblischer Sentenzen, die festhalten, was Sache ist, lauter das Dürfen und Sollen eingefleischter Sünder betreffende Rezepte herauszuleiern sind, war ihnen auch klar – dafür sind die Gewissheiten des Bekenntnisses ja erfunden und ausgeklügelt. Also – für diesen Schluss hat der menschliche Geist zu allen Zeiten gereicht – musste die Gültigkeit der Lehre, ihrer Fundamente wie ihrer in den Wechselfällen der Geschichte zu befolgenden Benimmregeln, gegen Abweichler gesichert werden; erklärtermaßen ohne das mit der Heraufkunft der Wissenschaft sich anbietende Handwerkszeug. Die tapfere Abwehr von Irrlehren – und darunter fielen auch die sich mehrenden Kenntnisse von den Naturgesetzen – wurde zur Überlebensfrage der Kirche, auch wenn, ja gerade weil die Zweifler selber im Namen Gottes und eines ganz und gar korrekten Glaubens auftraten. Mit der Verbindlichkeit der aktuellen christlichen Unterweisung war eben die Zuständigkeit der Inhaber des kirchlichen Lehramts für die sittliche Lenkung des Menschengeschlechts bestritten – eine Zuständigkeit, der in den guten alten Zeiten ein ansehnliches Stück weltlicher Herrschaft entsprach. Tüchtige Kirchenväter haben für dieses Problem eine Lösung gefunden, die bekanntlich die Jahrhunderte überdauert hat. Sie hat zwar den Verlust der Herrlichkeit, die mit weltlicher Herrschaft einhergeht, nicht verhindert, weil der Kampf um staatliche Hoheit nicht über Dogmen, sondern mit Geld und Gewalt entschieden wird. Auch eine große Spaltung konnte besagte Lösung nicht aufhalten, ebenso wenig wie zahlreiche Neugründungen kleinerer Vereine, die sich nach ihrer Fasson um die Pflege des einzig echten Glaubens bemühen und dafür nach demselben Muster vorgehen. Aber überlebt haben mit Hilfe der Einführung einer kirchlichen Rechtsordnung immerhin eine Weltreligion und mehrere Volkskirchen, die in vielen wichtigen wie unwichtigen Nationen etwas gelten.
Dieser weise Beschluss, den Generationen von Gottesmännern immer gründlicher ausgearbeitet haben, begründet einen recht drastischen Umgang mit Zweifeln an den und Einwänden gegen die „Glaubenswahrheiten“ und Glaubenspflichten, mit denen sich die Mitglieder der Gemeinde herumschlagen. Beim Missionieren fremder Leute, die schon glauben, dass Gott über ihr Leben gebietet, sich aber nicht sicher sind, verfahren die Geistlichen noch sehr entgegenkommend: Sie reden den Kandidaten der Gemeinde nach Kräften ihre Zweifel aus – mit welchem Arsenal an Argumenten auch immer –, verheißen den Genuss des Glaubens für den Fall, dass er bedingungslos und entschlossen daher kommt, also nicht bei jedem unangenehmen Zwischenfall wackelt. Auch mit den Unsicherheiten, von denen Mitglieder befallen werden, die sich in Treue zur Gemeinde und Furcht vor Gott fragen, ob sie auch auf einem guten Weg sind, gehen Geistliche sehr verständnisvoll um. Sie bemerken an solchen Drangsalen nämlich, wie gründlich ihre Belehrungen angeschlagen haben, dass sich da Christen nach Maßgabe der kirchlichen Unterweisung selbst prüfen und jeder weiteren ermahnenden Betreuung zugänglich sind. Wenn jedoch Leute, die sich bereits in der Gemeinde eingehaust haben und an mehr oder minder prominenter Stelle am Leben der Gemeinschaft im Glauben mitwirken, dann bezweifeln, ob gewisse alte oder neu eingeführte Rituale, gewisse Stellungnahmen bezüglich dessen, was sich im Leben von Christen gehört, gewisse innerkirchliche Sitten usw. überhaupt in Einklang mit dem Willen Gottes stehen und wirklich in der Form nötig sind, sieht die Sache anders aus: Da betätigen sich angebliche Brüder in Christo doch glatt wie alternative Kirchenleiter und -gründer, nehmen sich heraus, die amtierenden Gottesdiener ernsthaft der Verletzung des Glaubens zu bezichtigen; und das zielt auf nichts anderes ab denn auf Zerrüttung der real existierenden Gemeinde, auf Zerstörung dessen, was in der Geschichte der Kirche von den Lehrern und Schülern geleistet worden ist. Und da hört jedes Verständnis auf.
Wenn die Träger des Lehramtes beschließen, der Gemeinde eine Satzung zu spendieren, aus der hervorgeht, wer bestimmt, was in dem Verein Gottes zu glauben ist; wenn sie die einschlägigen Befugnisse auf hierarchisch geordnete Instanzen verteilen, so dass jeder an seinem Platz weiß, wem er zu gehorchen hat; wenn die Anerkennung der kirchlichen Autorität zum Index dafür wird, ob es einem, der Gottes Gnade teilhaftig werden will, auch wirklich ernst damit ist – dann haben die professionellen Gottesmänner an der Organisation politischer Macht Maß genommen. Für alle, die zur Gemeinde gehören, beanspruchen sie die Richtlinienkompetenz; die „Staatsräson“ und das ihr entsprechende Regelwerk, die Ausübung von Rechten und Pflichten sowie deren Inhalt stehen nicht zur Diskussion – denn dann stünden sie auch zur Disposition. Selbstverständlich finden auf Konzilien auch Diskussionen statt, sogar Korrekturen am ehernen Bestand von „Glaubenswahrheiten“ können vorgenommen werden – aber eben nur von denen, die laut Satzung dazu befugt sind. Der Rest der Gemeinde hat sich an die Ergebnisse solcher Beratungen zu halten: die Inhaber eines Lehramtes, indem sie diese Ergebnisse zitieren und als gültige Norm vertreten; die vielen anderen, indem sie sie respektieren und ihre gläubige Betätigung an diesen Normen ausrichten. Diese Ausrichtung bezeugt für die Gemeinde und vor allem für die belehrende und überprüfende Crew des Klerus, wie es um die Glaubensfortschritte der Laien bestellt ist.
Ebenso unsachlich wie ungerecht ist daher die geschmäcklerische Schelte der katholischen Kirche von Seiten moderner Zeitgeister zu nennen – sie hätte den Geist der Zeit nicht erkannt, wäre der Tradition zu sehr verhaftet und dergleichen mehr. In der fachkundigen Distanzierung der konkurrierenden Konfession vom Katholizismus ist jedenfalls weniger vom notorischen Konservativismus
der römischen Kirche die Rede als von einem Überschuss an Neuerungen, die einer Verfälschung der echt-ursprünglichen Glaubenslehre gleich kämen. So haben die Katholen es fertig gebracht, ein Dogma von der „Aufnahme Mariens in den Himmel“ aufzustellen, in dem einerseits die Mutter Gottes als Werkzeug des Herrn
gewürdigt wird wie bei allen anderen Christen auch; andererseits wollen sie die Jungfrau noch als vorbildliches Werkzeug beachtet wissen, damit ihrer einzigartigen Stellung in der Heilsgeschichte Genüge getan werde. Damit haben sie den Gläubigen eine neue Instanz anempfohlen, bei der sie um Fürbitte nachsuchen können und sollen, was wiederum der Königin aller Heiligen eine Unzahl von Rosenkränzen, Wallfahrten und sogar Erscheinungen eingetragen hat. Ebenso umwälzlerisch ist die katholische Kirche bei ihrem Dogma von der „Unfehlbarkeit des Papstes“ vorgegangen. Staat es dabei zu belassen, dass auf Beschlüsse der kirchlichen Amtsträger nun einmal zu hören ist – was andere Christenfraktionen als genauso dringlich erachten –, ist den römischen Kollegen der aus nicht-römischer Sicht ganz unzulässige Einfall eingefallen, dieses ihr Bedürfnis als Eigenschaft einer leibhaftig unter uns wandelnden und predigenden Figur festzuschreiben. Gegen den Vorwurf, da hätten sie es zu weit getrieben und wären nicht bei der bewährten alt- und neutestamentlichen Quelle gültiger Dogmen geblieben, müssen die katholischen Theologen sich verteidigen und tun das auch tapfer. Sie erläutern streng glaubenswissenschaftlich, dass der Papst natürlich nicht unfehlbar ist, wenn er am Dienstag über die Straße geht, sondern „nur“, wenn er gerade eine „Glaubenswahrheit“ definiert. Und wer so etwas zustande bringt, das muss man zugeben, ist auch unfehlbar.
Es bedarf schon ziemlich guter Laune, um die Auseinandersetzung zwischen den christlichen Fraktionen vergnüglich zu finden. Denn unter Aufbietung des intellektuellen Handwerkszeugs, das Theologen an Universitäten konstruieren und den Lehramtsanwärtern mit auf den Weg geben, wird da um die einzige Sorte Wahrheit gestritten, die der christlichen Lehre interessant vorkommt. Die theoretischen Notwendigkeiten, die sich die bibelfesten Parteien Gottes um die Ohren hauen, betreffen erstens die fundamentale Frage: Was muss geglaubt werden? Was zweitens in dieselbe Frage mündet: Wie müssen also Lehre und Befolgung des Glaubens organisiert werden? Über das Feuerwerk an Blödsinn, der herauskommt, wenn sich berufene Diener Gottes mit Argumenten an den Antworten zu schaffen machen, kann man deswegen nicht lange lachen, weil deren Ernst – mit dem der Blödsinn unmittelbar kontrastiert, was zum Lachen reizt – einer gar nicht angenehmen Sache gilt. Sie entwerfen ein komplettes Unterwerfungsprogramm – und zwar für „den Menschen“ –, in dem die Geistlichkeit der Kirche die Rolle des Betreuers übernimmt. Von ihrem „christlichen Menschenbild“ über die vorgeschriebenen Rituale des Gottesdienstes bis zur frei machenden betenden und reuigen Selbsterniedrigung, die wie weiland bei Sisyphos eine vergebliche Mühe bleibt, dafür aber selbst ein Erfolgserlebnis darstellt, verfolgen einsatzfreudige Priester das Ideal einer Hörigkeit, der sie als Autoritäten des Glaubens auf die Sprünge helfen.
Traurig zu sehen, dass zur aufgeklärten Demokratie eine Öffentlichkeit gehört, deren bescheidwisserische Wortführer dergleichen Umtrieben nicht widersprechen, wenn es schon der Staat nicht tut, der ihnen eine Lizenz zum Kritisieren ausstellt. Besagte Eliten der freien Meinungsbildung entdecken zwar an jeder Sekte die Niedertracht der (Ver-)Führer und die kultivierte Entmündigung der Opfer, halten aber die Volkskirchen samt ihrer Geschichte für einen unschätzbaren Beitrag zu unserer Kultur und zum Erfolg der westlichen Zivilgesellschaft. Wie der Staat, der unseren Schriftstellern und Journalisten das Wort erteilt, schätzen diese die Funktion der großen christlichen Gemeinden für das Gemeinwesen so hoch ein, dass sie das genuine Programm der Glaubensgemeinschaften überhaupt nicht verdächtig, geschweige denn abstoßend finden. Die geklärte Machtfrage zwischen Staat und Kirche gibt begeisterten Demokraten die Sicherheit, dass sich die Agenturen Gottes auf Erden zur Staatsnützlichkeit hingearbeitet haben, weswegen es sogar üblich geworden ist, das Minuswachstum der Kirchengemeinden zu bedauern und deren Leitungen zu raten – so geht heute Kritik! –, sie möchten sich doch zwecks erfolgreicher Mission attraktiver zurichten, den heutigen Bedürfnissen des Volkes in Sinnfragen mehr entgegenkommen und in gewissen Fragen mehr Toleranz üben. So ignorant stellt sich eine um den Zulauf zu den Kirchen wie um alles offiziell anerkannt Gute besorgte „Kritik“ zu einem Haufen von Berufenen, der nichts Geringeres vorhat als die gewissenhafte Vollstreckung von „Glaubenswahrheiten“ – und der schon damit, aber auch mit hochtheologischen Einlassungen klarstellt, dass er mit Toleranz nicht viel anfangen kann und – wie viele andere auch – die „Freiheit der Andersdenkenden“ nur respektiert, weil es ein staatliches Toleranzgebot gibt. Dabei ist es wirklich kein Rätsel, wozu die Kirche ihren Zulauf braucht:
Amtierende Christen pflegen ihrem Amt der Seelsorge – wie schon erwähnt – den Titel eines „Dienstes an den Brüdern und Schwestern“ zu verleihen. Der Gestus von Ausnahmegestalten, die nichts weiter im Schilde führen, als wildfremden Menschen einen Gefallen zu tun, ist unübersehbar. Die berufen sich einfach auf ein Bedürfnis, das auf seine Befriedigung wartet. Wer es hat, trifft im Seelsorger, der es offenbar von sich her kennt, auf jemanden, der sich auf die Behebung des Mangels versteht, der ihm da entgegenschlägt. Flugs ernennt er seinen Zulauf zu „Bruder“ und „Schwester“ und kümmert sich um ihn. Dass das Bedürfnis überhaupt nicht, noch nicht einmal wie Hunger und Durst wenigstens eine Zeit lang, erlischt, hat freilich seinen guten Grund in der Art, wie es bedient wird. Es wird nämlich gebraucht, und seine Dauerhaftigkeit macht den Erfolg der Betreuung aus. Das ist alles sehr merkwürdig.
Die landläufige Betrachtung der Kirchenbranche als marktwirtschaftlicher Glücksfall, in dem Nachfrage und Angebot so fein zusammenkommen, dass die Automobilindustrie vor Neid erblasst, bleibt selbst dann in Kraft, wenn das Angebot steht wie eine Eins und die Nachfrage versiegt. Sie wird auch stets richtig verstanden und angewandt, wenn über Kirche und Pfaffen hergezogen wird: Die Verunglimpfung der Institution wird zurückgewiesen, und zwar nicht durch den Hinweis auf Leistungen und Nutzen – der ganze Nutzen, auf den verwiesen wird, besteht im Vorhandensein einer Klientel, die die Institution offenkundig braucht. Was da so alles angestellt wird, ist mit dem Zulauf auch schon gerechtfertigt.
Solcher Respekt wird nicht jedem Geschäftszweig zuteil, und auch nicht jedem Bedürfnis wird so umstandslos das Recht zugesprochen, bedient zu werden. Schon gar nicht jedem materiellen, aber auch nicht jedem, das der Einbildung der Menschen entspringt. In unserem Fall sind Leute unterwegs, die keine Zeit darauf verwendet haben zu begreifen, wie ihnen geschieht; die mit der Vermutung beschäftigt sind, hinter all dem, was sie so erleben und mitmachen, würde was stecken. Und ehe sie sich’s versehen und dem Verdacht einer bislang nicht entdeckten Notwendigkeit des bunten Treibens, in dem sie manches tun und anderes mit ihnen getan wird, nachgehen, ist überall davon die Rede, wer dahinter steckt. Dann ist es nicht mehr weit zur Adresse, wo ‚Gott‘ drauf steht und nähere Auskünfte versprochen werden. Was jetzt garantiert nicht mehr passiert, ist, dass ihnen einer rät, sie sollten es mit Wissen probieren, das hätte sich auch beim Brückenbau, Fernsehen und in der Raumfahrt bewährt. Eine Zurückweisung ihres Bedürfnisses nach einer geheimen Wirkkraft und ihrer Personifizierung, zu der sie bei all den nützlichen und müßigen Verrichtungen im Leben in Beziehung treten, ist jetzt nicht mehr zu haben: Sie brauchen auch nichts mehr wissen zu wollen – denn, als hätten sie ein mühseliges faustisches Forscherleben hinter sich: es hätte ja nichts gebracht! –, weil sie gerade fündig geworden sind. Der Zugang zum Glauben an den Herrn ist geschafft, so dass im Wege der kirchlichen Betreuung einer Bewährung im Gottesdienst, in dem der Gemeinde wie im gewohnten Leben, nichts mehr im Wege steht. Der „Dienst an Brüdern und Schwestern“ dreht schlicht den Spieß um: Das Bedürfnis des Glaubens kommt nur auf seine Kosten, indem es sich in den Dienst Gottes und der Kirche stellt. Das Bedürfnis der Sinnsuche bleibt das einzige, das die Seelsorger unkritisiert respektieren; dafür fallen sie über ziemlich viele andere Begierden des Gläubigen gnadenlos her. Und fordern von ihm nichts Geringeres als eine lebenslange Selbstkritik nach dem Rezept, das Bibel, Dogmen und andere Hirtenworte hergeben. So befleißigen sich die „Menschenfischer“ – die Metapher aus der Petrus-Geschichte verstehen die missionierenden Geistlichen nicht als Schimpfwort, sondern als Kompliment – der Sorge um die Seelen: Sie bilden bei allen Leuten, die sie am passenden Zipfel ihres falschen Bewusstseins erwischen, ein möglichst nachhaltiges Gewissen aus, verpflichten damit deren Willen auf die Belange der Kirche – in der Gemeinde wie außerhalb –, weil der Mensch als Werkzeug Gottes sich genau das schuldig ist und darin seine Erfüllung findet. Die Seelsorger, denen die Heuchelei vom Dienst am Menschen und von der Einheit von Kirche und Gläubigen so zur innersten Überzeugung wird, dass sie ihnen glatt auf die Physiognomie schlägt, suchen in ihrem Gottesamt diese Art von Macht über die Menschen – und haben auch keinerlei Bedenken, unter Umgehung der anstrengenden Missionierung ihr Handwerk an Kindern auszuüben, die ihnen eine ihnen gewogene Gesetzgebung in den Unterricht bugsiert.
Und wie gesagt: Nicht nur der Staat, der wie seine „Wirtschaft“ ein solides falsches Bewusstsein des von ihm wie vom „Wachstum“ abhängigen Volkes braucht, damit es in aller Willensfreiheit alle verordneten, weil von Sachzwängen diktierten Notwendigkeiten mitmacht, genehmigt diese freie Ausübung der Religion. Auch die kritischen Geister des relativ vollkommensten Gesellschaftssystems auf Erden finden nichts dabei: Ziemlich große Sekten betreiben die Organisierung und ideologische Festigung einer unwissenden, weil gläubigen Demutshaltung, um sie zu benutzen; aus einem nicht aussterbenden Sonderfall falschen Bewusstseins machen sie ihr spezielles Geschäft.
5. Kirche & Staat heute
Mit ihrem Zugriff aufs Denken und Wollen einer Sinn suchenden Menschheit ist die Geistlichkeit aktiver Bestandteil jener Gesinnungswirtschaft, die noch jede politische Herrschaft lebenswichtig findet, weil sie die Loyalität der ihr untertanen Bürger braucht. Mit der stets konfliktreichen Symbiose von „Thron & Altar“ ist es freilich vorbei, seit der moderne bürgerliche Staat, der mehr auf Kapitalwachstum und militärischer Stärke als auf Glaubensartikeln gründet und das auch programmatisch zu seiner ‚Räson‘ erklärt, die Vormundschaft der Kirchen über Weltanschauung und Lebensmaximen der Gesellschaft als hinderliche Konkurrenz zu seiner freien Verfügungsmacht über die allgemein zu akzeptierenden gesellschaftlichen Lebensbedingungen erkannt, in Frage gestellt, die Frage auf seine Art per Gesetz und mit Gewalt beantwortet und die geistlichen Amts- und Würdenträger gründlich in die Schranken gewiesen hat. Beschränkt ist deren Autonomie beim Missionieren, Verkündigen, Zurechtweisen usw. nämlich nicht mehr bloß in dem Sinn, dass die weltliche Obrigkeit von den Kanzeln gefälligst nur Lobendes über ihre Tätigkeit und ausdrückliche Anstiftung zu staatsbürgerlichem Gehorsam hören will, sondern noch in einem grundsätzlicheren Sinn: Die höchsten Gewalten dekretieren die Gleich-Gültigkeit aller – oder fast aller – Konfessionen, lassen sogar das offene Bekenntnis zum Atheismus zu und schieben so jedem frommen Versuch, vermittels alternativer Willensbildung im Zeichen des Glaubens konkurrierend zum staatlichen Gewaltmonopolisten weltliche Macht auszuüben, einen Riegel vor.
Mit dem ganzen altehrwürdigen Hokuspokus aufgeräumt haben sie freilich nicht. Nachdem der moderne säkulare Rechtsstaat sich – und zwar weiß Gott nicht mit den Mitteln des herrschaftsfreien Dialogs – gegen die Macht der Kirche durchgesetzt hat, schließt er mit den Besiegten einen historischen Kompromiss: Sie bekommen einen herausgehobenen Platz in seinem Herrschaftsgefüge. Unter Achtung seines Gewaltmonopols dürfen sie sich breit machen, sollen diese Konzession sogar ausgiebig wahrnehmen und im Rahmen der geltenden Ordnung durchaus in Eigenverantwortung das Stück politisch relevanter Macht ausüben, das mit der organisierten Einflussnahme auf Überzeugungen und Lebensentscheidungen einer größeren Menschenanzahl allemal verbunden ist.
Für dieses großherzige Entgegenkommen haben die Vertreter der Idee des säkularen Staates gute Gründe; und die erzählen sie auch offen her, wenn sie – oft ohne nähere Spezifikation, gerne aber auch explizit die christlich-abendländischen – Werte als den unverzichtbaren Kitt ihrer Gesellschaft beschwören und sogar, obwohl selber von morgens bis abends mit dem Einsatz staatlicher Gewalt befasst, überlieferte Ideenwelten zum Fundament ihres Gemeinwesens erklären. Die dick aufgetragene Heuchelei braucht man ja nicht für bare Münze zu nehmen; aber so viel geht daraus schon hervor, dass die viel gepriesene aufklärerische Formel, die der alte Kant dem Alten Fritz in den Mund legt: Räsoniert, so viel ihr wollt, aber gehorcht!
, eben doch nicht die ganze Wahrheit über den Staatsbürger im modernen Klassenstaat ist. Auch der ‚räsoniert‘ nämlich beim Gehorchen; ein passendes Räsonnement möchte es daher schon sein, das er anstellt. Womit ein richtiges schon mal ausgeschlossen ist; solche Erkenntnisse über Grund und Inhalt von Herrschaft und Dienst im bürgerlichen Gemeinwesen geben niemals gute Gründe fürs Mitmachen her. Aber auch falsche Überlegungen können für das große Ziel allgemeiner Loyalität ganz unzweckmäßig sein, sogar zu Widerspenstigkeit verführen; und mit dem im Grundrecht auf Meinungsfreiheit erlassenen Verbot, der freien Meinung die gemeinten Taten folgen zu lassen, ist es auch für liberale Anwälte der Lizenz, sich nach Belieben alles denken zu dürfen, nicht getan. Auch die verspüren das unabweisbare Bedürfnis, ja die „staatspolitische“ Notwendigkeit, sich des Willens der Bürger zu versichern und deswegen deren freie Willensbildung ein wenig zu lenken – eine politische Sehnsucht, die nicht nur das stets präsente Misstrauen der Machthaber, moderner Demokraten nicht anders als alter Diktatoren, in die staatsbürgerliche Folgsamkeit ihrer Bürger verrät; sie offenbart auch ihre Kenntnis des Erfolgsgeheimnisses stabiler Herrschaft: freiwilliges Mitmachen.
Dem freien Willen auf die Sprünge helfen: Das geht freilich auf vielerlei Weise; das hat die ‚politische Klasse‘ des kapitalistischen Klassenstaats irgendwann begriffen und auch, wie kontraproduktiv es ist, die Legitimation ihrer Macht an ein ganz bestimmtes, zwar nützliches, andere genauso nützliche Alternativen jedoch ausschließendes Dogmensystem zu binden. Deswegen hat sie das große Prinzip der weltanschaulichen Neutralität der Staatsgewalt durchgesetzt, ihren Untertanen die entsprechende Tugend der Toleranz verordnet – und damit alles andere als ihr Desinteresse an den im Volk zirkulierenden Überzeugungen dokumentiert und für gleichgültig erklärt, was da gedacht wird. Mit dem Grundsatz der zugestandenen Gedankenfreiheit will der bürgerliche Staat nichts von dem wegschmeißen, sondern im Gegenteil alles ausschöpfen, was an falschen Räsonnements mit dem Ergebnis guter Gründe für staatsbürgerlichen Gehorsam im Angebot ist; was immer an zweckmäßig affirmativer Gesinnung zu mobilisieren ist, will er freisetzen. Und alle verantwortungsbewussten bürgerlichen Politiker, auch die Freigeister unter den mehr ideell Sorgeberechtigten, wissen, was sie in der Hinsicht an den christlichen Kirchen haben.
Denn darin sind sie sich sicher: Wer glaubt – und dabei nicht auf ultramontane oder gar islamistische Aufwiegler, sondern auf ordentliche, in der Landessprache predigende Gemeindevorstände und „Hirtenbrief“-Verfasser hört –, der „räsoniert“ garantiert richtig. Nicht nur, dass er in der Zeit, die er im Gottesdienst verbringt, keine dummen Sachen macht: So einer ist mit Verstand und Gemüt damit befasst, schlechte Erfahrungen, die zu einem systemwidrigen Erkenntnisinteresse und womöglich zu irgendeiner Sorte Widerstand führen könnten, konstruktiv, nämlich zu einer gottgewollten Bewährungsprobe zu verarbeiten. So jemand macht aus allen Übeln der Welt sich ein Gewissen, lässt sich dazu anleiten, den Folgen von Ausbeutung und Gewalt daheim und auswärts mit nächstenliebender Einsatzbereitschaft zu begegnen, und fügt den Opfern, die weltliche Mächte schaffen, geduldig sein eigenes hinzu. Das gehört nämlich allemal zur praktischen Quintessenz der Erziehung, die die Geistlichkeit ihrem Kirchenvolk zuteil werden lässt. Und eben das schätzt die weltanschaulich neutrale Staatsgewalt an ihren frommen Körperschaften so hoch, dass sie denen im Übrigen alle Freiheiten lässt, ihre innere Autonomie respektiert und sich wirklich nicht weiter darum kümmert, was sie in Sachen „Nachfolge Christi“ sonst noch alles meinen und predigen; in manchen Ländern sammelt sie sogar Steuern für sie ein, finanziert Militärpfarrer und Theologieprofessoren und mutet dem Kapital an jedem siebten Tag und sogar an etlichen Feiertagen einen geschäftsschädigenden Stillstand zu. Zum Ausgleich für Letzteres bedient sich der bürgerliche Sozialstaat auch ganz materiell an der kirchlich organisierten Glaubenspraxis: Einen guten Teil der sozialen Nöte, die seine Marktwirtschaft produziert und die seinen knapp gehaltenen Sozialkassen über den Kopf wachsen, schiebt er karitativen Einrichtungen der Kirche zu. Alles, was an frommer Opferbereitschaft auf die Beine gestellt wird, nutzt der ‚arme Staat‘ hemmungslos aus und überantwortet dafür ganze Unterabteilungen seines gesellschaftlichen Lebens, sogar Teile des öffentlichen Schulwesens, an die kirchliche Regie.
Die Trennung von Kirche und weltlicher Macht wird mit alledem nicht widerrufen; vielmehr bringt der bürgerliche Rechtsstaat, der sie durchgesetzt hat, deren Zweck und Inhalt auf den Punkt: Die Entmachtung der Geistlichkeit bedeutet die Indienstnahme des von ihr organisierten Glaubenslebens durch den irdischen Gewaltmonopolisten und wird mit einem Ehrenplatz und einer gesetzlich verbürgten Sonderstellung im System der säkularen Macht honoriert. Den Anspruch der Diener Gottes, die Menschen in ihrem sittlichen Gemüt ideologisch und praktisch zu lenken, hat der bürgerliche Staat gebrochen: nicht, um seine Bürger von derartiger Bevormundung zu befreien, sondern um genau die in allen brauchbaren Spielarten für sich zu funktionalisieren; er hat die Kirche entmachtet, um den Nutzen ihrer Macht für sich mit Beschlag zu belegen.
Dieses Verhältnis weiß die Kirche mittlerweile auch ihrerseits zu schätzen. Sie wehrt sich nicht mehr dagegen, dass sie ihre im Glauben begründete Herrschaft über ihre treuen Seelen und ihre ideelle generelle Richtlinienkompetenz in Fragen dessen, was sich gehört, im Rahmen einer säkularen Rechtsordnung auszuüben hat. Sie tut das, schöpft und testet diesen Rahmen ausgiebig aus und stört sich nicht weiter daran, dass ihr Wirken ein Beitrag zum gemeinen Wohl und Wesen sein soll. Im Gegenteil: sie empfiehlt sich mit ihren volkserzieherischen wie sozialpflegerischen Leistungen als wertvolle, unverzichtbare, in ihrer Eigenart unbedingt anerkennenswerte Stütze „auch und gerade“ der modernen Gesellschaft mit ihrem großen Bedarf an „Orientierung“. Als Institution, die sich einerseits nur der Sorge um die Seelen der Menschen annimmt, betätigt sie sich andererseits als soziale Betreuungsanstalt eigenen Rechts sowie als dauerhafte außerparlamentarische ‚Kraft‘ – mal mehr auf Regierungs-, mal mehr auf Oppositionsseite –; und als ‚ständige Vertretung‘ ihrer Anhänger bringt sie es zu Verbesserungsvorschlägen in allen großen Fragen der Politik, die bei den Mächtigen auch durchaus Gehör finden. Friktionen zwischen ihren dogmatischen Vorstellungen von einer einwandfreien christlich-freiheitlichen Lebensführung und den Maximen, die im Zuge der routinemäßigen gesetzlichen Bewirtschaftung eines kapitalistischen Standorts erst auf die politische Agenda geraten und dann für den bürgerlichen Willen verbindlich werden, bleiben da freilich nicht aus. Denn keineswegs alles, was ein moderner Staat in Fragen der sozialen Gerechtigkeit für schlicht notwendig erachtet und seinen Bürgern als zusätzliche „Schicksalsprüfung“ aufhalst, passt zu den Vorstellungen, die etwa eine katholische Soziallehre im Hinblick auf eine von Gott allenfalls noch gewollte Kombination von Armut und innerlicher Glückseligkeit im Repertoire hat; und die moderne staatliche Toleranz beim Umgang mit den Freiheitsrechten von schwangeren Frauen, Singles und anderen Abartigen verstößt im Weltbild der Kleriker ohnehin gegen alles, was Gottes Plan seit Adam und Eva und Sodom und Gomorrha dem Menschen als Weg seiner Besserung weist. Aber zum Aufstand gegen die Macher und Gestalter der rechtlichen Fluchtpunkte des weltlichen Sittengesetzes raten Gottes Diener deswegen noch lange nicht. Die Wortmeldungen zum Kindsmord, die das Entfernen eines Zellhaufens auf dem Mutterkuchen für sie nun einmal darstellt, lassen sie sich zwar ebenso wenig verbieten wie die obstinate Nörgelei an allem, was sie als Schändung des Sakraments der Ehe oder sonst einer Heiligkeit identifizieren; sogar ‚Kapitalismuskritik‘ ist von den wackeren Streitern gegen das Teufelswerk des Materialismus manchmal zu vernehmen. Sie lassen dabei aber schon auch wissen, wie ihre Meckereien von ihrem staatlichen Adressaten wie vom Publikum ihrer Gemeinde aufzufassen sind, nämlich keinesfalls als Einstieg zur Wiederaufnahme eines Kirchenkampfs gegen den weltlichen Staat und für die Aufhebung der Trennung, die es nun einmal zwischen dem einen überirdischen und den vielen wirklich regierenden Herren gibt. Eher zeugen ihre Einmischungen ins politische Alltagsgeschäft vom Gewicht, das die Kirchen bei der arbeitsteiligen Betreuung der sittlichen Gesamtkörperschaft ‚Volk‘ und seiner Gesinnung haben, vom Staat auch zugesprochen bekommen – und deswegen manchmal auch gegen ihn in Anspruch nehmen. Auch sie verstehen sich aufs Zitieren von Unzufriedenheit – eben der aller Gläubigen mit dem aktuellen Stand der Gerechtigkeit im weltlichen Betrieb. Aus Verantwortung gegenüber Gott müssen sie das tun, und in Verantwortung für das Gelingen der gottbefohlenen Sittlichkeit auf Erden tun sie es dann regelmäßig so, wie es sich gehört in einem säkularisierten Staat. Wenn der Staat Abtreibungswillige schon nicht am Fötenmord hindert, dann springen sie eben stellvertretend für Staat und Gott ein und machen, so gut sie können, den Schwangeren im Wege einer ‚Beratung‘ ihr Drangsal auch noch zur genuin christlichen Gewissenshölle.
*
Per Saldo arrangieren sich beide Seiten miteinander: Die weltliche subsumiert – mit all dem Zynismus, der einer bürgerlichen Herrschaft in Angelegenheiten des Höheren und Erhabenen eigen ist – den organisierten Glauben unter seine nützlichen Dienste als Motiv für unverwüstliches Mitmachen; die geistliche Seite nimmt sich – mit dem Opportunismus, auf den sie im bürgerlichen Staat zurückgeworfen ist – jede soziale Funktion, für die sie gebraucht, jedes Stück Anerkennung, das ihr zugestanden wird, und genießt die öffentliche Heuchelei, mit der die höchsten Gewalten bisweilen sich und sogar ihre Waffen segnen lassen, so als käme ihre Legitimität letztlich doch von ganz oben. Dabei sind Kirche und Staat sich im Laufe eines einzigen Jahrhunderts schon auf unterschiedliche Arten handelseinig geworden.
Faschistische Regenten haben gemeint, sie wären es ihrem Antikommunismus und Antimaterialismus schuldig, sich mit ihrer Herrschaft gleich auf einen allerhöchsten Auftrag – der Vorsehung z.B. – zu berufen, vor dem ihr gesamtes Volk bedingungslos strammzustehen hat. Etliche dieser Führerfiguren haben die nationale Kirche zur Beglaubigung dieses Erweckungsrufs herbeizitiert. Die hat sich, gegen die Opposition einer kleinen radikalen Minderheit, dazu auch verstanden. Sie vermochte in der faschistischen „Gleichschaltung“ der Klassengesellschaft und der gewaltsamen „Klassenscheidung“ zwischen anständigem Volk und kommunistischen Volksverderbern leicht ihr eigenes Ideal eines sittlich geeinten Gottesvolks wiederzuerkennen; außerdem wurde ihr das Plazet für die weltliche Diktatur mit viel ehrender Anerkennung, bisweilen sogar mit dem Status einer zusätzlichen Gesinnungspolizei vergütet. Dass den Kirchenbeamten unter irgendeinem Duce, Caudillo oder Pinochet oder wegen eines ortsüblichen staatlichen Gemetzels der Spaß am Gottesdienst vergangen wäre, ist nicht überliefert. In Hitlers Deutschland sind immerhin einige Bischöfe protestierend vorstellig geworden, weil die Auslöschung „lebensunwerten Lebens“ ihnen dann doch zuviel der Amtsanmaßung durch eine weltliche Obrigkeit war, ein flagranter Übergriff in die Entscheidungskompetenz des Schöpfers allen Lebens; und dass der regierende Rassenwahn nicht einmal vor konvertierten Juden Halt machte, ging ihnen auch zu weit. Die definitive Kündigung jeden Einvernehmens mit dem Nazi-Staat kam dann nach dessen bedingungsloser Kapitulation vor der Demokratie.
Dass nicht unbedingt diese Machart bürgerlicher Herrschaft, wohl aber die weltlichen Gewalten, die sich für ihre Belange auf vorbildliche, nämlich erfolgreiche Weise demokratischer Methoden bedienen, auch vom Glaubensstandpunkt aus als unbedingt gottgewollt und prinzipiell gottgefällig zu bewerten sind, ist dann ziemlich bald klar geworden; umgekehrt fanden die Chefs der demokratischen Staatenwelt am organisierten Christentum politisches Wohlgefallen.
- An manchen nationalen Standorten haben sich ganz normale demokratische Parteien, denen es um den Erfolg von Kapital und Staatsmacht in der globalen Konkurrenz der Firmen, Gelder und Nationen und überhaupt nicht ernsthaft darum geht, dass ihr Gemeinwesen vor den prüfenden Auge Gottes besteht, des Namens Christi bemächtigt, um von den Kirchen eingefangene Seelen für sich als Wähler zu mobilisieren. In einigen Fällen haben sich auch Vatikan-treue katholische Parteien nach verlorenem „Kirchenkampf“ zum parlamentarischen Sammelbecken unzufriedener Gläubiger gemausert und den Weg in die „politische Mitte“ gefunden. Die Funktionalisierung des Glaubens für eine affirmative politische Willensbildung ist so in gute Hände gekommen. Bei der frommen Gemeinde ist diese neue Symbiose von Parteienmacht und Altar auf wenig Protest gestoßen. Das Konkurrenzkalkül der christlichen Politiker geht noch immer ganz gut auf, weil umgekehrt die offiziellen Kirchen – gegen die Opposition einer kleinen radikalen Minderheit, die christliche Gesinnung nicht bloß bei einer Partei finden will – ihren Namen gerne für demokratische Wahlkämpfer hergeben, die ihnen Einfluss auf die Gesetzgebung in Streitfragen der nationalen Sitten sowie feste Posten in sämtlichen Ethik-Kommissionen garantieren.
- Gegen den großen Hauptfeind des freiheitlichen Kapitalismus, den im 2. Weltkrieg siegreichen Sowjet-Kommunismus, hat der organisierte Christusglaube für sich selbst, gegen seine angekündigte Abschaffung gekämpft; in den höheren Sphären der philosophischen Auseinandersetzung zwischen Diamat und Schöpfungsglaube, aber vor allem, wo immer man ihn gelassen hat, um das Gemüt von Völkern, die die Frage nach dem Sinn eines Lebens im ‚real existierenden Sozialismus‘ einfach nicht los geworden sind. Zu einer Art ‚historischem Kompromiss‘ ist es auch da gekommen, was im Rückblick den Kirchenmännern als zu weit getriebener Opportunismus übel genommen wird; dabei haben damit in Wahrheit die regierenden Staatsparteien ihre Niederlage im Kampf um die Zustimmung ihres Volkes eingestanden, die ja nicht mehr auf prinzipieller Opferbereitschaft, sondern auf begründeter materieller Zukunftshoffnung beruhen sollte. Mit der Wahl eines polnischen Bischofs zum Papst ist die katholische Kirche dann in die Offensive gegangen; und zwar keineswegs bloß für das Recht auf ein ungestörtes innerliches Zwiegespräch mit Gott: Es ging ihr um den Status einer machtvollen, nicht zu übergehenden Basisorganisation des wahren Polentums, des Platzhalters für einen wahrhaft nationalen neuen Staat. Den neuen Nationalstaat hat sie bekommen; freilich in Gestalt einer Demokratie, in der sich die Landeskirche mit ihrem Re-Katholisierungs-Programm dann doch „bloß“ in der Rolle eines parlamentarisch immerhin gleich mehrfach vertretenen Teils der polnischen Volksgemeinschaft wiederfindet. Weniger zwiespältig fällt der Ertrag fürs demokratische Weltsystem aus: Nato und ‚Globalisierung‘ triumphieren uneingeschränkt über den „proletarischen Internationalismus“ des einstigen Sowjet-Blocks, auch dank der frommen Intransigenz des katholisch-polnischen Nationalismus. Ihren Dank haben die Häupter der imperialistischen Welt der Leiche des polnischen Papstes abgestattet, was wiederum dem Stellenwert seiner Kirche im globalen Machtgefüge ohne Zweifel gut getan hat.
- Was schließlich die Führungsmacht und das Maßstäbe setzende Musterland der Demokratie, die USA betrifft, so trennt dieser Staat so strikt wie sonst kaum einer verfassungsrechtlich und in aller Form zwischen weltlicher Macht und Religion – auch wenn jede Dollar-Note vom Gottvertrauen der Nation berichtet –, verfügt Bekenntnisfreiheit im Innern, erhebt nach außen, gegen den Rest der Welt, das ‚Menschenrecht‘ auf freie Religionsausübung zu einer der entscheidenden Scheidelinien zwischen guter und Schurken-Herrschaft. Und nicht erst, aber auch nicht zuletzt mit der Figur eines Präsidenten, der keine Ansprache ohne Herabrufung des Segens Gottes auf sein Volk und seine Zuhörer ausklingen lässt, der jede Kabinettssitzung mit einem Gebet eröffnet und das auch aller Welt mitteilen lässt, der mit einem intimen Bekehrungserlebnis, das ihn vom Suff weggebracht hat, öffentlich und auch noch erfolgreich für sich als Bestbesetzung für den Posten des obersten Macht- und Befehlshabers wirbt, der, ohne mit der Wimper zu zucken, einen guten Draht aus dem Oval Office zu Gott zur unerlässlichen Grundqualifikation für den Job des „mächtigsten Mannes der Welt“ erklärt: mit diesem Inbegriff der Bigotterie stellt das große „Land der Freien“ klar, wie seine säkularstaatlichen Grundprinzipien gemeint sind. Nämlich so: Religionsfreiheit ist die Freiheit jedes einzelnen Amerikaners, sich auf seine ganz persönliche Art möglichst täglich und möglichst gemeinsam mit Gleichgesinnten zu dem Gott zu bekennen, den Amerika als einzige Instanz über sich anerkennt, weil der sich auch umgekehrt Amerika als sein auserwähltes Land unter sich ausgeguckt und zur unschlagbaren Erfolgsnummer unter allen Völkern gemacht hat; deshalb dürfen hartnäckig gottlose, ansonsten aber gutwillige Mitbürger sich auch ohne expliziten Gottesbezug zur Fahne und zu der nationalen Grundwahrheit bekennen, dass die USA die Nr. 1 auf dem Globus sind. Religionsfreiheit ist insbesondere die Freiheit für jede Kirche, Sekte, Gemeinde, ihren Gott als den Herrn zu interpretieren, den Amerika in so exklusiver Weise über sich stellt, ihren Kult um diesen Gott als attraktive Spielart des ‚american way of life‘ zu inszenieren und sich damit in die freie Konkurrenz um Mitglieder zu stürzen; zu so einer Konkurrenz sind alle Weltreligionen zugelassen, auch – von wegen „Kreuzzug“! – streng gläubige Anhänger Mohammeds und seines ‚heiligen Koran‘. Religionsfreiheit als weltpolitisches Unterscheidungskriterium und als Imperativ für andere Staaten ist das Gebot an alle Machthaber, den Geist dieser freiheitlich-amerikanischen Gottgefälligkeit in ihrem Land Einzug halten zu lassen und dafür allen missionarischen Sekten und frommen NGOs aus den Vereinigten Staaten eine uneingeschränkte Konzession zu erteilen. So nimmt die Demokratie als Weltmacht die Religion in ihre Dienste und spendiert ihr dafür einen festen Vorzugsplatz im System der hohen Meinung, die der amerikanische Imperialismus von sich hat.
Und dann wird auch noch ein Bayer Papst. Was will die Kirche eigentlich mehr?
6. Harte Zeiten für den Glauben
Der Heilige Vater in Rom ist nicht zufrieden. Noch mitten in der Euphorie der Trauer um seinen seligen Vorgänger, zwischen Leichenbegängnis und Konklave, findet er eindringliche Worte gegen ein Übel, das den Geist der Zeit bestimmt und dem die Kirche mit einer dogmatisch klaren Linie begegnen muss: Relativismus
hat sich breit gemacht, moralische und ideologische Oberflächlichkeit, eine Kultur der Beliebigkeit
, die speziell im ehedem christlichen Abendland das religiöse Leben vielerorts schon beinahe zum Verschwinden gebracht hat.
Darüber macht der Mann sich jedenfalls nichts vor: Wenn zu Beginn des dritten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung seiner Kirche etwas zu schaffen macht, dann weder staatliche Unterdrückung noch ein mächtiger Konkurrenzverein, sondern schlichtes Desinteresse ihrer Adressaten. Dass er denen das zum Vorwurf macht, ist verständlich; als unfehlbarer Chef ist er schließlich schon von Berufs wegen von der Unverzichtbarkeit der christlichen Botschaft mitsamt ihren Botschaftern, von der Unersetzlichkeit wie der Unvergänglichkeit seiner alleinseligmachenden Organisation überzeugt. Das ändert aber nichts an dem ernüchternden Befund: Ganz viele und immer mehr Leute, vor allem ausgerechnet in traditionell christlichen Ländern, halten den Glauben und erst recht die Kirche, die für dessen unverfälschte Verkündigung gerade steht, für entbehrlich; sie kämpfen sich nicht einmal daran ab, sondern lassen das Christentum einfach links liegen; die Basis der Gemeinde schrumpft. Und das ist – ganz unabhängig davon, was für ein verheerendes Zeugnis sich der Ungeist der Zeit damit selber ausstellt – ganz schlecht für die Kirche; in mehrerlei Hinsicht. Es schwindet die ‚kritische Masse‘, die sie braucht, um ihrem Selbstverständnis gemäß als Volkskirche gelten zu können; als Institution, die über einen an eine gewisse Kontrollmacht heranreichenden Einfluss auf Weltsicht und Benehmen „des Volkes“ verfügt, kann sie bald kaum mehr auftreten. Ihre Konzession, sich im bürgerlichen Staatswesen als mitgestaltende Kraft aufzuführen, wird vielleicht nicht explizit gekündigt; sie kann damit aber nichts Großes anfangen, wenn sie dem bürgerlichen Staat nicht mehr mit ihrer großen Anhängerschaft, am Ende womöglich nicht einmal mehr einer ihr grundsätzlich gewogenen Partei mit mobilisierbaren Wählerstimmen zu imponieren vermag.
Dass das Kirchenoberhaupt dieser gefährlichen Entwicklung auf gar keinen Fall mit Anpassungsbemühungen opportunistisch Rechnung tragen, sondern mit einem Fundamentalismus, den es sich nicht als solchen beschimpfen lässt, entgegentreten will, verrät sicherlich eine starke Sehnsucht nach jenen „alten Zeiten“, als der sonntägliche Kirchenbesuch als Familienangelegenheit noch die bürgerliche Norm und sogar weithin praktizierte Normalität war; als Predigt und Hirtenbrief noch nicht in Zweifel gezogen wurden; als die Jugend schon allein mangels Alternativen in kirchlichen Gruppen heran- und in die Gemeinde hineinwuchs; als vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr noch als Sünde das Gewissen belasteten; kurzum: als die abendländische Welt tatsächlich noch ein bisschen so aussah, wie der aufgeklärte Zeitgeist von heute es der „islamischen Parallelgesellschaft“ als verstockte Rückständigkeit vorwirft. Wie immer es um Sitte und Moral in Josef Ratzingers Jugendzeit wirklich bestellt gewesen sein mag: Ganz erheblich gewandelt haben sie sich tatsächlich; und Recht hat der neue Papst zweifellos auch darin: Die Versuche der Kirche, „mit der Zeit zu gehen“ und sich zum Wandel der abendländischen Sittlichkeit so zu stellen, als hätten fortschrittliche Kleriker ihn erfunden, haben sich nicht ausgezahlt.
Wie auch! Was sich da im Laufe einer halben Generation an den ideologischen und moralischen Selbstverständlichkeiten, die man ‚Zeitgeist‘ nennt, verändert hat, betrifft das kirchliche Angebot an religiöser Unterweisung und Seelsorge keineswegs nur in Methodenfragen des gewinnenden Auftretens und der glaubwürdigen Vermittlung. Die despektierliche Kritik, der sich die Amtskirche mitsamt ihrem umfangreichen Besitzstand an öffentlicher Heuchelei seitens einer „skeptischen“ Nachkriegs-„Generation“ ausgesetzt fand, richtete sich zwar bloß gegen „erstarrte“, „unverständlich gewordene“, ohne Sinn und Verstand mitgeschleppte „alte Rituale“; die „Basis“ würde viel zu wenig „demokratisch beteiligt“; das klerikale „Establishment“ wäre „nicht auf der Höhe der Zeit“ und weit weg von den „wahren Problemen der Menschen“, insbesondere von den Nöten der Armen in der „Dritten Welt“ und deren Bedürfnislage völlig entfremdet, weil „den Mächtigen“ gegenüber zu opportunistisch usw. Und diese Vorwürfe waren – und sind, soweit sie heute noch oder wieder von eifrigen „Basisgruppen“ erhoben werden – alles andere als der Auftakt dazu, sich von der Bevormundung freizumachen, die auf so zopfige Weise und mit so reaktionärer Schlagseite daherkommt und deswegen mehr nervt als begeistert. Da haben selbstbewusste Kirchenbürger im Gegenteil bei ihren fehlbaren Hirten den Antrag eingereicht – und tun das noch –, besser, überzeugender, zeitgemäßer angeleitet zu werden und an ihrer eigenen Bevormundung aktiver mitwirken zu dürfen. Diesem Begehren konnte entsprochen werden und wurde entsprochen: Die Liturgie wurde flotter, der Pfarrer verständnisvoller, sogar manches Dogma interpretationsfähiger und auf alle Fälle die Gestalt Jesu „lebensnäher“. Doch schon in dem unschuldigen, ganz und gar lieb gemeinten Wunsch, beim kollektiven Gotteslob sich „mehr einbringen“ zu können, mit Rock-Musik z.B. und selbstverfassten Meditationen, deutet sich die psychologische Wende der bürgerlichen Moral an, die mittlerweile „die Massen ergriffen“ hat und der kirchlichen Botschaft den erfolgreichen Zugriff aufs modernisierte abendländische Individuum ziemlich grundsätzlich schwer macht.
Denn das haben diese Individuen sich von ganz anderen Autoritäten als den geistlichen: von massenwirksamen Vorbildern, „Publikumslieblingen“, „Traumfrauen“ resp. „-männern“, von Lebensberatern in Zeitschriften, freischaffenden Psychologen, einer neuen Generation von Lehrern und Journalisten usw. ziemlich schnell beibringen lassen, dass es „heutzutage“ darauf ankommt, aus sich etwas
zu machen; dass im Grunde ein jeder das Zeug, das „human capital“ für seinen persönlichen Lebenserfolg mitbringt und alles daran setzen muss, diese Talente, worin auch immer sie bestehen, ohne „Fremdbestimmung“ aus sich herauszukitzeln und sich damit durchzusetzen; dass es im Grunde nur eine „Sünde“ gibt, nämlich beim „Selbstverwirklichen“ zu versagen; und dass es für den Erfolg im Grunde nur auf eine Tugend, auf die aber ganz unbedingt ankommt: Der Mensch muss an sich glauben. Das schließt den Glauben an einen Gott, der irgendwie darüber schwebt und alles lenkt, zwar nicht unbedingt aus, ist aber doch so ziemlich das Gegenteil der Demutshaltung, der entschieden schlechten Meinung von sich und seinesgleichen und von der autonomen Leistungsfähigkeit des Menschengeschlechts überhaupt, die der Glaube an einen absoluten Herrn im Jenseits – und sei es als Heuchelei, zu der noch der selbstzufriedenste Honoratior sich aus Anstandsgründen verpflichtet weiß – voraussetzt. Wer von jedem Sport-Reporter und alsbald auch von jedem praktizierenden Sport-Idioten die Lebensweisheit vorerzählt bekommt, dass über Sieg oder Niederlage niemand anders als das Selbstbewusstsein entscheidet, und dass letztlich jeder alles vermag, was er möchte, wenn er es sich nur entschieden genug zutraut; wer von allen Seiten dahingehend belehrt wird, er würde mit seinem Leben einschließlich aller Niederlagen nur dann, dann aber ganz bestimmt gut fertig und würde auch unweigerlich „besser“, wenn er sich selber „gut“ findet: der wird vielleicht verrückt; der wird sehr wahrscheinlich zu einem Psycho, der sich selbst fortwährend als Fall, nämlich einen solchen von verhindertem Selbstvertrauen reflektiert; der wird mit ziemlicher Sicherheit zu einem Angeber von der Sorte, wie sie längst nicht mehr bloß die Reklame-Spots im Fernsehen bevölkert. Ein Sünder jedoch, der sich zwar nur vor Gott und dessen Stellvertretern, vor denen aber ganz abgrundtief erniedrigt, wird so jemand nicht so leicht; die fromme Einsicht, dass Hochmut eine der schlimmsten Verfehlungen ist, deren ein armseliges Menschenkind sich schuldig machen kann, wird ihm eher fremd bleiben. Und einer derartigen Entfremdung vom Geist der Religion ist mit einer Auffrischung des kirchlichen Erscheinungsbilds in der Tat nicht beizukommen; eher riskiert ein allzu anpassungswilliger Klerus das Missverständnis, mittlerweile fände auch der liebe Gott coole Typen besser als schuldbewusste Gewissenswürmer.
Ob diese ‚Kultur‘ der permanenten psychologischen Selbstbespiegelung wirklich „oberflächlicher“ und unernster ist als die der geheuchelten Demut und des vorauseilenden Gehorsams gegen die kirchliche Erlösungsbotschaft, wie Papst Benedikt meint, mag dahingestellt bleiben. Leichter machen sich die modernen Individuen ihr Leben damit sicher nicht; was sie sich an Sündenbewusstsein ersparen, das geben sie für das angestrengte Bemühen um erfolgreiches Angeben und für ihre unausbleiblichen „Versagensängste“ locker wieder aus. Einigermaßen unvereinbar sind psychologische und religiöse Moral aber schon; das stellt der zum Oberhirten gewählte Intellektuelle im Vatikan mit seiner Absage an den „Relativismus“ des gegenwärtigen ‚Zeitgeistes‘ von seiner Seite aus klar und mahnt seine Unterhirten zur nicht-relativistischen Pflege jener Sorte falschen Bewusstseins, die die christliche Botschaft braucht – also vorfinden oder erzeugen muss –, um daran seelsorgerisch anzuknüpfen: Das moderne Idealbild vom souveränen Individuum, das ganz auf sein großartiges ‚Ich‘ gestützt mit der Welt locker fertig wird, taugt als Messlatte für ein christliches Gewissen überhaupt nicht. Die Erfahrung, ein ziemlich kleiner Wicht im Griff „anonymer gesellschaftlicher Mächte“ und den Drangsalen dieser Welt von sich aus überhaupt nicht gewachsen zu sein, muss der Mensch sich schon eingestehen – oder, wenn er sich schon für einen großen Max hält, wenigstens zugeben, dass er aufs Ganze gesehen nicht mehr als ein Staubkorn ist, und sich durch die Perspektive beeindrucken lassen, dass er sich demnächst wieder in ein unauffälliges Häufchen Dreck zurückverwandeln wird: Dann und nur dann ist er offen für die Legende von der Erbschuld, mit der er sich das alles eingebrockt hat, und von der Erlösung, die ihn da rausholt.
Dass der Papst diese alte Dialektik von „Jammertal“ und „Opium“ für ewig jung und neu und schlechthin unvergänglich hält, ist eine Sache – was denn sonst, bei dem Beruf. Eine andere ist die Erfolgsperspektive, die er für seine nicht-relativistische Erlösungsbotschaft sieht und in der er sich durch die Massenhysterie um den Tod seines Vorgängers wie durch den mächtigen Zuspruch Anteil nehmender Staatsoberhäupter bestätigt findet. Dass das irdische Leben letztlich doch nichts anders ist als ein einziger riesiger Schadensfall, der einem ehrlich nach Sinn und Zweck des Ganzen fragenden Menschen gar nichts anderes übrig lässt, als auf eine unendlich gnädige und zugleich unendlich gerechte Entschädigung zu hoffen, das ist für ihn und seine Kirche nicht bloß ein Glaubenssatz, sondern eine Erfahrungstatsache, von der die verabscheute ‚Kultur der Oberflächlichkeit‘ zwar zeitweilig ablenken kann, so dass die Menschen sich mit materiellen Ersatzbefriedigungen – für Christen wäre sogar die Vermeidung aller Beschädigungen eines normalen bürgerlichen Lebens nichts als ein schlechter Ersatz für die große jenseitige Entschädigung – abspeisen lassen. Irgendwann bricht sie sich aber wieder Bahn, da ist die Amtskirche sich sicher – in der neuen, nach Sinn und Halt suchenden „jungen Generation“ zeichnet sich das vielleicht schon ab! Irgendwann müssen die Menschen auch im „entchristlichten“ Abendland einfach wieder merken, wie schlecht sie in ihrem Erfolgsstreben mit der gesellschaftlichen Realität und den Glückserlebnissen des freien Marktes wirklich bedient sind!
Nicht als ob die Botschafter des jenseitigen Heils sich für Europa schlechte Zeiten wünschen würden, um bei Leuten in verzweifelter Lage besser anzukommen. Aber den praktischen Beweis haben sie ja vor Augen: Katastrophen wie das Attentat auf die Twin Towers oder die Flutwelle im Indischen Ozean füllen die Kirchen; der Tod von Nahestehenden und erst recht das Näherrücken des eigenen Ablebens – dasselbe in Kleinformat – lässt auch locker-flockige Zeitgenossen in ihrem psychologischen Irrglauben an die Machbarkeit aller Erfolge irre werden und nach den „Tröstungen der heiligen Mutter Kirche“ rufen; das massenhafte manifeste Elend im Nahen und Mittleren Osten treibt den Mullahs die Massen zu – ein geradezu Neid erregendes Vorbild, das die „Religionslosigkeit“ des Alten Kontinent so richtig wie eine Altersschwäche spürbar macht! –, weckt sogar, religiös zurechtinterpretiert, eine Opferbereitschaft bis zum Tod – zwar für eine verwerfliche Sache, aber immerhin…
So schlimm muss es ja nicht kommen; wer wollte sich das wünschen. Aber harte Zeiten, das steht auch fest, sprechen seit jeher für den Glauben. Und dass es nicht immer und vielleicht gar nicht mehr lange so relativ einfach bleibt, wie der Papst es den Aposteln der „Wellness-Kultur“ vorwirft, vor dem Elend eines durchschnittlichen Erdendaseins cool und selbstbewusst die Augen zu verschließen; dass die Armut schon wächst, die die Menschen ihren wahren und eigentlichen Bedarf an geistlichem Zuspruch wieder spüren lässt; dass auch in den wohlhabenden Weltgegenden mit ihrer Massenarbeitslosigkeit eine Verwahrlosung ins Haus steht, die auch der weltlichen Gewalt den Nutzen, ja die Unentbehrlichkeit der seelsorgerischen und karitativen Volksbetreuung durch die Kirche unzweideutig klar machen dürfte: Das sieht die Kirchenleitung in Rom schon kommen. Und wenn es so kommt, steht sie jedenfalls mit klaren Richtlinien bereit. Dann ist es vorbei mit Relativismus und Wohlfühlerei als Religionsersatz. Dann kann die Kirche wieder zeigen, was sie in Sachen Volksbetörung, -tröstung, -verblödung und -befriedung vermag – mehr jedenfalls als jede weltliche Konkurrenz. Dann wird wieder geseelsorgt, dass es Gott eine Freud’ ist und den irdischen Herren ein Wohlgefallen.
[1] Heutzutage ist es eine der bequemsten Pflichtübungen einer „aufgeklärten“ intellektuellen Elite, „der Kirche“ – womit die Vorstände und Päpste gemeint sind – den Vorwurf hinzureiben, sie hätte sich nicht selten mit üblen Machenschaften weltlicher Herrschaften gemein gemacht, gar selbst einiges von der Art verbrochen. Zur Vermeidung des Missverständnisses, hier ginge es einmal mehr um die Aufdeckung von verwerflichen Verirrungen in der Kirchengeschichte, als da sind Komplizenschaft mit und „Opportunismus“ gegenüber den Schlächtern der abendländischen Tradition, folgende Hinweise: Erstens ist von Prinzipien des Schaltens und Waltens der Gottesgemeinde auf Erden die Rede, nicht von Verfehlungen. Zweitens wird auch nicht bemängelt, dass sich gläubige Menschen manchmal mit den Falschen einlassen – vielmehr besichtigt, wie sie ihr Arrangement mit den weltlichen Mächten, das andere auch hinkriegen, bewerkstelligen. Drittens geht es also auch nicht um den rückwirkenden Antrag an Päpste, sie möchten sich nicht mit dem Bösen verbünden, wo ihr Beruf doch in der Beförderung des Guten besteht. Viertens wenden diese Überlegungen sich überhaupt nicht an Hirten, um sie zur politisch korrekten Regie über diejenigen zu ermahnen, die ihnen folgen. Fünftens schließlich gehört den beliebten Kirchenführern unserer Tage das Kompliment erspart, sie würden heute alles anders machen, wenn sie sich so blendend mit Demokratie & Marktwirtschaft
arrangieren und jeden Krieg und alle Armut mit Gebeten für Frieden & Menschenwürde begleiten. Oder ist sowieso alles wieder einmal ganz anders? Und die bekannten mächtigen Demokratien des Abendlandes und der Neuen Welt sind das vorbildliche Nonplusultra weltlicher Macht, so dass einer zum Widerstand allzeit bereiten christlichen Kirche nur zwei Dinge zu tun bleiben, die sie auch brav erledigt: Sie geißelt die menschlichen Verirrungen und kapitalistischen Auswüchse, die sie im System der menschlichen Freiheit antrifft, auf dass die Glaubenswahrheiten zu ihrem Recht kommen. Und sie bringt sich als Agentur der Menschlichkeit ins Spiel bzw. in die Weltgeschichte ein, indem sie alle finsteren Herrschergestalten, die ihren Schutzmächten in die Quere kommen, im Namen Christi den umfassenden Import der Freiheit abverlangt, zu deren wesentlichen Bestandteilen das organisierte Wirken von Christen seit jeher zählt…