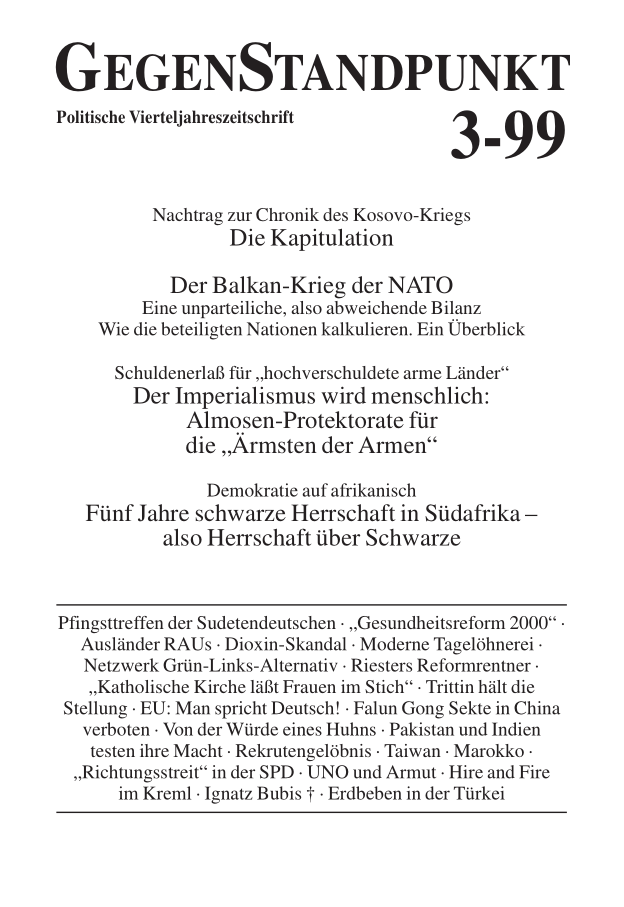Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Andrea Fischers „Gesundheitsreform 2000“:
Ein neuer Budgetdeckel auf die alte Wahrheit: Krankheit und Gesundwerden – für Lohnarbeiter einfach zu teuer
Deutsche Ärzte laufen Sturm: Aus dem geschrumpften Topf für die Kassenbeiträge sollen ihre Leistungen geringer entlohnt werden. Denn das Missverhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen beim Krankenkassentopf soll nicht zu entsprechend höheren Beiträgen führen, weil das die Lohnnebenkosten erhöht. Vilmar droht: Bei weniger Geld gibt´s eben weniger Leistung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Andrea Fischers „Gesundheitsreform
2000“
Ein neuer Budgetdeckel auf die alte
Wahrheit: Krankheit und Gesundwerden – für Lohnarbeiter
einfach zu teuer
Ministerin Fischer stellt der Öffentlichkeit ihren Gesetzentwurf zur Reform des nationalen Gesundheitswesens vor – und erntet, wie abzusehen, erneuten Aufruhr der organisierten deutschen Ärzteschaft. Denen mutet sie nämlich eine Änderung der Rechtslage zu, deren wesentlicher Gehalt sich in zwei Punkten zusammenfassen läßt: Ab dem kommenden Jahr soll für alle Bereiche des Gesundheitsgeschäfts, soweit von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert, ein gemeinsamer Finanzrahmen, ein Globalbudget gelten, das dann nurmehr im gleichen Verhältnis wie die national ausgezahlte Netto-Lohnsumme steigen darf; ein paar neue Kompetenzen für die Kassen, die Aufteilung dieses Budgets – auf Ärztehonorare, Medikamente, Kliniken, Heil- und Hilfsmittel etc. – betreffend, sollen sicherstellen, daß dieser Finanzrahmen auch wirklich nicht überschritten wird. Die Ärzteschaft sieht dadurch ihr Einkommen limitiert – zu Recht; das ist ja die erklärte Absicht des Kunstgriffs, unabhängig von allen Einzelabrechnungen ein verbindliches Gesamtbudget vorzugeben. Sie setzt die verordnete „Deckelung“ ihrer Einnahmen mit drohender Verelendung ihres ehrenwerten Standes gleich – auch das mit dem vollen subjektiven Recht von besseren Leuten, die ganz ohne erklärten Rassismus, dafür um so fragloser davon ausgehen, daß ihnen für ihre aufreibende Berufstätigkeit selbstverständlich völlig andere Vergütungen gebühren und deswegen auch ganz andere Einkommenszuwächse zustehen als jenem Großteil ihrer Klientel, der sich die nationale Lohnsumme teilt und mit den gesundheitlichen Konsequenzen der dafür erbrachten Leistung bei ihnen antanzt. Und weil Deutschlands Hippokratessen nichts klarer und geläufiger ist als der Sachzwang, im Maße der befürchteten Einkommenseinbußen ihre kostbaren Dienstleistungen am gesetzlich versicherten Krankengut einzuschränken – das nun wieder objektiv wie subjektiv völlig zu Recht in dieser besten aller marktwirtschaftlichen Welten, in der es überhaupt keinen Gebrauchswert ohne eine Bezahlung gibt, die dessen sei es großindustriellen, sei es mittelständischen Anbieter reicher macht –, leiten ihre Standesvertreter aus dem Globalbudget der Ministerin Fischer ohne jedes Zwischenargument eine einschneidende Verknappung ihrer Dienste und folglich eine massive Verschlechterung der Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland überhaupt ab. Ihr oberster Sprecher, als gebildeter Mensch sehr eingebildet auf seine starken Sprüche, kokettiert mit der Beschwörung einer Wiederkehr jener alten Zeiten, in denen noch das klassengesellschaftliche Motto gegolten habe: „Weil du arm bist, mußt du früher sterben!“ Und alle medizinisch tätigen Antikommunisten der Nation sind mehr oder weniger klammheimlich begeistert von ihrem Doktor Vilmar, der es den Alt-68ern an der Regierung wieder mal gut gegeben hat.
Vilmars polemischer Spruch ist nun allerdings nicht schon deswegen ganz verkehrt, weil der Vertreter eines Berufsstands mit recht hoher Millionärsdichte und lauter Mitgliedern, die aus guten Gründen nie und nimmer mit der Einkommenslage ihrer gesetzlich versicherten Patienten tauschen möchten, damit öffentlich für die ärztlichen Geldinteressen agitiert. Tatsächlich ist es ja so, daß jene Leute, aus deren Einkommen die Statistiker der Nation Deutschlands Netto-Lohnsumme zusammenzählen, sich zwei Dinge im Grunde gar nicht leisten können: weder den Luxus, krank zu werden – weil dann nämlich nach den reinen Regeln der Lohnarbeit die Einkommensquelle versiegt, mit der die normale Menschheit zurechtkommen muß –, noch den vorab gar nicht kalkulierbaren Aufwand dafür, wieder gesund zu werden bzw., objektiver formuliert, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen und eingetretene Krankheiten dementsprechend zu unterdrücken. Eben weil der für Arbeit gezahlte Normallohn das eine wie das andere nicht hergibt, Krankheiten und Verschleiß des Arbeitsvermögens, für dessen Verausgabung der lohnarbeitende Mensch seinen Lohn bezieht, aber allemal eintreten und Therapie unumgänglich machen, hat sich ja die Staatsgewalt im zivilisierten Abendland überhaupt herausgefordert gefunden und in der bekannten sinnreichen Weise eingegriffen – nämlich Lohnfortzahlung über die eine oder andere Krankheitswoche hinweg angeordnet und Kassen eingerichtet, die von den Lohnempfängern mit gesetzlicher Autorität regelmäßig soviel Geld einsammeln, daß sich daraus im Großen und Ganzen jenes „höchste Gut“ finanzieren läßt, das im Bedarfsfall, wenn es nämlich erst einmal abhanden gekommen ist, für den einzelnen absolut unerschwinglich ist und bleibt. Am entsprechend geschmälerten Nettolohn hat der lohnabhängige Patient dabei stets bemerken können, daß die sozialfürsorglichen Vorkehrungen seines Staates das marktwirtschaftlich-lohnsystematische Prinzip des Ganzen – daß abhängig Beschäftigte sich Kranksein und Gesundwerden nicht leisten können – keineswegs außer Kraft setzen und aus der Welt schaffen. Im Gegenteil: Dieser eindeutige Grundsatz wird durch das gesetzliche Kassenwesen so hingebogen, daß die Nöte der Krankheit fachgerecht bewältigt werden – auf Kosten der Geldsumme, mit der der Durchschnittsverdiener seinen Lebensstandard insgesamt zu bestreiten hat; und auf der anderen Seite eben so, daß die Krankenversorgung zum Stoff eines Geschäftszweiges werden konnte, dessen mittelständische Agenten sich durchaus nicht mit einem Durchschnittseinkommen zufrieden zu geben brauchen. Seither gilt: Je mehr Krankheiten einerseits, je kostspieliger der ärztliche Dienst an der Lebenstüchtigkeit der zwangsversicherten Nation andererseits, um so tiefer der Griff hinein in den individuell und insgesamt gezahlten Bruttolohn – ein wundersam selbstregulierender „Ausgleich“ zwischen der Not, gesund zu bleiben und wieder zu werden, und der Tugend, dafür ein bißchen mehr Armut hinzunehmen.
Nun weisen die Lohnabzüge, mit denen dieses System sich selbst reguliert, seit Jahren prozentual kräftig steigende Tendenz auf; hauptsächlich deswegen, weil Massenarbeitslosigkeit und Billiglohnformen die Summe schmälern, aus der diese Beiträge abgezweigt werden. Weil der Geldmangel bei den abhängig Beschäftigten steigt, steigt also außerdem das Maß, in dem sie geschröpft werden, um ihre Gesundheitsversorgung finanziell intakt zu halten – selbstverständlich ohne daß das der Gesundheit der Nation sonderlich gut bekäme. Das hat schon den christlich-liberalen Sozialreformern der vorigen Regierung schwer zu denken gegeben; und deren rot-grüne Nachfolger schreiten zu der Tat, die das Seehofer-Ministerium nie zuende gebracht hat: Sie tun einen – der Absicht nach – gut schließenden Deckel auf den Topf, aus dem die gesetzlichen Kassen die Kosten für Krankheit und Gesundheit aller versicherungspflichtigen Entgelt-Empfänger bestreiten. Das trifft die Ärzte natürlich hart und ins Mark und so weiter, praktisch dann aber doch nicht so übermäßig. Sie kündigen ja schon an, daß sie sich durch Verknappung ihrer kassenmäßig vergüteten Leistungen schadlos zu halten gedenken. Daß sie dabei einkommensmäßig nicht zu kurz kommen, steht auch schon fest; schließlich räumt der Gesetzgeber ihnen schon seit längerem allerhand Freiheiten ein, für Dinge, die die Kassen nicht mehr bezahlen, privat zu liquidieren. Daß sich so, nämlich mit der Waffe des Privatrezepts auch alle Schranken umschiffen lassen, die das Arzneimittelbudget ihrem pharmaindustriell stimulierten Verordnungsverhalten setzt, wissen sie gleichfalls aus langer praktischer Erfahrung mit den Budgetierungsversuchen der alten Regierung. Schließlich bieten die Löhne der Praxisangestellten noch einige Manövriermasse, bevor das größte anzunehmende Unheil eintritt und die wahren Leistungsträger unserer nationalen Gesundheitswirtschaft sich zu echtem Einkommensverzicht gezwungen sehen; deswegen gehen ärztliche Arbeitgeber auch schon mal gemeinsam mit ihren Helferinnen demonstrierend und trillerpfeifend auf die Straße.
Sehr viel härter als den Stand, dessen Vertreter am lautesten klagen, trifft der Budgetdeckel jedenfalls diejenigen, die im sozial-marktwirtschaftlichen Gesundheitswesen in jeder Hinsicht die Passiven sind. Die Patienten, die in ihrer Eigenschaft als Pflichtmitglieder gesetzlicher Kassen bereits eine zunehmende Schmälerung ihres Lohns hinnehmen müssen, sehen sich immer häufiger mit zusätzlichen Rechnungen konfrontiert, die sie aus dem verbliebenen Netto bezahlen müssen: Wer meint oder sich überzeugen läßt, daß das, wofür die Krankenkasse noch einsteht, nicht reicht, um bedarfsgerecht arbeitsfähig und im Alter noch munter zu bleiben oder wieder zu werden, muß eben sein privates Restbudget entsprechend deckeln und umverteilen. So meldet sich bei den Versicherten mit neuem Nachdruck das nie außer Kraft getretene Prinzip zurück – falls es denn in Vergessenheit geraten sein sollte: daß Lohnabhängige sich Krankheiten finanziell eigentlich überhaupt nicht leisten können.
Bleibt die Frage nach dem Nutznießer eines Finanzrahmens, der die Ausgaben der Krankenkassen an die Entwicklung der nationalen Nettolohnsumme bindet. Und die wird von der ökologisch-sozialen Regierung mit großem Stolz ohne Beschönigung beantwortet: die Wirtschaft. Schröders reformfreudigen Gesundheitspolitikern geht es darum, die Summe einzuschränken, die in der Lohnabrechnung der Arbeitgeber als „Nebenkosten“ figuriert. Das ist ein recht bemerkenswerter Beschluß, noch ganz unabhängig davon, wie eng die anvisierten Schranken im Endeffekt tatsächlich gezogen werden. Die Sozialpolitik übernimmt damit nämlich eine Rechnungsweise der lohnzahlenden Unternehmer, die die Logik des gesetzlich verfügten Versicherungswesens schon ein wenig auf den Kopf stellt. Tatsächlich und ihrer Zweckbestimmung nach handelt es sich bei den Zwangsabgaben an die Krankenkassen ja gar nicht um eine Zusatzkost, die den lieben Unternehmern vom Sozialstaat in Rechnung gestellt würde, sondern um Abzüge vom gezahlten Lohn, die eine Leistung erzwingen, für die das Arbeitsentgelt nicht taugt. Daß die Arbeitgeber diesen Lohnteil, weil sie ihn gar nicht erst an den Empfänger auszahlen, sondern gleich an die gesetzlichen Kassen überweisen, wie eine sozialpolitische Steuer betrachten, mit der der Staat sie bedrückt – das kann niemanden wundern und geht inmitten des marktwirtschaftlichen Wahnsinns voll in Ordnung: Kapitalisten und ihre Manager und Standesvertreter begreifen eben die Welt vom Standpunkt ihrer als gemeinnützig anerkannten Geldgier, und da ergeben sich manche Verkehrungen wie von selbst. Sie sind mit ihrem bornierten Interessenstandpunkt daher auch nie für verrückt erklärt, sondern stets ernst genommen worden. Nur haben sozial gesinnte Sozialpolitiker daneben immer auch noch die Notwendigkeit hochgehalten, von der Bruttolohnsumme als dem Betrag, den die Arbeit den Unternehmern wert ist, auszugehen und davon das für nötig Erachtete einzusammeln. Von diesem Standpunkt trennen sich die Machthaber, die jetzt daran gehen, den Sozialstaat zu reformieren. Sie wollen ganz entschieden gar nichts mehr davon wissen, wem sie mit ihren Zwangsversicherungen welche Last auferlegen, warum – nämlich weil der Lohn für Krankheit und Gesundwerden nicht reicht – und zu welchem Zweck – nämlich damit die lohnarbeitende Mannschaft ihren unternehmungsfreudigen Benutzern und ihrem gemeinwohlorientierten Staat trotzdem erhalten bleibt. Sie übernehmen vielmehr die interessiert verkehrte Sichtweise der kapitalistischen Lohnzahler, und zwar nicht mehr bloß ideologisch, sondern als Imperativ für ihre neue Sozialpolitik. Die Einkommensbeschränkung, die in Wahrheit die Lohnempfänger trifft, betrachten und behandeln sie als Last, die sie den Lohnzahlern bereiten und folglich denen erlassen oder wenigstens erleichtern müssen. Daß die Lohnsumme den Anforderungen der Krankenkassen immer weniger gewachsen ist, weil sie mit den Rentabilitätsfortschritten der nationalen Unternehmen zusammenschmilzt, verstehen die amtierenden Reformer als endgültigen Beweis, daß diese Summe so ungefähr um das, was die Kassen davon abzweigen, zu hoch ausfällt und zumindest eine weitere prozentuale Zunahme dieses Lohnbestandteils den so erfolgreich um Lohneinsparung bemühten Unternehmen auf keinen Fall zugemutet werden darf.
Im Sinne dieser modernen sozialreformerischen Logik ist das Globalbudget fürs Gesundheitswesen der Nation ein konsequenter Schachzug und Zwischenschritt; nicht mehr und nicht weniger. Ohne gleich alles wegzuschmeißen, kritisiert der Schrödersche Sozialstaat sein ererbtes System, die Krankheiten der armen Leute auf deren Kosten finanziell zu managen, als unzumutbare staatlich verordnete Lohnerhöhung und geht dazu über, die Kosten des Gesundheitsgewerbes aus dem Bruttolohn, der dementsprechend sinken darf, ein Stück weiter in das ohnehin schwindsüchtige Nettoeinkommen der Lohnarbeitermannschaft hinein zu verschieben. Er kündigt so den bisherigen „Kompromiß“ zwischen den Nöten der Krankheit und den Sachgesetzen des Lohns und erzwingt einen neuen auf Kosten des geminderten Nettolohns. Die Beitragszahler und Patienten erinnert er auf die Weise ganz praktisch daran, und seine Sachwalter verkünden das auch offensiv dazu, daß das von den Lohnabzügen gespeiste Gesundheitssystem eine „Rundumversorgung“ der Leute weder leisten kann noch leisten soll und deswegen auch gar nicht mehr verspricht.
Und die einzigen, die sich darüber aufregen, sind die Standesvertreter der Ärzteschaft, weil ihr Stand sich jetzt beim Geldeinnehmen ein wenig umstellen muß. So reibungslos funktioniert die Reformpolitik der „neuen Mitte“.