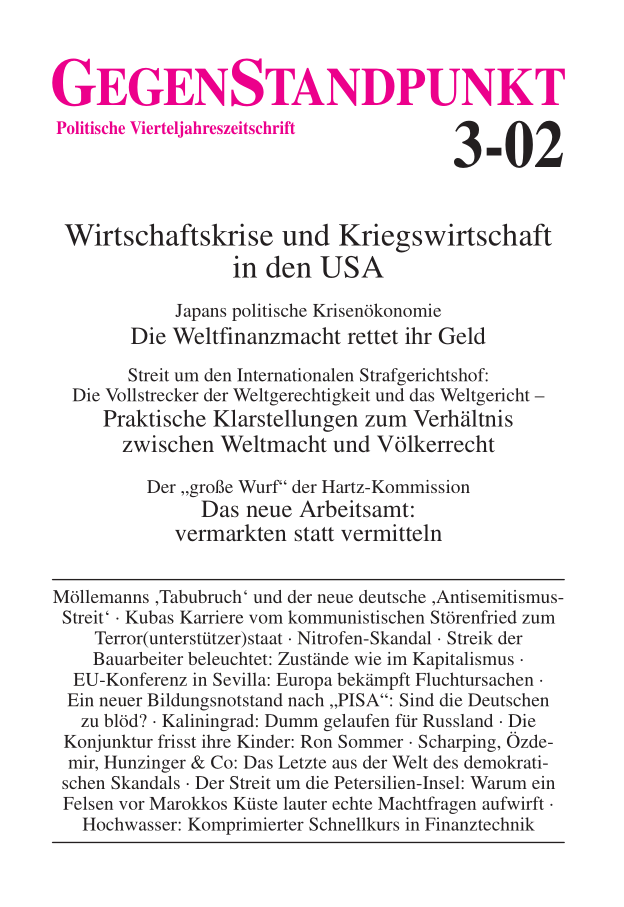Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Der Nitrofen-Skandal:
Auch wo ‚Bio‘ draufsteht, ist Kapitalismus drin
Krebserregendes Futtergetreide durch verseuchte Hallen bringen Bio-Unternehmen in Umlauf und gefährden ihre besondere Geschäftskalkulation: Das Versprechen, die Lebensmittel ungiftig zu produzieren, eröffnet die Chance, fürs Produkt mehr Geld zu erlösen. Die Skandalierung des Vorfalls wirkt dem drohenden Vertrauensverlust in die Güte der Bio-Lebensmittel und damit dem Erfolg des Geschäfts einer ganzen Sonderbranche entgegen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Der Nitrofen-Skandal
Auch wo ‚Bio‘ draufsteht, ist Kapitalismus drin
I.
Wieder einmal macht die Agrarbranche Schlagzeilen. Nach Antibiotika in Shrimps, Salmonellen in Eiern, BSE im Rindfleisch, Maul- und Klauenseuche und Schweinepest sind diesmal Puten und Hähnchen dran. Sie sind mit dem krebserregenden Unkrautvernichtungsmittel Nitrofen verseucht. Auch nach der Seite des Grunds der Vergiftung sind keine Neuigkeiten zu vermelden. Weil in der Marktwirtschaft Lebensmittel Geschäftsmittel sind, haben alle an der Produktion Beteiligten sich um ordentliche Gewinne gekümmert und deswegen Kosten vermieden, die mit der Beseitigung des Gifts verbunden gewesen wären. Als gewissenhafte Kaufleute und Betriebsführer haben sie ihre Bilanzen ent- und dadurch die Gesundheit der Konsumenten belastet. Eine „Norddeutsche Saat- und Pflanzengut AG“ lagert Futtergetreide in einer Halle, in der die DDR Unkrautvernichtungsmittel eingelagert hatte. Sicher, jeder, der will, kann riechen und sehen („klümpchengroße Nitrofenreste“), dass in der Lagerhalle chemische Produkte gebunkert waren. Aber die Firma will eben nicht so genau wissen, was da so streng riecht. Eine Untersuchung kostet ebenso Geld wie die anschließend eventuell notwendige Entgiftung. Auch die Anmietung einer anderen Halle wäre mit Umständlichkeiten und Kosten verbunden. Das Futtergetreide wird von einem Großhändler aufgekauft, der einige Tonnen an einen Bio-Geflügelhof liefert, dessen Geflügel an einen Hersteller von Babynahrung geht. Der testet die eingehende Ware im firmeneigenen Labor, entdeckt das Gift, schickt die vergifteten Hühnchen an den Geflügelzüchter zurück und besteht auf nicht mehr und nicht weniger als Rückerstattung des Kaufpreises. Sicher kommt auch dem Babynahrungshersteller und dem Geflügelhof der Verdacht, das bei ihnen gefundene Gift könnte noch weiter verbreitet auftreten. Aber die Sorge ums Geschäft gebietet allen Beteiligten, nicht Alarm zu schlagen und den Vorfall diskret abzuwickeln. Denn gerade in der Öko-Branche ist der gute Ruf als „sauberer“ Erzeuger ein unerlässliches Geschäftsmittel, und der würde durch die Meldung des Giftfunds an die Aufsichtsbehörden leiden. Daher wird ein „Kartell des Schweigens“ gebildet, und zu regeln ist nur eines: der finanzielle Schaden. Der Geflügelhof wendet sich an seine Versicherung, die für den Schaden aufkommen soll. Weil die für den Schaden keinen außenstehenden Dritten haftbar machen kann – die Versicherung, der Geflügelhof, der Großhändler und die Saatgut und Pflanzen AG, alle Betriebe gehören zum selben Konzern, der Raiffeisengenossenschaft –, empfiehlt die Versicherung in einem Gutachten Schadensvermeidung: das belastete Fleisch
könne teils als konventionelle Ware, oder in der Verarbeitung zu anderen Putenfleischerzeugnissen eingesetzt werden
(SZ, 3.6.02). Der Verkauf vergifteter Lebensmittel kann also weitergehen, wenn man entweder die Kontrollen umgeht, indem man auf Sektoren ausweicht, in denen weniger kontrolliert wird, oder per Giftverdünnung dafür sorgt, dass die Belastung unter dem staatlich festgesetzten Grenzwert bleibt. So kann der Großhändler seinen vergifteten Weizen weiterverkaufen, bis das Lager geräumt ist, und man braucht sich nicht zu wundern, dass sich der „Skandal“ nach der ersten Aufdeckung von Nitrofen täglich ausweitet. Zuerst findet man Nitrofen im Bio-Landbau, dann sind auch die Produkte der konventionellen Landwirtschaft betroffen: Geflügel, Schweine, Rinder und Brot, überall werden die Tester fündig.
Nichts Neues schließlich auch in der Technik der politischen Bewältigung der Affäre: Die zuständigen Aufsichtsbehörden, Landesminister und Bundesministerin an der Spitze, sind empört, diagnostizieren als Grund des Übels einmal mehr „unglaubliche Schlamperei“, „unbegreifliche Verantwortungslosigkeit“, sogar „kriminelle Energie“ bei ehrbaren Agrarökonomen – und entschuldigen so, mit Hilfe der erbittert gestellten Schuldfrage und des Versprechens diesbezüglicher „lückenloser Aufklärung“, das herrliche System der Gewinnerwirtschaftung, das den Nährwert von Lebensmitteln ausschließlich an der Spanne zwischen Gestehungskosten und Verkaufserlös misst und um der Vergrößerung dieser Spanne willen eine agrochemische und biotechnische Errungenschaft nach der anderen zum Einsatz bringt.
II.
Die Besonderheit dieses Mal: Der Skandal findet ausgerechnet in der Unterabteilung des Lebensmittelgewerbes statt – oder fängt zumindest da an –, in der nach dem großen Erschrecken über BSE-verseuchtes Rindfleisch die „Agrarwende“ eingreifen und unter der Obhut einer grünen Verbraucherschützerin im Ministerrang alles anders werden sollte: Die Produkte der Bio-Branche, so das Versprechen, könnten bedenkenlos genossen werden; und davon käme in Zukunft mehr auf den Markt; freilich zu etwas angehobenen Preisen, die die Ware aber auch wert sein würde. Und nun die Blamage! Da kommt Schadenfreude auf. Die christlich-liberale Opposition und die Lobby der „konventionellen“ Landwirtschaft sehen sich glänzend bestätigt – in ihrer Meinung, ein bisschen Gift im Futter wäre allemal im Preis mit drin, hätte im übrigen noch niemandem wirklich geschadet, würde nur von notorischen Miesmachern und Hysterikerinnen abgelehnt; und wenn jetzt bewiesen sei, dass Nahrung sowieso immer, auch unter rotgrüner Verwaltung, ein bisschen ekelerregend produziert und nie ganz ohne Gesundheitsgefahr verdaut wird, dann könne man doch auch gleich bei dem Warenangebot der herkömmlichen agroindustriellen Giftmischer bleiben… Und wo die Zyniker der marktwirtschaftlichen Esskultur Recht haben, da haben sie Recht – wenn auch aus etwas anderen als ihren Gründen:
- Die großartige rotgrüne „Agrarwende“ steht von vornherein nicht für das Projekt, den Konsumenten fortan nur noch einwandfreies Zeug zur Ernährung anzubieten. Bescheiden und „realistisch“ ist bloß an ein wenig mehr „Öko“ im „Landbau“ gedacht: an eine Steigerung des Marktanteils der „sauberen“ Produkte von derzeit 3% auf irgendwann 20% – also bestenfalls an die Eröffnung einer gesünderen Alternative neben dem „konventionellen“ Mist, den sich die große Masse weiterhin zumuten lassen darf.
- Und den sie sich auch zumuten lassen wird – warum, das deutet die Schützerin aller Verbraucher mit ihrer Parole „Klasse statt Masse“ schon an und spricht es mit ihrer Rüge an die Adresse derer, die für wenig Geld gut essen wollen, deutlich aus: Die Öko-Branche soll sich mit ihren „Premium-Lebensmitteln“ auf einem Hochpreissektor etablieren, neben der Billig-Abfütterung der Massen, die ihrem Budget keine Neuaufteilung zumuten können oder wollen. Auch in diesem Sektor der Warenwelt ist Klasse eben eine Klassenfrage der schlichtesten Art.
- Was wiederum überhaupt nicht bedeutet, dass hohe Preise und ein regierungsamtliches Öko-Siegel auch schon eine Garantie für Bekömmlichkeit wären. Am alles entscheidenden ökonomischen Prinzip der Nahrungsmittel-Produktion ändert die „ökologische Wende“ nämlich überhaupt nichts: Auch teure Lebensmittel sind, bevor sie überhaupt auf den Tisch kommen, erst einmal und vor allem Geschäftsmittel; ihr eigentlicher Nähr- und Gebrauchswert liegt darin, dass sie einen Überschuss ihres Verkaufspreises über ihre Produktionskosten beinhalten; ihr biologischer Inhalt ist das bloße Vehikel dieser politökonomischen Zweckbestimmung und in seiner Machart und Zusammensetzung davon abhängig. Der Drang zur Kostpreissenkung mit all seinen ekelerregenden bis gesundheitsschädlichen Konsequenzen für Herstellungsverfahren und Produkt hört deswegen bei Gütern der gehobenen Preisklasse überhaupt nicht auf. Der Konkurrenzzwang, in diesem Sinn erfolgreich zu wirtschaften, nimmt im Gegenteil in dem Maße zu, wie gemäß ministerieller Wunschvorstellung immer mehr mit Öko-Plaketten ausgestattete Lebensmittel auf den Markt gebracht werden und um deren Absatz konkurriert wird.
- Zu den Grundregeln der Gewinnerwirtschaftung ist die ökologische Alternative also überhaupt keine Alternative. Deswegen schließt sie den Standpunkt geschäftlich skrupulöser, also in allen anderen Hinsichten bedenkenloser Berechnung nicht aus, sondern ein – dafür und für sonst gar nichts ist der erste brancheneigene Skandal der praktische Beleg. Er widerlegt ganz nebenher das beliebte und vom Künast-Ministerium heftig aufgewärmte Gerücht, es läge am mündigen Konsumenten und dessen Kaufverhalten, was er zu essen kriegt: Der Öko-Kunde ist genau so das alberne Anhängsel des marktwirtschaftlichen Produktionsprozesses, ist genau so bloßer Erfüllungsgehilfe fremder Gewinnrechnungen wie der sichtbar fehlernährte BigMac-Vertilger.
- Das wird von den politischen Anwälten des Verbraucherschutzes im Übrigen auch ganz nüchtern genau so einkalkuliert; mit all dem zynischen „Realismus“, der den Berufsstand des Politikers überhaupt auszeichnet. Oder wie sonst wäre es zu verstehen, dass die „ökologische Wende“ im Wesentlichen in enger gefassten Vorschriften über zulässige „Belastungen“ in Nahrungsmitteln sowie dem in einem „Öko-Siegel“ vergegenständlichten Versprechen besteht, auf die Einhaltung dieser Vorschriften aufzupassen und Verstöße mit Geldbußen zu ahnden? Wo strafbewehrte Kontrollen nötig sind, um für „Lebensmittelsicherheit“ zu sorgen, da versteht es sich für alle Beteiligten, und für die Kontrolleure schon gleich, von selbst, dass sich in Sachen Unbedenklichkeit und Genießbarkeit der Produkte überhaupt nichts von selbst versteht – ausgenommen eben die ökonomische Rechnungsart, deren praktische Gültigkeit den gesundheitlichen Nährwert der produzierten Lebensmittel fortwährend in Frage stellt.
- Diese Rechnungsart darf daher durch restriktive ökologische Vorschriften und Kontrollen nicht bloß nicht durchkreuzt werden: Das ökonomische Kalkül, die Kunst des Gewinne-Machens, soll im Gegenteil von dem Öko-Label profitieren. Dessen eigentlicher und entscheidender Sinn und Zweck ist selber von ganz und gar marktwirtschaftlicher Art: Es soll gar nichts anderes als die Chance eröffnen, fürs Produkt mehr Geld zu verlangen und auch zu kriegen; im Konkurrenzkampf mit anderen einheimischen Anbietern, darüber hinaus aber durchaus auch auf dem gemeinsamen Euro-Markt. Die kontrollierte und besiegelte Öko-Qualität ist praktiziertes nationales Agrar-Marketing, nicht mehr und nicht weniger.
- Weil Verkaufsförderung der eigentliche Sinn und Zweck aller Qualitätskontrollen ist, darf daraus logischerweise keine Kostenbelastung erwachsen, die die Vermarktung der schönen Qualitätsprodukte durch unrentablen Aufwand gleich wieder erschwert. Das sieht wie ein Dilemma aus; die Lösung ist aber überraschend einfach: Am besten, man überlässt das Kontrollieren, in der Hauptsache wenigstens, den Verbänden der Öko-Produzenten selber. Die werden schon den passenden Weg finden, dass der Aufwand für Öko-Siegel-würdiges Produzieren und einwandfreie Kontrollergebnisse nicht aus dem Ruder läuft.
- Umso schlimmer andererseits, wenn dann doch eine größere Sauerei auffliegt. Das Geschäft ist dann zwar längst gemacht, das ungesunde Zeug im Übrigen auch meistens längst verdaut, am Verbraucher also ohnehin nichts mehr zu schützen. Der ganze Sinn des regierungsamtlichen Verbraucherschutzes jedoch: der Wettbewerbsvorteil in der Konkurrenz der Volksernährer, ist in Gefahr. Die Extraportion Zahlungsbereitschaft, die vermittels der Güte-Garantie „Bio aus Deutschland“ mobilisiert werden soll, steht auf dem Spiel; der Öko-Markt wird geschädigt, bricht womöglich gar zusammen, wenn es nicht gelingt, das Verbrauchervertrauen wiederzugewinnen!
- Womit schließlich auch schon die Aufgabe der zuständigen Ministerin beschrieben wäre: Als oberster nationaler Verbraucherschützerin obliegt ihr der Schutz des Vertrauens der Verbraucher – vulgär ausgedrückt: ihrer Zahlungsbereitschaft. Und den Job erledigt sie dann auch – mit ehrlicher Erbitterung über „kriminelle Elemente“ im Agro-Business, mit demonstrativem Aufdeckungseifer und mit viel Engagement bei der Verfolgung „schwarzer Schafe“. So kämpft sie für die „Agrarwende“: für die Rettung der Vermarktungsstrategie „Öko-Klasse statt Masse“, die sie doch schon so vielversprechend auf den Weg gebracht hatte, dass sogar manch reaktionärer Bauernlobbyist hellhörig geworden ist…
III.
Derweil ist die Kundschaft, glaubt man dem ideellen Gesamt-Lebensmittelkunden von der Süddeutschen Zeitung, in der Vertrauensfrage schon einen ganzen Schritt weiter. Die erwartet sich nämlich vom Öko-Landbau ohnehin nicht die Garantie, einwandfrei sauber ernährt zu werden, sondern bloß das, was da wirklich bloß geboten wird: den Luxus einer eventuell etwas weniger vergifteten und weniger ekelhaften Essware, den man sich gelegentlich gönnt. Dieses kleine Vergnügen mit der total unrealistischen Verheißung einer gift- und skandalfreien Lebensmittelversorgung zu befrachten, macht sich überhaupt nicht gut und ist gar nicht zweckmäßig für ein erfolgreiches Marketing:
„Im Grunde kann es der Marke ‚Öko‘ nur gut tun, wenn sie jetzt entzaubert wird. Man kann die Welt nicht mit Öko-Landbau retten, ökonomische ebenso wie ökologische Hindernisse stehen einer Total-Umstellung der Landwirtschaft auf Bio-Standards entgegen. … Auch Biobauern müssen sich in die arbeitsteilige Wirtschaft einfügen und ihre Kosten hart kalkulieren – die erfolgreichen tun dies längst. … Die meisten Biohöfe arbeiten energie- und umweltschonender als ihre Nachbarn und liefern in aller Regel gesunde Lebensmittel – auch wenn es gelegentlich zu Skandalen kommt wie bei der konventionellen Konkurrenz.“ (SZ, 12.6.)
Eine schöne Dialektik: Mit dem Vorteil von Öko-Ware wirbt man am besten, wenn man es mit ihrer Extravaganz nicht übertreibt. Wenn ein nachgewiesener Gift-Skandal belegt, wie wenig das hochgelobte Zeug vom Normalfall marktwirtschaftlicher Ernährung letztlich doch bloß abweicht, dann eröffnet sich genau damit die Chance, Öko-Produkte als festen Sonderbestandteil der normalen marktwirtschaftlichen Volksfütterung zu etablieren. Schlangenfraß allemal, aber nicht immer derselbe; hin und wieder – man gönnt sich ja sonst nichts – kommt die Luxus-Variante auf den Tisch: Das ist sie dann, die rotgrüne Agrarwende.