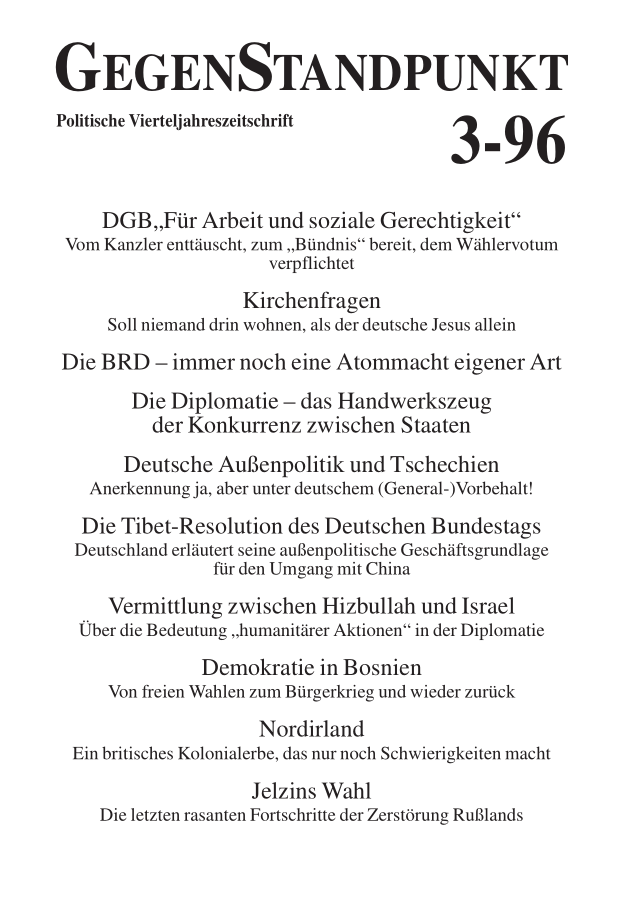Nordirland
Ein britisches Kolonialerbe, das nur noch Schwierigkeiten macht
In Nordirland stehen sich Katholiken und Protestanten so unversöhnlich gegenüber, weil sie jeweils Untertanen unterschiedlicher Herrschaft (Republik Irland versus Großbritannien) sein wollen. Großbritannien will aus der Bürgerkriegsregion endlich einen funktionierenden Bestandteil seines Herrschaftsgebiets machen und bietet deshalb die Perspektive Wiedervereinigung in Form von gemeinsamen Gremien. Durch die Bedingungen, die England setzt, sehen sich beide Parteien in ihrem Anspruch bedroht, den sie deswegen weiterhin mit Gewalt verteidigen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Großbritannien: Seit 30 Jahren um „Normalisierung“ bemüht
- Vom Versuch, aus einem unversöhnlichen Volksgruppenstreit eine britisch-irische Verhandlungsfrage zu machen
- Warum ändert Großbritannien seinen Standpunkt in der Nordirlandfrage?
- Das Agreement zwischen der britischen und irischen Regierung heizt den nationalen Wahn erst recht an
Nordirland
Ein britisches Kolonialerbe, das nur
noch Schwierigkeiten macht
Nach fast zwei friedlichen Jahren in Nordirland, in denen schon von einem Aufschwung der Investitionen und von wachsender Unterstützung des „Friedensprozessen“ durch die Bevölkerung die Rede war, ist alles wieder wie vorher: Im Februar dieses Jahres hat die IRA ihren Befreiungskrieg mit Bombenattentaten in England wieder aufgenommen; im Juni haben die Protestanten ihre „marching season“, die traditionellen Siegesmärsche durch katholische Wohnviertel, wieder angekündigt. Die – protestantische – Polizei hatte die Märsche zunächst verboten bzw. den Marschierern weniger provokative Alternativrouten vorgeschlagen und in Portadown die Straße durchs katholische Viertel blockiert. Nach drei Tagen Dauerdemonstration an ihrer Straßensperre gab sie den Widerstand gegen den „Orange Order“ auf und machte den Männern mit Bowler und orangefarbener Schärpe den Weg frei, indem sie nun umgekehrt die katholischen Blockierer aus dem Weg prügelte. Der Polizeichef begründete sein Nachgeben gegenüber dem Druck der Straße damit, daß er angesichts der aufgeheizten Atmosphäre um Menschenleben fürchten mußte. Gegenüber den Ausschreitungen, mit denen Katholiken auf die Genehmigung der Oranier-Märsche antworteten, obsiegte dann wieder der Standpunkt von Recht und Ordnung über die Rettung von Menschenleben: Bei der Zerstreuung der Unruhestifter kam ein Katholik zu Tode, der von einem gepanzerten Fahrzeug der Ordnungsmacht überrollt wurde. Die Öffentlichkeit in Großbritannien und Europa sieht nun einen ermutigenden „Friedensprozeß“ in die Brüche gehen.
So übermäßig scheint dieser „Friedensprozeß“ also nicht gewesen zu sein. Und er hat ja auch tatsächlich nichts beseitigt von der erbitterten Feindschaft, mit der in Nordirland seit Jahrzehnten zwei nationalistische Fraktionen aufeinander losgehen: Protestanten und Katholiken dreschen aufeinander ein – und keiner macht sich etwas darüber vor, daß Katholizismus und Protestantismus nichts anderes bedeuten als die Signatur für den jeweiligen Willen, sich als Untertan der Republik Irland resp. Großbritanniens zu definieren. Die verfeindeten Parteien treibt die staatsbildende Gewißheit an, daß das Leben nur lebenswert ist unter einem Staat eigener völkischer Provenienz. Die protestantische Mehrheit, die eine britische Loyalität in sich fühlt, kämpft für die bleibende Zugehörigkeit von Ulster zum „Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland“ und verteidigt ihr Recht als echte Briten gegenüber den katholischen Iren, wenn sie diese nach Kräften nicht als gleichgestellte Untertanen ihrer Majestät, sondern als die kolonial unterworfenen Ureinwohner behandelt, die sie einmal waren. Die diskriminierten Katholiken sind das passende nationalistische Spiegelbild ihrer Gegner: Sie haben keinen anderen politischen Willen als den zum eigenen Staat der Iren, den es im Süden der Insel schon gibt. Anschluß an die Republik ist das Ziel katholischer Selbstbestimmung und der Inhalt ihres Kampfes gegen Diskriminierung. Es ist schon gleichgültig, wer da angefangen hat: ob die Katholiken auf ihre Ausgrenzung durch die Protestanten mit der Forderung nach Wiedervereinigung des irischen Volkes geantwortet oder die Unionisten die Katholiken wegen eben dieses seit der irischen Staatsgründung virulenten Anschlußwunsches bekämpft und aus Staat und Wirtschaft verdrängt haben. Die feindlichen Seiten werden es selbst nicht wissen bzw. sich ganz sicher sein, daß ihre jeweilige Haltung nur die Reaktion auf die volksfeindlichen Praktiken der anderen ist. Stets pflegt der Nationalismus seine Ein- und Ausgrenzungen praktisch wahrzumachen und sich dadurch – schön zirkulär – die Anschauung der Benachteiligung und Demütigung zu verschaffen, aus der er dann seine sozialmoralische Berechtigung ableitet und seinen Haß nährt; denn am Ende ist das soziale Elend, das zur heimischen Klassengesellschaft gehört, zwischen den verschiedenen Volksgruppen ungleich verteilt. Der Grund für den Aufruhr ist es deswegen noch lange nicht – dann wären auch in Nordirland ganz andere Fronten fällig als die zwischen fanatischen Anhängern einer irischen und denen einer britischen Obrigkeit.
Großbritannien: Seit 30 Jahren um „Normalisierung“ bemüht
Durch den Bürgerkrieg auf seinem Hoheitsgebiet sieht sich Großbritannien zur Ordnungsstiftung herausgefordert. Sein Interesse, diesen Unruheherd zu befrieden, versteht sich von selbst. Denn solange das Gewaltmonopol der Nation nicht unangefochten gilt, kommt nichts von dem zustande, was ein Staat von seinem Volk will und wozu er es regiert. Insofern trat Großbritannien auch in der Vergangenheit nicht als Partei innerhalb des Bürgerkriegs in Aktion – auch wenn es von den protestantischen Loyalisten als solche in Anspruch genommen und von der irisch-katholischen Fraktion als solche angesehen und angegriffen wurde –, sondern verfolgte das übergeordnete Interesse, den Bürgerkrieg zu beenden und so die britische Hoheit über die Provinz zum Funktionieren zu bringen: Ulster sollte endlich auch ein normaler Landesteil werden und seinen Beitrag zum britischen Nationalprodukt leisten, anstatt auf ewig ein kostspieliges Ordnungsproblem zu sein.
Eines steht allerdings fest: An der Entstehung ihres schwierigen Befriedungsproblems war die Ordnungsmacht selber nicht unbeteiligt. Die Grundlage dafür hat sie bereits mit ihrer Kreation der politischen Einheit Ulster geschaffen: Als das Königreich die aufmüpfigen Iren nach dem Ersten Weltkrieg nolens volens aus der „Union“ erst als „Irish Free State“ in den Status eines Dominions des Commonwealth und nach 1949 in die staatliche Selbständigkeit der „Republic of Ireland“ entließ und damit die koloniale Herrschaft über die Nachbarinsel beendete, hat man im Norden 6 Counties abgetrennt und bei Großbritannien belassen. Diese Grafschaften, die man heute Ulster nennt, entsprechen nicht der alten Provinz Ulster, die neun Grafschaften umfaßte. Die sechs Counties wurden so zurechtgeschnitten, daß den Protestanten, die sich England zurechneten und die irische Selbständigkeit ablehnten, die Mehrheit über die katholische Bevölkerung gesichert wurde., die sie schon auf der Ebene von 9 counties nicht mehr gehabt hätten. Das Selbstbestimmungsrecht, das Großbritannien gewährte, wurde also so geregelt, daß die Anhänger des United Kingdom es wirksam ausüben und ihr Ziel erreichen konnten. Dem Gesamtvolk von Irland und den Katholiken im Norden wurde dasselbe Recht dadurch verweigert. Wer das Selbstbestimmungsrecht gewährt, bestimmt eben auch die Zusammensetzung des Elektorats und definiert den politischen Willen, der sich selbst bestimmt. Die Protestanten haben die britische Trennlinie durch Irland – geteilte Selbstbestimmung für die 26 katholischen Counties des Südens und ihre 6 des Nordens – als das aufgefaßt, was sie war: die Einrichtung eines eigenen Staats innerhalb des britischen Gesamtstaats. So haben sie sich dann auch aufgeführt. Die Demokratie, das gelobte Mehrheitsprinzip, taugte unter der Bedingung der nationalen Spaltung der Bevölkerung wunderbar dazu, die Minderheit von allen besseren Posten und Positionen auszuschließen und zu unterdrücken. Die sorgsam konstruierte Mehrheitslage gab für die Protestanten einen universellen Rechtstitel her: Die Katholiken sollten sich gefälligst den demokratischen Entscheidungen unterwerfen; taten sie es nicht, so qualifizierten sie sich als Terroristen, die unterdrückt gehörten. Seitens der Katholiken dagegen wurde die Legitimität dieser Mehrheit überhaupt bestritten und auf gesamt-irischer Mehrheitsentscheidung bestanden.
Diesen unversöhnlichen Streit der beiden Volksgruppen suchen alle britischen Regierungen seit der Eskalation des Bürgerkriegs 1968 zu befrieden. Dabei haben alle britischen Schlichtungsbemühungen die leicht absurde Seite an sich, daß Großbritannien, wenn es als „Schiedsrichter“ zwischen den verfeindeten Nationalisten antritt, auch gegen seine eigenen fanatischen Anhänger vorgehen muß. Die Auflösung des Stormont-Parlaments, die nach den großen Unruhen Ende der sechziger Jahre die regionale Selbstverwaltung 1972 beendete und Ulster einer „Direktregierung Londons“ unterstellte, enthielt durchaus das Eingeständnis der britischen Regierung, daß bürgerliche Rechts- und Chancengleichheit in Ulster nur gegen die Herrschaft der Unionisten zu gewährleisten wären; Einrichtungen wie die „Fair Employment Agency“, „Equal Opportunities Commission“, „Advisory Commission on Human Rights“ und „Police Complaints Board“ gingen in dieselbe Richtung. Und in ihren ersten Nordirland-Einsatz 1969 wurden britische Soldaten als „Beschützer“ der Katholiken gegen den Terror der Oranier geschickt. Doch wie bei Interventionen dieser Art in nationalistische Streitigkeiten nicht anders zu erwarten, haben 30 Jahre bewaffneten Eingreifens nichts an der nationalen Spaltung der nordirischen Bevölkerung geändert. Nach wie vor ist der Staatsdienst, insbesondere die Polizei, zu fast 100% in protestantischen Händen; nach wie vor leben die beiden Bevölkerungsgruppen in konfessionell getrennten Städten und Stadtvierteln – die Katholiken in den schlechteren; nach wie vor ist unter ihnen die Arbeitslosigkeit – in Ulster ohnehin um einiges höher als im „mainland“ – doppelt so hoch wie unter Protestanten. Den kämpferischen Nationalismus der Mehrheit hat die britische Regierung erst recht nicht unter Kontrolle gebracht. Dafür hätte sie ja glatt mit ihren eigenen Fans brechen müssen. Die Protestanten, die sich praktisch und demonstrativ als Herrenvolk aufführen, sollen wohl gebremst und zur Toleranz angehalten werden. Wenn es aber zu Provokationen und Konfrontationen kommt, dann sind die Unionisten für die britische Staatsmacht halt doch die eigenen Leute und die Katholiken das eigentliche Ordnungsproblem. Auch beim diesjährigen Marsch des Orange-Order durch ein katholisches Viertel von Portadown hat die Ordnungsmacht die Konfrontation mit den englandtreuen Provokateuren nicht ins Extrem getrieben: Die Polizei hat sich von der Entschlossenheit der Ulster-Aktivisten erpressen lassen und nachgegeben. Bei den Krawallen, mit denen die Katholiken antworteten, fuhr sie dann einen Katholiken tot. Damit war das mühsam erzeugte Bild einer „gleichen Wertschätzung“, die die britische Regierung beiden „Traditionen“ und „Communities“ in Nordirland entgegenzubringen versprach, wieder zerstört. London wird eben das aparte Problem nicht los, daß die eine Fraktion der permanenten Friedensstörer gleichzeitig der Garant der britischen Zuständigkeit für Nordirland ist.
Vom Versuch, aus einem unversöhnlichen Volksgruppenstreit eine britisch-irische Verhandlungsfrage zu machen
Die zweifelhaften Erfolge seiner Befriedungsbemühungen haben Großbritannien freilich nicht daran gehindert, sich jahrelang mit seiner Armee in Nordirland aufzubauen und so zu tun, als wäre der dortige Bürgerkrieg nichts weiter als ein terroristischer Aufruhr, der mit Polizei- und Militärgewalt niederzuschlagen wäre. Daß sich die Sache gar so sehr in die Länge gezogen hat, hat allerdings schon 1985 Margret Thatcher dazu bewogen, ein Anglo-Irish-Agreement auszuhandeln, mit dem die „Nordirlandfrage“ nicht mehr völlig unter „Terrorismusbekämpfung“ subsumiert, sondern der Versuch unternommen wurde, die Angelegenheit als britisch-irische Verhandlungssache zu regeln. In diesem Agreement hat Großbritannien konzediert, sich einem zukünftigen Mehrheitsvotum über die Staatszugehörigkeit Nordirlands beugen zu wollen, auch wenn es gegen die „Union“ und für ein Vereinigtes Irland ausschlagen sollte. Dafür hatte die irische Regierung anerkannt, daß eine Änderung des Status der Provinz unbeschadet ihres verfassungsmäßigen Wiedervereinigungsgebots nur aus einem demokratisch erklärten Mehrheitswillen in Ulster hervorgehen könne und daß dieser Wille gegenwärtig nicht existiere.[1] Zweck des Abkommens war, die irische Regierung von der stillen Unterstützung des katholischen Terrors abzubringen und so zu einer Befriedung der Provinz zu kommen. Der zuvor zurückgewiesene Anspruch Irlands auf den Norden sollte dafür ein klein wenig anerkannt, zugleich aber eingeschränkt werden auf das Recht, in Angelegenheiten, die die katholische Minderheit betreffen, der britischen Regierung nichtbindende Vorschläge machen zu dürfen.[2]
Die neuen Vereinbarungen Großbritanniens mit Irland mögen zwar immer noch dasselbe Motiv – Verbesserung der Sicherheitslage und Befriedung des Nordens – haben, sie sprechen jedoch eine andere Sprache. In der „Joint Declaration“ von 1993, vor allem aber im „Framework Document“ von 1995 ist die Rede von einem „irischen Volk“ oder, vorsichtiger, einem „Volk der irischen Insel“, dessen Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen, beide Regierungen als ihre Pflicht ansehen. Die Exekution dieses Rechts binden sie freilich an einen Konsens nicht der Mehrheit der Inselbewohner, sondern politischer Einheiten auf der Insel; also an eine Zustimmung der nordirischen Mehrheit. London unterschreibt ausdrücklich, was bei Mrs. Thatcher nur als Möglichkeit erscheinen durfte, weil sie irreal war:
„Die britische Regierung hat keinerlei selbstsüchtige Interessen an Nordirland, weder strategischer noch ökonomischer Natur. Sie wird den demokratischen Willen der größeren Zahl des Volkes von Nordirland unterstützen, ob diese es nun vorzieht, der Union oder einem souveränen vereinigten Irland anzugehören.“ [3]
Aber bei dieser nach wie vor jede Veränderung blockierenden Bedingung will man es nicht belassen: Es wird anerkannt, daß der Mehrheitswille nicht der vollständige, allein verbindliche politische Wille der nordirischen Provinz ist, sondern daß die „substanzielle Minderheit“ den Status des Landes ebensowenig billigt, wie die Mehrheit eine Änderung desselben. Die britische und irische Regierung bieten Konstruktionen an, die dem Wiedervereinigungswunsch der Minderheit und dem Anspruch der Mehrheit, im Vereinigten Königreich zu bleiben, gleichermaßen Angebote machen. Ausschließendes soll gleichermaßen zum Zuge kommen: Britische Souveränität wird – bis zu einer irischen Einigung – nicht aufgegeben, der katholisch-irische Anspruch auf Wiedervereinigung soll gleichwohl vorankommen:
„Die Verschiedenheit der Identitäten und Zugehörigkeitsgefühle könnte von allen eher als Quelle wechselseitiger Bereicherung angesehen werden, denn als Drohung gegen die jeweils andere Seite. Das trennende Thema der Souveränität könnte aufhören, Symbol der Herrschaft einer Gemeinschaft über die andere zu sein. Diese Frage würde statt dessen einer Entscheidung anheimgestellt, die unter akzeptierten Basisregeln, gerecht und ausgeglichen gegenüber beiden Ansprüchen, und über einen Prozeß demokratischer Überredung zustande kommen müßte, die auf dem Prinzip des Konsens und nicht auf Drohung, Furcht und Zwang beruht.“
Um diese Quadratur des Kreises zustande zu bringen, machen die beiden Regierungen Anleihen bei der Konstruktion der EU: Sie erklären sich bereit, neu zu schaffenden gesamtirischen Körperschaften, die sich aus Abgeordneten oder Regierungsstellen des Nordens und Südens zusammensetzen, in wachsendem Maße Politikfelder zu überantworten, die dadurch aus ihrer Hoheit entlassen werden. Die Bereitschaft dazu bezieht sich im projektierten Endzustand auf so gut wie alle Staatsaufgaben, zunächst aber bezeichnenderweise auf die Wirtschafts- und Infrastrukturentwicklung beiderseits der inner-irischen Grenze und die Benutzung von EU-Programmen dafür. Beide Regierungen fassen sogar ein Druckmittel gegen die Unionisten im Norden ins Auge, von deren Konsens nach wie vor alles abhängig gemacht wird und der natürlich nicht zu haben ist. Sie drohen, diese Sorte grenzüberschreitender gesamt-irischer Kooperation auch dann voranzutreiben, wenn der erforderliche Konsens im Norden nicht zustande kommt; dann eben als Zusammenarbeit der Regierungen ohne Mitsprache der Betroffenen. Die Seiten bekennen sich schließlich zu einem besonders starken Minderheitenschutz, den jede zukünftige Regelung der irischen Frage vorsehen müsse, und erwähnen als mögliche Begünstigte mehrfach die protestantische Bevölkerung im Norden, die eines Tages in die Position der Minderheit geraten könnte – in einem vereinigten Irland.
Warum ändert Großbritannien seinen Standpunkt in der Nordirlandfrage?
So häufig ist es ja nicht, daß Imperialisten die Selbstverständlichkeit, die Reichweite der eigenen Macht nicht bestreiten zu lassen, relativieren und nicht mehr mit allen Mitteln behaupten wollen, was sie einmal besitzen. Der erste Grund für die Aufweichung des Herrschaftsanspruchs über Nordirland ist der Mißerfolg aller Versuche, den Laden in den Griff zu bekommen, ihn normal und zu einem Beitrag zur Nation zu machen. 80 Jahre einer bloßen Behauptung der Hoheit über die Provinz, 30 Jahre Bürgerkrieg ohne die Perspektive einer Bereinigung verunsichern den selbstverständlichen imperialistischen Ausgangspunkt der Nation und provozieren die Frage nach Aufwand und Ertrag.
Dies besonders im Lichte einer Staatsräson, die nicht mehr die des militärischen Weltreiches ist, das mit Krieg zusammengehalten wird und das im Militärischen dann auch seine Bewährungsprobe und sein entscheidendes Erfolgskriterium hat. Im Nachhinein erscheint auch Mrs. Thatchers Krieg um die Falkland-Inseln von 1980 als unergiebiger Versuch einer derartigen Reminiszenz. Militärisch ist Großbritannien eine bedeutende Bündnismacht, die zusammen, aber auch nur noch zusammen mit den anderen kapitalistischen Hauptmächten den Globus beherrscht. Ökonomisch ist es EU-Partner und hat in der Bewährung als europäischer Kapitalstandort seine Aufgabe und sein Erfolgskriterium. Ein mühevoller britischer Machtbeweis in Ulster, der nicht eindrucksvoll ausfällt, trägt weder in der einen noch in der anderen Hinsicht zum britischen Gewichts bei. Stattdessen bietet die drittgrößte Macht der EU in einem ihrer Landesteile das Bild eines unfertigen, instabilen Staates, der einen Bürgerkrieg nicht beenden kann und nicht durchgängig auf dem Willen des Volkes zu seiner Herrschaft beruht. Mit dem Nachbarn Irland handelt sich das Land darüber eine – inzwischen – dysfunktionale Konfliktlage ein. Den übrigen Partnern und Konkurrenten – der „Weltmeinung“ – bietet es Angriffsflächen. Während die – eher gleichrangigen – EU-Partner sich heraushalten, den Bürgerkrieg nach Kräften ignorieren und strikt als innere Angelegenheit behandeln, werfen sich die USA, die schon bei der Gründung der irischen Republik Pate standen, zum Obervermittler auf, der sogar Großbritannien in die Rolle einer Partei weist. Auf einer unteren Ebene ihrer Außenpolitik tun die USA seit langem etwas dafür, daß die Befriedung der Provinz nicht einfach nach britischem Rezept gelingt: Sie erlauben ihrer „irish community“, Geld für die Waffen der IRA zu sammeln, und bedeuten den Briten diplomatisch, daß ein ewig ungelöster Volksgruppenkonflikt keine innerbritische Angelegenheit bleiben kann. Sie haben den Bann über Sinn Fein, die politische Partei der IRA, gebrochen und ihrem Vorsitzenden, Gerry Adams, die Einreise und die Propaganda für seine Sache erlaubt. So tragen die USA dazu bei, daß die Briten eine Lösung dringlich finden.
Auf der anderen Seite hat die EU Irland aus dem Status eines britischen Hinterlandes befreit und zu einem wirklich selbständigen Staat gemacht, der sich seine eigenen nationale Lebensmittel zu beschaffen vermag. Auch im nordirischen Konflikt tritt die Republik mittlerweile Großbritannien als gleichberechtigte Macht gegenüber.
Der gegen die Briten erkämpfte Gründungsakt der irischen Republik hatte seinerzeit eine Unterwerfung des „Irish Free State“ unter Vorrechte des großen Nachbarn, also die Beschädigung des irischen Nationalismus eingeschlossen: die Teilung der Insel zwischen dem neuen Staat und der britischen Kolonialmacht. Irland hatte sich in die Rolle des minderberechtigten kleinen Nachbarn geschickt und die von seiner Verfassung „gebotene“ Wiedervereinigungspolitik von sich aus nicht aktiv betrieben.[4] Es hat aber auch nie die Legitimität des katholischen Anschlußwillens in Ulster abgestritten. Praktisch war die Republik das Rückzugsgebiet und damit eine Existenzbedingung der IRA. Seitdem das Land sich dank seiner EU-Mitgliedschaft Märkte und Anlagekapital an England, dem größten Abnehmer irischer Waren, vorbei beschaffen konnte, war es britischen Pressionen immer weniger zugänglich. Distanzierung vom Terror der IRA, sogar eine gewisse Einbindung in die britische Terrorbekämpfung ließ sich Irland nur gegen die britische Anerkennung seines Einmischungsrechts in Ulster abhandeln. Die Abkommen von Sunningdale 1973 und Hillsborough 1985 bis zur „Joint Declaration“ 1993 und dem „Framework Document“ 1995 markieren lauter Fortschritte in diesem Sinn. Die Reihe britischer Versuche, sich einerseits der polizeilichen Hilfe Irlands im Kampf gegen die IRA zu versichern, sich andererseits aber auch des Vertrauens, das die katholische Minderheit im Norden in die Regierung des Südens setzt, dadurch zu bedienen, daß gemeinsame, also für Katholiken zustimmungsfähige Regelungen gesucht wurden, hat eine zunehmende vertraglich anerkannte Mitsprache Dublins in nordirischen Angelegenheiten hervorgebracht – bis hin zur britischen Anerkennung der Legitimität des irischen Anspruchs, die Eingliederung der „six counties“ in die Republik anzustreben – freilich nur auf friedlichem und konsensuellem Weg.
In dem von ihnen betriebenen „nordirischen Friedensprozeß“ haben Großbritannien und Irland eine Gemeinsamkeit konstruiert, die zwar nicht das Ende der Streitereien zwischen beiden Staaten bedeutet. Querelen und Beschwerden zwischen beiden Staaten bezüglich Nordirlands gibt es zuhauf – sie verraten allerdings das Maß anerkannter Einmischung und den Grad der Ansprüche, die beide Seiten aneinander stellen und stellen lassen. Mit ihrem Verzicht auf einen immerwährenden Hoheitsanspruch auf Ulster hat die britische Regierung nicht ihren Abzug von der Insel angekündigt; London gibt seine Hoheit über Nordirland nicht auf, überläßt das „Nordirlandproblem“ nicht einfach der Republik Irland; es relativiert sie aber, indem es sie zum Verhandlungsgegenstand mit Irland macht. Damit ist eine neue Runde britisch-irischer Nordirlanddiplomatie eröffnet. Irland sieht sich zu forderndem Auftreten dem großen Nachbarn gegenüber berechtigt. Es äußert laut Empörung über die britische Duldung der Oranier-Märsche; sein Außenminister und gegenwärtiger EU-Ratsvorsitzende Spring droht, im äußersten Fall britischer Intransigenz den Streit vor EU-Gremien zu bringen. Die Regierung Major besteht dagegen zwar nicht mehr unbedingt auf britischer Hoheit am Ende des „Friedensprozesses“, aber auf einer britischen Hoheit über diesen Prozeß. Sie sieht ihre Souveränität über Ulster noch längst nicht verloren, sondern möchte aus voller Souveränität den Inselbewohnern das Selbstbestimmungsrecht gewähren, dessen faire Ausübung selbst definieren und garantieren.
Das Agreement zwischen der britischen und irischen Regierung heizt den nationalen Wahn erst recht an
Von ihrem übergeordneten Standpunkt aus, als EU-Partner miteinander zurechtkommen zu wollen, haben sich Irland und Großbritannien also auf einen neuen diplomatischen modus vivendi in der Nordirlandfrage geeinigt. Der Haken ist bloß, daß dieser diplomatische Verkehr weder für die IRA noch für die Ulster-Nationalisten als modus vivendi akzeptabel ist. Im Gegenteil, die beiden verfeindeten nationalistischen Bürgerkriegsparteien sehen in der Verständigung der Regierungen der Nationen, denen sie jeweils unbedingt zugehören wollen, eine Gefährdung ihres gerechten Anliegens.
Das großzügige Angebot an die beiden Bürgerkriegsparteien ist daher keines, sondern eine Drohung gegen beide:
„Die Joint Declaration selbst verkörpert einen wichtigen Schritt in diese Richtung (Frieden), denn sie bietet den Iren, Nord wie Süd, was immer ihre Traditionen sein mögen, die Grundlage zur Verständigung darüber, daß von nun an ihre Gegensätze verhandelbar und ausschließlich durch friedliche politische Instrumente gelöst werden.“
Das will in Nordirland nur leider niemand. Der Gegensatz, um den es den Parteien geht, heißt: zu Britannien gehören oder zu Irland, nationale Selbstbestimmung für uns und nationale Unterdrückung für die anderen oder umgekehrt – Die oder Wir! Alle Zwischenformen, die der britische und der irische Staat anbieten, betrügen beide Nationalismen um ihr erstes Recht, die völkische Zugehörigkeit. Das Verhandlungsangebot bedeutet beiden Parteien, daß ihre Rechte nun auf dem Spiel stehen und erst recht unbedingt verteidigt werden müssen. Auf den von der britischen und der irischen Regierung in Gang gebrachten Verhandlungsreigen lassen sich die Bürgerkriegsparteien nur ein, weil sie Kooperationsbereitschaft zeigen müssen, um die Unterstützung durch ihre jeweilige Schutzmacht nicht zu verlieren.
Die IRA hat am 31. August 1994 einen freiwilligen einseitigen Waffenstillstand ausgerufen, aber auf die Vorbedingung der britischen Regierung für Allparteien-Gespräche, den endgültigen Verzicht auf „bewaffneten Kampf“ und ihre überwachte Entwaffnung, läßt sie sich nicht ein. Die Kriegspartei ist nicht bereit, ihre diplomatische Anerkennung als politische Richtung dadurch zu erkaufen, daß sie eine Partei aus eigener Macht nicht mehr ist, nachdem sie ihre Aufwertung zur Verhandlungspartei nur durch ihre Waffen gewonnen hat. Sie will sich nicht auf Gedeih und Verderb dem Verhandlungsprozeß ausliefern, den sie mit gutem Grund als britisches Mittel zu ihrer Isolierung, zur Spaltung der katholischen Front und schließlich zu ihrer Unterwerfung fürchtet. Schließlich sieht das britische Angebot als Voraussetzung für jeden Fortschritt ja doch einen Konsens innerhalb Nordirlands, also den ausschlaggebenden Willen der protestantischen Mehrheit vor – eine Variante der „inneren Lösung“, die die Katholiken grundsätzlich ablehnen. Die Briten, die sich inzwischen dazu herbeilassen, mit „gewesenen Terroristen“ zu verhandeln, lehnen Verhandlungen mit aktiven Terroristen – „unter der Drohung von IRA-Waffen“ – ab. Unter dem Hinweis auf andere Fälle britischen Rückzugs aus Kolonien besteht die IRA aber gerade darauf; die britische Anerkennung dieser Analogie wäre schon eine Vorentscheidung der entscheidenden Rechtsfragen. Wegen dieser ausschließenden Vorbedingungen für Gespräche kommt der groß angekündigte Friedensprozeß erst gar nicht in Gang – und die IRA sieht sich nach 18 Monaten Stillhalten berechtigt, zur Erzwingung „echter“ britischer Verhandlungsbereitschaft wieder zu bomben. Die Allparteiengespräche finden inzwischen statt, freilich ohne Sinn Fein, die entscheidende Partei, deren Unzufriedenheit eingebunden werden sollte. Sie bleibt ausgeschlossen, weil die IRA einen „endgültigen Waffenstillstand“ nicht versprechen mag und sich ihre Entwaffnung bis nach einer Friedensregelung vorbehält.
Die Protestanten halten sich an die andere Seite des „Framework Document“ und bekämpfen es deswegen: Die Perspektive immer weitergehender gesamt-irischer Regelungen bis hin zu einem Anschluß ihrer Provinz an die Republik kommt für sie einem britischen Verrat an den treuesten Untertanen ihrer Majestät gleich. Sie hetzen nun gegen die „Verräter von Westminster“ und kämpfen gegen die britische Politik für die britische Hoheit über Ulster. Ian Paisley, der klerikale Hetzer der Unionisten, ließ sich lieber von Premier Major aus Downing Street hinauswerfen, als ihm sein Versprechen abzunehmen, er habe Ulster nicht längst in geheimen Zusätzen zur „Joint Declaration“ an die Iren verkauft. Der britische Hebel gegen die Protestanten besteht in deren Angewiesenheit auf die britische Bereitschaft, in Nordirland zu bleiben. Der Hebel des protestantischen Kampfes gegen Londoner Konzessionsbereitschaft besteht im britischen Anspruch auf die Hoheit über den Friedensprozeß und seiner Vorbedingung friedlicher Verhältnisse. Dem – ebenfalls vorläufigen – Verzicht auf protestantischen Terror stehen gezielte Provokationen unionistischer Herrenmenschen in katholischen Vierteln gegenüber, die jederzeit den Beweis für den Bedarf nach britischer Ordnungsstiftung und für den terroristischen Charakter der katholischen Organisationen liefern können.
So wird er denn seinen Gang gehen, der „Friedensprozeß“ in Nordirland – und alle Welt kann von Zeit zu Zeit seine „Rückschläge“ bedauern. Es sei denn, die Menschen auf der irischen Insel besinnen sich tatsächlich auf die Frage, was sie eigentlich davon haben, die treuesten britischen oder irischen Untertanen zu sein. Aber dafür gibt es in dem ganzen Aufruhr ja nun leider nicht den geringsten Anhaltspunkt.
[1] Der Artikel 1 des
Anglo-Irish-Agreement, der dann in sämtlichen folgenden
Vereinbarungen bestätigt wird, lautet: Die beiden
Regierungen a) bestätigen, daß jedwede Änderung des
Status von Nordirland nur mit der Zustimmung der
Mehrheit des Volkes von Nordirland zustandekommen kann,
b) anerkennen, daß die Mehrheit des Volkes von
Nordirland gegenwärtig keine Änderung des Status von
Nordirland wünscht, c) erklären, daß, wenn in Zukunft
die Mehrheit des Volkes von Nordirland die Errichtung
eines vereinigten Irland eindeutig wünscht und ihr
formal zustimmt, sie die entsprechende parlamentarische
Gesetzgebung in die Wege leiten, um diesen Wunsch zu
realisieren.
[2] Margret Thatcher zum
Anglo-irischen Abkommen: „Meine eigenen Gefühle
waren grundsätzlich unionistisch… Jeder Konservative
sollte bis in die Knochen Unionist sein… Ich glaube,
daß kein Preis zu hoch ist für das Recht jener, deren
Loyalität dem Vereinigten Königreich gilt, die seine
Bürger bleiben und seinen Schutz genießen wollen… Mein
Ausgangspunkt (in der Diplomatie mit der Republik
Irland) war der unabweisbare Bedarf nach einer
Verbesserung der Sicherheitslage. Falls diese
beschränkte politische Konzession an den Süden
verlangen würde, hatte ich solche zu erwägen, so sehr
ich auch diese Sorte von Schacher haßte. Wir wußten,
daß sich die Terroristen über die Grenze in die
Republik zurückzogen, um ihre Aktionen zu planen und
Waffenlager zu errichten. Wir bekamen keine
hinreichenden Erkenntnisse über ihre Bewegungen. Sobald
sie die Grenze passiert hatten, waren sie verschwunden.
Tatsächlich hatten wir viel bessere
nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit praktisch
allen anderen europäischen Ländern als mit der
Republik… Die größte Chance, in beiden Punkten
(Verbot der IRA im Süden und Zusammenarbeit der
Polizeien über die innerirische Grenze hinweg)
voranzukommen, schien in einem anglo-irischen Abkommen
zu liegen, welches das Interesse der Republik an den
Angelegenheiten des Nordens offiziell anerkennt,
während es ihr jede Entscheidungsgewalt darüber versagt
und diese definitiv in unseren Händen beläßt. Die
Angewiesenheit auf irische Hilfe in Sicherheitsfragen
war evident … aber es war klar, daß die Iren eine
Gegenleistung für ihre Dienste erwarten würden. Die
meisten ihrer Ideen waren unmöglich, da sie auf einer
irgendwie geteilten Hoheit über Nordirland beruhten.
Ich war in gar keiner Weise bereit, so etwas
zuzugestehen, aber Ende Mai 1984 beauftragte ich Robert
Armstrong, das Konzept einer konsultativen Rolle für
die Republik in Nordirland zu entwickeln. Für die Iren
freilich blieb es stets schwierig, zu verstehen,
that joint sovereignty was a nonstarter
… In der
Antwort (des damaligen irischen Premiers Haughey auf
Thatchers Protest gegen seine die britische
Nordirlandpolitik anklagende Rede im April 1987 in den
USA) beteuerte er in stärksten Formulierungen seine
Ablehnung des Terrorismus, wiederholte seinen Einsatz
für das anglo-irische Abkommen und übermittelte seine
persönliche Unterstützung für die
Sicherheits-Kooperation. Aber diese Klarstellung zeigte
auch, wogegen wir überhaupt standen; er machte nämlich
deutlich, daß sein ganzer Ansatz auf das Ziel eines
vereinigten Irland gegründet war und daß er das
anglo-irische Abkommen als einen Zwischenschritt
dorthin ansah. Das war durch und durch inakzeptabel.
Langsam zeigte sich, daß die weitergehenden
Fortschritte, die ich mir von einer größeren
Unterstützung durch die nationalistische Minderheit in
Nordirland oder von Volk und Regierung Irlands im Kampf
gegen den Terrorismus versprochen hatte, nicht
zustandekommen würden. Nur mit der internationalen
Dimension konnten wir dank des Abkommens merklich
leichter fertig werden… Es erschien (trotz
aller Enttäuschung) nie lohnend, sich vollständig aus
dem Abkommen zurückzuziehen, denn das hätte Probleme
geschaffen nicht nur mit der Republik, sondern auch und
wichtiger mit der breiteren internationalen
Meinung.“ (Margret Thatcher,
The Downing Street Years, aus dem Kapitel: Shadows of
Gunmen, S. 379-415.)
[3] Alle folgenden Zitate aus: Framework Document 1995, Gemeinsame Erläuterungen der britischen und der irischen Regierung zur Joint Declaration von 1993.
[4] Die Artikel 2 und 3
der 1937 verabschiedeten und bis heute gültigen
Verfassung lauten: Das nationale Territorium umfaßt
die ganze Insel Irland, seine Inseln und
Küstengewässer. Bis zur Re-Integration des nationalen
Territoriums und ohne das existierende Recht
anzutasten, das Parlament und Regierung durch die
Verfassung zur Gesetzgebung über das gesamte
Territorium berechtigt, sollen sich die vom Parlament
verabschiedeten Gesetze auf das gleiche Gebiet
erstrecken wie die Gesetze der Republik Irland und die
gleiche extra-territoriale Gültigkeit haben.