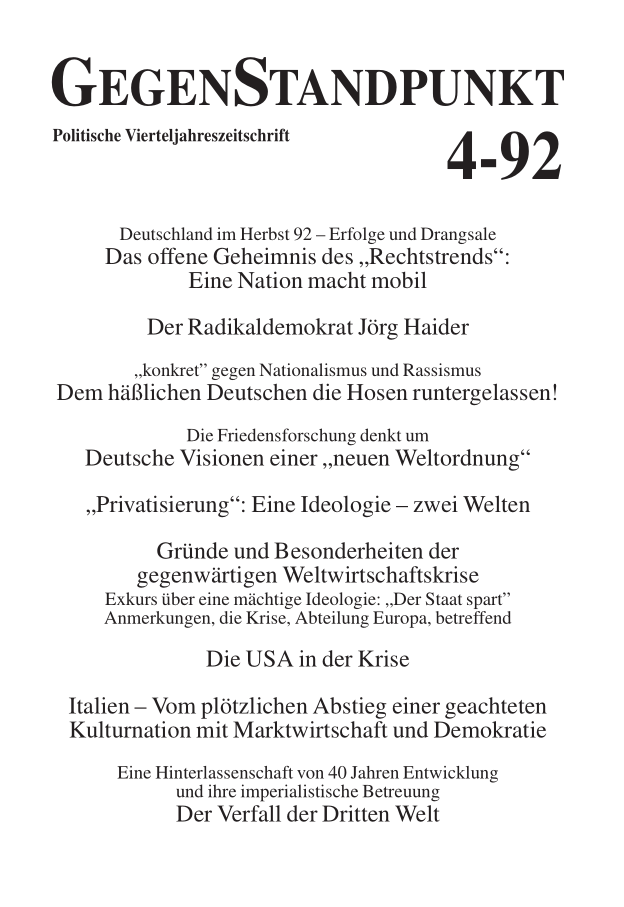Die Friedensforschung denkt um
Deutsche Visionen einer „neuen Weltordnung“
Die Anpassung der kritischen Politologie an die veränderte Weltlage anhand von Stellungnahmen einiger Protagonisten (Senghaas, Czempiel, Staack, Tetzlaff u.a.): Wo Demokratie und Menschenrechte nach Abtritt der SU endlich den Frieden verbürgen können, braucht die gute Politik keine „militärisch abgestützte Machtpolitik“ mehr zu sein. Sondern überparteiliche „Verantwortungspolitik“ für eine internationale Friedensordnung, die im Interesse Deutschlands als geborener Friedensmacht liegt und viel Einmischung in andere Staaten erforderlich macht.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Die Friedensforschung denkt um
Deutsche Visionen einer „neuen Weltordnung“
Die Friedens- und Konfliktforschung gilt als kritischer Zweig der Wissenschaft von den internationalen Beziehungen. Nicht etwa deshalb, weil sie beim Studium der Formen zwischenstaatlicher Gewaltanwendung Einsichten in die Natur einer Politik ermittelt hätte, die dergleichen nötig hat. Nein: Auch Friedensforscher interessieren sich, wie die übrigen Politologen, für die Taten und Absichten von Politikern nur insoweit, als sie daran Belege für die – exklusiv von ihnen entdeckten – „eigentlichen“ Ziele und Aufgaben von Politik finden. Die Herstellung einer Ordnung
zum Beispiel, damit das Chaos – im Staat selbst und zwischen Staaten auch – nicht überhand nimmt. Ihren kritischen Ruf haben diese speziellen Experten für Außenpolitik sich durch eine skeptische Wendung des Ordnungsgedankens erworben. An der Logik der Abschreckung, die den kalten Krieg bestimmte, wollten sie die Fragwürdigkeit des damit gestifteten „Friedens“ entdeckt haben. Von den Waffen des „atomaren Patt“ zogen sie nicht den Schluß auf die wenig friedliebenden politischen Zwecke, denen die Waffen dienten, vielmehr wollten sie an ihnen eine objektive Unmöglichkeit bemerkt haben, im Zeitalter des wechselseitigen „overkill“ noch ans Kriegführen zu denken. Die Politik, die den Krieg vorbereitete und plante und dafür ihre Gründe schon hatte, zeichnete sich für sie dementsprechend vor allem durch den Mangel an jener Einsicht aus, auf die sie sich versteiften und derzufolge ein „Atomkrieg“ gar keinen Sieger, sondern nur die „Vernichtung der ganzen Menschheit“ kennen könne. Damit wandten sie sich dann an die „Verantwortlichen“ und redeten denen, den wirklichen Herren über Krieg & Frieden, manchmal sogar heftig ins Gewissen. Denn daß es den Staatsmännern in West und Ost um Frieden
zu gehen hätte, stand in ihrer leicht idealisierenden Optik einfach fest. Deswegen kam ihnen bei keinem der Rüstungsvorhaben, die sie akribisch studierten, der Verdacht, die geschätzten Macher der internationalen Beziehungen würden bei ihren politischen Vorhaben vielleicht doch von eher niedereren Beweggründen geleitet. Allenfalls sahen diese sich dem Vorwurf ausgesetzt, aufgrund eines – überkommenen – „Machtdenkens“, wegen – überflüssiger – „Feindbildprojektionen“ und nicht zuletzt wegen einer in Rüstungsfragen manchmal vorherrschenden „Eigendynamik“ den Aufgaben nicht gerecht zu werden, die die Forscher in Sachen Frieden für sie vorsahen. Im Resultat landete man, die Beurteilung der politischen Lage betreffend, bei einer Art versöhnlichem Zweifel und bescheinigte der Ost-West-Konfrontation mit D. Senghaas, daß hier ein Zustand „organisierter Friedlosigkeit“ erreicht sei: Kein echter „Frieden“, aber immerhin „organisiert“ im Rahmen gehalten das Ganze – oder umgekehrt: zwar „organisiert“, wegen „friedlos“ aber auch wieder problematisch.
Wie man hört, ist dieser Befund inzwischen erschüttert worden. Der kalte Krieg ist zu Ende, und „nachdem sich die Blöcke und mit ihnen der Abschreckungsfrieden abrupt aufgelöst hatten, stand auch die Friedensforschung nackt da.“ (Senghaas, 1)
Was mögen die wissenschaftlichen Sachverständigen des Friedens da am Abgang des Gegners im kalten Krieg bloß festgestellt haben?
Die Friedensforscher werden konstruktiv
Senghaas erlaubt sich folgenden Rückblick:
„Die alte Konstellation war von der Maxime militärischer Friedenssicherung geprägt: Si vis pacem, para bellum… Entsprechend war die Friedensforschung vor allem an Aggressions-, Gewalt- und Kriegsursachenforschung orientiert.“ (1)
Richtig – jüngst war da ja noch was. Senghaas erinnert sich dunkel an eine „Konstellation“, alles andere hat er wohl vergessen. Den Jahrzehnte hindurch konservierten Unwillen der westlichen Wertegemeinschaft zum Beispiel, sich mit der Existenz eines Ostblocks abzufinden. Oder das aus diesem Unwillen resultierende Kriegsbündnis der Nato, nebst der auf „friedliche Koexistenz“ pochenden Gegenrüstung des Ostens. Oder die etlichen heißen Kriege, mit denen die Staaten der Demokratie und Freiheit dem kommunistischen Lager Einflußsphären bestritten. Usw. usw. Sein Langzeitgedächtnis dafür reicht bis nach Rom zurück, wahrscheinlich deshalb, weil er sich seine „Maxime“, alle Politik, also auch die Vorbereitung eines Krieges, drehe sich letztlich um „Frieden“, auf lateinisch besser merken kann. Dann erinnert er sich noch, daß diese „Konstellation“ für ihn und seinesgleichen der Ausgangspunkt war, sich ans Nachdenken über – immerhin: – Kriegsursachen zu machen. Nennenswerter Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Bemühungen scheint er sich aber schon wieder nicht entsinnen zu können, denn von jenen souveränen Rechten, zu deren Durchsetzung Staaten ihr Militär zu unterhalten pflegen, erfährt der interessierte Leser ebensowenig wie von den Zwecken der westlichen Abschreckungspolitik, von der der Theoretiker dem Thema nach ja immerhin schon redet. Statt dessen bekommt man zu hören, daß mit dem Wegfall des sowjetischen Erzfeindes sich auch die wesentliche Kriegsgefahr in Nichts aufgelöst habe und deshalb die Forscher des Friedens auch nicht mehr über Grund und Ursachen von Kriegen nachzudenken bräuchten:
„Heute nun muß eine Friedensursachenforschung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden.“ (Nach der Maxime: „Si vis pacem, para pacem.“ – diesmal nicht altes Rom, sondern Senghaas) „Dabei sind vier Orientierungspunkte von besonderer Bedeutung: Rechtsstaatlichkeit, Erwartungsverläßlichkeit, Empathie und ökonomischer Ausgleich.“ (1)
Kaum hat eine, die östliche Kriegspartei abgedankt und mit der auch der Wille und das Vermögen, sich gegen den freiheitlichen Monopolanspruch auf Weltherrschaft zur Wehr zu setzen, ist für den Friedensforscher die Welt in Ordnung – weil sich alle Sorgen schlicht erübrigt haben, die er sich im Zusammenhang mit dem „globalen Vernichtungsszenario“ von gestern gemacht hat. Zwar sind die Waffen nicht weg, die bis neulich noch gegeneinander in Anschlag gebracht wurden, und von einem Aufbruch zur freiwilligen Selbstentwaffnung aller an der Weltkriegslage beteiligten Staaten wird wohl auch Senghaas nichts vernommen haben. Zwar kann auch von einem nunmehr einsetzenden Absterben aller Gegensätze, die Staaten in ihrem Verkehr untereinander begründen und für deren Austragung sie sich wappnen, eher nicht die Rede sein. Aber für einen auf „Frieden“ geeichten Schreibtischstrategen westlicher Außenpolitik hat das Kontrafaktische so seine Reize, und wenn man bei Krieg bzw. „Atomkrieg“ ohnehin nur an eine, mit der Existenz der Sowjetunion begründete, tragische Verstrickung gedacht hat, dann bricht mit deren Verschwinden eben zwangsläufig der „Frieden“ aus. Dieser hat nun auch so seine Ursachen, die erforscht werden wollen, und es erstaunt nicht, daß Senghaas diesbezüglich schon ziemlich weit gekommen ist: Gleich „vier Orientierungspunkte“ weiß er, die, wenn Staaten sie beherzigen täten, seiner Vorstellung nach das Paradies auf Erden herbeizaubern würden. Der Theoretiker staatlicher Außenpolitik hat nämlich seinen weltfremden Idealismus „Frieden“ einfach weiter in Richtung gelebter Fairneß & Nächstenliebe ausgesponnen – und schon stehen die Säulen des nachsowjetischen zwischenstaatlichen Katechismus: „Rechtsstaat“, wahrscheinlich weil die Demokratie der natürliche Feind von Raketen ist; „Erwartungsverläßlichkeit“, wohl weil das unter guten Freunden sich gehört; „Empathie“, weil solches den sanftmütigen Demokratien ohnehin gegeben ist, und „ökonomischer Ausgleich“, weil dieser stets auch hilfreich und gut ist. Mit einem Idyllenbild der dümmlichsten Sorte entläßt Senghaas die westlichen Staaten in die „neue Weltordnung“, damit sie an deren Vollendung wirken und dafür Sorge tragen, daß sie möglichst nur noch von ihresgleichen bevölkert wird. Denn für den Friedensforscher gibt es schlechterdings keine Bedenken mehr, die Außenpolitiker der westlichen Welt könnten sich bei ihrer hohen Aufgabe der „Friedenssicherung“ – wie noch zu Zeiten, als es das bewaffnete „Reich des Bösen“ gab – durch militärische Verstrickungen oder nationale Selbstsüchteleien selbst im Wege stehen. Sie, die nunmehr das unbestrittene Monopol für Weltordnung und -kontrolle besitzen und – nur nebenbei bemerkt: – das entsprechende Gerät zur gewaltsamen Absicherung ihrer Ordnungsvorstellungen auch, sind einfach die berufenen Kräfte, für „Frieden“ zu sorgen und mit dem gründlich aufzuräumen, was bisher (wegen der Russen und der problematischen „Lage“) auch für sie Versuchungen und selbstgeschaffene Gefahren darstellte:
„Machtbesessenheit und Expansionismus, politische Diskriminierung und Mißachtung von Menschenrechten, ökonomische Disparitäten und damit verbundene Chancenungleichheit, autistische Orientierungen und sich daraus ergebende Feindbildprojektionen.“ (1)
Wenn Demokratie und Menschenrecht den „Frieden“ verbürgen, reduziert sich eine Außenpolitik in dessen Dienst ganz darauf, solche Staaten auf Linie zu bringen, die von der vorgestellten demokratischen Lichtgestalt – die famosen „vier Orientierungspunkte“ sind diesmal negativ der Maßstab – abweichen. Freilich: Ein bißchen Macht wird wohl eingesetzt werden müssen, wenn es „Expansionismus“, den man bei anderen nie leiden kann, zu bekämpfen gilt. Ohne politische Diskriminierung wird es auch nicht abgehen, wenn eine „Mißachtung von Menschenrechten“, die man je nach Konjunktur zur moralischen Untermauerung der eigenen Feindseligkeit auswärts zu monieren pflegt, gesühnt werden soll. Und wenn „autistische Orientierungen“ zur Korrektur anstehen, stellen sich die passenden Feindbildprojektionen ganz von selbst ein. Daß das alles aufgrund der nunmehr geklärten Machtverhältnisse in Ordnung geht, steht für Senghaas außer Frage. Andererseits ist die Frage berechtigt, bei wem eigentlich und weshalb haargenau dieselben Absichten und Methoden einer erfolgversprechenden „Machtpolitik“ soviel Ehre verdienen, daß er sie im Auftrag einer ganzen „neuen Weltordnung“ anderen verbieten darf. Ganz zu schweigen von der anderen Frage, ob die Welt nun friedlicher oder unfriedlicher wird, wenn die Störer irgendeiner Ordnung seit neuestem mit dem Segen von Friedensforschern zur Räson gerufen werden sollen. Aber die Fachleute werden sich schon erklären.
Vorher fassen sie noch einmal ihre Vision zusammen und erklären, daß sie sich trotz gewisser Perspektivenwechsel treu geblieben sind:
„Diese Welt muß sicher sein, damit die Notwendigkeit der Verteidigung sich drastisch reduziert, vielleicht sogar ganz entfällt. Die Hauptfunktion des Staates besteht dann darin, die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft zu ermöglichen und alle von ihr erzeugten Güter in erster Linie diesem Ziel zuzuwenden.“ (Czempiel, 5)
Im Grunde ihres Herzens sind Staaten – freilich: nur die guten, demokratischen – prima Kumpels. Wenn man ihnen zu nahe tritt, „verteidigen“ sie sich natürlich, und da kann es schon sein, daß man das Gute an ihnen gar nicht mehr sieht. Aber wenn man ihnen nichts in den Weg stellt, sie in Ruhe und machen läßt, was sie wollen, brauchen sie sich nicht zu verteidigen und die Lage ist „sicher“. Dann haben sie auch ganz viel Zeit, ihrem Daseinszweck nachzukommen und bringen nur noch Wohltaten unter die Menschheit… Und wie die Welt der neuen Ordnung so schön „sicher“ wird, weiß man auch schon ziemlich genau. Wieder Senghaas, der seine Vorbilder kennt:
„Es wird dann nicht mehr eine militärisch abgestützte Machtpolitik betrieben, sondern ‚Verantwortungspolitik‘ (Genscher).“ (1b)
Das bringt uns der Sache schon näher.
Friedensforscher sind realistisch
Daß ihr „Problemaufriß“ so herrlich abstrakt ausfällt, daß man fast meinen könnte, bei einer Niederlage des Westblocks im kalten Krieg hätten sie einer realsozialistischen Welt dieselben „Friedensperspektiven“ angedichtet, ist nämlich nur die eine Seite. Spätestens dort, wo sie auf schon gegebene Voraussetzungen der künftig wünschbar-möglichen Weltordnung verweisen, stehen sie wieder fest auf dem Boden der Tatsachen. Aus zweckdienlichen Hinweisen wie den folgenden ist das um Bestätigung heischende „Ist es nicht so?“ ebenso herauszuhören wie die Parteinahme, von der aus und für die da argumentiert wird:
„Die Länder des Westens, die untereinander institutionell, ökonomisch, kulturell, informationstechnisch (!) eng vernetzt sind, bilden das neue Gravitationszentrum der internationalen Politik. Eine Kriegsgefahr unter diesen ‚großen Mächten‘ ist nahezu ausgeschlossen – eine in der Weltgeschichte einmalige Konstellation. … Der Club der OECD-Länder ist der unerbittlichen Logik von Handelsstaaten unterworfen: … Wettbewerbsfähigkeit, nicht militärische Macht, ist heute das Kennzeichen von internationalem Status.“ (Senghaas, 1)
Extrem realistisch. Wer wollte schon bestreiten, daß es im „Club“ der führenden Imperialisten unglaubliche Vernetzungen gibt – vor allem, wenn dabei von der Nato über den Studentenaustausch bis zur Informationstechnik gleich an alles gedacht werden darf! Daß diese Staaten nach dem Untergang der einzigen Gegenmacht ziemlich im „Zentrum“ stehen, ist bei aller Unschärfe des Ausdrucks auch nicht ganz von der Hand zu weisen; und einen Krieg haben die „großen Mächte“ in der letzten Zeit ebensowenig vom Zaun gebrochen, zumindest nicht untereinander. Bloß: Der Anschein der Gemütlichkeit, mit dem der sog. „OECD-Frieden“ gleichsam Modellcharakter für die Welt gewinnen soll, geht aus dieser bescheidenen Tatsachenaufzählung nicht hervor und ist nur der wohlwollenden Optik des Friedensforschers geschuldet. Das Verhältnis des glorreichen Zentrums zu den eher peripheren Staaten ist nicht einer so ausgemachten Rollenverteilung zu verdanken, wie das blöde Bild mit der „Gravitation“ glauben machen will; Staaten mit anderen Physikbüchern – siehe Irak – werden schon immer noch mit Gewalt darauf hingewiesen, woher die Schwerkraft weht. Daß die „großen Mächte“ in solchen Fällen gemeinsam auftreten, statt sich wechselseitig zu bekriegen, macht ihre Gewalt konkurrenzlos überlegen. Das mag welthistorisch „einmalig“ sein, legt aber weder den Schluß nahe, daß Zerwürfnisse unter ihnen deshalb schier undenkbar sind, noch schließt es den Einsatz dieser zusammengelegten Gewalt gegen Dritte aus. Und die „unerbittliche“ – Maria hilf! – „Logik von Handelsstaaten“ ist ja die Krönung der Schönfärberei: Seit wann ersetzt Wettbewerbsfähigkeit denn militärische Macht, die ökonomische Druckmittel so passend ergänzt und sogar in der Lage ist, so manchen „Statusverlust“ auf dem Weltmarkt auch wieder zu korrigieren?
Die zivilisierende Wirkung des Kapitals scheint für Friedensforscher überhaupt ein unschlagbares Argument zu sein. Kollege Czempiel z.B. kennt noch eine Form friedensstiftender Vernetzung:
„Während die Welt in den Sachbereichen der Sicherheit und der Herrschaft staatlich fragmentiert und nur ganz rudimentär geordnet ist, erscheint sie im Sachbereich der wirtschaftlichen Wohlfahrt als weitgehend vereinheitlichter Markt mit einer von den privaten Großunternehmen selbst hergestellten und praktizierten Ordnung.“ (5)
Das übertrifft selbst die Logik des Handelsstaats. Genaugenommen gibt der gute Mann zwar hinten und vorn keinen Zusammenhang an, wenn er „Sachbereiche“ (wovon?) nach dem Grad ihrer „Fragmentierung“ bzw. „Vereinheitlichung“ unterscheidet. Und umdrehen ließe sich das suggestive „Während“ auch ohne weiteres: „Während“ die Welt in der UNO schon „weitgehend“ als Einheit auftritt, „erscheint sie“ auf wirtschaftlichem Gebiet in ziemlich viele Konkurrenten zersplittert und durch staatliche Eingriffe nur rudimentär geordnet. Um so besser ist der losen Zusammenstellung dafür zu entnehmen, was uns der Dichter sagen will. Dem populären Gedanken, daß Geld die Welt regiert, werden hier endlich einmal positive Züge abgewonnen! Daß es gut fürs Geschäft ist, wenn ihm keine nationalen Schranken in den Weg gelegt werden und auch in Hinterindien satte Profitchen eingestrichen werden können, überzeugt Czempiel – das dient der „Wohlfahrt“ und ist immerhin eine „Ordnung“. Außerdem hat er gehört, daß kapitalistische Staaten ein intimes Verhältnis zu ihrem Geschäftsleben haben, dem sie nach Möglichkeit Schranken aus dem Weg räumen – also vergißt er mal kurz, daß das ohne den Einsatz der Staatsgewalt gar nicht zu haben ist, und deutet den drolligen Widerspruch zwischen wirtschaftlichem Staatsinteresse und „Fragmentierung“ an. Fertig ist die Laube und der Beweis, daß der Weltmarkt eine gewaltige Friedensbedingung ist, weil er eine gemeinsame „Sicherheit und Herrschaft“ in Aussicht stellt. Wer davon was haben soll, bleibt wieder dunkel – vielleicht sollte man bei Gelehrten, die nur verkehrte Prinzipien wissen, auch nicht so fragen.
Es sei nur am Rande vermerkt, daß derselbe Mann denselben Beweis bei Bedarf auch genau umgekehrt beherrscht. Waren die privaten Großunternehmen eben noch die Stifter einer ökonomischen Weltordnung und darin Vorbilder ihrer staatlichen Anwälte, fällt zwischendrin der harsche Ausdruck „Imperialismus“:
„‚Send the marines‘ – die vertraute Devise des amerikanischen (und des europäischen) Imperialismus hat sich ausgelebt. Damit kann man heutzutage Bodenschätze und Seewege sichern, wenn es denn nicht anders geht.“
Also doch nicht so gewaltfrei und internationalistisch, diese kapitalistische Wohlfahrt; aber eben schon in Ordnung, wie man am Golfkrieg gesehen hat, wo es ja nun bei diesem „Autisten“ aus Bagdad wirklich nicht mehr anders ging. Nur geht es jetzt um eventuelle Nato-Einsätze auf dem Balkan und steht dafür:
„Inner- und zwischengesellschaftliche Konflikte reagieren auf Gewaltzufuhr um so blutiger. Kriegs- und Bürgerkriegsparteien kann man schon gar nicht mit militärischer Gewalt zu friedlichem Zusammenleben zwingen.“ (5)
Mit dem ersten Satz hat er zwar recht, mit dem zweiten deswegen aber umso weniger: Wenn, dann lassen sich Kriegsparteien nur durch eine überlegen ausgestattete Gewalt zum „friedlichen Zusammenleben zwingen“. Aber der vernagelte Friedensfreund sieht in dem laufenden Krieg auf dem Balkan eben nur das Versäumnis, die Ethnien nicht schon längst vorher politisch zivilisiert und zum „Zusammenleben“ gezwungen zu haben, denn im Grunde ist ja die Politik schon unterwegs, die Fortschritte ihrer wirtschaftlichen Ordnung auch auf ihr eigentliches „Sachgebiet“ zu übertragen und Schluß mit der überholten Zerstrittenheit zu machen. Europa ist dafür ein besonders gutes Beispiel:
„Die internationale Organisation ist das tauglichste Instrument zur Zivilisierung der prinzipiellen Anarchie in den internationalen Beziehungen. … Diesen Anforderungen entspricht für Europa die KSZE. Sie verringert Anarchie durch Kooperation und intensive Interaktion.“ (Staack, FU-Arbeitsgruppe, 2)
Die sinnige Feststellung, daß prinzipielle Anarchisten sich erstens – unter schnöder Mißachtung ihrer Grundsätze – nur in Organisationen zusammenrotten müssen, damit sie dort zweitens den Kampf gegen ihre eigene, anarchische Staatennatur betreiben können, ist gut dahingesagt. Wie paßt denn das zusammen? Ja, in Europa geht es doch, versichern die Mitarbeiter der FU-Arbeitsgruppe – mögen die „Anforderungen“ auch ein einziger Widerspruch sein, die Existenz der KSZE verbürgt, daß sie „den Anforderungen entspricht“! Der bescheidene Umstand, daß die Mitglieder dieses Gremiums sich wahrhaftig an einen Tisch setzen und heftig interagieren, statt unzivilisiert ihrer Wege zu gehen, ist schon dasselbe wie der Ansatz zu „stabilen“, friedens„tauglichen“ Verkehrsformen. Wenn der tiefere Sinn eine so ausgemachte Sache ist, kann die Frage, was denn da verhandelt wird, natürlich getrost als zweitrangig gelten.
Die Liebhaber internationaler Zivilität haben sogar einen Grund für ihr Desinteresse an der Frage, warum die im Rahmen der Ost-West-Konfrontation eingerichtete KSZE nach dem Ende dieser Konfrontation eigentlich noch fortbesteht. Im Gegensatz zu früher, wo die „Interaktion“ durch gegenseitige Rüstung immer wieder durchkreuzt wurde, entspricht nämlich heute ihre friedensfördernde Aufgabe einem Herzensbedürfnis der Teilnehmerstaaten. Bei allem Anarchismus, den Staaten nun einmal so an sich haben, erfüllen diese Staaten wenigstens schon einen „Orientierungspunkt“ der künftigen Friedensordnung. Es sind rechtsstaatliche Demokratien, für die gilt:
„Auch unter Demokratien bestehen selbstverständlich unterschiedliche oder gegensätzliche Interessen fort. Ihre Gesellschaften lassen deren gewaltsame ‚Lösung‘ aber nicht zu, denn sie bevorzugen auch für die zwischenstaatliche Konfliktbearbeitung gewaltfreie Lösungsstrategien, wie sie ihrer innerstaatlichen Politik eigen sind.“ (2)
Solchen Theoretikern fallen ihre Gesetze wirklich stets an den passenden Stellen ein. Geht es um die Aufgabe der „Zivilisierung“, wird statt Roß und Reiter eine prinzipielle Unverträglichkeit der Staatenwelt an die Wand gemalt. Geht es aber um die realen Chancen dieser Aufgabe, wird das Gegenteil nicht nur behauptet, sondern gleich wieder zum Prinzip erhoben – einmal zu einem ökonomischen, diesmal zu einem demokratischen Prinzip. Die Abstraktionskunst ist auch in diesem Fall beeindruckend. Selbst innerstaatlich ist die „Konfliktbearbeitung“ des Rechtsstaats nicht gewaltfrei, da sie auf einem staatlichen Gewaltmonopol beruht, das gegensätzliche Interessen durchaus nicht auf dem Gesprächswege zum Stillhalten verpflichtet. Und eine „Lösung“ vorhandener Interessengegensätze wird durch die Rechtsgewalt weder bezweckt noch erreicht, da es nur um die Unterordnung aller Konflikte unter die allein maßgeblichen Staatsziele geht. Die Verkehrsformen im Staatsinnern mit dem Argument einer von Natur aus naheliegenden Neigung dann aber gleich aufs Zwischenstaatliche zu übertragen, ist schon das Allerschönste. Wollen die Fachleute für solche Fragen allen Ernstes behaupten, daß die westliche Abschreckungspolitik von gestern – mit der auch von ihnen bemerkten Verwandtschaft zum Krieg – auch nur eine etwas ausgefallene Form „gewaltfreier Lösungsstrategien“ war? Scheint’s nicht. Selbst ihnen unterläuft ja die Einschränkung, daß ihr soeben entdecktes Naturgesetz vorwiegend „unter Demokratien“ gilt – im Verhältnis zu Staaten anderer Verfaßtheit also weniger. Aber auch dann: Was rechtfertigt die offenkundige Unterstellung, daß zwischenstaatliche Gegensätze überhaupt etwas mit innerstaatlichen Interessenkonflikten gemein haben, so daß man die jeweiligen Formen der „Konfliktbearbeitung“ miteinander vergleichen könnte? Bloß die matte Vorstellung, daß da beidemal Gegensätze vorliegen und beidemal Ordnung geschaffen wird?
Der ganze Realismus des durch ökonomische Vernetzung, europäische Kooperation und gemeinsame Rechtsstaatlichkeit schon erreichten Standes der staatlichen Selbstzivilisierung kürzt sich also auf immer die gleiche Logik zusammen: Stur am Gesichtspunkt der eingekehrten „Ordnung“ gemessen, nehmen sich die auswärtigen Verhältnisse der führenden Demokratien – worum es da geht, interessiert keinen – weitgehend enorm ordentlich aus. So ordentlich, also friedenssichernd, daß die Friedensforschung nicht umhin kann, wenigstens einem Teil der Staatenwelt das eigene Tun als Leistung anzurechnen. Und die Idee des „ewigen Friedens“, konstruktiv gewendet, ist beim nächsten Schritt – diese Staaten könnten ihrem Hang bzw. Zwang zum Frieden noch besser dienen, wenn sie den anderen ihre Neigung zu Zwist, Hader und vorschnellen Gewalteinsätzen endlich austreiben würden.
Frieden braucht Einmischung – gewaltfrei, wenn’s geht
Die Demokratie hat den Mitgliedsstaaten der KSZE zu ihren zivilisierten Umgangsformen verholfen, also versteht sich auch von selbst:
„Eine zentrale Aufgabe für die KSZE liegt … in einer aktiven Demokratisierungspolitik.“
Nun sind schon die früheren Ostblockstaaten nicht deshalb in den europäischen Demokratenclub übergewechselt, weil westliche Demokratieaktivisten sie vom rechtsstaatlichen Prinzip mit seinen friedlichen Aussichten überzeugt hätten. Dort wurde der Rechtsstaat vielmehr als passende Ergänzung der Marktwirtschaft eingeführt, als Befreiung des Staats von sozialen Ansprüchen und als Zwang, in den von ihm erteilten Rechten fortan alle gesellschaftlichen Interessen aufgehoben zu sehen. Da der ökonomische Mißerfolg das erwartete Ergebnis – der Staat stärkt sich, und dank nützlicher Dienste kann auch das Volk leben – vorerst ausbleiben läßt, hält sich auf beiden Seiten die Begeisterung für rechtsförmliche Verfahrensweisen in Grenzen. Auch die Ideologen des KSZE-Friedens nehmen das als „nicht vollendete“ Demokratie, „nicht abgeschlossene“ Rechtsverwirklichung zur Kenntnis. An der Auffassung, daß Demokratie und Menschenrechte das Lebenselixier Gesamteuropas sind, macht sie das noch lange nicht irre. Hier liegt schließlich ein „Standard“ vor, dem man sich nicht entziehen kann:
„Dennoch kann vom Erreichen eines gesamteuropäischen Demokratiestandards ausgegangen werden, der das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten als überholt erscheinen läßt. Im Gegenteil stellt die gewaltfreie Einmischung der Staaten und Gesellschaften für Demokratie und Menschenrechte eine zentrale Bedingung für die Sicherheit in Europa dar.“ (Staack, 2)
Rückwärts und vorwärts ein aufschlußreicher Ausgangspunkt. Zum einen hat die westliche Seite in der alten KSZE gar keine „Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten“ des gegnerischen Lagers unterschrieben, die heute „überholt“ sein könnte. Sie hat sich stattdessen die Menschenrechte körbeweise unterschreiben lassen, in deren Namen es dann die östlichen „Unrechtsregimes“ anzuprangern und zu Zugeständnissen zu erpressen galt. „Überholt“ kann also nur die Form der Nichteinmischung sein, auf die der Osten seinerzeit im Vertragswerk noch Wert legte: die Respektierung der wechselseitigen Grenzen und eingerichteten staatlichen Souveräne. Man erfährt insoweit, daß die Friedensforschung damals nicht aus innerer Überzeugung, sondern nur aus Sorge um die militärischen Folgen nicht einem Marsch auf Moskau das Wort geredet hat. Na gut. Warum jedoch heute, wo manche Menschen längst etwas von „gesamteuropäischen Demokratiestandards“ läuten hören, eine friedenstheoretisch inspirierte Neuauflage der Breschnew-Doktrin notwendig sein soll, geht daraus auch nicht hervor. Es muß wohl so sein, daß der Glaube an den Friedensdienst des Rechtsstaats gleich mehrere Öffnungsklauseln kennt: Selbst bei aufrechten Demokraten scheint man welche unterscheiden zu können, die ihre natürliche Neigung zur sanften Konfliktlösung ernstnehmen, und solche, bei denen umgekehrt der alte Chaot durchbricht. Wenn dann die einen sich bei den Nachbarn einmischen, weil sie das innerstaatliche Verhalten der andern für unerträglich halten, dann ist das schon deshalb gewaltfrei, weil es dem Vollzug eines gemeinsamen Bekenntnisses zu gewissen „Standards“ dient und der Vorrang der Kooperation manchmal nur auf unkooperativen Wegen durchzusetzen ist. Und wenn zur Überwindung der Souveränität auf der einen Seite ein Aufbau von Macht- und Druckmitteln – der „Staaten und Gesellschaften“, goldig! – auf der anderen Seite fällig wird, so ist das nichts anderes als eine „zentrale Bedingung der Sicherheit in Europa“.
Wie schnell sich doch das Deuten auf schon erreichte „Friedenslösungen“ in die Beschwörung ihrer Unvollständigkeit übersetzen läßt! So wenig ein weiteres Mal erkennbar wird, wer hier wovon herausgefordert wird – freilich: die Vermutung liegt nahe, daß die Hüter der Demokratiestandards auch die Sicherheitsbeauftragten für Europa sind –, so unübersehbar ist der Totalitarismus des Gedankengangs: Jenseits aller nationalen Interessen (andere kommen hier sowieso nicht vor, und selbst von jenen will man nur wissen, daß es sie gibt), ohne Feind, ja sogar ohne die früher gern ausgepinselte Kriegsgefahr sollen „Staaten und Gesellschaften“, die „Völkergemeinschaft“ insgesamt und die KSZE im besonderen alles Nötige zur universellen Einmischung tun; kein inner- oder zwischenstaatlicher Konflikt darf der Frage entzogen werden, ob er nicht ein „Ordnungsfall“ ist.
Kein Wunder, daß sich die Besichtigung der fälligen Aufsichtsinstrumente nur in Nuancen von dem unterscheidet, was Friedensforscher sonst als „traditionelle Machtpolitik“ für das Gegenteil ihrer Absicht halten:
„Um ihre neuen Aufgaben erfüllen zu können, benötigt die KSZE ein wirksames, sanktionsbewehrtes Instrumentarium zur Konfliktverhütung und -schlichtung. … An die Stelle des Konsensprinzips müssen qualifizierte Mehrheitsentscheidungen treten. Zur Durchsetzung der Sanktionsmechanismen ist außerdem die Aufstellung einer KSZE-Friedenstruppe unter dem Befehl des Sicherheitsrats anzustreben.“ (2)
Wer sagt’s denn. Da der Haken gewaltfreier Lösungen daran liegt, daß der andere in seine Beaufsichtigung einstimmen muß, sind Sanktionen nötig; und was wären Sanktionen ohne die militärischen Mittel ihrer Durchsetzung. Die friedliche Nuance liegt natürlich auch auf der Hand – mit der Vorstellung, daß die Macht des Gesetzes jeden treffen kann, weil es um supranationale Prinzipien und weiter nichts geht, können „qualifizierte Mehrheitsentscheidungen“ und „Friedenstruppen“ ohne Firmenschild unmöglich noch mit Interessengemeinschaften alter Machart verwechselt werden.
Außerdem ist eher der Souveränitätsanspruch unkooperativer Staaten eine Bedrohung des möglichen Weltfriedens als dessen gutgemeinte Verletzung. Im Fall Jugoslawien sagen wir das mit ungewohnter Deutlichkeit:
„Die Tatsache, daß die Völkergemeinschaft es bereits als selbstverständlich betrachtet, in den Konflikt diplomatisch einzugreifen, anstatt ihn vollständig zur inneren Angelegenheit des betroffenen Staates zu erklären, zeigt, daß – zumindest innerhalb Europas – die großkalibrige Gewaltanwendung als legitimer Anlaß empfunden wird, um den Souveränitätsanspruch eines Staates zu relativieren. Wäre das nicht so, könnten wir im übrigen alle Überlegungen zur Konstruktion einer Friedensordnung auf der Grundlage des Endes des Ost-West-Konflikts begraben. Will das jemand?“ (Müller, HSFK, 4b)
Ob dieser engagierte Forscher tatsächlich glaubt, daß die europäischen Politiker genau wie er mit der Überlegung zur Konstruktion von Ordnungen befaßt sind, wenn sie den Balkan ein für allemal nicht sich selbst überlassen wollen, sei dahingestellt. Überraschend wäre es jedenfalls schon, wenn sie nach Jahren der Rüstung – keine Kleinkaliberpistolen – und ihrer sachkundigen Verwendung in einem kaltem Krieg und etlichen heißen auf einmal ihre Abneigung gegen „großkalibrige Gewaltanwendung“ entdeckt hätten. Aber die Hauptsache sind hier ja die „Selbstverständlichkeiten“ und „Empfindungen“ der Völkergemeinschaft. Wenn dieser Verein, den es nicht gibt, neuerdings beschlossen hat, nur legitime staatliche Souveräne zu respektieren, dann ist es nur recht und billig, daß die wirklichen Außen- und Kriegsminister dasselbe tun. Vorausgesetzt, sie sind so legitimiert wie unsere „innerhalb Europas“ mit ihren ökonomischen, institutionellen und demokratischen Vorleistungen auf den künftigen, größeren Frieden, und dürfen deshalb auch entscheiden, wann ein Staat Respekt verdient und wann nicht.
Die Ableitung eines moralischen Rechts auf Eingriffe jenseits der eigenen Landesgrenzen ist allerdings nur die eine Seite. Das Bedürfnis, die verlangten Strafaktionen von jenem staatlichen Gewaltgebrauch abzugrenzen, gegen den sie nötig sein sollen, möchte die höhere Rechtmäßigkeit auch noch am Umgang mit den Gewaltmitteln erkennen können, die im Sinne der Gewaltfreiheit aufgefahren werden. Wenn das etwas diffizile Unterscheidungskünste erfordert, bittesehr:
„Wird unter ‚Intervention‘ weder eine kriegerische Handlung von externen Akteuren, noch eine bloße harmlose Einmischung ohne spürbare Folgen für das betroffene Land verstanden, sondern ein Mittelding zwischen beiden Extremen – sagen wir eine politische Nötigung seitens der Staatengemeinschaft mit spürbar unangenehmen Folgen im Fall der Ignoranz gegenüber externen Forderungen –, dann ist eine politische Intervention bei Verletzung eines kollektiven Gutes durch einen Nutznießer und Mitspieler möglicherweise geboten oder vertretbar.“ (Tetzlaff, 6)
Interventionen so zu definieren, ist natürlich kein Problem. Wenn darin zugleich augenfällig wird, unter welchen Bedingungen ein friedensbewußter Politologe Auswärtsspielen seines Staats „möglicherweise“ seine Zustimmung nicht versagen kann – er muß eben die passende Definition im Zettelkasten finden –, so ist das sein Problem. Warum sollte die spinnöse Auffassung, daß Politik eine Art praktischer Philosophie im Geiste von Kant & Küng ist – „ewiger Frieden“, „Weltethos“ –, das Zutrauen in deren Veranstalter auch ausgerechnet dann verlieren, wenn diese gegen die Richtigen mal wieder „spürbar unangenehm“ werden? Andererseits wird auch ein Meister im definitorischen Einordnen nicht im Ernst behaupten können, daß ihm damit eine Unterscheidung in der Sache gelungen ist. Der Unterschied zwischen militärischem Zwang und vorkriegsmäßig „spürbarer Nötigung“ mit diplomatischen oder wirtschaftlichen Erpressungsmitteln ist in Anbetracht von Absicht und Wirkungen nicht übermäßig; und daß sich verschiedene Methoden der Gewaltanwendung, die der Durchsetzung derselben „externen Forderungen“ dienen, hinsichtlich ihrer moralischen Qualität unterscheiden sollen, ist ja nur ein sachfremder Zusatz.
Wenn es auf den ankommt, kann man das überkommene Relativieren – das Krieg und Frieden, Gewalt und Gewaltfreiheit immer als unüberbrückbare Gegensätze sehen will – auch gleich lassen und Klartext reden. Außer dem guten Zweck heiligt die Mittel sowieso nichts, also sind Definitionsleistungen der anderen Art angebracht:
„Die ‚Selbstbeschränkung‘ auf die individuelle oder Bündnisverteidigung ist gerade noch einem alten und zunehmend veraltenden Begriff der nationalen Souveränität verhaftet, den es gerade im Sicherheits- und Militärbereich zu durchbrechen gilt. … ‚Allianz und Selbstverteidigung‘…, die der nationalen Gewaltpolitik jedenfalls näher stehen als die kollektive Sicherheit.“ (Müller, 4b)
Verteidigung ist Gewalt, und kollektives Durchbrechen nationaler Gewalten schafft Sicherheit! Sicher, auch dieser Beitrag zum „out of area“-Einsatz bewährter Verteidigungsbündnisse kann seine Herkunft aus einem wissenschaftlichen Ideenhimmel nicht verleugnen, wo die staatliche Hoheit über Volk und Territorium nur ein „Begriff“ ist, der sogar „zunehmend veralten“ kann. Ob dabei unter „nationaler Gewaltpolitik“ noch etwas anderes verstanden wird als eine Abweichung vom eigenen Ideal kollektiver Sicherheit, darf auch bezweifelt werden. Bemerkenswert ist es aber schon, daß ein Friedensforscher bei seinem lebenslangen Suchen nach Bedingungen von Möglichkeiten inzwischen dabei angelangt ist, daß Kriegsbereitschaft – zwar kollektiv, aber unter Verzicht auf Selbstbeschränkungen – auch eine, wenn nicht sogar die Friedensbedingung ist. Nicht nur, daß die Kriegsbereitschaft der Nato rückblickend als Friedensgarantie gewürdigt wird, die allerdings nur dem damals aktuellen Souveränitätsbegriff gerecht wurde, – die heute fällige Entscheidung supranationaler Gewaltfragen hängt auch eng damit zusammen, welchen Frieden „wir“ letzten Endes wollen:
„Die Frage, um die es letzten Endes geht, ist: ob die Weltordnung von kollektiver Sicherheit oder von der Machtentfaltung selbsternannter Weltpolizisten geprägt sein wird, ob sie vorwiegend auf friedlichen Mitteln oder auf dem willkürlichen Einsatz des Militärs nach dem Gusto der Stärksten beruht.“ (Müller, 3)
Auf diese Weise nimmt der universelle Einmischungsgedanke doch noch realpolitische Formen an. Einmal abgehakt, daß zur Weltordnung sowieso nur ordentliche Staaten befugt sind, daß sie nur im Auftrag der Völkergemeinschaft und nur zur Konfliktregelung tätig werden und ihr kollektives Interventionsrecht vorwiegend – wenn auch nicht ausschließlich – mit friedlichen Mitteln wahrnehmen sollen, – das alles abgehakt, erhält das erträumte Weltaufsichtsbündnis sein letztes Recht aus einer Alternative, die nicht sein soll. Die Ordnung, die „selbsternannte Weltpolizisten“ schaffen, ist natürlich auch eine Ordnung; die Konflikte, die von „den Stärksten“ unter Kontrolle gebracht werden, werden von ihnen schon auch unter Kontrolle gebracht; und die Annahme, daß die entsprechenden Militäreinsätze deswegen „willkürlich“ ausfallen, ist im Rahmen von Polizeiaufgaben gar nicht naheliegend: „Frieden“ kommt so oder so zustande. Soweit es also um die immerselben Abstraktionen geht, ist der gewichtige Unterschied zwischen dieser und der anderen „Weltordnung“ einfach nicht abzusehen. Aber der Gegensatz von Weltfriedensmächten zu Weltmächten, von überparteilicher Friedensintervention zu nationaler Machtentfaltung folgt auch nicht aus der methodischen Konstruktion, sondern aus ihrer parteilichen Anwendung. Der Weltmacht USA – diesem Urbild eines „selbsternannten Weltpolizisten“ – trauen Friedensforscher offensichtlich nicht denselben Kollektivismus und dieselbe weltumspannende Ethik zu, wie das in der Noch-nicht-Ordnungsmacht Europa schon tendenziell angelegt sein soll. Diese muß vorankommen, damit aus der kollektiven Sicherheit was wird, „die Stärksten“ allmählich ihre usurpierte Rolle in der Weltpolitik verlieren und auch sie zu „zivilen“ Umgangsformen zurückfinden. Erst dann ist „der Frieden sicher“ und nicht mehr ein Spielball zweifelhafter Mächte.
Weltfriedensmacht Deutschland
Die Frage einmal so gestellt, ergeben sich ganz neue Einblicke in das Thema. Die Möglichkeit und Legitimität der heutzutage angesagten Friedenspolitik ist ja gut und schön – wenn es darum geht, sie zu machen und verkehrte Vorbilder zu überwinden, braucht es Staaten, bei denen sich die gute Absicht mit der vorhandenen Macht verbindet, sie auch durchzusetzen. Um das Problem noch einmal klarzustellen:
„Eine erfolgreiche europäische Zivilmacht … könnte ein positives Gegenmodell zu der überreizten, absteigenden Supermacht USA bilden, die sich allzu leicht in militärische Abenteuer in anderen Weltregionen verstricken läßt, obwohl ihr die Macht fehlt, dort wirklich Ordnung zu garantieren.“ (Rode, 7a)
Das wäre was! Europa wird „zivil“ zur Macht, kümmert sich „zivil“ darum, daß es auch anderswo etwas zu melden hat, setzt sein Militär nur in wohlbegründeten Ausnahmefällen ein – doch nicht für Abenteuer! – und schafft so eine Ordnung, von der Supermächte nur träumen können. Und Amerika, dessen Weltordnung auf nichts als militärischer Gewalt gründet – freilich, „überreizt“ und auf dem absteigenden Ast –, steht daneben und erbleicht vor Neid über so ein „positives Gegenmodell“. Schön ausgedacht. Zum einen soll sich die zivile von der bloß militärisch garantierten Ordnung tatsächlich durch ihre Effektivität unterscheiden – ein enorm friedlicher Gesichtspunkt. Zum andern kann man Fragen der Weltaufsicht natürlich ohne weiteres für eine politische Schönheitskonkurrenz halten und dem europäischen Angebot viel Erfolg wünschen, solange die aufstrebende Zivilmacht ihre speziellen Instrumente nicht bei der gewaltfreien Verarbeitung dieses Konflikts erproben muß.
Aber bis dahin steht ja erst einmal die Frage an, wie „Europa“ aus einer friedenstheoretischen Perspektive eine praktische Realität werden kann. Den „Gegebenheiten“ kommt dabei eine Schlüsselrolle zu:
„Bei der Zivilisierung der internationalen Politik in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird der deutschen Außenpolitik so oder so eine Schlüsselrolle zukommen… Diese besondere Verantwortung ergibt sich aus drei Gegebenheiten: Aus ihrer Mittellage in Europa, aus dem wirtschaftlichen Gewicht der Bundesrepublik und schließlich aus der zentralen Rolle Deutschlands im Prozeß der europäischen Integration.“ (Maull, 8)
Idealismus und Realismus der Betrachtungsweise passen also wieder prachtvoll zusammen. Aus der schönen Idee der „Zivilisierung“ wird nichts, wenn sich nicht starke Nationen dahinterstellen; und die gewachsene Macht des neuen Deutschland ist ein einziger Auftrag für weltpolitische Verantwortung. Wozu hat einem der Herrgott Mittellage, wirtschaftliches Gewicht und europäische Führungsrolle denn sonst geschenkt? Gegen die Möglichkeit, erst Europa und dann die ganze Welt zu „zivilisieren“, sieht die Außenpolitik, die Deutschland schon längst betreibt, geradezu beschränkt aus. Große Nationen haben eben auch große Aufgaben!
Und da jedenfalls heute feststeht, daß das deutsche Wesen, an dem die Welt genesen soll, durch und durch gut ist, kann man durchaus zu ungewohnt pathetischen Tönen greifen. Friedensforscher Müller über das Hin und Her, was künftige Bundeswehreinsätze angeht:
„Was mich an der ganzen Debatte am meisten erschüttert, ist die Strategielosigkeit des deutschen Vorgehens. Wo soll die Reise hingehen? Welche Vision von Weltpolitik, von Weltordnung steht dahinter, zu der der schwererrungene deutsche Beitrag letztlich führen soll?“ (Müller, 3)
„Vision von Weltordnung“, das kannte man bisher nur von amerikanischen Präsidenten oder aus früheren Zeiten. Jetzt, wo ihm eine Vision vorschwebt, wirft der Wissenschaftler der deutschen Politik vor, daß sie eigentlich viel zu bescheiden auftritt und die Völkergemeinschaft mit keinem Programm als Weltfriedens- und Zivilmacht des 21. Jahrhunderts blendet! Selbstverständlich äußert sich hier nicht nationalistischer Größenwahn, sondern der wissenschaftliche Sachverstand. Deutschland hat nämlich nicht nur wegen seiner Macht eine besondere Verantwortung, im Gebrauch seiner Macht vielmehr schon vieles vorweggenommen, was heute als Grundausstattung einer tauglichen Friedensordnung Konsens in Fachkreisen ist – womit wir endlich beim Punkt wären:
„Denn die deutsche Außenpolitik ist in vieler Hinsicht moderner und besser auf die Verhältnisse des 21. Jhds. ausgerichtet als die unserer Freunde. Ob es die Selbstverständlichkeit ist, mit der sich die Deutschen den Multilateralismus zu eigen gemacht haben; … ob es um die völlig richtige Erkenntnis geht, daß viele Konfliktursachen wirtschaftlicher und sozialer Natur sind und daher der wirtschaftlichen und finanziellen Betreuung bedürfen (es besteht überhaupt kein Grund, dies als ‚Scheckbuchdiplomatie‘ abzuqualifizieren); … – in keiner Hinsicht brauchen wir uns zu verstecken vor Frankreich, das sein nukleares Spielzeug als Symbol einer längst vergangenen Unabhängigkeit braucht, vor England, das gravierende Probleme mit dem unvermeidlichen Souveränitätsverzicht in Europa hat, vor den USA, deren Regierung noch nicht verstanden hat, daß nichtmilitärische Fragen für die Welt – und für die USA selbst – eine wesentlich gewichtigere Rolle spielen als herkömmliche Belange der Sicherheitspolitik…“ (3)
Da kann die Friedensforschung ja froh sein, in Deutschland einen so maßgeschneiderten Stellvertreter ihrer konstruktiven Ideale auf Erden zu haben. Wenn das so ist, darf das erstaunliche Entsprechungsverhältnis aber auch umgekehrt gesehen werden: Die ganze „Friedensordnung“, auf deren methodische Prinzipien ihre wissenschaftlichen Konstrukteure so stolz sind, ist offenbar nur ein verhimmeltes Abziehbild der wirklichen deutschen Politik. Oder verhält es sich nicht so:
- Die westdeutsche Politik hat in ihrem „Multilateralismus“ erst ihre Erfolgschance, dann ihren Erfolgsweg gesehen. Um nach dem Krieg wieder einen konkurrenzfähigen Kapitalismus auf die Beine stellen zu können, war amerikanische Unterstützung sehr recht; weil es gleich um Erschließung des Weltmarkts, daneben um das anspruchsvolle Ziel der nationalen Vergrößerung ging – mitten ins Lager einer Siegermacht hinein –, war die Einordnung in ein machtvolles Kriegsbündnis namens Nato angebracht; mit den ersten Erfolgen des Wiederaufstiegs reifte das Projekt, in und mit Westeuropa eine Weltwirtschaftsmacht zu werden; und nachdem all diese Rechnungen aufgingen, hat die deutsche Politik – schon wieder „multilateral“ – das Ziel, aus der europäischen Wirtschaftsmacht auch eine Weltmacht Europa zu machen. Deutschland ist also überhaupt kein Beispiel eines Staats, der aus „selbstverständlicher“ Vernunft-Neigung „Multilateralismus“ statt seiner nationalen Interessen betreibt. Aber weil sich in diesem Fall das eine so gut mit dem andern verträgt, schwelgen die wissenschaftlichen Interpreten in der unglaublichen „Modernität“ einer solchen Außenpolitik und halten ihre Ambitionen für einen Ausbund an Selbstlosigkeit.
- Der westdeutsche Multilateralismus hatte auch einen Haken. Das Mittel, sich außenpolitische Einflußzonen zu schaffen – die souveräne Verfügung über ein eigenes Militär –, war der BRD vierzig Jahre lang verschlossen. Allerdings schuf der Umstand, daß alle anstehenden Gewaltfragen von den Amerikanern geregelt wurden, die seltene Möglichkeit, auswärtige Herrschaften durch rein wirtschaftliche Mittel zu abhängigen und befreundeten „Partnern“ zu machen; wozu der Export von Kriegsgeräten übrigens allemal gehörte. Daß das doch nur eine Notlösung war, merkt die deutsche Politik jetzt an Fällen wie Irak und Jugoslawien, wo der Einfluß trotz weitgediehener wirtschaftlicher „Bindung“ so eine Sache ist. Den Friedensforschern gefällt dagegen die bisherige Verfahrensweise ausgezeichnet, weil sie erneut den Sonderfall vergessen und die Not mit einer Tugend verwechseln; ohne Sturmtruppen vor Ort wollen sie gleich eine „Konfliktbetreuung“ um ihrer selbst willen ausgemacht haben.
- Daß Deutschland auch jetzt, wo es die Freiheit dazu hätte, seine nationale Militärpolitik hinter das Projekt einer „europäischen Sicherheitsgemeinschaft“ zurückstellt, trägt ihm die meisten Lorbeeren ein. Das ist „realitätsgerecht“ und „zivil“, während Weltmächte von gestern ihre „längst vergangene Unabhängigkeit“, ihren „unvermeidlichen Souveränitätsverzicht“ und überhaupt, daß mit „herkömmlicher Sicherheitspolitik“ nichts mehr zu holen ist, noch gar nicht gemerkt haben. Dabei unterscheidet sich die hochmoderne deutsche Politik von der herkömmlichen nur in einem: Militär- und Aufsichtsmacht, die andere schon – oder noch – sind, will Deutschland erst werden. Das ist eine Herabstufung der Souveränität anderer Staaten, der zur Aufsicht vorgesehenen ebenso wie der bisher selbständig kalkulierenden Partner, deren atomares „Spielzeug“ gemeinsamen Entscheidungen unterstellt werden soll. Und wenigstens denen, die dagegenhalten könnten, soll der gemeinsame Machtzuwachs die Beschränkung ihrer alten militärischen Rolle wert sein. Logisch, daß so ein Programm nicht mit der Parole „Deutschland, Deutschland über alles“ antritt, sondern sich die Stiftung einer „europäischen Ordnung“ im inhaltsleersten und abstraktesten Sinn auf die Fahnen schreibt. Und deswegen logisch, daß Friedensordnungs-Theoretiker in einer solchen Politik geradezu Geist von ihrem Geist wiederfinden und vor lauter „Zivilisierung“ keinen Zweck mehr ausmachen können, solange die Gegensätze des deutschen Programms nicht zum Tragen kommen (sollte das innerhalb Europas, im Verhältnis zu Dritten oder gegenüber den USA irgendwann der Fall sein, wird man nach der Anlage des Gedankens freilich schon jetzt vermuten können, wer die schönen Friedenschancen wieder versaubeutelt hat).
Solange das so ist, braucht ein Friedensforscher im übrigen auch nicht unbedingt Elogen auf die deutsche Außenpolitik abzuliefern, um seine gute Meinung von ihr kundzutun. Es genügt, sich im Sinne von Genscher – „Verantwortungspolitik“ ist gefragt und endlich, endlich möglich – in ihre Nöte und Versuchungen hineinzuversetzen.
„… eine Rückkehr zu einer ‚normalen‘, sprich: nationalstaatlichen Außenpolitik wäre schon im Ansatz fatal. Dagegen schafft die Bekräftigung der Kontinuität durch den Modellcharakter der deutschen Außenpolitik auch Gestaltungsspielräume gegenüber ihren Partnern…“ (Maull, 8)
„Die Zeit ist reif, die Angewiesenheit auf Notwehrmittel abzulösen durch ein verläßliches System der Nothilfe. Daran sollte die Bundesrepublik mitwirken. Statt dessen wird der Druck wachsen, sich einer vorgestrigen Normalität anzugleichen.“ „Man will aus Furcht vor Inferiorität nicht länger auf jenen politischen Einfluß verzichten, den Waffenmacht eröffnet, in Europa wie in der Welt.“ (Mutz, 4a)
„Dem größeren Europa mit Deutschland in der Mitte wird mehr als nur wirtschaftliche Macht zuwachsen. Die Versuchung für Deutschland bestünde … darin, womöglich das antiquierte englisch-französische Beispiel eines Weltmachtinterventionismus mittragen zu wollen, anstatt ihm gegenzusteuern.“ (Rode, 7a)
Das war ja irgendwie zu erwarten. Die deutsche Außenpolitik ist sogar besser als ihre eigenen Vertreter womöglich wissen oder sich zu vertreten trauen! Ohne guten Grund, aber am Ende wegen der anderen könnten sie doch hereinfallen auf „normale, sprich: nationalstaatliche Außenpolitik“, „vorgestrige Normalität“ oder „antiquierte Beispiele“. Da muß der Kenner der 1992er Konstellation schon entschieden Einspruch erheben und einen letzten Beweis antreten, wes Geistes Kind er ist. Wo es um die Methode der Politik geht, die „Ordnung“ schafft, sind Nationalstaat und egoistische Machtpolitik das negative Schreckbild der Zivilmacht und das Gegenteil von Kooperation. Wo es aber um den Einsatz der Politik für so fortschrittliche Methoden geht, erfährt man Erstaunliches darüber, wieso die „Zivilmacht“ gerade ein deutsches Projekt sein müßte: „Gestaltungsspielräume“ gegenüber den Partnern würde man sonst verscherzen und am falschen Platz „Inferiorität“ empfinden, anstatt die längst vorhandene „mehr als nur wirtschaftliche Macht“ gegen die wirklich Inferioren und Vorgestrigen in Anschlag zu bringen. Wenn das deutsche Interesse über jeden Zweifel erhaben ist, weil es sowieso nur eine ganz und gar überparteiliche Friedensordnung im Sinn hat, läßt sich eben auch der Satz vertreten, daß das Eintreten für eine „neue Logik internationaler Politik“ (Statz, 7b) ausgesprochen im deutschen Interesse liegt. Als „Staat wie jeder andere … den machtpolitischen Weg“ zu gehen (ebd.), wäre für diesen Staat doch eine ausgesprochen langweilige Machtpolitik!
Insofern hat es schon seine Richtigkeit, daß die Friedensforschung mit ihren neuen Ideen das Ende des kalten Kriegs abgewartet hat. Nicht unbedingt eine militärische Maxime, aber die militärische Machtverteilung hat sowohl der deutschen Politik wie ihren wissenschaftlichen Beratern Höhenflüge verboten, die heute möglich sind. Das alte Problem, daß keine maßgebliche Partei „den Frieden“ sichern konnte, ist überwunden, die geborene Friedensmacht gefunden – und der Anschein einer theoretischen Distanz der Debatte über die beste = „modernste“ = zweckmäßigste deutsche Außenpolitik zum imperialistischen Programm der deutschen Nation gewichen.
Zitate:
1. D. Senghaas, In den Frieden ziehen, FAZ 6.6.92 1b. ders., Die Neugestaltung Europas
2. M. Staack / FU-Arbeitsgruppe, Die gewaltfreie Einmischung garantiert Sicherheit in Europa, FR 23.3.92
3. H. Müller / HSFK, Wie ein kollektiver Rambo zum völkerrechtlichen Monster wird, FR 25.7.92
4a. R. Mutz / IFSH, Die zwei Gesichter militärischer Gewalt, FR 9.7.92
4b. H. Müller, ebd.
5. E.-O. Czempiel, Pax Universalis, Merkur 8/92
6. R. Tetzlaff, Zur Legitimität „politischer Interventionen“, S+F 1/92
7a. R. Rode, Deutschland: Weltwirtschaftsmacht oder überforderter Euro-Hegemon?, Friedensanalysen 26 (es 1738)
7b. A. Statz, Zwischen neuer Machtpolitik und Selbstbeschränkung. Deutsche Außenpolitik am Scheideweg, ebd.
8. H.W. Maull, Zivilmacht Bundesrepublik Deutschland, Europa-Archiv 10/92