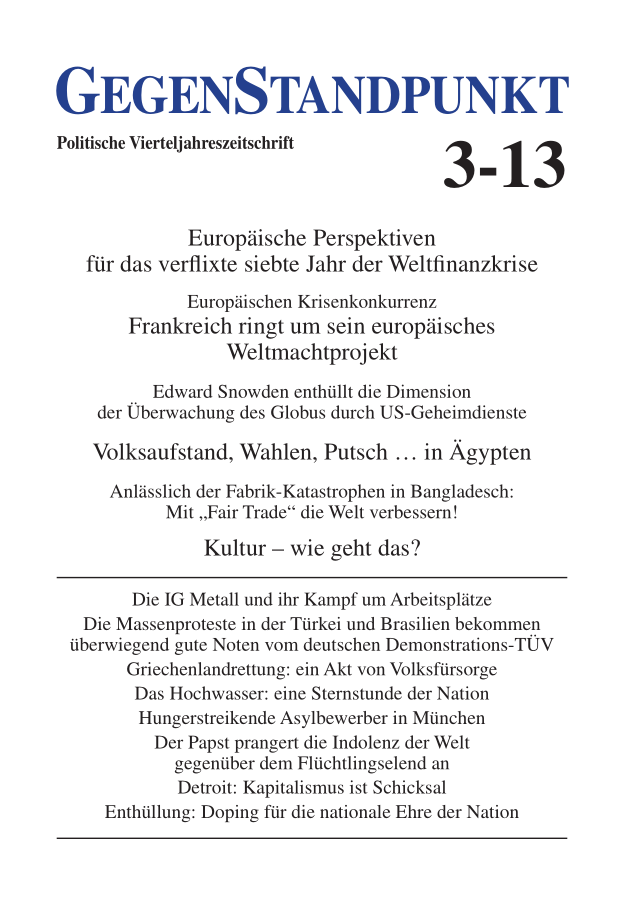Anlässlich der Fabrik-Katastrophen in Bangladesch: Mit „Fair Trade“ die Welt verbessern!
Ausbeutung in der 3. Welt: Nichts weiter als eine Herausforderung an die Moral des westlichen Verbrauchers
Seit der Nachricht über brennende oder einstürzende Textilfabriken mit Tausenden Toten stehen Hungerlöhne und Arbeitshetze in der Dritten Welt am Pranger. Die Verbraucher in den Zentren der globalen Marktwirtschaft sollen wissen, unter welch brutalen Bedingungen ihre Klamotten hergestellt werden: „Nähen und sterben für den Westen!“ (Spiegel, 1.7.13) Und verschwiegen wird ihnen tatsächlich nichts.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Anlässlich der Fabrik-Katastrophen in Bangladesch: Mit „Fair Trade“ die Welt verbessern!
Ausbeutung in der 3. Welt: Nichts weiter als eine Herausforderung an die Moral des westlichen Verbrauchers
1.
Seit der Nachricht über brennende oder einstürzende Textilfabriken mit Tausenden Toten stehen Hungerlöhne und Arbeitshetze in der Dritten Welt am Pranger. Die Verbraucher in den Zentren der globalen Marktwirtschaft sollen wissen, unter welch brutalen Bedingungen ihre Klamotten hergestellt werden: „Nähen und sterben für den Westen!“ (Spiegel, 1.7.13) Und verschwiegen wird ihnen tatsächlich nichts.
„Bangladesch – Die Geschichte einer absehbaren Katastrophe
80 % der Exporterlöse stammen aus der Textilindustrie. Die Volkswirtschaft Bangladesch hat nur diesen einen Trumpf: die niedrigsten Löhne der Welt. Dazu 160 Mill. Menschen, die sich duldsam ausbeuten lassen, weil es immer noch erträglicher ist, im Industriepark Dhaka zwölf Stunden am Tag Knochenarbeit zu leisten, als landlos in einem halbüberschwemmten Dorf Hunger zu leiden. (…) Im Rana Plaza arbeiteten zwischen Wellblechhütten ca. 3500 Menschen für Textil-Discounter und Kaufhausketten aus USA und Europa. Auf jeder Etage stehen Hunderte elektrische Nähmaschinen, 70 in einer Reihe, und 4 schwere Dieselgeneratoren, weil an manchen Tagen 50-mal das Stromnetz zusammenbricht. Das ohne amtliche Genehmigung errichtete Haus hatte zu dünne Zwischendecken; die Maurer hatten nie zuvor ein so hohes Gebäude gebaut. Der Beton war mit zu viel Sand versetzt, der Boden nachgiebig. Zwei weitere Etagen wurden nachträglich aufgestockt. All dies würde der hohe Ermittler aus dem Innenministerium später herausfinden… Billig, billig, billig! Wenn Sicherheit und Arbeit nichts kosten, steigen die Gewinne. Wenn Bangladeschs Regierung aber das Gebäude- und Brandschutzabkommen durchsetzt und die Mindestlöhne anhebt, wird die Branche einfach weiterziehen – ins nächste, billigere Land.“ (Spiegel/SZ)
Solche Reportagen bringen die Interessen der beteiligten Subjekte anschaulich zur Sprache:
- Der Staat Bangladesch wirbt mit seinen billigen und willigen Massen um die Gunst international agierenden Kapitals; diesen Trumpf bietet er westlichen Firmen zur Ausbeutung an. Das verschafft ihm die Rolle als „Nähstube der Welt, eine riesige Textilfabrik mit Hymne und Sitz bei der Uno“ – die ständig gegen die Konkurrenz gleichartiger Nationen zu verteidigen ist.
- Die Konzerne schätzen derart gastfreundliche Investitionsbedingungen. Sie verbuchen das schier unerschöpfliche Reservoir an Elendsfiguren sowie die Freiheit von staatlicher Aufsicht als prima Geschäftsgelegenheit. Je weniger das kostet, umso besser für sie; „regelmäßige Industrieunfälle“ sind die absehbare Folge ihres Wettbewerbs um das preiswerteste Humankapital.
Beide Seiten treffen sich im selben Interesse. Sie geben – unter ausdrücklicher Berufung auf den Sachzwang der Rentabilität
– zu Protokoll, dass der Reichtum kapitalistischer Volkswirtschaften auf der Armut der Lohnarbeiter beruht. Das gilt insbesondere für Niedriglohnländer
, die dem kapitalistischen Weltmarkt außer ihrem darbenden Volk wenig anzubieten haben.
2.
Mit möglichst wenig Lohn aus der Firmenbelegschaft möglichst viel Leistung herausholen: Das Prinzip kennt man als den Normalfall hier. Aber mit extrem niedrigen Kosten maximalen Gewinn zu machen: Das geißelt man in Bangladesch als Ausbeutung. Dabei zeigen die Berichte, dass diese Praxis an „unseren verlängerten Werkbänken“ keine Entgleisung ist, sondern ein Extremfall der marktwirtschaftlichen Regel. Deren „Sachzwänge“ enthalten sachdienliche Hinweise auf ein weltweites System der Ausbeutung.
Der Kapitalismus „Made in Bangladesch“ ist, wie bekanntlich alles aus dieser Gegend, eine Kopie des Originals. „KiK, Primark, Aldi, Lidl, Benetton, H&M, Gucci, Gap“: Dieselben Firmen, die es hier in jeder Fußgängerzone gibt, lassen per Handarbeit für ein paar Cent Stundenlohn produzieren, was sie an ihren Supermarktkassen für ein paar Euros versilbern. Warum nahezu die gesamte Textilindustrie nach Südostasien, China oder in die Türkei „abgewandert“ ist, ist allseits bekannt: Dem Kapital ist sein Arbeitvolk im Westen allmählich zu teuer geworden; die Globalisierung eröffnet die Möglichkeit des Exports westlicher Produktivitätsstandards; neue Belegschaften, die dieselbe Arbeit viel billiger erledigen, sind schnell gefunden. Kein Wunder. Für die Milliarde der Erdbevölkerung, die in unbewohnbaren Gebieten vor sich hin vegetiert, ist eine Hütte und ein Job in einem der neu entstehenden Industrieghettos allemal ein Angebot zum Überleben – und die hoffnungslose Lage dieser Leute befördert die massenhafte Nachfrage.
Diese Lage zeigt eine vielleicht unvorstellbare Armut, doch könnte die Logik ihrer Ausnutzung einen gewissen Wiedererkennungswert haben: Dieselbe Rechnungsweise, die die Firmen daheim praktizieren, verlängern sie an ihre auswärtigen Werkbänke; ins Verhältnis setzen sie den Preis der gekauften Arbeit und den Ertrag, der sich aus ihr herausquetschen lässt. Auch im internationalen Vergleich behandeln sie den Lohn, von dem die Leute leben wollen, als einen Kostenfaktor; und in diese Rubrik fällt auch alles, was heutzutage und hierzulande als Sozialstandard gilt. Brand- und Gebäudeschutz, Notfall-, Hygiene- und andere Sicherheitsmaßnahmen – all das ist betriebswirtschaftlich nichts als Abzug vom Gewinn. Ein Armutszeugnis im wahrsten Sinne: Kann man etwas Schlimmeres über eine Wirtschaftsordnung sagen, als dass sie das Überleben der Produzenten laufend in Frage stellt? Dass jede Maßnahme zum Schutz von Leib und Leben eine Unkost ist, die den Zweck des Produzierens beeinträchtigt? In einer kapitalistischen Fabrik wird so gerechnet: Alles, was die Arbeit ungefährlicher, gar bequemer machen würde, schmälert den Profit, also das, wofür produziert wird. Die Unternehmen haben daran kein Interesse; aktiv werden sie erst, wenn sie – durch Kämpfe der Arbeiterklasse oder von Staats wegen – dazu gezwungen werden.
So zeigt sich im Sonderfall Bangladesch der Normalfall. Aus der Gemeinsamkeit der materiellen Zwangslage, die die Leute immer wieder in die Fabrik nötigt, folgt der Unterschied: Überall kann man nur leben, wenn man fürs Kapital lebt; dort aber macht sich das Heer von Hungerleidern, für das jede Art von Arbeit eine Chance ist, der Not zu entfliehen, als zusätzliches Erpressungsmittel geltend. Es ist dasselbe Diktat zur Lohnarbeit, dem die Insassen hiesiger Industrienationen unterworfen sind, woraus die besonderen Formen der Armut dort hervorgehen. Der Maßstab rentabler Arbeit, der jede nationale Arbeiterklasse in Berufstätige und Erwerbslose scheidet, sortiert auch die Völker in weitgehend benutzte Lohnabhängige und weitgehend ungenutzte Über-Bevölkerung – und diese Differenz der Lebenslagen an den Wirtschaftsstandorten hier und dort macht sich das Kapital zunutze. Millionen eigentumsloser Leute in der marktwirtschaftlich nun komplett globalisierten Staatenwelt werden neu verfügbar, und die ökonomischen Subjekte dieser Welt, die Multis, greifen zu: Da hinten gibt es einen Riesenhaufen armer Menschen, die nichts zum Beißen haben – nichts wie hin!
3.
Als Grund der üblen Produktionsbedingungen in der Dritten Welt ermittelt unsere kritische Öffentlichkeit eine „Ist-mir-egal-Haltung des Westens“; den dort engagierten Firmen wirft sie systematisch betriebene „gewissenlose Ausbeutung“ vor. So verwandelt sie die Systemfrage in einen Kalauer der Moral: Es fehlt an „Verantwortungsbewusstsein“.
„Bangladesch steht für Tod. Für Ausbeutung und Profit. Für Arbeit ohne Würde und für Gewissenlosigkeit der Produzenten. Bangladesch steht für Korruption und Wegschauen. Für Kinder- und Sklavenarbeit. Für eine Ist-mir-egal-Haltung des Westens und 4-Euro-Shirts.“ (SZ, 4./5.5.)
Die Landeskunde fängt an mit Ausbeutung & Profit
. Und sie hört auf, so als wäre das die gründlichere Erklärung, mit dem Befund: Ist-mir-egal-Haltung & 4-€-Shirts
. Meint der Autor wirklich, aus Billigblusen Profit herauszuholen und dafür am Golf von Bengalen Massen von Näherinnen auszubeuten, wäre mit Gleichgültigkeit zu machen? Zwischendrin greift er ins Standardrepertoire moralischer Beschimpfung – Gewissenlosigkeit
, Wegschauen
–, um das Offensichtliche nicht gelten zu lassen: die in ehrenwerten Geschäftsberichten dokumentierte Absicht, mit Billigstarbeit Profit zu machen; eine planmäßig exekutierte Unternehmenspolitik, die Bangladesch als passenden Standort für so ein Geschäft entdeckt und dazu hergerichtet hat., Dass die einschlägig engagierten Konzerne für die Produktion vor Ort Subunternehmen einschalten, kritisiert der Berichterstatter – unter Berufung auf eine zuständige Hilfsorganisation – in einer Weise, die diese Gepflogenheit kapitalistischer Arbeitsteilung radikal verharmlost:
„‚Viele internationale Firmen tun zu wenig, um für faire Jobs zu sorgen. Wenn es um Praktiken ihrer Subunternehmer geht, drücken sie gern ein Auge zu‘, sagt die Hilfsorganisation Care.“ (SZ)
Die billige Technik, die brutalen Konsequenzen eines geschäftlichen Auftrags dem Auftragnehmer anzulasten und für die eigene Kalkulation auf Unschuld zu plädieren, äußerstenfalls Versäumnisse einzuräumen, nimmt diese Kritik für bare Münze. Sie will, bei allem melodramatisch ausgedrückten Abscheu über die Wirkungen stinknormaler kapitalistischer Geschäftstätigkeit einfach nicht wahrhaben, dass es sich dabei um Wirkungen stinknormaler kapitalistischer Geschäftstätigkeit handelt. Eine andere Variante derart verharmlosender Kritik fordert Aufklärung über das Offensichtliche – auch eine Art, nicht auf die praktizierte Geschäftspolitik der Textilkonzerne loszugehen, sondern stattdessen die Verletzung von Kriterien des geschäftlichen Anstands zu vermuten, deren Aufdeckung den Firmen ein furchtbar schlechtes Gewissen machen würde:
„Firmen wie GAP, Zara oder H&M müssen endlich öffentlich Rechenschaft ablegen, wieso sie jährlich Riesen-Gewinne machen und dennoch den verarmten Beschäftigten ihrer Zulieferer keinen Existenzlohn bezahlen. Es kann nicht sein, dass Textilarbeiterinnen 12 Std. pro Tag schuften und dennoch vor Hunger kollabieren.“ (Clean Clothes Campaign)
„Dennoch“? Weil sie Mini-Löhne zahlen, machen die Multis Riesen-Gewinne; und im Ernst kann selbst diese Saubere-Klamotten-Kampagne nicht so naiv sein, dass sie den wirklichen Zusammenhang nicht kennt. Aber genau das schlichte Verhältnis von Ursache und Wirkung will sie so nicht stehen lassen: Ihre Empörung lebt von der Fiktion eines Riesengegensatzes zwischen „Riesengewinn“ und dem Mittel seiner Erwirtschaftung. Und weiter: Es kann nicht sein, dass ...
? Genau so ist es doch; und dass man das ‚unmöglich!‘ mit drei Ausrufezeichen findet, ist keine Kritik an der Ursache, sondern die Kundgabe eines Vorurteils, das der Sachlage Hohn spricht: Eigentlich hätten die Firmen die Besatzungen ihrer südasiatischen Profitmaschinerie gut zu behandeln – warum? Weil ihre schlechte Behandlung so gute Erträge abwirft! Unerbittlich halten diese Kritiker das Ideal der versöhnbaren Interessen von Kapital und Arbeit, eines wechselseitigen Gebens und Nehmens hoch; gegen die Realität globaler Marktwirtschaft, in deren fernöstlichen Dependancen von einer solchen Verheißung am allerwenigsten zu merken ist. Und wenn sie das entdecken, lässt sie das nicht etwa an ihrem Standpunkt irre werden, sondern bestärkt sie nur in dem Urteil, als Grund des aufgedeckten Elends käme nichts anderes in Frage als ein Verstoß gegen den eigentlichen guten Geist kapitalistischer Profitmacherei.
Die Fehlanzeige in Sachen Gewissen landet folgerichtig bei lauter Verbesserungsideen, wie den verarmten Beschäftigten da unten doch noch zu einem Existenzlohn zu verhelfen sei.
4.
Aus der Diagnose folgt die Therapie: Schrankenloser Ausbeutung Grenzen ziehen! Doch wer soll das tun? Weit oben auf der Liste der Bremser ungebremster Herrschaft des Profits steht neben zivilisiertem EU-Kapital das Vorbild westlicher Sozialstaaten, die das Arbeitsvolk vor dem Gröbsten schützen. Auf diesem Wege werden die Täter als Helfer angerufen.
„Bangladesch ist nach China der zweitgrößte Textilproduzent der Welt, und die EU ist der größte Handelspartner. Der bangladeschische Staat ist also auf die Textilkonzerne aus den Industrieländern angewiesen. Sie haben Macht! Ist es nicht längst an der Zeit, dass die westlichen Firmen die Sozialstandards vorgeben anstatt nur die Abnehmerpreise? Sie können für anständige Arbeitsbedingungen sorgen und sie haben die Verantwortung dazu.“ (SZ, 4./5.5.)
Der Glaube an eine Verantwortung der Ausbeuter für ihre nützlichen Opfer findet hier eine interessante Fortsetzung: Ausgerechnet die Macht der Konzerne, gegen die nach der kundigen Analyse der Berichterstatter nicht einmal die politische Macht des Staates Bangladesch etwas auszurichten vermag, die ökonomische Macht, über deren Gebrauch und deren Wirkungen man in der Sache alles Nötige erfahren hat, kriegt hier das Kompliment, gleichbedeutend mit einer Pflicht zur Fürsorge für die Lebensbedingungen der kommandierten Massen zu sein. Dass von solcher Fürsorge nichts zu merken ist, hält der Autor für ein Versäumnis, das nicht länger zu entschuldigen sei – offenbar war in seinen Augen die Macht der Konzerne bis neulich noch nicht groß genug, um mehr als die Abnehmerpreise
zu diktieren; nämlich andere als diejenigen Sozialstandards
, die sie tatsächlich vorgegeben
haben. Um welche es sich da handeln sollte, weiß man in den zuständigen Redaktionsstuben auch:
„Das Sterben in den Fabriken Bangladeschs wird so lange weitergehen, bis das umgesetzt ist, was längst auf dem Papier geschrieben steht: Die Achtung der Menschenrechte, das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, der Gesundheitsschutz, Chancengleichheit und das Recht, Gewerkschaften zu gründen. Es sind die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Es sind Mindeststandards und jene Arbeitnehmerrechte, die in vielen Industrieländern, in denen die Blut-Klamotten gekauft werden, selbstverständlich sind.“ (SZ)
Aufgeschrieben gibt es die Normen und Gebote humaner Ausbeutung des Faktors Arbeit also schon – dass es sich da um Ge- und Verbote handelt, dass sich demnach für die ökonomisch mächtigen Akteure des Geschäfts mit menschlicher Arbeit offenkundig überhaupt nichts von selbst versteht in Sachen Anstand, dass denen sogar der Verzicht auf Kinder- und Zwangsarbeit
erst gewaltsam aufgenötigt werden muss: das scheint die wohlmeinenden Kritiker der bangladeschischen Textilindustrie genauso wenig zu irritieren wie der Befund, dass die papierene Existenz solcher Mindeststandards
anscheinend gar nichts bewirkt und praktisch gar nichts bedeutet. Diese Kritiker sind sehr zufrieden mit dem schönen Gedanken, dass es das extreme Elend – Sterben in den Fabriken
– nicht mehr geben würde, wenn man sich auch in Bangladesch an dessen Verbot halten würde, weil es dieses Elend ja nur so lange
gibt – und ein kleines „nur deswegen“ ist hier schon mitgedacht! –, wie seine Verhinderung nicht umgesetzt
ist. Woran es „also“ fehlt, ist, dieser kritisch-optimistischen Sicht der Dinge zufolge, gar nichts Großes, sondern bloß die Verwirklichung dessen, was in den Abnehmerländern der südasiatischen Textilindustrie selbstverständlich
ist: die „Umsetzung“ auch in den Ländern, die nur deswegen eine Textilindustrie haben, weil die zuständigen Konzerne dort etwas andere Sozialstandards
selbstverständlich finden.
Zu diesem Hoffnung stiftenden so lange ... bis
sind dann doch zwei Dinge anzumerken.
Erstens versteht sich das, was der Autor des Sittenbilds aus Bangladesch hierzulande so selbstverständlich findet, so ganz von selber keineswegs. Um der Ruinierung der für Lohn arbeitenden Menschenklasse überhaupt ein paar Schranken zu setzen, konnte diese Klasse sich nie auf die wohltätige Macht ihrer Arbeitgeber verlassen, auch nicht auf die Kalkulationen ihrer politischen Obrigkeit, und auf die Menschenrechte schon gleich nicht. Dafür musste sie schon den Willen aufbringen, Staatsgewalt und Kapital unter Druck zu setzen, und nicht zu knapp Gegengewalt organisieren. Und das ist auch in den so vortrefflichen Industrieländern
, in denen T-Shirts vier Euro kosten, alles andere als abgeschlossene Vergangenheit: Mitten im europäischen Wohlstand debattieren die politisch Verantwortlichen immer wieder über die Kosten sozialer Netze, die bei wachsendem kapitalistischen Reichtum nicht überflüssig, sondern unfinanzierbar
werden. Und sie debattieren nicht bloß: Sie setzen überkommene Standards bei den Arbeitsbedingungen außer Kraft, wo die im internationalen „Wettbewerb“ nachteilig wirken könnten, und schaffen Rechtssicherheit für Lohndrückerei bis unters Existenzminimum. Wenn sie dann Staaten wie Bangladesch „Lohn-“ und „Umweltdumping“ als ungerechtfertigten Konkurrenzvorteil vorwerfen, dann stellen sie damit vor allem klar, welchem Vergleich sich die stolzen „Arbeitsplatzbesitzer“ hierzulande unausweichlich stellen müssen, weil in der globalisierten Marktwirtschaft weltweit operierende Firmen diesen Vergleich praktisch anstellen und die zuständigen Staaten das als sehr vernünftigen ökonomischen Sachzwang akzeptieren.
Zweitens verhält es sich in Bangladesch nicht mit der Moral-, sondern mit der Machtfrage zwischen Textilarbeitern auf der einen, Textilindustrie plus Staat auf der anderen Seite ein bisschen anders als da, wo Kernarbeitsnormen
geachtet und Blut-Klamotten gekauft
werden. Da steht nämlich auf der einen Seite ein so massenhaftes und so nacktes Elend, dass an eine organisierte Gegenmacht kaum zu denken ist. Und auf der anderen Seite stehen hinter der ökonomischen Macht des Geldes, mit der sich ein paar Weltkonzerne eine einheimische Textilindustrie mit brutalen Ausbeutungsmethoden hingestellt haben, gleich zwei mächtige politische Instanzen: die Staatsgewalt vor Ort, die allemal stark genug ist, dem Kapital zu seinem Geschäft zu verhelfen und Protest gar nicht erst hochkommen zu lassen, und die ein eigenes ökonomisches Interesse daran hat, den Konzernen diesen Dienst auch zu leisten; und außerdem die hochzivilisierten Staatsgewalten der Ersten Welt, die rund um den Globus dafür sorgen, dass den Multis, die bei ihnen zu Hause sind, nirgends ein Leid geschieht, dass deren Eigentum und dessen geschäftliche Verwendung gesichert sind und bleiben, und dass kein drittweltlicher Staatsmann das Gemeinwohl seiner Nation woanders als in der Bedienung des globalisierten Kapitals sucht, geschweige denn eine Chance findet. Unter solchen Bedingungen gehört es zu den realen „Selbstverständlichkeiten“, dass nicht einmal eine brave, konstruktiv gesinnte Gewerkschaftsbewegung auf einen grünen Zweig kommt.
Auch das alles ist im Übrigen nicht unbekannt. Bloß hindert das die Anwälte „fairer Jobs“ in aller Herren Länder einerseits nicht, unsere Konzerne und unsere Sozialstaaten ideell in die Liste der Hilfsorganisationen einzugemeinden, an die man zwecks Abhilfe zu appellieren hat. Andererseits weiß man es zugleich doch besser: Immer wieder siegt die Profitgier über soziale Verantwortung, werden wohlklingende Rezepte zur Linderung der Armut nicht umgesetzt. Das Ende der Fahnenstange ist dennoch nicht erreicht: Wenn Appelle an den sittlichen Wertehimmel unserer sozialen Marktwirtschaft verhallen – Bestürzung, Trauer, Angst: Doch sie nähen einfach weiter!
(SZ) –, dann müssen wir alle
handeln und die Verantwortlichen an den Schalthebeln von Ökonomie und Politik eben zur Rücksicht auf die armen Näherinnen zwingen.
5.
So landet die Therapie bei ihrer letzten Instanz, an die von Anfang an gedacht war: Die Macht des Verbrauchers soll reparieren, was die kapitalistische Produktionsweise anrichtet. Die Parolen dieser beliebten Initiative heißen „Fair Trade“ und „Ethischer Konsum“ – „sozial verantwortliche“ Hersteller belohnen, „Ausbeuterfirmen“ bestrafen! Das ist mal eine echt konstruktive Kritik: Konsequenzen abmildern, ohne den Ursachen zu nahezutreten!
So viel steht fest, und davon gehen auch die Kritiker des Arbeitselends in den „armen Ländern“ aus: Druck machen zur Besserung dieser Verhältnisse, das können nur diejenigen, die den Konzernen die ökonomische Macht verschaffen, mit der sie in Bangladesch und andernorts so wüst herumfuhrwerken. Und das, auch davon gehen sie aus, sind nicht die ohnmächtigen Hungerleider vor Ort, sondern die Massen in den Zentren der Weltwirtschaft.
Fest steht allerdings auch: In der Eigenschaft, in der diese Massen von Dritte-Welt-Gruppen und Fair-Trade-Aktivisten zur Tat aufgerufen werden, nämlich in ihrer Eigenschaft als zahlungsfähige und -bereite Konsumenten sind sie nicht Produzenten, sondern Anhängsel der Macht der Unternehmen, die die globale Marktwirtschaft beherrschen. Und in der Eigenschaft, in der die lohnarbeitenden Bewohner der Ersten Welt tatsächlich die ökonomische Macht des global wirtschaftenden Kapitals produzieren und mehren, also auch schwächen und überwinden können, nämlich als Quelle des kapitalistischen Wachstums, werden sie gerade nicht angesprochen.
Dabei ist das der einzige Zusammenhang zwischen den verschiedenen ökonomischen Welten, der hiesige Hochleistungs-Proletarier und auswärtige „Sklavenarbeiter“ wirklich – und nicht bloß über zufällige Kaufakte – miteinander verbindet: Ihrem ökonomischen Status nach sind sie tatsächlich Kollegen – leibhaftige Produktivkraft, die die kapitalistische Unternehmenswelt sich zunutze macht, nämlich für die wachsende Macht ihres Geldes; in technisch perfektionierter Form und entsprechend ergiebig hier, äußerst billig und unter miesesten Arbeitsbedingungen auch ganz schön einträglich an anderen Orten. Hier wie dort dienen ‚Arbeitnehmer‘ einem Reichtum, der ihnen dort wie hier, jeweils mit seinem ortsüblichen Instrumentarium, als Kommandogewalt gegenübertritt, Profit aus ihnen herausholt und ihre Abhängigkeit vom Eigennutz des kapitalistischen Eigentums perpetuiert. Letzteres jedenfalls so lange, wie sich die Dienstmannschaften, auf deren weltrekordmäßigen Glanzleistungen die weltweite Kommandogewalt ihrer ‚Arbeitgeber‘ wesentlich beruht, nicht dazu entschließen, mit ihrer Arbeitskraft etwas Besseres anzufangen und deren Verbrauch durch globalisierte Kapitalisten zu kündigen. „Solidarität mit den armen Näherinnen“ ergibt sich daraus dann ganz von selbst und ist auch etwas ganz anderes als hohle Gewerkschaftsphrase: Ein entmachtetes Kapital kann auch die „Ärmsten der Armen“ nicht mehr unter Druck setzen.
Doch genau darauf zielen die Kampagnen der Drittwelt-Freunde nicht. Die drücken ganz im Gegenteil auf die Unterschiede zwischen Lohnarbeitern hier und dort. Ihr Appell zur Solidarität ergeht an Leute, die ihren Arbeitstag hinter sich haben und mit den wie auch immer verdienten Kröten einkaufen gehen. Ein Herz sollen die haben für arme Opfer, in denen niemand mehr den besonders mies behandelten Kollegen erkennt und erkennen soll. Als Kundschaft mit Geld sollen sie sich ein bisschen verantwortlich fühlen für „Menschen in Not“ und werden dafür auf eine Weise angequatscht, die, ernst genommen, schon wieder ein verheerendes Licht auf die herrschenden weltwirtschaftlichen Verhältnisse wirft:
„3500 Menschen begaben sich an ihren Arbeitplatz, obwohl die Einsturzgefahr augenfällig war. Dennoch gingen sie hinein. Warum? Ein Teil der Antwort findet sich nicht in Bangladesh, sondern in unseren Städten, bei H&M, bei Zara, bei Next und Primark, überall, wo ein T-Shirt verlockend wenig kostet. 4,99 Euro, 3,99 Euro, fast nichts. Ein solcher Preis setzt voraus, dass Käufer und Produzent möglichst wenig voneinander wissen. Von den Entstehungsbedingungen will der Kunde in London oder München nicht wirklich hören. Er will ein T-Shirt, kein Schicksal.“ (Spiegel)
In der Tat, der Mensch will ein Hemd und sonst nichts, aber in der Marktwirtschaft ist nichts normal und kein nützliches Ding einfach nur ein nützliches Ding. Der Mensch braucht einen Artikel – aber das Geld, das er als Kunde dafür hinlegen muss, der Kaufpreis, ist seiner wahren ökonomischen Natur nach das Ergebnis und der Anzeiger eines Produktionsverhältnisses, von dessen Brutalität er wiederum gar nichts zu wissen braucht, weil er als Kunde damit praktisch auch gar nichts zu tun hat. Der Mensch denkt also, er ersteht ein T-Shirt – in Wahrheit finanziert er, ob er will oder nicht, ein Stück Ausbeutung, die Vernutzung menschlicher Arbeitskraft für den Profit eines Unternehmens. Schreibt der Spiegel und hat damit mehr Recht, als er selber meint: Dieses System organisiert Bedürfnisbefriedigung durch Ausbeutung. Geht’s noch verrückter?
In der Sache kaum; moralisch schon. Dann nämlich, wenn man diese Absurdität als gegebene Sachlage akzeptiert und die Menschheit mit ihren Bedürfnissen dazu aufruft, als Kundschaft der profitierenden Unternehmen die schlimmsten Konsequenzen dieser Sachlage zu mildern. Wie? Dadurch, dass man mit einem höheren Preis den profitierenden Unternehmen ein bisschen was von ihrer brutalen Kalkulation abkauft. Dadurch, dass man sie mit Geld entschädigt für das bisschen Profitverzicht, den sie sich mit ein bisschen besserer Behandlung und Bezahlung ihrer Dienstkräfte antun müssten. Spenden – mal nicht für die Armen, sondern für die Reichen, die für bittere Armut sorgen, damit die es nicht gar so schlimm treiben!
Auf die Art die Welt verbessern: Das ist zwar einerseits nicht ganz einfach. In der Kalkulation der Unternehmen steckt der noch so wohlmeinende Kunde nicht drin. Mit dem Preis, den er zahlt, erteilt er ein für allemal keinen Produktionsauftrag und schon gar keinen Auftrag bezüglich der Produktionsbedingungen. Er kann allenfalls teurere Hemden kaufen und darauf hoffen, dass deren Produzent den Preisaufschlag nicht selber einsteckt – so wie die Unternehmen, deren hochpreisige Markenware in den eingestürzten Textilfabriken gleich neben der Billigware der Discounter zu finden war –, sondern in irgendeiner Form an die Bedienungsmannschaft seiner Profitmaschinerie weiterleitet: ein Vertrauensvorschuss, der eingestandenermaßen in der Welt der freien Marktwirtschaft niemanden zu irgendetwas nötigt. So weit die schlechte Nachricht.
Andererseits jedoch, das die gute Botschaft, ist dieser Vertrauensvorschuss billig zu haben. Jedenfalls in der Bangladesch- und T-Shirt-Frage. Denn da sind die Arbeitsbedingungen so brutal, die Löhne so niedrig, das Elend ist so groß, dass mit ein paar Cent pro Einkauf schon etwas Spürbares auszurichten wäre:
„Verdi-Experte Rösch verlangt mehr Fairness: Wenn die deutschen Textilhändler in ihrer Kalkulation für jede Näherin in Bangladesch im Monat zusätzlich 50 Euro berücksichtigen, würde das einzelne Produkt wie das T-Shirt oder die Bluse lediglich 12 Cent mehr kosten. Das ist für die Händler ein lächerlicher Betrag, für die Beschäftigten aber ein großer Schritt aus der Armut.“ (SZ)
Der Kunde muss nicht fürchten, dass es richtig teuer würde, den Ausbeutern in Bangladesch und anderswo ein bisschen Rücksichtnahme vorzufinanzieren. Außer ein bisschen gutem Willen und 12 Cent kostet die Weltverbesserung praktisch nix. Gibt’s quasi zum Nulltarif.
Fazit: Weltverbesserung an der Ladentheke lohnt sich.
Vielleicht, ein bisschen, für „die Näherin“ in Bangladesch, wenn nämlich genügend gute Menschen am Werk sind und dafür sorgen, dass bei der tatsächlich was ankommt vom höheren Endverkaufspreis. Wahrscheinlich, schon etwas mehr, für das Unternehmen, das mit mehr Erlös kalkulieren kann und für seinen Gewinn keine guten Menschen, sondern gute Manager braucht. Ziemlich sicher für die Gemütslage der kleinen radikalen Minderheit in der Ersten Welt, die die Produktionsbedingungen der weltweiten Marktwirtschaft zwar nicht im Griff hat, sich daraus aber ein Gewissen macht: Das fühlt sich dann wohl besser an.
Auf jeden Fall lohnt sich das Ganze für ein globales Ausbeutungssystem, das von seinen empörten Kritikern nichts Schlimmeres zu fürchten hat als einen Preiszuschlag für seine nachhaltige Finanzierung.