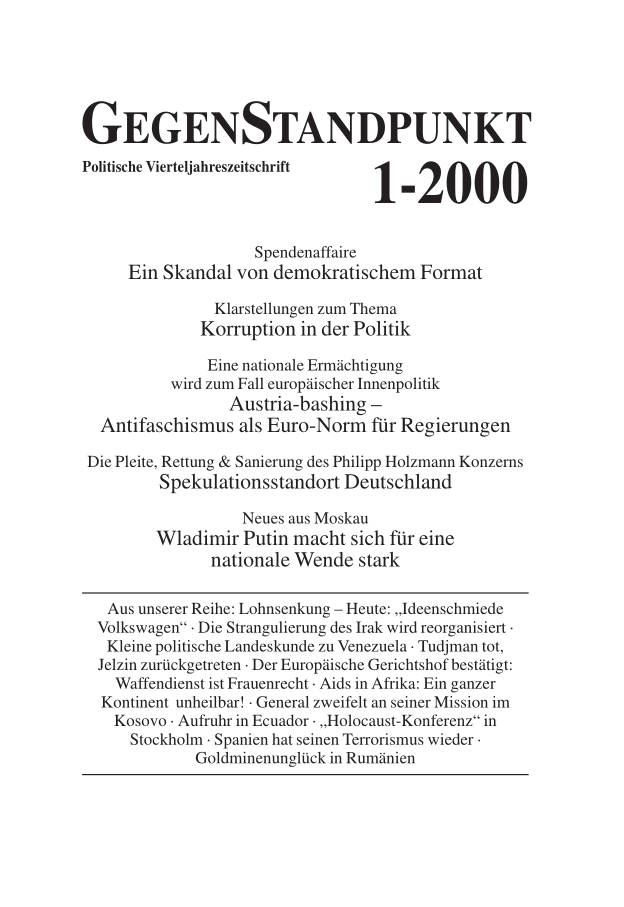Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Aufruhr in Ecuador:
Ein Staatsbankrott neuen Typs und ein schnell entschiedener Machtkampf in Amerikas Hinterhof
Ecuador erklärt sich für zahlungsunfähig und dekretiert die „Ersetzung“ der Landeswährung durch den US-Dollar. Ersetzt wird damit nichts, durch ein Dekret wird aus Ecuador natürlich keine prosperierende Dollar-Ökonomie; der Staat bekundet mit der Bankrotterklärung seine Unfähigkeit, als Stifter eines eigenen Geldes eine nationale Ökonomie zu inszenieren – eine Wirkung ist sicher: die totale Verelendung der Massen, deren Protest durch die Armeespitze schnell erledigt wird – zur Zufriedenheit der Weltmacht USA.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Aufruhr in Ecuador:
Ein Staatsbankrott neuen Typs und
ein schnell entschiedener Machtkampf in Amerikas
Hinterhof
1.
Ecuador schafft einen weltwirtschaftspolitischen Präzedenzfall. Erst erklärt der Staat sich nach außen hin für zahlungsunfähig:
„Im Herbst 1999 musste Ecuador als erstes Land überhaupt den Schuldendienst auf seine Brady-Bonds einstellen.“ (Handelsblatt, 21.1.2000)
Besagte Bonds sind selber schon das Resultat einer großen Umschuldungsaktion, die die Finanzverhältnisse des Landes – und überhaupt etlicher lateinamerikanischer Nationen – zur kapitalkräftigen Außenwelt dauerhaft bereinigen sollte, selbstverständlich ohne ihm seine längst uneinbringlichen Schulden einfach zu erlassen; die Bedienung der neuen Schuldscheine sollte absolut sicher sein. Wenn dieser Schuldendienst storniert wird, gesteht der Staat ein, dass er endgültig keine Devisen mehr hat. Irgendwo gibt es dann doch noch „3 Milliarden Dollar ausländischen Kapitals“, die sich noch ‚abziehen‘ lassen und auch prompt „abgezogen werden“ (ebd.). Damit ist dann aber auch klar, dass Ecuador definitiv nicht bloß kein Geld, sondern auch keinen Kredit mehr hat. Als weltwirtschaftliches Subjekt ist der Staat bankrott und leistet vor der devisenbesitzenden Außenwelt den Offenbarungseid.
Diesem ersten Präzedenzfall folgt folgerichtig der zweite: Zum Beginn des neuen Jahres dekretiert der Staatspräsident die „Ersetzung“ der Landeswährung – ihr Name, ‚Sucre‘, tut nichts zur Sache – durch den US-Dollar. Natürlich wird nichts ersetzt; aus den Ecuadorianern wird kein Volk von $-Verdienern und -Besitzern; wo sollten die Dollars auch auf einmal herkommen. Beschlossen ist etwas ganz anderes: Der Staat befindet, dass er wirklich und überhaupt kein Geld mehr hat. Das, was er bisher als sein nationales Geld hat zirkulieren lassen, ist kraft amtlichen Eingeständnisses kein Geld in dem Sinn mehr. Soweit die alte Währung Eigentum repräsentiert hat, findet Enteignung statt; dass ein Umtausch dieser Währung in Dollar in Aussicht gestellt wird, ist deren Verlaufsform. Soweit das staatliche Ex-Geld als Geschäftsmittel fungiert hat, wird das Geschäftsleben storniert. Der Souverän zieht nicht bloß ein paar wertlose Scheine, sondern sich selbst als Quelle eines national geschäftsfähigen Kreditgelds aus dem Verkehr. Er zieht sich damit aus der elementaren ökonomischen Funktion zurück, die nach der Logik der weltbeherrschenden Geld- und Kreditwirtschaft der Staatsmacht zukommt, nämlich aus der Rolle des souveränen Anstifters einer nationalen Marktwirtschaft. Die „Dollarisierung“ ist kein finanzwirtschaftliches oder -politisches Rezept, das die Regierung jetzt zur Anwendung brächte – auch wenn der Präsident sowie der ökonomische Sachverstand, den es selbstverständlich auch in und in Bezug auf Ecuador reichlich gibt, es doch immer noch so sehen möchten; am Ende bleibt doch nur die zwischen Ratlosigkeit und Zynismus changierende Feststellung, die der Ökonom P. Krugman im ‚Guardian‘ in die Frage kleidet: „Kann man das Vertrauen in eine Währung wiederherstellen, indem man sie abschafft?“ Was der Staatspräsident „Dollarisierung“ nennt, ist keine Währungsreform, sondern der erklärte Verzicht auf den Schein, mit und in einer ecuadorianischen Währung ließe sich wirkliches Geld verdienen. Der Staat gibt damit den Versuch auf, überhaupt so etwas wie eine nationale Ökonomie zu inszenieren; politökonomisch dankt er ab. Was im Land an Wirtschaft im weltweit gültigen Sinn von Geldvermehrung stattfindet, ist denen überantwortet, die Dollars haben und mit diesen nichts besseres anzufangen wissen, als den Versuch zu unternehmen, mit, in, an Ecuador – seinen Ölquellen, seinen paar Fabriken, seinen Bananen, seinen Touristenhotels… – mehr Dollars zu verdienen.
2.
Zu den Konsequenzen dieses inneren Offenbarungseids der Staatsgewalt gehört, dass – teils schon auf die bloße Ankündigung des Präsidenten hin, teils erst allmählich – die Warenzirkulation im Land zum Erliegen kommt, über die die Masse der Bevölkerung sich das Nötigste verdient und verschafft hat. Man kann diesen Effekt natürlich auch SZ-sachverständig „Kaufkraftverlust“ nennen und in „Reallohnsenkungs“-Prozente umrechnen. In das Schema von Inflationsraten und Tarifrunden hat der durchschnittliche ecuadorianische „Lebensstandard“ aber bisher schon nicht hineingepasst. Was jetzt auf die Leute zukommt, ist daher auch keine „Minusrunde“, sondern die Annullierung der bislang per Gesetz zwingend vorgeschriebenen ökonomischen Existenzbedingung.
Dieses Dekret zur totalen Verelendung einer ganzen Bevölkerung trifft auf Widerstand.
3.
Eine landesweite Indianerorganisation, unterstützt von den Gewerkschaften, trägt den Widerstand in die Hauptstadt. Mit Demonstrationen begnügen sich die aufgeregten Massen nicht; zu verlieren haben sie wirklich nicht mehr viel. Zu einem großen Blutbad kommt es dennoch nicht. Etliche der zum Schutz der gesetzlichen Ordnung abkommandierten Soldaten verbrüdern sich mit Parlamentsbesetzern; ein großer Teil der mittleren Armeekader sympathisiert mit dem Aufruhr, den sie niederschlagen sollen. Die Gründe sind kein großes Geheimnis. Der Beschluss der Regierung, dass mit nationalem Geld im Lande nichts mehr läuft, trifft natürlich auch die, die im Militär Dienst tun. Und er fordert außerdem die Repräsentanten der bewaffneten Staatsmacht heraus. Die stehen ja schon von Berufs wegen dafür ein, dass die Grundlagen des nationalen Zusammenhalts mit Gewalt und nicht mit Geld gestiftet und gesichert werden. Deswegen sind sie im Krisenfall durchaus auch für den Standpunkt zu haben, dass, wenn mit nationalem Geld eingestandenermaßen nichts mehr läuft, das Leben der Nation trotzdem einigermaßen weitergehen muss und die Existenz des Volkes nicht aufs Spiel gesetzt werden darf. Auch darüber ergeben sich Berührungspunkte zwischen dem nationalen Aufruhr und der nationalen Streitmacht.
So tun sich Vertreter von Conaie – der Indianer-Organisation – und halbhohe Militärs zu einer „Junta der nationalen Rettung“ zusammen und entmachten den Präsidenten.
4.
Keineswegs entmachtet ist die Armeespitze. Die nimmt als erstes der Junta mit einem Kompromiss die Initiative aus der Hand: Man einigt sich auf ein Triumvirat aus dem Armeechef, dem Conaie-Präsidenten und – von wegen der Legalität – dem Obersten Richter des Landes. Das Gremium übernimmt die Staatsmacht, entlässt den alten Staatschef in aller Form – und telefoniert mit Washington. Denn im Unterschied zu den verelendeten Massen und empörten Soldaten ist den Anführern des Umsturzes klar, dass ein südamerikanischer Staat zwar sein Volk vor die Hunde gehen lassen darf und die US-Regierung dazu wohlwollend oder allenfalls ein wenig skeptisch nickt – in der Frage, ob Ecuadors „Dollarisierung“ mehr „zusätzliche Lasten“ fürs Federal Reserve System bedeutet oder eher „Vorteile und Gelegenheiten“ bietet, „die Macht der USA und deren Interessen zu befördern“ (IHT, 24.1.), hat die Clinton-Administration sich noch nicht entscheiden können –; sobald sich aber irgendwo eine Machtfrage stellt, führt an Washingtons Machtwort kein Weg vorbei.
Das lautet in dem Fall so:
„Ein erfolgreicher Militärputsch wäre der erste seit Jahren in Südamerika gewesen und hätte eine Welle ähnlicher Bemühungen auf einem Kontinent ermutigen können, wo mehrere Länder sich in einer Wirtschaftskrise befinden.“ (ebd.)
Ein Militärputsch in dem Sinn – wie etwa einst in Chile… – findet in Ecuador zwar gar nicht statt. Das ist aber unwesentlich. Die US-Regierung kennt das südamerikanische Massenelend; sie kennt die Notwendigkeit, mit der Überlebensfragen eines Volkes in Gewaltfragen umschlagen; sie kann beides zusammenzählen – und fertig ist eine Domino-Theorie des Elends-Putsches. Mit der ist die Sache entschieden. Das Triumvirat kehrt mit der Ernennung des bisherigen Vize zum neuen Präsidenten zur Legalität zurück. Die rebellischen Offiziere und Soldaten werden interniert, die aufständischen Indianer wieder heimgeschickt, ein paar Anführer verhaftet. Der Conaie-Chef fügt sich unter Protest. Der neue Staatschef verspricht, am „Programm“ der „Dollarisierung“ festzuhalten.
5.
Aus dem Projekt der Total-Verelendung eines Volkes wird für ein paar Tage eine Machtprobe. Die Staatsmacht, die sich tapfer zu ihrer ökonomischen Ohnmacht bekennt, erweist sich als militärisch und politisch mächtig genug, um diese Probe zur Zufriedenheit der demokratischen Weltmacht zu bestehen. Das Leben geht weiter in Ecuador.