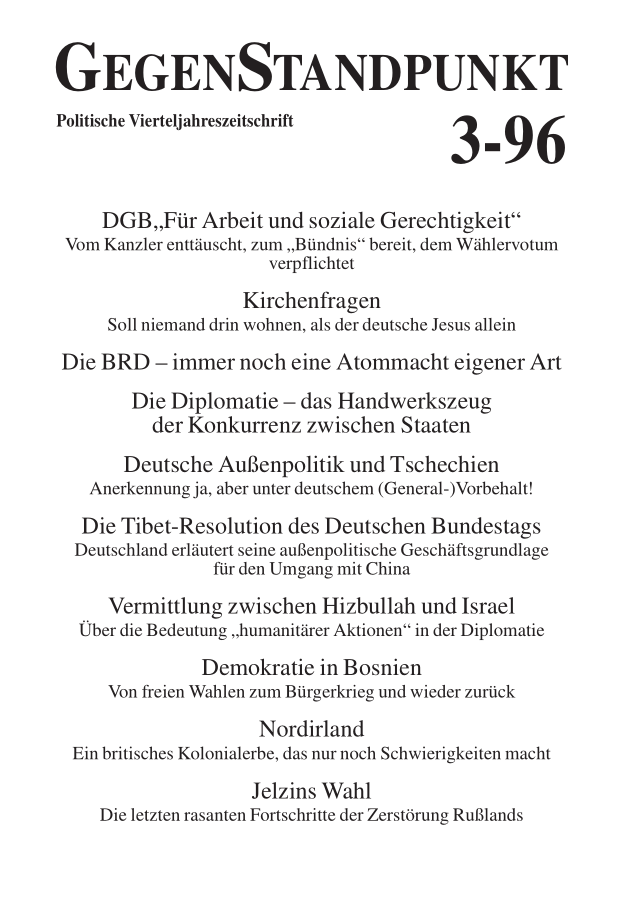Die Diplomatie – das Handwerkszeug der Konkurrenz zwischen Staaten
Staaten besitzen das Gewaltmonopol über ihr Territorium und die darauf lebenden Subjekte. Beschränkt werden sie durch das Gewaltmonopol aller anderen Staaten. Der Gegensatz wird produktiv gemacht, in dem man versucht, die Ressourcen der anderen für sich nutzbar zu machen. Dies geht nicht ohne Anerkennung der anderen Souveränität. In den Formen der Diplomatie wird den Konkurrenten der Respekt gezollt, der nötig ist, um den gegensätzlichen anderen Willen für sich zu funktionalisieren.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
- I. Der Ausgangspunkt der Diplomatie: Der unhaltbare Zustand eines territorialisierten Gewaltmonopols
- II. Vom Respekt, den sich staatliche Konkurrenten schulden, und von den Formen, in denen sie sich ihn zollen: Der Auftakt des diplomatischen Verkehrswesens und seine Fortentwicklung
- 1. Der Vertrag der Anerkennung
- 2. Die Verträge zwischen Staaten
- a) Der zwischenstaatliche Vertrag als solcher: Wie Unverträgliches vereinbar zu machen geht.
- b) „Pacta sunt servanda. Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen.“[13]
- c) Die diplomatische Pflegebedürftigkeit gegensätzlicher Vertragsverhältnisse
- 3. Die Verlaufsformen der genehmigten „Einmischung in innere Angelegenheiten“
- 4. „Der Stand der Beziehungen“
- III. Die internationale Streitkultur und ihre Kontinuität. Eine Kette von Konflikten, die zuerst angezettelt und dann vorläufig beigelegt werden…
- Die Leistungen der Diplomatie
Die Diplomatie – das Handwerkszeug der Konkurrenz zwischen Staaten
Die vielfältigen auswärtigen Angelegenheiten
, die
ein moderner Staat im Verkehr mit seinesgleichen
betreibt, sind auf Anhieb nicht einfach zu durchschauen.
Das liegt nicht nur an der fremden, weitab vom Umkreis
vertrauter Belange liegenden Materie dieser
Angelegenheiten, sondern zum beträchtlichen Teil auch
daran, wie man mit ihnen Bekanntschaft schließt.
Da muß man sich damit vertraut machen, daß bisweilen
außenpolitische Großprojekte zwischen Staaten davon
abhängig sein sollen, wie zwischen ihnen gerade die
Atmosphäre
beschaffen ist. Ob sie vielleicht
gespannt
ist, weil eine Verstimmung
vorliegt; die womöglich aus dem an sich nicht übermäßig
weltbewegenden Umstand resultiert, daß ein
Staatsoberhaupt sehr brüskiert
ist; weil er
vielleicht zur falschen Zeit an den falschen Ort geladen
wurde; oder vielleicht gar nicht auf der Gästeliste
stand; oder vielleicht doch, aber zusammen mit einem, mit
dem er auf keinen Fall zur selben Zeit am selben Ort sein
wollte. Oder ob gute Beziehungen
vorherrschen,
sogar von einer Freundschaft
gesprochen werden
kann; zwischen Staaten, die allenfalls
juristische, sonst aber keine Personen sind,
auch wenn ihnen die Fähigkeit zu freundlichen
Akten zugesprochen wird. Herrscht Freundschaft zwischen
Staatenlenkern, dann können die miteinander
besonders gut, und das spricht schon Bände – irgendwie
nämlich gleich über das Verhältnis, wie es zwischen ihren
Nationen insgesamt besteht. Möglicherweise ist aber auch
ein nicht so genau zu umreißendes, eher traditionell
schwieriges
Beziehungswesen zu vermelden; dann muß
ganz genau auf die Signale
geachtet werden, denen
die Weiterentwicklung des außenpolitischen Verhältnisses
zwischen beiden Seiten zu entnehmen sein soll – und
tatsächlich auch entnommen wird: Nixons Ping-Pong-Spieler
in China und Brandts Kniebeuge in Polen haben ganz neue
Zeitalter diplomatischer Beziehungen eingeleitet, fernab
vom aktuellen Verhandlungsstoff, der das außenpolitische
Tagesgeschäft und die Beziehungen
regelmäßig so
schwierig
macht; manchmal liegen diese
Signale
aber auch darin, daß Stellungnahmen
einfach ausbleiben – dann ist womöglich das sehr
vielsagend für die Lage, in der man sich außenpolitisch
mit dem gerade befindet, der da durch sein Schweigen
diplomatische Mitteilung
macht…
Gleichwohl kommen auch interessierte Beobachter, die sich
nicht zu den gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen
rechnen können, mit diesem Verhau zwischen der Sache, um
die es Staaten geht, wenn sie Außenpolitik treiben, und
der abstrusen Form, in der sie diese abwickeln, auf ihre
Weise gut zurecht. Der kosmopolitische Blick, der sich da
die außenpolitischen Affairen vornimmt, verliert nämlich
nie den allerobersten Bezugspunkt, dem Nationalisten ihr
ganzes Interesse schenken – die Sache ihrer Nation eben
–, und dementsprechend kümmert sich der nationale
Betrachter eher weniger um Grund und Zweck der regen
Engagements, die im staatlichen Außenverkehr stattfinden.
Dagegen umso heftiger darum, ob den für diesen Verkehr
Zuständigen ein Erfolg beschieden ist und dem
Interesse der Nation, dem ihre Machenschaften ja zu
dienen haben, auch wirklich gedient worden ist. Genauere
Kenntnisse über die Beschaffenheit dieses Interesses sind
dabei nicht vonnöten: Auch in ihrer tiefen
Ahnungslosigkeit verraten Fragen wie: Warum geben wir
Geld an …?
, Warum geht uns … an?
noch die
Hauptsache, nämlich die unbedingte Parteinahme für den
Erfolg der Nation bei allen ihren
außenpolitischen Drangsalen. Die Besichtigung des
Weltgeschehens, die auf diesem Wege zustandekommt, legt
sich hierfür die vielen, mehr oder weniger
wichtigen
zwischenstaatlichen Treffen, auf denen
sich die Kontrahenten darüber verständigen und streiten,
welche ihrer Interessen sie einen bzw. trennen, als Stoff
einer Prüfung vor, die nur eines erkunden will: Ob und in
welchem Maß da unseren Interessen
das
Recht widerfahren ist, das ihnen ganz
selbstverständlich gebührt. Sofern vom außenpolitischen
Wirken der für die Sache der Nation Verantwortlichen
diesbezüglich Erfolgsmeldungen verlautbart
werden und die Nation mit den Resultaten ihrer
Diplomatie zufrieden ist, heimsen sie Lob ein ob des
Geschicks und der Kunst
, die sie bei den
naturgemäß schwierigen außenpolitischen Manövern unter
Beweis gestellt hätten – worüber die Sache, die
diese Schwierigkeiten aufwirft, ganz hinter der
Form verschwindet, in und mit der sie so
glorreich zugunsten des eigenen Interesses abgewickelt
wurde.
Taugen umgekehrt die Ergebnisse, die bei irgendwelchen
Verhandlungen oder Konferenzen auf zwischenstaatlicher
Ebene zustandekommen, nicht so recht dazu, der
außenpolitischen Führung dieses gute Zeugnis
auszustellen, bleibt es regelmäßig nicht aus, daß
sie selbst für den ausgebliebenen
Erfolg haftbar gemacht wird. Mit Verweis auf die
Unnachgiebigkeit der einen oder anderen
Verhandlungspartner, die man nicht auf die eigenen Seite
hat ziehen können, wird ihr das offenbar mangelnde
Vermögen attestiert, das für die Nation Erforderliche
befriedigend zuwege zu bringen. Da ersetzt dann die
Unzufriedenheit mit den Resultaten der
Diplomatie die Befassung mit dem, womit
diese eigentlich befaßt ist, woran da wer
warum gescheitert ist, und dieses so rigoros auf
nationalen Erfolg erpichte politische Urteilswesen
erklärt schon mal ein ganzes Gipfeltreffen für
nutzlos
, wenn das Schlußkommuniqué ganz ohne die
konkreten Ergebnisse
dasteht, die man sich
gewünscht hätte. Dann war, weil eigentlich
ja
nichts Greifbares
herausgekommen ist, das ganze
diplomatische Gemache eben bloß das, so daß die
betreffenden Herrschaften sich ihren Aufwand glatt auch
hätten schenken können.
Dabei ist diesem politischen Anspruchsdenken durchaus
geläufig, daß es im diplomatischen Verkehr immerzu darum
geht, sich gegen andere Nationen durchzusetzen,
den Willen fremder Mächte dem eigenen gefügig zu machen,
sich zu einigen
– und diese Aufgabe beruht auf der
schlichten Tatsache, daß die politischen Willen, die es
da miteinander zu tun haben, einander
entgegengesetzt sind: Die unterschiedlichen
Auffassungen
von einer Sache, die abweichenden
Positionen
von Regierungen im Verlauf von
Verhandlungen sind keine verschiedenen Urteile, die sich
in einem theoretischen Disput als richtig oder verkehrt
herausstellen. Sie drücken vielmehr die
Unvereinbarkeit der Interessen aus, mit denen
Staaten aneinander herantreten, und der Disput, den sie
führen, kreist darum, wer mit seiner Position
Recht behält. Zu den Kompromissen, in
die sie einwilligen, sind sie daher gezwungen,
und was immer da an Abkommen, Verträgen und Bündnissen
sowie an Maßnahmen ihrer fortgesetzten Bewirtschaftung
herauskommt, ist kein Dementi der prinzipiellen
Ausschließlichkeit, die zwischen Angelegenheiten
besteht, die von verschiedenen Nationen betrieben werden.
Es belegt sie vielmehr, und das diplomatische Procedere
demonstriert formvollendet, wie wenig Staaten
den zwischen ihnen vorhandenen Gegensatz vergessen, wenn
sie inhaltlich etwas voneinander wollen. Und
zwar nicht erst dann, wenn von der Wahrung und Schaffung
von Frieden die Rede ist.
Denn in genau dem Zustand, in dem sie untereinander mit
ihrer Diplomatie einen Zustand namens Frieden wahren, auf
Kompromißfindung
und Ausgleich der
Interessen
aus sind, bringen sie alle Interessen, die
sie aneinander haben, gegeneinander in Anschlag. Der
Wille zur einvernehmlichen Regelung aller Fragen, die der
Entschluß zur wechselseitigen Benutzung aufwirft, setzt
ja den Umstand keineswegs außer Kraft, daß sich da
jeweils Mächte bemühen, in und mit ihrem Verkehr
untereinander exklusiv sich zu stärken, den
Zugriff auszuweiten, den sie über die monetären
und sachlichen Mittel ihrer Macht haben. Um
diesen Zugriff ins Werk zu setzen und dauerhaft
in Gang zu halten, dabei Differenz und Übereinstimmung
von Macht und Interesse abzuklären, „Argumente“ für
„Kompromisse“ und Konzessionen der anderen Seite zu
finden und mit ihnen auf deren widerständigen Willen
einzuwirken – für das alles betreiben die modernen
Staaten des Imperialismus Diplomatie.
Die hat im übrigen auch dann nicht ausgedient, wenn im
Ausgang dieser Konkurrenz für die eine oder andere Nation
die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln
geboten erscheint. Denn die nationalen Urheber der
außenpolitischen Beziehungen
selbst wissen genau,
daß in letzter Instanz der Ausgangs- wie Endpunkt ihrer
Politik nach außen nichts anderes ist als eine Frage
der Macht, die zwischen ihnen zu klären ist. Mit
ihrer eifrigen Rüstung stellen sie unter Beweis, wie sehr
ihnen ihre so zivil anmutenden Beziehungen als die Quelle
von ganz viel Gründen vertraut ist, von den Waffen der
Konkurrenz zur Konkurrenz der Waffen zu
schreiten. Dann wird die Machtfrage zwischen ihnen
elementar zur Entscheidung aufgeworfen – und auch da ist
für die Diplomatie viel zu tun: Auch auf den
Krieg, den sie gegeneinander führen, beziehen
sich Nationen noch als ein Verhältnis, in dem sie etwas
voneinander wollen, weswegen sie sich noch kurz vor, aber
auch während und nach dem Waffengang diplomatisch viel zu
sagen haben.
I. Der Ausgangspunkt der Diplomatie: Der unhaltbare Zustand eines territorialisierten Gewaltmonopols
1. Die Rechtlosigkeit zwischen höchsten Gewalten
a) Staaten sind politische Gemeinschaftswesen, in denen ein herrschaftlicher Willen sich über die Menschen in seiner greifbaren Reichweite aufbaut und sie sich unterwirft. Dieser Herrschaftswille mag sich im einzelnen vornehmen, was er will: Die Ausübung aller seiner Vorhaben hängt ausschließlich an dem Mittel, mit dem sich diese Unterwerfung wirksam und auf Dauer ins Werk setzen läßt; und dieses Mittel ist seine Gewalt, die er sich gegen seine – wirklichen und möglichen – Konkurrenten erfolgreich aneignet. So kommt ein Gewaltmonopol im Wege des tatkräftigen Entschlusses zustande, die Frage, wie das Zusammenleben der Vielen zu organisieren sei, nicht den Betreffenden selbst zu überlassen, sondern sie praktisch zu entscheiden. Wenn sie entschieden ist, bezieht die Staatsgewalt den Willen aller, die ihr unterstehen, auf sich selbst als die ihm übergeordnete Instanz und diktiert ihm mit den einschlägigen Ge- und Verboten die allein gültigen Bedingungen seiner Betätigung. So wird aus den Untertanen einer Herrschaft ein Volk, das seine Identität darin hat, derselben Macht und demselben Recht zu gehorchen, sich daher dieser Macht selbst zurechnen und deren innere wie äußere Belange als seine eigenen Anliegen auffassen soll.[1]
b) Die Gewalt, die die Staatsmacht
exklusiv für sich beansprucht und von der sie
unangefochten, daher souverän Gebrauch macht,
kennt in einer Hinsicht keine Grenzen. Alles,
was den Bestand eines Staates ausmacht und zu seinen
inneren Verhältnissen
gehört, geht auf das Wirken
seiner Gewalt zurück. In ihr als seinem allerersten
Ursprung gründet alles, was es in seiner Gesellschaft an
Rechten und Pflichten, an verbindlich
gemachten Interessen und etablierten Gegensätzen zwischen
deren ganz unterschiedlich bemittelten Mitgliedern gibt.
Sie ist das Mittel, mit dem die Herrschaft sich alles,
was ihr unterliegt, zum eigenen Gebrauch herrichtet. Für
das Prinzip ist es dabei gleichgültig, ob die waltende
Souveränität meint, von Gottes Gnaden bestellt zu sein,
und sich ihren Laden als persönliches Herrschafts- und
Gefolgschaftswesen einrichtet, das ihr tributpflichtig
ist. Oder ob sie die unpersönliche Form einer „modernen“
bürgerlichen Herrschaft besitzt, bei der die Gesellschaft
überhaupt nicht mehr persönlichen Herrschaftsinteressen,
sondern so anonymen Sachnotwendigkeiten wie der Mehrung
des privaten Eigentums und darüber der
staatlichen Herrschaft zu dienen hat.
Allerdings gilt für die Reichweite des staatlichen Gewaltmonopols auch die Umkehrung, und es ist mit ihr auch die Grenze der eigenen Machtvollkommenheit mitbeschlossen. Frei im Gebrauch ihrer Macht ist die Staatsgewalt trivialerweise nur dort, wo sie herrscht, so daß sie ihre Grenzen, die mit denen des Territoriums, über das sie gebietet, identisch sind, zurecht gleich als das zur Kenntnis nimmt, was sie für sie sind: Hinter ihnen liegt, was ihrem exklusiven herrschaftlichen Zugriff entzogen ist und entzogen bleibt – weil nämlich eine andere souveräne Gewalt ihre hoheitlichen Befugnisse wirksam etabliert hat und ihr Monopol auf die gewaltsame Kontrolle des betreffenden Erdfleckens und die Unterjochung seiner Insassen behauptet. Die einzigen Grenzen, die ein staatliches Gewaltmonopol überhaupt kennt, sind daher diejenigen, die ihm praktisch durch die schiere Existenz von seinesgleichen gezogen werden, und das macht das hohe Gut der staatlichen Souveränität zu einer nie aufhörenden Frage der Behauptung der Macht, die sie in Anspruch nimmt: Jede Herrschaft, die über ihr Territorium und dessen Insassen exklusives Verfügungsrecht beansprucht, steht prinzipiell negativ zu allen anderen, die – als ihre unmittelbaren oder entfernten Nachbarn – für sich dasselbe tun. Jeder Akt einer hoheitlichen Verfügung über das, was dem eigenen staatlichen Inventar zuzurechnen ist, ist unmittelbar die praktizierte Ausgrenzung der betreffenden Staatsmacht gegen alle anderen staatlichen Subjekte, die Land und Leute gleichfalls nur als Material ihrer Herrschaft kennen und sich aneignen wollen. Seinen eigenen Bestand, seinen exklusiven herrschaftlichen Zugriff sichert sich ein Staat überhaupt erst dadurch, daß er einen ganz genauso beschaffenen, auf Exklusivität erpichten herrschaftlichen Zugriffswillen praktisch zurückweist, sich gegen jeden Hoheitsanspruch behauptet und zur Wehr setzt, der nicht sein eigener ist.
c) So ist das Verhältnis, in dem
die Staaten zueinander stehen, eines von Mächten, die gar
nicht anders können als einander wechselseitig zu
bestreiten, was sie sind. Als jeweils höchste
Gewalt, die über möglichst viel Territorium und
möglichst viel Volk verfügen will, findet sie
neben sich ihresgleichen vor, einen hoheitlichen
Verfügungsanspruch in Form eines konkurrierenden
Gewaltmonopols, der ihren eigenen Anspruch einer durch
nichts bestrittenen, souveränen Machtausübung einfach
dadurch negiert, daß es ihn gibt. Seiner Natur nach ist
dieser Gegensatz zwischen Staaten unversöhnlich, und des
prinzipiellen Charakters ihres Gegensatzes sind sich
Staaten bewußt. Sie gehen davon aus, daß ihre
Souveränität nicht nur eine Frage ihres Gewaltmonopols
nach innen, sondern auch davon ist, inwieweit sie es
nach außen sicherstellen. Die unbedingte Wahrung
ihrer äußeren Sicherheit
resultiert keineswegs aus
schlechten Erfahrungen, die sie gemacht haben, sondern
rangiert von Anbeginn an oberster Stelle des staatlichen
Pflichtenkatalogs.[2] Diese Selbstverständlichkeit,
mit der Staaten vom Widerspruch eines Pluralismus von
Gewaltmonopolisten ausgehen, schlägt sich in den
Gewaltmitteln nieder, die sie sich zusätzlich zu denen,
mit denen sie den Rechtszustand in ihrem Inneren sichern,
immer auch noch verschaffen. Die sind eigens dafür
reserviert, sich gegen die Macht, auf die sich ein
fremder Staatswille gründet, im Bedarfsfall praktisch
durchzusetzen.[3]
2. Die produktive Nutzbarmachung fremder Souveränität: „Den Grenzen das Trennende nehmen!“
a) Daß das staatliche Gewaltmonopol sich selbst Zweck ist, ist die allererste und bleibende Existenzbedingung aller Zwecke, die die staatliche Herrschaft in die Welt setzt, die sie ihren Bürgern verbindlich vorschreibt und die die Staatsraison, den Inhalt des politischen Herrschens, ausmachen. In den modernen bürgerlichen Staaten ist diese Raison – was nicht Vernunft meint, sondern die Vorhaben, um die es der Staatsmacht sachlich geht – im Privateigentum und in allen anderen Einrichtungen der Klassengesellschaft verkörpert, die im Dienst an seiner produktiven Vermehrung stehen und die Interessen bestimmen, die die in die Freiheit der Konkurrenz entlassenen Bürger verfolgen dürfen. Der bürgerliche Staat zwingt seiner Gesellschaft mit seiner Macht das Interesse an der Mehrung von Reichtum in Form des abstrakten und exklusiven Verfügungsrechts auf, das in einem von ihm garantierten Geld dinglich existiert und sein Maß hat, und stiftet so mit seinem Gewaltmonopol seine gleichfalls ihm exklusiv zur Verfügung stehende ökonomische Existenzgrundlage: In seinem nationalen Maß wird der materielle Reichtum als Wachstum des Kapitals gemessen, über das der Staat gebietet und von dem er sich hoheitlich aneignet, was er zur Finanzierung seiner Herrschaft braucht.
Allerdings bleibt es nicht dabei, daß die Staatsmacht sich mit einem großen Wurf ihren Kapitalismus als Lebensgrundlage einrichtet und im übrigen passiv zusieht, was sie von ihrem Werk hat. Gerade weil der kapitalistische Erfolg die Grundlage seiner Macht ist, bestellt der bürgerliche Staat sich auf Dauer zum Anwalt aller Erfordernisse, von denen sein Zustandekommen abhängt. Er erklärt das produktive Privateigentum zur politischen Hoheitsfrage, behandelt alle Bedingungen seines Zustandekommens bzw. Ausbleibens als Angelegenheiten, die unmittelbar ihn betreffen und den entsprechenden Einsatz seiner Macht gebieten – und muß gewärtigen, daß er dies eben nur soweit kann, wie seine Macht reicht. Die Reichweite seines Gewaltmonopols begrenzt unmittelbar sein Vermögen zur Mehrung des Reichtums, weil so viele Potenzen, die zu seiner Schaffung zu gebrauchen wären, von ihm nicht zu gebrauchen sind. Sie bleiben bloße Potenzen seiner Geldvermehrung, weil sie nicht seinem, sondern dem Zugriff einer anderen souveränen Gewalt unterliegen, und das ist für ihn damit gleichbedeutend, daß er von dieser in seinen Lebensgrundlagen beschnitten wird.
b) Dasselbe Prinzip der Schaffung
von Reichtum in der abstrakten und universellen Gestalt
von Geld, das der bürgerliche Staat bei sich eingerichtet
hat, stößt ihn so darauf, daß er selbst, wegen
und mit seiner territorial limitierten Hoheit, die
Schranke von dessen Entfaltung ist. Die bei ihm gültig
gemachte „Definition“ eines Reichtums, der ausschließlich
in Form des in Geld ausgedrückten exklusiven
Zugriffsrechts besteht, existiert zwar nur innerhalb
seiner eigenen Landesgrenzen; sie ist aber insofern
prinzipiell über diese hinaus, als sie in ihnen und damit
an dem, was sie an Volk und sonstigen Stoffen zur
Schaffung und Mehrung dieses Reichtums zufällig
vorfindet, ihr Maß gar nicht hat: Sie hat überhaupt kein
Maß, sondern erstreckt sich auf schlechterdings
alles, was sich für diesen Reichtum produktiv nutzen
läßt. Darüber wird der Staat zum
politischen Interessenten an allen
ökonomischen Ressourcen
, die als
wirkliche oder mögliche Quellen seines Reichtums zwar
vorhanden, aber außerhalb seiner Reichweite sind. Weil
diese nicht ihm als Mittel seiner eigenen
Bereicherung zur Verfügung stehen, sondern ein anderer
Souverän den Nutzen in Beschlag nimmt, der aus ihnen zu
ziehen ist, nimmt die bürgerliche Staatsmacht
diesen ins Visier. Um das Wachstum
ihrer kapitalistischen Reichtumsquellen auch
außerhalb der der eigenen Hoheitsgrenzen zu
ermöglichen, bezieht sie sich positiv auf die
ausgrenzend und beschränkend ihr gegenüberstehende
staatliche Macht, tritt mit ihr in ein eigenes Verhältnis
ein und sinnt auf Beziehungen
, die zuallererst die
prinzipielle Brauchbarmachung und
Benutzbarkeit des fremden Hoheitsraums
herstellen sollen. Denn alles – von der
menschlichen Arbeitskraft über Rohstoffe und die
vorhandenen Produktionsmittel bis hinunter zur Nutzung
von Transportwegen –, was da möglicherweise zu nutzen
ist, unterliegt der Entscheidungsbefugnis der Macht, die
ihren Raum kontrolliert, so daß die angestrebte Benutzung
ganz davon abhängig ist, ob sie von dieser auch
gestattet wird. Und mit Fragen dieser
grundsätzlichen Art – ob überhaupt und wie zwischen
souveränen Gewalten trotz und wegen des Gegensatzes, in
dem sie zueinander stehen, bezüglich welcher
Angelegenheit Einvernehmen herzustellen sei –,
entsteht überhaupt erst das Bedürfnis nach einem
institutionalisierten zwischenstaatlichen Verkehr.
c) Dessen Inhalt besteht in dem
identischen Interesse kapitalistischer Staaten, zur
Mehrung ihres Wachstums und der ihnen dafür zu Gebote
stehenden Mittel die Beschränkung aufzuheben,
die sie als Staaten füreinander darstellen.
Fremde Herrschaftsgebiete sollen als Ressourcen
erschlossen, das heißt dem eigenen Wachstum zugänglich
gemacht werden, daher anerkennen sie das Faktum,
daß ihre Machtmittel in dem ihre Grenze haben,
was ihnen andere Staaten diesbezüglich entgegenstellen –
und suchen genau diese Grenze für sich praktisch
unwirksam zu machen: Die weltweit ins Auge gefaßten
stofflichen wie menschlichen Quellen des Reichtums wollen
sie als Material einer im Prinzip allen offenstehenden
Bereicherung behandeln, die dann erst als Ergebnis
ihrer Konkurrenz wieder ihrer exklusiv nationalen
Verfügung zufallen soll. Um dieses Prinzips ihrer
Bereicherung aneinander willen, aus ihrem Interesse an
einer ökonomischen Benutzung fremder Mächte zur Stärkung
ihrer eigenen verfertigen sie den Antrag an
ihresgleichen, die Befriedigung des wechselseitigen
herrschaftlichen Egoismus kooperativ zu
gestalten.
Aus diesem Interesse an Benutzung kommt der Stoff der
Außenpolitik, die die kapitalistischen Staaten
untereinander pflegen. Das eigene Interesse an der
Nutzbarmachung des anderen schreitet zur Prospektion von
dessen Hoheitsbereich. Es orientiert sich an den dort
vorhandenen Wachstumsbedingungen und -mitteln. Es
entdeckt miteinander Vereinbares, womöglich sogar auch
einander sich Ergänzendes; oder eben nicht und wird statt
dessen auf die Unbeugsamkeit des fremden
Herrschaftswillens als seine bleibende negative Bedingung
gestoßen, hat sich also zuerst an dem abzuarbeiten und
ihn sich herzurichten, damit er benutzbar wird.
Dieses Pensum eines beständigen Arrangements von Mächten,
die sich zur Kooperation entschlossen haben; die
fortwährende Ermittlung der aktuell oder überhaupt
möglichen und tauglichen Grade einer Zusammenarbeit, bei
der es jeder der beteiligten Seiten um sich geht;
umgekehrt die Bemühung, selbst Herr der aus fremder
Souveränität erwachsenden Beschränkungen zu werden und
sich diese nützlich zu machen: Das ist die politische
Sache, die die Staaten in ihren
Außenbeziehungen
bewegt. In diesen geht es auf der
einen Seite prinzipiell nur darum, den Reichtum
der ganzen Welt der eigenen Nation, also gegen
alle anderen zu erschließen. Deswegen kennen diese
Nationen auf der anderen Seite aber auch sehr viele
Abhängigkeiten
, durch die sie sich in ihrer
Handlungsfreiheit allzu gefesselt vorkommen. Diese
resultieren aus dem Umstand, daß ihre Erfolgsbemühungen
stets an die Voraussetzung des kooperativen,
also dem Prinzip nach einvernehmlichen
Abwickelns aller Fragen gebunden bleibt, die ihr
Wettbewerb aufwirft. Es ist daher ganz folgerichtig, wenn
ambitionierte Nationen in der Emanzipation von
diesen Abhängigkeiten
eine nicht unwichtige
Perspektive ihres weiteren Erfolgswegs sehen und sich
die wirtschaftliche Aufrüstung ihres Standorts
vornehmen: Der ist die Basis ihrer Macht, also auch ihre
Waffe gegen die Schranken, die alle anderen ihnen setzen.
Solange sie bei ihren Waffen der Konkurrenz
bleiben, nennen die kapitalistischen Nationen den
Zustand, in dem sie sich befinden, Frieden
.
Insofern dieser Zustand einer ist, in dem der
Interessensstandpunkt der bürgerlichen Staaten, der
Reichtum der Welt sei ihrer exklusiven Verfügungsmacht
auch dann zu unterstellen, wenn er ihnen nicht gehört,
auf seine Kosten zu kommen sucht, lauert in ihm aber auch
immer der Übergang zur Gewalt, zur Konkurrenz der
Waffen. So haben sich an dem Prinzip, allein ihrem
Erfolg beim Wirtschaftswettbewerb sei zu überantworten,
was aus den elementaren Fragen ihrer Macht wird, die
kapitalistischen Staaten bereits öfter sehr ernsthaft
gestoßen.[4] In
ihrem Ersten Weltkrieg ging es ihnen nach eigenem
Bekunden um die Aufteilung der Welt
zu jeweils
eigenen Gunsten, um die Eroberung von Exklusivzonen des
eigenen Zugriffs unter Ausschluß der
Konkurrenten. In ihrem Zweiten Weltkrieg war es
gleichfalls der Unwille der Nationen, sich mit den
Ergebnissen ihrer Konkurrenz zu bescheiden, der zur Tat
schritt und mit Gewalt die für fällig erachteten
Korrekturen unternahm – erst von deutschem Boden aus, zur
Eroberung von neuem Lebensraum
für diese Nation,
dann als die passende Antwort der betroffenen
imperialistischen Konkurrenz, die sich diese Korrektur
der Machtverhältnisse nicht gefallen ließ. Und
unmittelbar nach dem Ende dieses Krieges war den
bürgerlichen Staaten der Umstand, daß die Welt nicht nach
ihrem Interesse geteilt war, die Vorbereitung auf den
nächsten Weltkrieg wert – weil ein sozialistischer
Staatenblock sich ihrem Zugriff und einer Kooperation
nach ihrer Lesart entzog, gingen sie gegen ihn gewaltsam
vor. Sie nahmen die nachhaltige Verschließung der UdSSR
gegen ihre wohlmeinenden Anträge auf Benutzung zu eigenen
Gunsten unmittelbar als Beschneidung ihrer
Macht. Ihre alles überragende außenpolitische
Aufgabe sahen sie darin, sich diese abweichende Macht
gefügig zu machen, und ihre Methode dafür war die
Androhung der Vernichtung dieser Macht. Zuerst mit ihrem
Kalten Krieg
, dann mit Entspannungspolitik
,
immer aber vom Standpunkt ihrer prinzipiellen
Unversöhnlichkeit mit dem Realsozialismus beschieden sie
seine Anträge negativ, man könne mit ihm einfach
koexistieren
. Ökonomisch verwehrten sie der Macht
mit dem abweichenden Systems erst generell den Zugriff
auf alles, was ihrer weiteren Behauptung hätte nutzen
können; dann nutzten sie einige ihrer Notlagen zu
Geschäften aus, welche garantiert ihnen selbst, ihrem
Gegner aber garantiert nicht nutzten, seine Macht
vielmehr weiter zu zersetzen gestatteten.
Politisch machten sie der abweichenden
Herrschaft das Angebot, sich ihre Akzeptanz im Wege der
freiwilligen Übernahme der kapitalistischen Staatsraison
und ihrer Unterordnung unter die Verkehrsprinzipien zu
verschaffen, wie sie die imperialistischen Staaten für
sich vorsahen, und dieses Angebot untermauerten sie mit
einer Rüstung, die auf die Erledigung des
Gegners zielte.
d) Nachdem sich – dank einer Fügung
der Geschichte – dieser Störfall erledigt hat und sich
alle Nationen auf den kapitalistischen Einheitstyp
zurechtregiert haben, kommen weltweit die grundsätzlich
auf wechselseitigem Einvernehmen beruhenden
außenpolitischen Beziehungen
zwischen Staaten zum
Zuge, die sich auf kooperatives Konkurrieren festgelegt
haben. Der Art und Weise, wie sie zum Zuge
kommen, der diplomatischen Form, die sie zur
Abwicklung ihres Geschäftsverkehrs für unbedingt
erforderlich halten, läßt sich entnehmen, wie prinzipiell
schwer es ihnen fällt, das Faktum ihrer wechselseitigen
Ausgrenzung und Beschränkung zu respektieren,
gerade weil und wenn sie soviel voneinander wollen.
II. Vom Respekt, den sich staatliche Konkurrenten schulden, und von den Formen, in denen sie sich ihn zollen: Der Auftakt des diplomatischen Verkehrswesens und seine Fortentwicklung
1. Der Vertrag der Anerkennung
a) Im Akt der Anerkennung
vergewissern sich Souveräne höchstförmlich des
Sachverhalts, der ihren Gegensatz ausmacht, und erklären
ihre Absicht, sich positiv auf ihn als Modus vivendi zu
beziehen. Sie versichern einander, die jeweilige Macht
des anderen über Territorium und Volk als Schranke des
eigenen Zugriffsinteresses auf beides zu akzeptieren. Das
halten sie aufrecht, indem sie die höchste Gewalt
,
die auch ihr Gegenüber ist, in Rechnung stellen, also
davon ausgehen, daß der vorliegende Status quo der
Subsumtion von Territorien und Bevölkerungen unter
exklusive Staatsgewalten die bleibende Voraussetzung
ihres weiteren Verkehrs sein soll. Sie erkennen die Lage
an, wie sie zwischen ihnen als Souveränen besteht, daher
sich als die Subjekte, die diese Lage bestimmen.[5]
b) Staaten, die sich anerkennen, relativieren ihren Anspruch auf unbedingte Gültigkeit ihrer eigenen Gewalt, und diesem selbstbeschränkenden Moment verdankt der Akt der Anerkennung seinen guten Ruf als zivilisatorische Errungenschaft im Staatenverkehr. Der Grund allerdings, dessentwegen kapitalistische Staaten diese Selbstverpflichtung auf sich nehmen, ist das Gegenteil ihrer Selbstbeschränkung. Respektiert wird die fremde Hoheit, da die besondere Leistung, auf die man aus ist und für die man miteinander in Kontakt tritt, anders nicht zu haben ist. Verfügbar für einen selbst zu machen sind die „Ressourcen“ eines fremden Souveräns erst, wenn der als die Instanz akzeptiert wird, die aufgrund ihrer Macht jeden fremden Zugriff unterbindet – ihn deswegen aber auch zu gewähren vermag, und daß sie sich so sehen und behandeln wollen, beurkunden sich die Staaten wechselseitig.
Als höchste Souveräne, die über sich und daher auch zwischen sich kein Recht kennen, hofieren sie sich als das, was sie sind. Sie begründen mit dieser Respektbezeugung den Schein eines Rechtsverhältnisses, das es zwischen ihnen nicht gibt, das aber fortan bestehen soll, weil sie es so wollen. Wie in ihrem Inneren das Recht die Verlaufsform des Staatswillens und seiner Gewalt ist, so wollen sie auch in ihrem gegensätzlichen Verhältnis zueinander die Rechtsförmigkeit als die bewährte Methode nicht missen, einen fremden Willen herrschaftlich zu funktionalisieren. Allemal gilt ihr Wille zur Zusammenarbeit dem Zugriff auf den fremden Hoheitsbereich, und diesen Zugriff gestehen sie sich wechselseitig als Recht zu, worüber ihr jeweils exklusiver Herrschaftswille füreinander funktionalisierbar wird: Als prinzipell gleichberechtigte Partner stehen sie sich dann gegenüber, die überhaupt nur so die Konditionen der wechselseitigen Benutzung vereinbaren können, auf die sie aus sind.
Ihr ausschließendes Verhältnis zueinander, das ihrer Gewalten, überführen die Staaten so in eine Form der Kontrahierbarkeit der Interessen, die sie aneinander haben. Sie entschließen sich dazu, daß die aus dem bürgerlichen Rechtsleben bekannte Synallage, das Prinzip der Leistung um der Gegenleistung willen, auch zwischen ihnen gelten und ihren Verkehr untereinander bestimmen soll: Jede Seite soll berechtigt sein, ihr Interesse an und in Vereinbarungen geltend zu machen und das Interesse der anderen Seite nur soweit gelten zu lassen, wie sie selbst im Gegenzug Vorteile eingeräumt bekommt – umgekehrt verpflichtet sie sich darauf, die Anträge der anderen Seite entgegenzunehmen und auf Vereinbarkeit mit den eigenen Interessen zu prüfen. In dieser wechselseitigen Zusicherung, alles, was man voneinander will, zum Gegenstand von Verhandlungen zu machen und in einer auf Einvernehmen zielenden Vereinbarung zu regeln, geben die Staaten ihre souveräne Rechtshoheit keineswegs preis. Sie wahren sie, indem sie einen Zugriff auf ihren Hoheitsbereich grundsätzlich zum Akt ihrer Gewährung machen. Gleichzeitig kommen sie darüber überein, daß ihre Macht kein grundsätzliches Hindernis für alle Anliegen sein soll, die andere Souveräne vorzubringen haben, sofern diese sich nur zur selben Willenserklärung bereitfinden.[6]
c) Im Akt ihrer Anerkennung löschen Staaten das unversöhnliche Verhältnis also nicht aus, in dem sie als souveräne Mächte stehen. Zwar nehmen sie sich wegen ihres Interesses an wechselseitiger Benutzung in ihrem Standpunkt zurück, daß ihrer Souveränität Universalität gebührt, eine Relativierung durch andere mit dem eigenen Hoheitsanspruch unverträglich ist – immerhin schließt ja die Anerkennung des fremden Genehmigungsrechts die eigene Verpflichtung mit ein, es als Schranke des eigenen Ansinnens gelten zu lassen, wenn die andere Seite sich diesem gegenüber unzugänglich zeigt. Auch erklären sie sich mit der Aufnahme von Beziehungen damit einverstanden, daß die Regeln, nach denen sie ihr staatliches Innenleben gestalten, fortan nicht mehr ihrer ausschließlichen Zuständigkeit unterliegen: Nach ihrem eigenen Willen sollen sie Gegenstand von verpflichtenden Absprachen sein, so daß dem staatlichen Verhandlungs-Partner zwar nicht gleich die Regierungshoheit, aber doch die Konzession zufällt, auf die eigenen inneren Verhältnisse geregelten Einfluß auszuüben.
Aber dieser freiwilligen Selbstbeschränkung der Souveränität steht auf der Haben-Seite erstens gegenüber, daß sich ja alle anderen Souveräne im Gegenzug entsprechend zu revanchieren haben und einem selbst die Anerkennung zuteil werden lassen müssen, die man ihnen gewährt: Indem man anderen deren Souveränität konzediert, verschafft man sich umgekehrt selbst die Unversehrtheit der eigenen, ist bei allen Souveränen als Macht präsent, die sie als ihresgleichen respektieren. Und zweitens gilt in Bezug auf das konzedierte fremde Mitspracherecht bei der Gestaltung der eigenen Belange gleichfalls die Umkehrung – mit demselben Schritt der Anerkennung, die den anderen zur Einflußnahme berechtigt, verschafft man sich dieselben Rechte für sich selbst und hat sich das Mitspracherecht bei dessen Belangen verschafft.
d) Weil sich die Staaten so dazu
entschließen, ihre eigene Macht auf dem Wege der
Genehmigung zu sichern, ist der unbedingte
Respekt vor dem jeweils anderen Souverän
die dauerhafte Vertragsgrundlage
jedes
zwischenstaatlichen Verkehrs. Im Bewußtsein, daß jede
eingegangene Beziehung eine Beeinträchtigung ihres
souveränen Alleinverfügungsrechts ist, legen die Staaten
Wert darauf, als die in letzter Instanz genehmigende
Macht bei jeder Vereinbarung erneut bestätigt zu werden,
und in der beständigen Kundgabe dieses Respekts
hat die Diplomatie ihre erste wesentliche Materie: In
ihren Formalismen und Ritualen bekräftigen sich die
Staaten, daß sie den in der Anerkennung ausgesprochenen
Standpunkt ihres Einvernehmens mit der fremden
Gewalt, die Form der Abwicklung ihrer Beziehungen
betreffend, jenseits aller in der Sache auftretenden
Differenzen wahren wollen. [7]
Schon der nach der Konsultation zwischen Regierungsvertretern erfolgende Akt des Austausches von Botschaftern hat zu dokumentieren, daß hier Staaten in ein dauerhaftes Verhältnis von Beziehungen eingetreten sind und nicht bloß ein zufälliges politisches Einvernehmen zwischen Regierungen hergestellt wurde.[8] Mit dem feinen Unterschied, daß nicht Regierungen, sondern Staaten sich anerkennen, stellen beide Seiten klar, daß sie zwischen dem grundsätzlichen Respekt vor der Souveränität und den jeweiligen Interessen zu unterscheiden vorhaben, die von dieser geltend gemacht werden. Sie unterstreichen, daß ein gemeinsames Interesse an der Abwicklung ihres Verkehrs jenseits von nationalen Personen- und Linienwechseln vorliegt, und dafür hat sich die Staatenwelt im Eigenleben der Diplomatie die nötigen Einrichtungen und ein politischen Konjunkturen nur bedingt unterworfenes Personal geschaffen. Die Botschaften, die als Anlaufadresse für staatliche Beziehungen aller Art fungieren, werden mit den Rechten und Zuständigkeiten ausgestattet, die dem Umstand entsprechen, daß da eine fremde Macht auf dem eigenen Territorium präsent ist: Im gewährten Status der Exterritorialität grenzt der Staat ein Stück des eigenen Territoriums aus seiner Hoheit aus und behandelt es, als stünde es unter der Jurisdiktion der anderen Macht; die fremden Diplomaten erfahren Sonderbehandlung als Personen, die im eigenen Hoheitsbereich zwar gegenwärtig, aber nicht der eigenen Souveränität unterworfen sind; im Agrément wird ihnen eigens bestätigt, als Repräsentant der fremden Macht genehm zu sein, womit die Zuständigkeit des Gastlandes für den eigenen Hoheitsbereich prinzipiell gewahrt bleibt. Einmal akkreditiert, genießt das Botschaftspersonal einen Sonderstatus, der es von anderen in- und ausländischen Bewohnern des staatlichen Territoriums unterscheidet. Da sein Beruf darin besteht, die Interessen einer fremden Macht zu wahren und vorzutragen, ist für es nicht das Ausländergesetz einschlägig, und das einheimische Recht gleichfalls nicht: Immun, wie Diplomaten sind, können sie würgen, wen sie wollen – sie dürfen nicht eingesperrt und auch nicht abgeschoben, sondern höchstens ausgewiesen werden. Für ihre Dienstwohnung gilt tatsächlich „Unverletztlichkeit“ durch staatliche Heimsuchungen, im Gegenzug verpflichten sie sich, einheimische Staatsfeinde nicht zu beherbergen – Ausnahmen bestätigen die Regel. Mit Zollfreiheit, der Erlaubnis zur Versendung unzensierter Post und noch anderen Feinheiten dokumentiert das Gastland seinen Respekt vor der Botschaft des anderen Landes als ein Stück ins eigene Land versetzter fremder Souveränität und ermöglicht dem Personal die Erfüllung seines Auftrags.
Der besteht im täglichen Staatenverkehr darin, die Demonstration der Anerkennung, die eine Macht bei der anderen genießt, bei jedem Kontakt erneut abzuleisten. Das diplomatische Regelwerk legt für alle denkbaren Fälle und Gelegenheiten, in denen Staatsvertreter miteinander zu tun haben, minutiös fest, wie die wechselseitige Achtungsbezeugung stattzufinden hat – vom roten Teppich beim Empfang eines ausländischen Gastes bis hin zur Frage, welche Art von Mitteilung auf welcher Briefpapiersorte zu erfolgen hat. Besonders schön zeigt das gemeinsame Abschreiten einer aufgeputzten Abteilung des fremden Militärs die Doppelbedeutung des Respekts, den sich beiden Seiten zollen: Die symbolische Zurschaustellung des eigenen Machtapparats ehrt den Gast in seiner Souveränität, weil sie die Macht des Gastgebers ebenso dokumentiert wie die vorhandene Bereitschaft, nicht ihre Anwendung, sondern den Respekt vor der souveränen Macht des Gastes zum Verkehrsprinzip mit ihm zu machen.
2. Die Verträge zwischen Staaten
a) Der zwischenstaatliche Vertrag als solcher: Wie Unverträgliches vereinbar zu machen geht.
Ihre Anerkennung ist für die Staaten die Voraussetzung dafür, die Interessen, die sie aneinander haben, in konkrete Vertragsverhältnisse zu überführen. Deren Stoff und Inhalt umfaßt alles, was die Staaten sich selbst und ihren Bürgern beim jeweils anderen an Rechten eingeräumt sehen wollen, damit diese ihren privaten Geschäften nachgehen können und der Staat zu mehr Reichtum kommt. Die diplomatischen Verfahren, in denen die Staaten über diese Vereinbarungen kontrahieren, drehen sich daher darum, ihren gegensätzlichen Interessen die Form des Rechts zu geben: In ihrer Diplomatie bringen die Staaten das Interesse zum Ausdruck, ihren Vereinbarungen den Charakter der verläßlichen Verpflichtung zu verleihen, daher umgekehrt auch den bleibenden Vorbehalt, den sie als Souveräne gegenüber jeder bindenden Zusage wahren wollen.
Mit Vertragsverhältnissen, wie sie Bürger eines Staates untereinander eingehen, haben die Abmachungen zwischen Staaten nur das Formelle gemeinsam, daß sich zwei gegensätzliche Willen auf gegenseitige Leistung einigen. Damit hört die Gemeinsamkeit auch schon auf.[9] Die Vertragsverhältnisse, die Bürger eingehen, finden sie nach Form und Inhalt fix und fertig kodifiziert vor; in allen vertraglichen Abmachungen, die sie treffen, exekutieren sie lediglich praktisch ihre Interessensstandpunkte in Form eines verrechtlichten Willensverhältnisses, vollziehen also nach, was die staatliche Gewalt ihnen diesbezüglich in Paragraphenform vorgezeichnet hat: Es ist die Gewalt des Staates, die allen materiellen Gütern die Form des privaten Eigentums verleiht und die Bürger zu Rechtspersonen, zu Besitzern von Rechten macht, die als solche dann miteinander Verträge über Weggabe und Erhalt ihres Eigentums abschließen. Staaten dagegen kontrahieren nicht auf Basis eines vorhandenen Rechts, sondern verleihen Rechte – und darüber kontrahieren sie: Sie räumen sich wechselseitig hoheitliche Befugnisse ein, einigen sich in ihrer Eigenschaft als rechtsetzende Gewalten darüber, welche Fragen sie wie regeln wollen, indem sie festlegen, welche Rechte sie gegeneinander jeweils in Anspruch nehmen dürfen.[10]
Daß sie selbst über diesen Rechten stehen, vergessen sie dabei freilich nicht. Weil alles, was bei ihren Vereinbarungen zustandekommt, aus der Selbstverpflichtung souveräner Gewalten erwächst, wird im diplomatischen Procedere diesem Umstand eigens Rechnung getragen. Kontrahiert wird ja über Hoheitsrechte, also muß bei jedem Antrag die prinzipielle Respektsbezeugung vor dem anderen Souverän erneuert werden: Er soll Eingriffsrechte in seine Verhältnisse konzedieren, will also als oberster Konzessionär gewürdigt werden. Im feierlichen Unterzeichnen von Übereinkünften – am besten durch führende Staatsmänner – wird nicht nur aller Welt die Leistung demonstriert, die in der Herstellung eines gemeinsamen Willens zwischen Gewaltmonopolisten liegt; jede Seite betont damit zugleich auch den bleibenden Souveränitätsvorbehalt, den sie als Unterzeichner wahrt. Der Austausch von Hoheitsrechten verlangt bei jedem Zustandekommen eigens die Demonstration des Entgegenkommens, der Berücksichtigung der anderen Seite, zu der sich die souveränen Willen zum gemeinsamen Regeln da bereitgefunden haben. Daher dient jedes erzielte Resultat immer beiden Seiten dazu, die eigene Bereitschaft zur Einigkeit zu bezeugen – umso mehr, je schärfer die Gegensätze waren, die es zu überwinden, d.h. in Vertragsform zu gießen galt.[11]
Den Vertragsverhältnissen selbst ist anzusehen, daß es beiden Seiten der Übereinkunft nur darum geht, die andere auf die Einräumung von Rechten zu verpflichten, die Selbstverpflichtung nur der dafür notgedrungen gezahlte Preis ist. Festgelegte Fristen machen deutlich, daß allerlei Umstände, auch grundlegende Veränderungen der nationalen Interessenslage eine Revision einmal für nützlich gehaltener Verpflichtungen angesagt sein lassen können. Wenn Vertragsfristen sich ihrem Ende nähern, setzt lebhafter diplomatischer Verkehr über die Frage ein, ob und wie die Vereinbarung verlängert, gekündigt, modifiziert oder einfach so weitergeführt wird, wie sich also der Wille beider Seiten zu dem Vertrag, seinen Folgen und Ergebnissen stellt bzw. in Zukunft zu stellen gedenkt. So trägt man dem Umstand Rechnung, daß das beiderseitige Einhalten des Vertrags mit einem bleibendem Einverständnis mit seinen Ergebnissen nicht zu verwechseln ist. In diesem Sinne werden auch Konditionen eines möglichen Widerrufs, akzeptierte Formen der Nichteinhaltung sowie Bedingungen der Neuverhandlung gleich mitvereinbart, wobei immer das Prinzip gilt, daß die Verpflichtung auf die Vertragsform keinesfalls mit einem Verzicht auf das eigene Recht zur Neudefinition der Verkehrskonditionen verwechselt werden darf, wenn einem die Ergebnisse eingegangener Verpflichtungen nicht passen.[12]
b) „Pacta sunt servanda. Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen.“[13]
Die Materie, über die Staaten kontrahieren, bringt es mit sich, daß sich immerzu Anlässe zum Streit über den Umgang mit geschlossenen Verträgen bieten: Mehr als ihr Versprechen, sich an das Vereinbarte halten zu wollen, haben sie bei deren Vereinbarung ja nicht abgegeben. Wenn Staaten z.B. übereinkommen, zwischen sich eine „Zollmauer“ zu beseitigen – wie etwa neulich die EU und die Türkei –, jede Seite also auf bisher erzielte Einkünfte aus dem grenzüberschreitenden Warenverkehr verzichtet, dann tun sie dies in der Erwartung, diese Kostensenkung für die ex- und importierende Geschäftswelt möge das Geschäft beleben und darüber ihre jeweilige Handels- und Zahlungsbilanz verbessern. Womöglich mag sich die Geschäftsbelebung auf beiden Seiten einstellen, deren Wirkung auf die nationale Bilanz ist allerdings nicht so ganz gleichgewichtig: Was die eine Nation als ihren Außenhandelsüberschuß einstreicht, verbucht die andere als ihr Minus. Bei diesem Befund bleibt es natürlich nicht. Regelmäßig bezieht ihn die geschädigte Nation zurück auf die eingegangenen Verträge und stellt fest, daß der Preis, den sie für die Ermöglichung von mehr Geschäft entrichtet hat, sich für sie nicht auszahlt. So wird aus der schlechten Handelsbilanz nicht nur ein Auftrag an die eigene Wirtschaftspolitik, sondern auch einer an die Diplomatie: Die hat dem Vertragspartner einerseits die Maßnahmen zu vermitteln, die zur Abwendung des Schadens im nationalen Interesse ergriffen werden, andererseits auszuloten, inwieweit er für eine Modifikation vereinbarter Konditionen zu haben ist. Da kennen Regierungen allerlei Varianten: Man kann beim Vertragspartner vorstellig werden, auf die negativen Ergebnisse deuten und sich die Genehmigung zur abweichenden Interpretation der Klauseln abholen. Man kann – dafür hat sich in diesem Falle die Türkei entschieden – bestimmte Teile der Vereinbarung einseitig nicht einhalten und beim Vertragspartner wegen besonderer Umstände um Nachsicht bitten, ihm also bedeuten, daß er die Abweichung vom Vereinbarten nur als vorübergehende Maßnahme werten möchte, aus der nicht auf fehlende Bereitschaft zur Vertragstreue zu schließen sei. Schließlich gibt es auch den Übergang zum offenen Vertragsbruch, verbunden mit dem Hinweis an den Vertragspartner, daß die Rechte und Zuständigkeiten, die er aus dem Vertrag ableitet, in diesem speziellen Fall mit dem eigenen nationalen Interesse nicht vereinbar sind.
Letzteres stellt in der Welt der Diplomatie eher die Ausnahme dar. In der Regel dominiert schon die Heuchelei von „Treu & Glauben“, also das Interesse, den eingetretenen Schaden im Einverständnis mit dem Vertragspartner zu regeln, seine Zustimmung zu eigenen, abweichenden Interpretationen vereinbarter Bestimmungen zu erlangen. Weil bekannt ist, daß dies gegen das Interesse des Vertragspartners verstößt – er zieht ja gerade aus der praktizierten Anwendung des Vertrags seine Vorteile –, läßt es sich die Diplomatie angelegen sein, beim Vorbringen des eigenen Anliegens den Willen zur Fortführung des beidseitig nützlichen Vertragsverhältnisses zu betonen. Sie ergeht sich in der Kunst der Bezeugung, daß der Gegensatz, den man gerade aufbringt, nicht als solcher gemeint ist, also keiner sein muß, weil er sich im Rahmen des Vereinbarten gemeinsam bewältigen läßt. Zu allen Maßnahmen, die als Vertragsbruch zu deuten wären, werden Angebote zur Interpretation mitgeliefert, die sie als vereinbar mit dem fremden Interesse erscheinen lassen sollen – jedenfalls im Prinzip, wenn auch nicht im besonderen Fall. Auch die diplomatische Drohung mit der Nichteinhaltung von Absprachen teilt keineswegs ohnehin schon Geplantes mit, sondern ist als Aufforderung an die Gegenseite zu verstehen, zwecks Vermeidung weitergehenden Schadens in Verhandlungen einzuwilligen. Daher die Wichtigkeit des „Tonfalls“, der diplomatischen „Ebene“, der Methode, mit der Unzufriedenheiten zur Kenntnis gebracht, Maßnahmen erläutert oder angedroht werden. Teilt man z.B. dem anderen Souverän eigene Entscheidungen auf offiziellen Kanälen mit? Vorher oder nachher? Oder soll er sie erst aus der Zeitung erfahren? Mit solchen Demonstrationen größerer oder geringerer Verständigungsbereitschaft wird Interesse an der Geneigtheit der anderen Seite bekundet und zugleich ausgelotet, mit welcher Reaktion von ihrer Seite man rechnen bzw. auf welches Entgegenkommen man hoffen darf.
Welche Bedeutung der diplomatischen Form auch und gerade beim ausdrücklichen Vertragsbruch zukommt, konnte man zur Kenntnis nehmen, als die deutsche Politik sich jüngst entschloß, sich bei der Förderung des deutschen Automobilkonzerns VW nicht mehr an EU-Auflagen zu halten. Der Beschluß war als Bruch des EU-Rechts[14] von deutscher Seite bewußt in Kauf genommen worden, daher stand unmittelbar das Erfordernis an, die Behörde in Brüssel diplomatisch wissen zu lassen, welches Gewicht die diesem Vorgehen beimessen soll. Diesbezüglich entschloß man sich zur innerstaatlichen „Arbeitsteilung“: Die sächsische Landesregierung übernahm die Rolle, den deutschen Standpunkt zu verstehen zu geben, wonach die bisherigen Übereinkünfte mit der EU bezüglich der Subventionierung des deutschen Ostens hinfällig seien.[15] Die Bundesregierung nahm die Aufgabe wahr, gegenüber der EU „bei allem Verständnis in der Sache“, nämlich VW, das eigenmächtige Vorgehen Sachsens zu „bedauern“ und ihr Interesse an weiterer kooperativer Zusammenarbeit mit der Kommission zu bekunden. So wurde das deutsche Interesse daran bekundet, daß die EU-Kommission diesen „Fall“ erstmal als solchen und nicht gleich als Indiz dafür werten soll, daß die deutsche Politik sich prinzipiell nicht mehr an die in der EU vereinbarten Verfahren halten wolle.
Der Witz an diplomatischen Verrenkungen dieser Art ist nicht, daß sie nicht leicht durchschaubar wären. Als Ausdruck des Sachverhalts, für den sie stehen, sollen sie ja durchschaut werden: Dem diplomatisch angesprochenen Partner sollen sie Ernsthaftigkeit wie Gültigkeit des eigenen Interesses ebenso bedeuten wie den fortbestehenden Willen, dieses mit seinem vereinbar zu machen – wenn er sich nur darauf einläßt. Im diplomatischen Vorbringen des eigenen Interesses veranstalten Staaten einen Test auf den Willen des anderen Souveräns. Ihm wird das Angebot unterbreitet, wie er die Sache nehmen kann: Mehr als Gegensatz – oder mehr als Gegenstand der Verständigung, was dem Antrag gleichkommt, sich zum Vorgehen der anderen Macht so oder so zu verhalten. Selbst wenn Verhandlungen mit der Bekanntgabe enden, daß Vereinbarliches in dem zur Debatte stehenden Streitfall nicht auffindbar ist, bedeutet dies nicht den Übergang dazu, daß die Streitparteien aus einseitiger Machtvollkommenheit über Zölle, Importgenehmigungen, Devisentransfers usw. entscheiden. Die Kunst der Diplomatie besteht dann darin, von den wechselseitigen Anfeindungen und Verdächtigungen wieder zu versöhnlicheren Tönen zurückzufinden, den eingetretenen Schaden an den Beziehungen ins rechte Licht zu rücken und damit den Weg für deren gedeihliche Fortsetzung zu bahnen.
Die Zerwürfnisse, derer sich die Diplomatie auf diesem Felde anzunehmen hat, gewinnen ihre Heftigkeit aus der notwendig einseitigen Interpretation, die Staaten eingegangenen Vertragsverhältnissen angedeihen lassen, sobald deren Ergebnisse ihnen nicht mehr passen. Im Nachhinein stellt der geschädigte Souverän – Partei, die er nun einmal ist – fest, daß der Akt, mit dem er sich erweiterten Zugriff auf nationale Erträge sichern wollte, sich als Freibrief an andere Staaten erwiesen hat, sich auf seine Kosten zu bereichern, so daß sein logischer Rückschluß heißt, daß er seinen Vertragspartnern wohl zu große Zugeständnisse gemacht habe. Dafür verantwortlich gemacht wird einerseits immer der andere Souverän: Wenn er Vorteile aus – zu wechselseitigem Nutzen geschlossenen! – Vereinbarungen zieht, hat er offensichtlich die Beziehungen einseitig ausgenutzt und die ihm im Vertrag eingeräumte Macht zu rücksichtslos zur Geltung gebracht. Seinen eigenen Mißerfolg bei der Ausnutzung vertragsweise erworbener Rechte bilanziert der geschädigte Staat so nachträglich als Beschränkung seiner Souveränität – umgekehrt erfährt die Art und Weise, in der sein Vertragspartner seine ihm eingeräumten Befugnisse genutzt hat, eine Verurteilung als unzulässiges Hineinregieren, das man sich in Zukunft nicht mehr bieten lassen kann. Kritik trifft deshalb auch die eigenen diplomatischen Verhandlungsführer: Die hätten nicht energisch genug verhandelt, sich statt dessen über den Tisch ziehen lassen. Die Diplomatie muß sich mangelnde Pflichterfüllung am nationalen Auftrag vorwerfen lassen – und wird mit der Vorgabe in die nächste Runde geschickt, erfolgreich dafür zu sorgen, daß die zugestandene Preisgabe von Souveränität nationale Vorteile erbringt. Das macht manchmal die Auswechslung von Außenministern oder Regierungen erforderlich.
c) Die diplomatische Pflegebedürftigkeit gegensätzlicher Vertragsverhältnisse
Das diplomatische Gerangel um Vertragsauslegungen und erlaubte Verstöße ist kein Gegensatz zur Kooperation der Staaten, sondern deren Verlaufsform. Je mehr Staaten miteinander vereinbart, also praktisch miteinander zu tun haben, desto mehr Notwendigkeiten, Gelegenheiten und Anlässe zu einer retrospektiven, konstruktiv in die Zukunft weisenden Kritik ihres Verkehrs gibt es. Diese Kritik speist sich aus der gezielten Fehlinterpretation des Umstands, daß die Rechte, die man beim anderen erwirbt, allemal nur Bedingungen des nationalen Interesses sind, dem sie erst zum Durchbruch verhelfen sollen: Wenn Staaten unerwünschte Folgen des grenzüberschreitenden Handelns und Wandelns bilanzieren, liegt ihnen nichts ferner, als sachlich zur Kenntnis zu nehmen, daß sie es mit der Eröffnung des zwischenstaatlichen Verkehrs eben den Machenschaften der privaten Geldvermehrung überantwortet haben, ob sich ein nationaler Reichtumszuwachs einfindet oder nicht. Statt dessen beziehen sie jede Auswirkung der auf sie zurückgehenden Vereinbarung auf sich als ihren Autor zurück – und sinnen auf diplomatische Wege zur Optimierung der Ertragsbilanz des bisherigen Verkehrs.
Dem Umstand, daß sie sich mit ihren Verträgen
wechselseitig binden und dies für sie negative Folgen
haben kann, tragen die kontrahierenden Staaten auch
vorsorglich schon Rechnung: Sie sichern sich mit jedem
Vertrag zugleich das Recht zu, ihn auch im Lichte
seines Zieles und Zweckes auszulegen
.[16] Der Kunstgriff, mit dem
sie hier die Kollision ihrer Interessen zum Motor ihrer
vertraglichen Beziehungen machen, besteht darin, sich die
Freiheit auszubedingen, unter Berufung auf den
geschlossenen Vertrag sich eher nicht von ihm,
sondern von dem Interesse an seiner positiven Ausnutzung
gebunden zu fühlen. So wird der Vertrag ausgelegt
und damit versucht, die in ihm niedergelegte formelle
Bindungswirkung für den geschätzten Partner auch auf
Interessensgegenstände zu erstrecken, über die gar nicht
kontrahiert wurde, bzw. sich selber von Verpflichtungen
freizusprechen. Der Gegensatz der Interessen der Parteien
verläuft so als Konkurrenz divergierender Exegesen ein
und desselben Schriftstücks, und mit der halten die
Parteien unverdrossen die Fiktion aufrecht, die mit ihrem
Entschluß zur rechtsförmigen Abwicklung ihrer Anliegen
auf die Welt gekommen ist: Zwar stehen sich in Gestalt
der hohen Vertragsparteien
nur Schädiger und
Nutznießer gegenüber; gestritten aber wird in der Form
von interpretationswütigen Rechtsgelehrten, die das
Staatsinteresse unbedingt durch die formelle Autorität
beglaubigt haben wollen, die kraft ihres eigenen
Beschlusses einem Vertragstext entspringt, der die
Unterschrift der anderen Seite trägt.[17]
Jedes angemeldete Interesse an einer – wie auch immer beschaffenen – schöpferischen Weiterentwicklung des zwischenstaatlichen Verkehrs beruht auf dem materiellen Gehalt der bereits eingegangenen Beziehungen – und auf den beiderseitigen Abhängigkeiten, die aus diesen ziemlich naturwüchsig entstanden sind. Selbstverständlich führt der Entschluß zur Konkurrenz dazu, daß sich Erträge des grenzüberschreitenden Verkehrswesens unterschiedlich ansammeln, aber Sieger wie Verlierer haben je für sich unabweisbare Gründe, sich für den Fortbestand des eingerichteten Systems staatlicher Vereinbarungen einzusetzen, mit dem sie sich den Zugang zu neuen Reichtumsquellen eröffnen: Eine Macht, deren wirtschaftlicher Erfolg sich in der Verfügung über eine Weltwährung niederschlägt, hängt sehr vom Fortgang aller Beziehungen ab, die sie für sich so grandios zu nutzen verstand – sie weiß sich glatt abhängig von allen Abhängigkeiten, in die sie ihre Konkurrenten manövriert hat. Umgekehrt entwickelt eine andere Macht, die die Folgen des Wirtschaftswettbewerbs womöglich als Ruin ihres Geldes bilanzieren muß, von sich aus auch das Interesse an der weiteren Pflege der Beziehungen – als Weg, für sich das Beste aus allen Abhängigkeiten zu machen, in die sie geraten ist. So ist das nationale Fortkommen der Konkurrenten in unterschiedlicher Weise von der dauerhaften Nutzung der Zugriffsrechte abhängig, die sie sich einräumen, und ihr Bedürfnis nach Kontinuität ihrer Beziehungen schlägt sich in eigenen diplomatischen Formen ihres Verkehrs nieder.
Einige Staaten schließen zur Verstetigung ihrer
Beziehungen Bündnisse. Sie verständigen sich
darauf, daß sie es in ihrem Verkehr zu einem Fundus
gemeinsamer Interessen gebracht haben, deren weitere
gemeinschaftliche Pflege eigens vertraglich fixiert
werden soll: Sie werden aus dem täglichen Geschäft des
Erlaubens und Versagens ausgeklammert, eine prinzipielle
Verfahrensweise wird vereinbart, mit der die Regelung
aller ökonomischen, politischen und militärischen Fragen
angegangen wird. Mitvereinbart werden gleichfalls
Schritte oder Modelle
einer weitergehende
Zusammenarbeit, aber natürlich auch besondere Verfahren
der Streitschlichtung, die alles an Gemeinsamkeit
Erreichte bestätigen und nicht untergraben sollen. Die
etablierte Festigkeit in den Angelegenheiten der
wechselseitigen Benutzung sichert vor allem eines: Die
Machtmittel eines jeden Bündnispartners gegen Dritte,
denen gegenüber man sich zum Vorrang der
Bündnisverpflichtungen bekennt und denen man eine solche
Vorzugsbehandlung ihrer Rechte nicht zugesteht. Daß auch
Bündnisse ihre Fristen haben und nicht für die Ewigkeit
geschlossen sind, dokumentiert nur, daß mit dem
weitergehenden Souveränitätsverzicht, zu dem sich die
Beteiligten bereitfinden, die nationale Berechnung nicht
aufhört, um deretwillen man sich zusammengetan hatte.
Weil sie sich so sehr von ihm abhängig gemacht haben,
kennen die Staaten auch das Bedürfnis, ihrem
eingerichteten Rechtsverkehr eine Verläßlichkeit
einzuprägen, die gewissermaßen ganz aus sich erwachsen
soll. Es sind ja bloß sie, die sich da wechselseitig
Rechte einräumen, allerdings auch versagen, und daher
wüßten sie gerne einen Hebel für sich, mit dem sie den
fremden staatlichen Willen in die rechtlichen Bahnen
bringt, die dem eigenen passen. Ein Völker-Recht
leistet den entsprechenden Dienst: Unter Berufung auf die
prinzipielle Gemeinsamkeit und den Konsens mit dem ganzen
Rest der imperialistischen Staatenwelt wird der für das
nationale Interesse in Anspruch genommene Rechtscharakter
fingiert, den es eben nicht hat. Ganz unparteilich, weil
im Namen aller Völkerschaften, lassen sich dann
„Verstöße“ monieren und Staatswillen in die Pflicht
nehmen, an denen man sich stört. Den Seufzer nach der
fehlenden Gewalt, die es zur Vollstreckung mancher
Urteilssprüche braucht, erhört dann vielleicht eine
Weltmacht – dazu Näheres in Abschnitt III.
3. Die Verlaufsformen der genehmigten „Einmischung in innere Angelegenheiten“
a) Das Ringen um neue Verträge
Die Unzufriedenheit mit dem Ertrag bestehender
Vertragsverhältnisse veranlaßt die Staaten dazu, ihre
Vertragspartner zu einer Korrektur ihres Willens
zu drängen und das Betätigungsfeld ihrer Diplomatie
entsprechend zu erweitern. Ihr obliegt die Aufgabe,
Beschwerden vorzubringen, auf Rechte zu pochen, das
Interesse an einer Korrektur eingegangener
Vertragsverhältnisse anzumelden und zu erforschen, wie es
um die Bereitschaft der anderen Seite steht, sich auf die
übermittelten Anträge einzulassen. Dabei dient die
Mitzuständigkeit für die Belange der anderen
Souveränität, die diese mit bereits eingegangenen
Verträgen zugestanden hat, stets als der
Berufungstitel für alle Forderungen, die man neu
geltend macht: Jede einmal geschlossene Vereinbarung gilt
als Beleg dafür, daß die neuen Ansinnen nur allzu
berechtigt seien – schließlich bestehe man mit
ihnen nur auf die Einlösung der Ansprüche, die in anderen
Vereinbarungen bereits grundsätzlich anerkannt worden
seien. Wenn etwa die USA das – allen
Marktöffnungsvereinbarungen
zum Trotz – bleibende
Handelsdefizit mit Japan auf die Tatsache zurückführen,
daß in Japan dann eben „Handelshemmnisse“
anderer Art existieren müßten, und auf neue
Abmachungen drängen, agieren sie nach diesem Schema: Ihr
Interesse an den Abkommen mit Japan war, an und
in Japan mehr Geld zu verdienen als vorher;
Marktöffnung
hieß der diplomatische Vertragstitel
für die Maßnahmen, die es dazu zweckdienlich einzurichten
galt; bleibt der Verdienst aus, wird der
Rechtsanspruch in der Form erneuert, daß Japan
mit neuen Genehmigungen für das Zustandekommen
des gewünschten Ergebnisses zu sorgen hat. Dem Ansinnen
der USA wurde die diplomatisch passende Antwort erteilt:
Der Partner hat sich einerseits auf den Buchstaben des
Vertrages berufen, den er eingehalten habe und für dessen
– für die USA unbefriedigend ausgefallenen – Ergebnisse
er nicht verantwortlich zu machen sei, andererseits hat
er auch auf Neuverhandlungen eingelassen. Diplomatisch
passend ist diese Antwort insofern, als Japan sich auf
den bestehenden Rechtszustand als – weil vereinbart –
gültigen beruft, die eigene Vertragstreue unterstreicht
und den USA damit zu verstehen gibt, daß diese
selbst doch die Bedingungen des japanischen
Wirtschaftserfolgs genehmigt hätten. Als Auftakt zu neuen
Verhandlungen dient der Verweis auf die eigene
Rechtsposition zur Demonstration, daß die eigene
Diskussionsbereitschaft noch lange nicht
bedeutet, daß man den Inhalt des amerikanischen
Korrekturwunsches akzeptiert – entsprechend
zäh
und erbittert
verliefen dann ja auch
die Auseinandersetzungen.
Die diplomatische Technik, sich beim Stellen
neuer Forderungen auf bereits Vereinbartes zu
berufen, arbeitet sich an einem offensichtlichen
Widerspruch ab. Der Grund für die Berufung ist, daß die
Abmachungen von gestern nicht mehr gelten
sollen, der Antragsteller vielmehr auf eine
Revision der eingegangenen Beziehungen aus ist.
Berufen wird sich im Ernst also gar nicht auf den alten
Vertrag, sondern auf den in ihm dokumentierten
Willen der anderen Seite zum Kontrahieren über
die jeweilige Materie. Die Logik, daß aus einer erteilten
Genehmigung die Befriedigung des darin angestrebten
Nutzen zwingend folgen
müsse, ist eben keine,
sondern verlangt vom Gegenüber eine Einsicht
etwas
anderer Art ab; nämlich die, daß Beziehungen, wie er sie
doch schätzt, keinen Bestand haben können, wenn er sich
nicht bereitfindet, sie in Richtung neuer Konzessionen zu
verändern. Die Forderung an eine andere Macht, sich zur
Korrektur ihrer Machtausübung bereitzufinden,
erklärt die Festlegung der fremden Souveränität auf das
eigene Interesse ausdrücklich zum Zweck der
eingeleiteten Verhandlungen, mutet also dem Partner zu,
seinen souveränen Willen dem eigenen gemäß zu
machen. In den Formalismen der Diplomatie muß daher
wie immer und jetzt erst recht der Respekt vor dem
Ansprechpartner bezeugt werden – um ihm deutlich zu
verstehen zu geben, daß und wo man sich an der
Abhängigkeit stört, in der man vom seinem Willen
steht. Instrumente und Gelegenheiten, um in abgestuften
Varianten eigene Verhandlungsbereitschaft, gepaart mit
Intransigenz, Respekt und zugleich die Verärgerung zu
demonstrieren, daß man ihn zollt, finden sich genug: Wahl
des Verhandlungsortes, Festlegung des Tagesordnung,
rechtzeitiges Erscheinen, passendes Krankwerden, gezielte
Indiskretionen und andere Kindereien entfalten hier ihre
Bedeutung. Diplomatische Verlautbarungen der Art, daß man
zwar in den Verhandlungen gut vorankomme, sich aber noch
kein Stück aufeinander zubewegt habe, findet daher aus
gutem Grund niemand absurd.[18]
b) Vom Recht auf Einmischung zur Diplomatie der Erpressung
Wer sich mit welchem Erfolg mit seinem Gestaltungsdrang bei der Modifizierung der Beziehungen durchsetzt, ist – wie immer und überall bei Staaten – eine Frage des Machtverhältnisses zwischen ihnen.
Das stellt sich als zwangsläufiges Ergebnis des Vergleichs der unterschiedlichen Mittel ein, mit denen die Teilnehmer der Konkurrenz antreten und die sie in ihr zu mehren suchen. Es ist ihre ökonomischen Potenz, die die einen beim Vergleich ihrer kapitalistischen Standorte mitbringen, die den anderen umgekehrt abgeht, die für die recht unterschiedlichen Ergebnisse verantwortlich ist, die die Nationen als jeweils ihren Nutzen aus den erteilten Genehmigungen zur wechselseitigen Benutzung bilanzieren. Der Umstand, daß vom ungestörten Fortgang des grenzüberschreitenden Handels und Wandels, also von der Verläßlichkeit eingerichteter Vertragsverhältnisse, alle Beteiligten, Sieger wie Verlierer der Konkurrenz, abhängig sind, sorgt dafür, daß aus den unterschiedlichen Resultaten der Konkurrenz gerechterweise auch etwas unterschiedliche Abhängigkeiten werden, die sich dann auch in der Ausgestaltung der zwischenstaatlichen Beziehungen niederschlagen. Wie sehr ein Staat auf die laufenden Beziehungen zu einem anderen angewiesen ist, kann er unmittelbar an dem Ausmaß ablesen, in dem die Quellen und Mittel seiner Macht – Erträge, Kredite, militärisches Potential – bereits von Vereinbarungen mit anderen abhängig sind; umgekehrt hat ein anderer Staat, der dieselben Beziehungen für seine Konkurrenz erfolgreich zu nutzen verstand, mit seinem Erfolg auch das Vermögen in Händen, Abhängigkeit andersherum zu buchstabieren – und ist vielleicht zu den Konzessionen bereit, die ein Staat der ersten Sorte dringend braucht.[19]
Erpressung findet also allemal statt, wenn
eingerissene Abhängigkeitsverhältnisse zur Herleitung
neuer Rechte bemüht werden. Ob ausgesprochen oder nicht –
im Hintergrund lauert stets der Schaden, der dem
anderen Staat zugefügt werden könnte, wenn er sich dem
eigenen Antrag gegenüber nicht gefügig zeigt, sich zur
Revision eingerichteter Vertragsverhältnisse
herbeizulassen: Erpreßt wird er mit seinem eigenen
Willen, die angedrohte Unterbrechung der eingerichteten
Beziehungen oder gar deren Abbruch zu vermeiden, wobei
das Ausmaß des widrigenfalls eintretenden Schadens den
Ausgang der Überzeugungsarbeit natürlich entscheidend
mitbestimmt. Das erfordert enorm viel diplomatisches
Geschick
. Der Zweck der Veranstaltung ist ja nicht
die Schädigung selbst – diese soll vielmehr nur der
Potenz nach vor Augen gestellt werden, um die
beiderseitig nützlichen Beziehungen in der korrigierten
Form fortzusetzen, die dem eigenen Nutzen besser dient.
Wenn es dann doch zu Handelskriegen
kommt, hat die
Diplomatie wieder sehr viel zu tun, um diese zu beenden.
Nicht nur, weil beide Seiten unter der Störung der
Geschäfte leiden – der Übergang zur ausdrücklichen
Schädigung des anderen Souveräns ruft ihn auch als
Macht auf den Plan, die sich fragen muß, ob sie
in diesem Akt nicht einen grundsätzlichen Angriff auf die
Rechte sehen will, die ihr beim anderen Staat längst
eingeräumt waren. Damit droht das ganze Geflecht
nützlicher Vereinbarungen in Frage gestellt zu werden,
auf denen der Verkehr der Staaten beruht – und ihren
Beziehungen der Rückfall auf die Grundsatzfrage,
inwieweit das Recht der anderen Gewalt für die eigene
überhaupt anerkennenswert ist.
Die Staaten wissen um diese Gefahr, daher sind sie in der
Sphäre ihrer Diplomatie bemüht, die „Fragen“, aus denen
ihnen Gegensätze dieser Art bereits erwachsen sind oder
erwachsen könnten, zum Gegenstand von Verhandlungen und
Vereinbarungen zu machen. So kommt z. B. ein
transatlantisches Wirtschaftsabkommen
zwischen der
EU und den USA zustande, in dem beide Seiten
übereingekommen sind, wegen ihrer zunehmenden Differenzen
auf diesem Felde zum Zwecke ihrer Bereinigung ein eigenes
Verhandlungsforum zu institutionalisieren.
Sogar die letzten Machtmittel der Staaten, die die allerempfindlichsten Belange ihrer „äußeren Sicherheit“ betreffen, werden noch zum Werkstoff der Diplomatie und ihres Bemühens, auf Basis aller laufenden Beziehungen die Berechenbarkeit der anderen Seite zu wahren. Wo mit Waffen und gleichfalls im Weltmaßstab Geschäfte gemacht werden, braucht es auch die Diplomatie des Waffenhandels. Mit ihren vielen in-, halb- oder höchstoffiziell abgewickelten Rüstungsgeschäften statten sich die Staaten ja immerhin mit Mitteln aus, die sie als Mächte unmittelbar respektabel machen. Prinzipiell genießt daher jeder Ex- und Import dieser heißen Waren ihre höchste politische Aufmerksamkeit und ist daher Gegenstand diplomatischer Betreuung: Die eigene Bedarfsdeckung ist laufend dahingehend zu überprüfen, von welchem Lieferanten man sich mit ihr abhängig gemacht hat und von dem erpreßbar ist, weil ihm Einmischungsrechte im Bereich des Allerheiligsten der eigenen Souveränität zugefallen sind; und der Bedarf der restlichen Welt natürlich auch, weil man mit eigener Belieferung ja umgekehrt nutzbare Rechte und Erpressungsmittel erwirbt.
c) Die diplomatischen Hebel zur Änderung des Kräfteverhältnisses
Wenn Staaten den Nutzen verfolgen, der ihnen aus den
Rechten ihrer vielfältigen Beziehungen erwächst; wenn sie
ihren Partnern
gegenüber auf Einmischung drängen
und erreichte Abhängigkeiten dazu erpresserisch nutzen –
dann wollen sie jedenfalls sich selbst nicht
durch die Abhängigkeiten bestimmen lassen, die
sie bereits eingegangen sind. Umgekehrt stößt dem
Rechtsstandpunkt, der sich aus den Erfolgen der fremden
Benutzung herleitet, das Hindernis auf, daß er
mit seinem Recht stets gegen das Recht der
anderen steht. Die Berufung auf schon erreichte
Abhängigkeiten ist üblich, garantiert aber in keiner
Weise das Placet des Kontrahenten, fordert vielmehr
ebensogut dessen Willen heraus, die überkommenen
Beziehungen gemäß seinem Interesse in Frage zu stellen.
Dennoch machen sich die Staaten weiter daran, ihre
Erfolge gegen und ihre Überlegenheit über ihre
Konkurrenten in Vertragsregelungen festzuklopfen, aus den
Erfolgen von gestern neue Rechte für heute und morgen
abzuleiten: Sie arbeiten daran, die laufenden Beziehungen
und ihren Fortgang zu einer Frage der Unterordnung
unter ihre Rechtsansprüche werden zu lassen.
Das „Sachgesetz“, auf das sie sich beim Verhandeln berufen und wonach aus Abhängigkeit Willfährigkeit zu resultieren habe, gibt es nicht, daher beschreitet die Diplomatie den Weg, die hergestellten Abhängigkeitsbeziehungen erpresserisch in Anschlag zu bringen und den betreffenden Partner zu der Überzeugung zu bringen, daß die doch wohl hinlänglich die Inferiorität seiner Rechte belegten. Die übliche Drohung mit dem Entzug von Genehmigungen, auf die die andere Seite angewiesen ist, ist der Hebel, dem Souverän anzutragen, seinen Willen den Abhängigkeitsverhältnissen anzupassen und sich in der Ausübung seiner Hoheit auf das Interesse festzulegen, das man selbst verfolgt. Er soll in die Zumutung einwilligen, daß er sich mit einmal zugestandenen Befugnissen und Nutzungsrechten auch die dauerhafte Mitzuständigkeit seines Konkurrenten über die eigenen Verhältnisse ins Land geholt hat – und der nunmehr Rechnung tragen. Die vertragliche Kodifizierung des erreichten Standes der Abhängigkeit zielt darauf, eine Veränderung des Kräfteverhältnisses festzuschreiben, wie es sich als Resultat der zwischenstaatlichen Konkurrenz ergeben hat: Im selben Maß, in dem Staaten in dieser Einbußen an materiellen Potenzen ihrer Macht hinzunehmen haben, sollen sie sich in der Sphäre der zwischenstaatlichen Beziehungen dauerhaft zu der Relativierung ihrer Souveränität bekennen, die damit begründet sei. Sie sollen akzeptieren, daß ihre Freiheit zur Nutzung nationaler Potenzen ausweislich des Ergebnisses beim Wettbewerb unwiderruflich relativiert, dafür aber die Mitverfügung ihrer erfolgreichen Kollegen über diese etabliert ist – und sich von denen die Rolle zuweisen lassen, die sie infolgedessen im Konzert der Mächte nur noch zu spielen haben.
Daran arbeitet sich die deutsche Politik
beispielsweise in Europa ab. Unter Verweis auf die
Abhängigkeit, in der sich alle anderen europäischen
Nationen von der Fortsetzung des Erfolgsweges des
deutschen Geldes befinden, machen deutsche Politiker
Ernst damit, diese zu einer weitergehenden Unterordnung
ihrer Souveränität unter das deutsche Interesse zu
bewegen. Diplomatisch operieren sie dabei gemäß der
Logik, die ökonomischen Abhängigkeiten, die Deutschland
mit der Ankerwährung
DM in der EU bereits
gestiftet hat, begründeten einen deutschen Rechtsanspruch
gegenüber allen anderen, sich in ein wesentlich
deutsch bestimmtes Europa einzuordnen. Der
„undiplomatische“, d.h. absichtsvoll die anderen
EU-Staaten in ihrem Unwillen zu dieser
Unterordnung attackierende Spruch des deutschen Kanzlers
vom Frieden, der nur durch diese europäische Einheit zu
sichern sei, bezeugt allerdings auch die Frustration
einer Führungsmacht, die sich im Verlangen nach
Unterordnung ihrerseits von der entsprechenden
Bereitschaft der anderen abhängig weiß.
Daß es Deutschlands Politikern gelang, eine engere
Definition der „Maastrichtkriterien“ durchzusetzen,
feierten sie deshalb nicht nur als Erfolg in der Sache,
sondern auch als Bereitschaftserklärung der anderen
EU-Staaten, der verlangten Unterordnung Folge zu leisten.
Das ermuntert sie zu weiterem, und so verkünden sie ihren
fortbestehenden Willen, die übrigen Partner auch noch in
eine „Politische Union“ nach deutscher Lesart
hinzuregieren – und diese ihrerseits reagieren sehr
diplomatisch: Ihr Bekenntnis, bei „Europa“ mitmachen zu
wollen, also zur Gemeinsamkeit der europäischen
Sache, verbinden sie mit abweichenden Vorschlägen, den
Weg dorthin bzw. die Ausgestaltung der Union betreffend,
beharren also bei der Demonstration ihres Einigungswillen
ihrerseits auf dem Recht, als Souveräne über
Zustandekommen und endgültige Gestalt des neuen Europa
mitzuentscheiden.
In diesem Kontext bekommt der Streit zwischen der EU und Deutschland über die lächerlichen Subventionsbeträge für VW im deutschen Osten seine zweite, härtere Bedeutung. Eben die Einmischung in die nationale Subventionspolitik, die Deutschland sich jetzt seitens der EU verbittet, ist es, die Deutschland ausdrücklich als sein Recht gegenüber dem Rest von Europa beansprucht. Unter Berufung auf die in Europa hergestellten Abhängigkeiten spricht Deutschland etwa Italien unter dem Titel der dort wohl fälligen „Haushaltskonsolidierung“ das Recht auf weitere Subventionierung seiner notleidenden Industrien ab – und behält es sich für sich selbst zugleich vor, Industrieförderung nach dem Gesichtspunkt seiner nationalen Standortpolitik zu betreiben. Um die blühenden Fabriken in Sachsen geht es dabei durchaus: Sie sind der Testfall für die prinzipielle Frage, welche Macht da welchen anderen Rechte zugesteht und sie sich darüber unterzuordnen vermag.
Weil sie auf Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen den Staaten zielen, werden die eingerichteten Beziehungen zum Material für den fortwährenden diplomatischen Test auf die Gefügigkeit anderer Staaten: Am Stoff aller laufenden Affairen, aber auch getrennt davon wird geprüft, inwieweit die andere Gewalt grundsätzliche Bereitschaft zeigt, sich dem eigenen Interesse gemäß zu verhalten. Wie nahe sie dabei der Grundsatzfrage zwischen ihnen – es sind Gewalten, die sich da wechselweise untertan machen wollen – kommen und auch kommen wollen, macht ihre Kunst deutlich, Vorbehalte zu demonstrieren, die sie gegenüber dem Recht anderer Nationen hegen. Die Rechte und Mitzuständigkeiten, die ein Staat dem anderen einräumt, will er grundsätzlich nicht als Freibrief zur eigenmächtigen Ausnutzung der Konzession mißverstanden wissen; daher ist die fortwährende Erinnerung daran fällig, daß jedes gewährte Recht dem Vorbehalt der Genehmigung unterworfen bleibt – wozu die laufende Unterstreichung der eigenen Unbeeinflußbarkeit dient, mit der der Anspruch auf Unterwerfung unter hergestellte Abhängigkeiten zurückgewiesen wird, wie etwa von Großbritannien in der BSE-Frage. Mit Recht unterliegen alle Anträge, mit denen die Souveräne sich beglücken, dem Verdacht, daß es bei ihnen neben ihrem jeweiligen Inhalt schon auch ein wenig um die Klärung der heißen Frage geht, wie sich die Souveräne so als Mächte zueinander stellen. Staaten und ihre Vertreter haben ein sehr sicheres Gespür dafür, daß in dem Anspruch anderer Mächte auf Übereinkunft immer auch die Drohung steckt, sich die Sache mit dem Respekt vor dem Recht der anderen Gewalt auch einmal anders zu überlegen, wenn ihr anders nicht beizukommen ist. Jeder konkrete Streitpunkt, der zwischen ihnen aufkommt, kann deshalb zum Auslöser eines Streits um den Respekt werden, den man sich wechselseitig schuldet oder verweigert. Umgekehrt ist es für Staaten auch allergrößte Selbstverständlichkeit, Streitfälle erbittert auszutragen, bei denen es gleich um gar nichts anderes geht als um die Frage, inwieweit die eigene Gewalt im und vom anderen Land geachtet wird. So arbeitet sich die Diplomatie in ganz vielen Verrenkungen und an unendlich vielen Stoffen, aus denen sie Beziehungen flicht, mühselig daran ab, die Schranke, die die fremde Souveränität für das eigene Interesse darstellt, als Hindernis für die eigenen Belange möglichst außer Kraft zu setzen, um sie nur umso besser als Hebel für das eigene Interesse zu instrumentalisieren – und ihre auftraggebenden Staaten ziehen dann auf eine ziemlich abstrakte und schlichte Manier die Zwischensumme aller ihrer Anstrengungen:
4. „Der Stand der Beziehungen“
Im ständigen Beurteilen dessen, was andere Gewalten im
Verhältnis zum eigenen Interesse so treiben, wieweit sie
sich ihm fügen oder sich widersetzen, wird die Gesamtheit
der Beziehungen, die Staaten miteinander pflegen, einer
eigenständigen Bewertung unterzogen. Neben ihren
jeweiligen Kalkulationen mit Nutzen und Nachteilen, die
ihnen der Verkehr mit anderen Staaten einträgt, auch
neben den Verhandlungen über diese oder jene
Materie legen sich die Staaten ein Urteil darüber zu, wie
es mit der Interessenslage ihrer Verhandlungspartner im
Verhältnis zur eigenen überhaupt bestellt ist,
welcher Grad grundsätzlicher Übereinstimmung oder
Mißbilligung zwischen ihnen als Machthabern herrscht. Sie
halten fest, wie sich der andere Staat zu den Resultaten
ihrer Beziehungen stellt und mit ihnen
umgeht, und fassen das Ergebnis ihres
Bilanzierens im Stand der Beziehungen zusammen,
der dann zwischen beiden Seiten gegeben ist: Der
resümiert, inwieweit ein Kontrahent sich mit seinem
Interesse an Unterordnung, also sein Recht gegen
das der anderen durchgesetzt hat, inwieweit diese sich
alle hergestellten Abhängigkeitsbeziehungen gefallen
lassen, sie womöglich gar als Lage
akzeptieren,
die ihr künftiges Handeln bestimmt. Oder inwieweit sie
dies eben nur bedingt oder gar nicht tun und mit
ihrem Rechtsstandpunkt dem eigenen im Weg
stehen.[20]
Das leitende staatliche Erkenntnisinteresse, wie es um
die Fügsamkeit und Verläßlichkeit des
außenpolitischen Partners bestellt sei, setzt alle Formen
des praktischen wie diplomatischen Umgangs mit ihm zum
Indiz für die grundsätzliche Verfassung der
herrschenden Beziehungen herab – worüber der formelle
Kodex ihrer Abwicklung dann wieder auf seine Weise
Auskunft erteilt. In den besonderen Formen, in denen
Meinungsaustausch gepflegt wird, in denen Mitteilungen
überbracht, Konsultationen nahegelegt und Informationen
ausgetauscht werden, findet seinen Niederschlag, wie das
Prüfungsergebnis bezüglich des Respektsverhältnisses zum
anderen Souverän gerade ausfällt. Affige Posen bezeugter
Ehrerbietung, herziges Küssen und Händchenhalten, aber
auch ausgesuchte Flegelei und Schroffheit haben da
Bedeutung, nämlich die der Kundgabe, wie die
vorliegende Bilanz von Übereinstimmung und Differenz der
Staatsinteressen von der jeweiligen Seite
bewertet wird. Solchen Botschaften hat der
Adressat dann zu entnehmen, wie wichtig sein
Kontrahent eine aktuelle Streitfrage nimmt; welche
Bedeutung er ihr im allgemeinen
zwischenstaatlichen Verhältnis zuweist; wie sehr es ihm
überhaupt noch um wechselseitiges Einvernehmen
geht und zu welchen Übergängen der
Konfliktbeilegung
er sich hinreißen lassen
könnte – kurz: wie sehr er mit und wegen der
laufenden Beziehungen dorthin geraten ist, sich an dem
Rechtsverhältnis selbst zu reiben, das die
Souveräne zwischen sich etabliert haben.[21]
Weil die Staaten laufend Maßnahmen ergreifen, die dem
anderen nicht passen, also immerzu aneinandergeraten, muß
der Stand der Beziehungen fortlaufend neu bilanziert
werden – am besten bei Staatsbesuchen und Konferenzen auf
höchster Ebene
, bei denen die Auslotung der
Beziehungslage oft auch der einzige Zweck der
Zusammenkunft ist. Vor allem dann, wenn die beteiligten
Staaten viel gemeinsam zu regeln haben, weil sie auf
vielen Feldern Gegensätzliches treiben, ist der
Meinungsaustausch
darüber besonders wichtig,
inwieweit die Affairen, die man miteinander hat, das
Prinzip stören, Streitfälle grundsätzlich einvernehmlich,
unter Anerkennung des Rechtsstandpunktes der anderen
Seite zu regeln.[22]
Sofern letzteres der Fall ist und bleibt, dürfen sich
Staaten guter Beziehungen
rühmen. Vorläufig
jedenfalls und nur für den Moment, denn sie selbst wissen
schon ganz genau, wie es um deren Haltbarkeit bestellt
ist – es ist ja alles, was sie in und mit diesen treiben,
dazu angetan, die Harmonie ihrer Rechtsstandpunkte zu
untergraben, die sie zum Prädikat des Status quo
zwischen ihnen erklären. Daher legen sie – im Normalfall
– ganz besonderen Wert darauf, die Austragung ihrer
diversen Gegensätze immer in den Dienst an der Wahrung
des Gütezustands ihres Verhältnisses zu stellen: Auch ein
Deutschland, das sich aus seinen gewachsenen Machtmitteln
die Rechte zur Unterordnung Europas herleitet, widmet
sein Ansinnen nichts Geringerem als dem Ausbau aller
guten Beziehungen
, die in der Union herrschen.
Notwendig aber ist das nicht, und manchmal gebietet das
nationale Interesse durchaus die Inkaufnahme einer
Verschlechterung der Beziehungen
. Mit dieser
stehenden Redeweise bezieht sich die Diplomatie auf ihren
allerersten Ausgangspunkt, um die Mitteilung loszuwerden,
auf die es dem betreffenden Staat hier ankommt: Sie macht
die Bedingtheit deutlich, der der Respekt vor
dem anderen Souverän und seinen Rechten unterliegt, indem
sie in Erinnerung bringt, daß er ein Akt staatlicher
Gewährung ist und bleibt. Sie schert aus
dem Prinzip der prinzipiellen Gleich-Berechtigung von
Partnern, der Konkurrenz von zwischenstaatlichen
Rechtspositionen aus und bringt statt dessen das
unbedingte Recht der eigenen Souveränität als
Grundlage eines jeden weiteren Verkehrs mit ihrer
Konkurrenz in Erinnerung. Sie macht eine Frage
zur Prinzipienfrage, indem sie sie
anders aufwirft, nämlich nicht vom Standpunkt
eines Willens aus, der sich auf Einigung festgelegt weiß.
Vielmehr in der undiplomatischen
, gewissermaßen
waldursprünglichen Manier, wie sie einem Interesse
gebührt, das eine Nation zu ihren unbedingten
Rechten zählt.
Hierin liegt die dritte, heikelste Bedeutung des deutschen Vorgehens in der Frage der Subventionen für die deutsche Osteroberung. Die deutschen Politiker legen kurzerhand einen Vertrag so aus, als ob die herrschende Rechtslage in der europäischen Union dasselbe wäre wie ein Auftrag zur Bedienung exklusiv deutscher Interessen. Sie demontieren damit ganz nebenbei die demokratische Legitimität der EU-Kommission in Brüssel, indem sie mit der Wahrnehmung ihres deutschen Rechtsstandpunkts das ganze politische Entscheidungsverfahren aushebeln, auf das sich die europäischen Unionsmitglieder geeinigt haben – und provozieren durch beides deren Nachfrage, ob sie das deutsche Vorgehen nun als einseitige Kündigung des EU-Rechtszustands auffassen sollen oder nicht. Von deutscher Seite mit der recht grundsätzlichen Frage konfrontiert, wieviel praktisches Gewicht denn ihre Souveränität überhaupt hat, in der sie als Mitgestalter der EU gleichwohl nach wie vor anerkannt sind, haben sie sich ihre Antwort darauf zu überlegen. Von der, also davon, ob und wie sie selbst diese Prinzipienfrage zur prinzipiellen Frage ihrer Souveränität aufwerten oder sie lieber konstruktiv ignorieren wollen, hängt dann ab, wie gut demnächst die Beziehungen in Europa werden.
Einen Schritt weiter als die Deutschen in Europa sind die
USA bei ihrer Aufkündigung des Prinzips einer
wechselseitigen Achtung nationaler Rechtsstandpunkte
gegangen. Zwischen dieser Weltmacht und ihrer
europäischen Konkurrenz sind die Beziehungen
ausgesprochen schlecht, seitdem die USA in der
Frage des Handels mit Terroristenstaaten
Fakten
gesetzt haben. Sie haben beschlossen, ihrem Verlangen
nach weltpolitischer Exkommunikation einiger Staaten die
Form eines nationalen Gesetzes zu
geben, mit dem ausländische Firmen für Geschäfte
mit den betreffenden Ländern bestraft
werden
sollen. Sie haben damit absichtsvoll die Grundregel der
Diplomatie außer Kraft gesetzt, sich beim Ergreifen von
Maßnahmen gegen andere Souveräne mit diesen in
einvernehmliches Benehmen zu setzen – und damit
ihr Recht gegen und über alle Beziehungen und
Rechte gestellt, die die imperialistische Konkurrenz in
ihrem Verhältnis mit den inkriminierten Staaten wahren.
Die darüber eingeleitete Verschlechterung der
Beziehungen
zwischen sich und Europa nehmen die USA
bewußt in Kauf. Sie sehen die Sache so, daß die Europäer
daran schuld sind, weil sie sich vorherigen Bemühungen
zur diplomatischen Herstellung eines Konsenses nach
US-Lesart nicht gefügt haben. Wie weit diese
Verschlechterung geht, hängt auch in diesem Fall von der
europäischen Reaktion ab; davon, ob einseitig
Gegenmaßnahmen und ein bißchen Handelskrieg angedroht
werden; oder ob man sich lieber auf die gemeinsamen
Regeln der WTO beruft und den fortbestehenden eigenen
Willen zur Einhaltung bestehender Verfahrensprinzipien,
also zu guten Beziehungen
dokumentiert. Der
transatlantische Partner hat vorsorglich seine
diplomatische Verhandlungsposition schon verlautbart und
wissen lassen, daß er sich an einen zu seinen Ungunsten
gefällten Schiedsspruch nach WTO-„Recht“ nicht gebunden
weiß.
III. Die internationale Streitkultur und ihre Kontinuität. Eine Kette von Konflikten, die zuerst angezettelt und dann vorläufig beigelegt werden…
Nationen haben allen Grund, ununterbrochen Buch zu führen über den Stand der Beziehungen, die sie nach allen Himmelsrichtungen hin unterhalten. Und sie tun auch gut daran, zur Pflege ihrer Beziehungen einigen Aufwand zu treiben. Durch die Prüfung und Bestätigung des Vertrauens, das zwischen ihnen „herrscht“, versichern sie sich ihrer Bereitschaft, die aus ihrer Konkurrenz erwachsenden Gegensätze in lauter Fragen der Zusammenarbeit zu übersetzen. Ihre widerstreitenden Interessen erachten sie prinzipiell für vereinbar, sich für kompromißfähig und -willig, sooft in Briefwechseln, Konsultationen und anläßlich von Staatsbesuchen gute Beziehungen, ein ausgezeichnetes Klima und persönliche Wertschätzung zwischen den Regierungschefs vermeldet werden.
Frohe Botschaften dieser Art halten Regierungen allemal für angemessen, wenn sich zwischen ihren Nationen über längere Zeit ein gedeihlicher Handel eingespielt hat, der sich in guten Bilanzen niederschlägt; auch gemeinsame Interessen gegenüber Dritten, zumal in Gewaltfragen, stiften jenes herzliche Einvernehmen, von dem in den Kommuniqués wie von einem Tatbestand die Rede ist, der unabhängig vom Zutun derer existiert, die da konferieren. Allerdings ist die Bekräftigung solider Beziehungen nicht immer Ausdruck einer rundum gelungenen Partnerschaft und Index der Zufriedenheit darüber, daß die Anliegen der einen Nation zum festen Bestandteil in den Rechnungen der anderen geworden sind. Häufig beschwört die Rede von den („unverändert“) guten Beziehungen schlicht die Notwendigkeit ihrer Fortsetzung angesichts und trotz erheblicher Differenzen, die in der gerade verhandelten Sache zutage getreten sind. Dann nimmt sich die Kunde vom „Stand“ wie ein Imperativ an die eigene und andere Seite aus, wegen der eröffneten Gegensätze die nützlichen Abhängigkeiten, auf die sich die Partner eingelassen haben, nicht zu vernachlässigen.
Die Vermeidung von Störfällen
gehört zum diplomatischen Gewerbe wie der Katastrophenplan zum Atomkraftwerk. Alle „Gegenstände“, über die Staaten kontrahieren, so daß sie zu Partnern werden, interessieren sie schließlich als Mittel der Konkurrenz. Vom Zollabkommen bis zum Abrüstungsvertrag geht es um das wechselseitige Zugeständnis von Rechten, deren Wahrnehmung auf die Mehrung der nationalen Macht berechnet ist. Und so wenig sich Staaten darauf verlegen, das von anderen erzielte Wirtschaftswachstum als Erfolg zu verbuchen, der ihre eigene mißratene Bilanz kompensiert, so geläufig ist ihnen schon gleich der polemische Charakter ihres Gewaltapparats. Deswegen wissen sich die Diplomaten aller Herren Länder nicht nur beauftragt, die Interessen ihres Landes zu vertreten – vertraut ist ihnen auch die Aufgabe, jeden Bedarf ihrer Nation mit einem Dementi anzumelden: Kein Antrag, mit dem sie den internationalen Verkehr nützlicher für ihr Vaterland gestalten wollen, kommt ohne den Hinweis aus, daß er sich gegen niemanden richte; jede Korrektur an den überkommenen Abmachungen wird um des eigenen Vorteils willen angestrengt – und mit der Beteuerung vorgetragen, nicht auf den Nachteil der Partner berechnet zu sein. Stets triefen die Vorschläge zur Veränderung des ‚status quo ante‘ vor Heuchelei – des Inhalts, daß die legitimen Interessen der anderen Seite nach wie vor ge- und beachtet werden, daß jedenfalls „die Beziehungen“ als die alten, guten erhalten bleiben.
Bei diesem Bemühen um Kontinuität ist freilich nicht zu übersehen, daß Diplomaten, vom Botschafter bis zum Außenminister, ihren respektvollen Umgang mit dem Ausland immer auch sehr anmaßend abwickeln. Darin geübt, den von ihnen und ihren Vorgängern ausgehandelten Verkehr mit anderen Nationen kritisch zu messen – nämlich daran, welche Veränderung die eigene Macht erfährt – befinden sie stets auch darüber, was der übrigen Staatenwelt zusteht. Sie sind dauernd damit befaßt, die „legitimen Interessen“ der anderen Souveräne zu definieren, wenn sie sie berücksichtigen. Daß die Potenzen ihres Staates nur so viel taugen, wie sie im Verhältnis zu denen der anderen hergeben, ist diesen Kunsthandwerkern des Imperialismus eben kein Geheimnis.
Die Erzeugung von Störfällen,
die bewußt herbeigeführte Beeinträchtigung „guter Beziehungen“, ihre ausdrückliche Verweigerung hat also auch noch ihren festen Platz im diplomatischen Gewerbe. Wenn die Charaktermasken der Außenpolitik dem ‚status quo‘ die Botschaft ablauschen, daß er eine unerträgliche Einschränkung der eigenen Machtmittel mit sich bringt; wenn sie an den Fortschritten, die andere Nationen machen, gewahren, daß eine Veränderung des Kräfteverhältnisses eingetreten ist oder droht – dann verlegen sie sich auf eine „undiplomatische“ Form des diplomatischen Verkehrs. Vom Standpunkt des verletzten oder bedrohten Rechts ihrer Nation aus rechnen sie dem Ausland vor, was es nicht darf. Mit grundsätzlichen Vorbehalten gegen das Recht auswärtiger Souveräne beantragen sie eine Beschränkung von deren Befugnissen; dabei wahren sie die Form des diplomatischen Procedere nur noch darin, daß sie die Zustimmung des Adressaten ihrer Wünsche verlangen. Die Sache, zu der sich ein anderer Souverän herbeilassen soll, hat in solchen Fällen den Charakter einer Schuld, die es einzugestehen gilt. Praktisch wird er aufgefordert, einen als Unrecht klassifizierten Gebrauch seiner Souveränität aufzugeben.
Am nachhaltigsten wird das Anerkennungsverhältnis zwischen Nationen strapaziert, wenn ein Staat territoriale Ansprüche gegenüber seinen Nachbarn geltend macht. Die Unzufriedenheit mit der politischen Landkarte, der Anspruch auf die hoheitliche Zuständigkeit für einen Volksteil, den es unter die Fuchtel eines falschen Souveräns verschlagen hat, ist ein einziger Sprengsatz für das friedliche Kooperieren zwischen den Nationen; bisweilen kommt ein geregeltes diplomatisches Schachern deshalb gar nicht erst zustande. Die Bundesrepublik Deutschland hat auf diesem Feld jahrzehntelang Vorbildliches geleistet, eine Diplomatie der Nicht-Anerkennung wie der bedingten Aufnahme von Beziehungen betrieben – und besteht auch heute noch gegenüber einigen Nachbarn auf der Begleichung offener Rechnungen, wobei sie manche Störung für den ansonsten erwünschten zwischenstaatlichen Betrieb hervorruft.
Am Beispiel Deutschlands – analoge Fälle kleineren und größeren Kalibers sind in der Ägäis, in Lateinamerika, in Mittel- und Fernost… zu besichtigen – läßt sich auch studieren, welche Rolle die Geschichte für den Verkehr zwischen den Völkern spielt. Weit davon entfernt, eine „von Klassenkämpfen“ zu sein, fungiert sie als Quelle des Rechts, das sich Souveräne erteilen und anderen vorhalten. Während der Auf- und Ausbau nützlicher Beziehungen zwischen Staaten die Anerkennung der bestehenden Grenzen gebietet, lehrt die Geschichte etwas anderes: Die Veränderungen, die die Reichweite ein- und derselben Staatsmacht in der Zeit und durch ihre Waffengänge erfahren hat. verlangen von dabei zu kurz gekommenen Souveränen die Wiederherstellung der alten Proportionen von Volk und Raum.
Ebenso wie ein gestandener Revisionismus bereichert auch
eine fundamentalistische Kritik am Wirken auswärtiger
Herrschaft die diplomatische Szenerie um manchen
Dauerkrach. Mit dem Gebot, gefälligst
Demokratie & Marktwirtschaft
zu praktizieren,
ergänzen gewisse Nationen ihren prinzipiellen
Respekt vor dem Gewaltmonopol anderer Souveräne
um deren ebenso prinzipielle Ächtung. Dieses
Nebeneinander hat die Kommunikation zwischen Ost und West
im jahrzehntelangen „Kalten Krieg“ bestimmt, die
Fragwürdigkeit eines vom Osten extra beantragten status
quo namens „friedliche Koexistenz“ unterstrichen, weil
für unerwünscht erklärt – und nicht nur den Insidern des
diplomatischen Betriebs war geläufig, daß ihr
Reden
dem für fällig erachteten Schießen
gewidmet war. Die organisierte Heuchelei dieser Epoche
hat es so weit gebracht, die per Diplomatie ein ums
andere Mal erstrittene Vertagung des großen Schießens
„Sicherung des Weltfriedens“ zu taufen. Ansonsten mußte
intensiv über Verlauf und Ergebnisse der während dieses
Zustands weltweit ausgetragenen Kriege gar nicht geringen
Formats verhandelt werden.
Bis auf den heutigen Tag ist nicht recht klar, welche Diplomaten den Weltfrieden eigentlich gerettet haben. Wahrscheinlich gebührt der Preis der Rüstungsdiplomatie. Dieses Fach besteht in der Kunst, die „Sicherheitsbedürfnisse“ der anderen Seite einerseits für legitim zu halten, andererseits nicht. Mit den Erkenntnissen ihrer Spionage ausgestattet, machen sich die Unterhändler beider Lager daran, einander den Willen zum Krieg vorzuhalten. Aber nicht einfach so, sondern als eine Bereitschaft, die aus der in Waffen und Soldaten präsenten Fähigkeit zum Krieg abzulesen ist. Diese Großveranstaltung, in der sich die feindlichen Parteien die Vergleiche zwischen ihren Kriegspotentialen um die Ohren schlugen, war dringend erforderlich, um den Feind kalkulierbar zu machen, also für die auf Hochtouren laufende Kriegsvorbereitung – jedenfalls auf der westlichen Seite. Und die Weltöffentlichkeit wurde mit lauter ideologischen Sprachdenkmälern über die Strategien und Szenarien des großen Showdown bekannt gemacht.
Die Aufgabe, per Diplomatie die Beschränkung der Befugnisse anderer Staaten zu erwirken, also mit Diktaten anzurücken, die durch Drohungen überzeugen sollen, welche ihnen zur Seite gestellt werden – das schlichte Dringen auf Gehorsam eben, wird schließlich auch noch erledigt. Dieser Manier, dem internationalen Recht auf die Sprünge zu helfen, liegt erstens das Urteil zugrunde, daß gewisse Staaten sich Dinge anmaßen, die ihnen nicht zustehen. Manche legen sich z.B. Waffen zu, atomare sogar, um sich in Sachen „äußere Sicherheit“ besser zu stellen; andere mischen sich in Auseinandersetzungen in ihrer Nachbarschaft ein und die Kräfteverhältnisse einer Region auf. Dann handelt es sich nicht nur um keine Demokraten, sondern um Terroristen. Daß hinter solchen Definitionen der Diplomatie jede Menge Gewalt lauert und kein Frieden ausgerufen wird, ist offenkundig. Zweitens beruhen solche Affären nämlich darauf, daß da eine überlegene Staatsgewalt den projektierten oder vollzogenen Zuwachs an fremder Macht nicht duldet und sich zum Richter aufschwingt, der jeden solchen Versuch strikt verurteilt. Nach dem Muster des Strafrechts wird gerade heute, nach der endgültigen Sicherung des Weltfriedens, gerne Politik gemacht. Dem Versuch zahlreicher Souveräne, sich die Mittel zu beschaffen und sich derselben Techniken der Einflußnahme zu bedienen, die in einigen Metropolen ein beträchtliches „Gewicht in der Weltpolitik“ zustandekommen ließen, wird da energisch entgegengetreten. Auf „gute Beziehungen“ zu denen, die mit einem Verbot beglückt werden, kommt es dabei überhaupt nicht an.
Dafür haben die Diplomaten der wenigen Nationen an der
Spitze der Staatenhierarchie alle Hände voll zu tun, um
ihre guten Beziehungen untereinander zu erhalten. Denn
unter diesen ökonomischen und militärischen Partnern hat
die Konkurrenz nicht aufgehört, die sich dank
„Globalisierung“ auf die Benutzung der ganzen Staatenwelt
richtet. Und bei der Erschließung von „Märkten“ wie bei
der dafür erforderlichen Zusammenarbeit mit den Herren
Souveränen kommt auch Überwindung des schnöden
Kolonialismus die Ausschließlichkeit zu ihrem
Recht, die der nationale Zugriff aufs Ausland so
mit sich führt. So haben die Diplomaten so mancher
Großmacht immer öfter Gelegenheit, einen von den USA
geächteten Souverän gar nicht so schlimm zu finden, sich
von den USA zu distanzieren und gleichzeitig
unverbrüchliche Freundschaft zu versichern. Die
Beziehungen unter den Großmächten müssen – NATO hin, G7
her – dauernd ein wenig gepflegt werden; sei es wegen
Jugoslawien, für das sie sich alle gleichberechtigt, aber
gar nicht so einig in der Sache zuständig wissen; sei es
wegen Cuba, China, Iran, Irak, Türkei, Beirut etc. etc.
Und mit der höchstförmlichen Einschwörung eines ganzen
Wirtschaftsgipfels auf „Terrorismus“ ist noch ganz viel
offen. Aber offene Fragen
sind schließlich die nie
versiegende Quelle, von der das diplomatische Handwerk
lebt, weil es sie aufwirft…
Die UNO, das Völkerrecht, die Völkergemeinschaft…
Ob die UNO einer konkurrierenden Staatenwelt gerade noch gefehlt hat, ist zu bezweifeln. Wo Nationen unablässig damit beschäftigt sind, einander ihre Rechte zu bestreiten; wo sie jedes einander einmal zugestandene Recht als Instrument für seine Korrektur handhaben, mutet das Bedürfnis nach einem weltweiten „Rechtszustand“ etwas seltsam an. Daß nach einem Weltkrieg, der so heißt, weil die Macht auf dem Globus gewaltsam neu verteilt wurde, in der Staatenwelt eine tiefe Sehnsucht nach der endgültigen Festschreibung des status quo ausgebrochen wäre, läßt sich auch nicht behaupten. Im Gegenteil – die großen Teilnehmer des Krieges wußten gleich ganz große Affären, die zur Revision der Lage anstanden. Und ganz viele kleine Souveräne meldeten ihren Bedarf an, manche wollten auf Kosten anderer erst noch souverän werden; an kriegerischer Gewalt war viel unterwegs.
Der Beschluß, eine UNO aufzumachen, war denn auch ein bißchen anders gemeint. Die Konkurrenz der Nationen sollte nicht beendet werden, sondern kontrolliert stattfinden. Die Erfindung verdankt sich dem Bedürfnis einer Großmacht und ihrer halbwegs potent gebliebenen Partner, den weltweit verfügten Umgang mit Geld sowie die anstehenden Gewaltfragen einigen verläßlichen Regeln zu unterwerfen, nach denen die Staaten ihren Verkehr abzuwickeln hatten. Daß der Anti-Kommunismus in Gestalt von Menschenrechten für den innerstaatlichen Benimm gleich mit zum Zuge kam, war für die Erfinder sehr wichtig. Die per NATO angetragene Feindschaft hatte so gleich ihren festen Platz unter der Kuppel des Zirkus, in dem sich seitdem unvereinbare Interessen aller Nationen unter Berufung auf ein Völkerrecht vortragen, dem alle verpflichtet sind.
Der bis heute aufrechterhaltenen Fiktion, daß sich Nationen nur das herausnehmen, was sie nach Maßgabe einer über ihnen stehenden Geschäftsordnung dürfen, wurde energisch Rechnung getragen. Angesichts der Tatsache, daß die Weltmächte sowieso alles etwas anging, was die übrigen Staaten so treiben, wurden auch alle Nationen geladen, um auf diesem Forum gleichberechtigt ihre Schadensmeldungen einzureichen und sich ihre Rechte vorlesen zu lassen – die Ausnahmen der ersten Stunde wurden nach und nach geregelt. Zugleich wurde eingedenk des Verhältnisses von Recht und Macht der Idealismus der von gemeinsamem Geist beflügelten Vollversammlung, die über erlaubte und verbotene Taten der Nationen zu richten befugt war, um ein bißchen Realismus ergänzt und ein Weltsicherheitsrat eingerichtet. Der sollte auch richten, vor allem über die härteren Konflikte. Gerade die aber ließen es geraten erscheinen, den etwas gleicheren unter der Völkerfamilie ein Veto-Recht einzuräumen.
Davon wurde auch ausgiebig Gebrauch gemacht; und die Fiktion einer übergeordneten Instanz, die als Schlichter in Aktion tritt, wurde oft genug blamiert. Auch die Urteile der Vollversammlung mit ihren sauber durchgezählten Resolutionen haben es nicht zu jener Verbindlichkeit gebracht, die Gerichtsentscheiden im Innern von Nationen so eignet. Die USA und ihnen verbundene Nationen haben es am häufigsten geschafft, auf die Mehrheitsbeschlüsse des sowieso zerstrittenen Gerichts zu pfeifen. Seinen letzten Höhepunkt hat das chronische Mißverhältnis von Schein und Sein in der Betreuung des Jugoslawien-Krieges erlebt, als ein paar Wochen lang die UNO allen Ernstes zur Aufsichtsmacht ernannt worden war, die sich der Macht real existierender Staatsgewalten „bedienen“ sollte – bis die USA die Sache wieder selbst als NATO-Führungsmacht in die Hand genommen haben.
Und dennoch – so ganz für überflüssig hat die UNO von den vielen Staatenlenkern noch keiner erklärt, auch wenn ihre Entschließungen den einen nichts nützen und von den anderen mißachtet werden. Letztere, vor allem die USA, sind noch am ehesten auf dem Sprung dahin, das ganze Getöber für ein untaugliches Instrument zu halten – gelegentlich gefällt es ihnen aber auch nach Jahren der Beitragszurückhaltung, die Sache der USA mit dem Siegel der weltweiten Billigung zu versehen. Ihren Irak-Krieg ließen sie als Auftrag der vereinigten Völker absegnen und das Atomverbot, das es gegen Korea und andere durchzusetzen gilt, macht sich als Vollzug einer internationalen Behörde ganz gut.
Damit ist nicht der verlogene „Eindruck“ gemeint, den eine Weltmacht schindet, sooft sie ihren Nationalismus als eine einzige Grußadresse ans Völkerrecht verkauft – die deutsche Politik versteht sich seit der Dichtung des Grundgesetzes, mit ihrer Demokratie und ihrer Geschichte, ebenfalls bestens auf diese Masche.
Die eigentümliche Leistung der UNO – und der ihr angegliederten internationalen Organisationen – liegt in dem Dienst, den sie als ständig geöffnete diplomatische Börse gewährt. In einer Staatenwelt, deren „Mitglieder“ ein universelles Interesse geltend machen, also in sämtlichen eingezäunten Erdenwinkeln mit ihrem Geld und ihrem Einfluß tätig sind; in einem Konkurrenzkampf, durch den jede Nation von den Unternehmungen jeder anderen auf jedem Meridian „betroffen“ ist, kommt es sehr auf die diplomatischen Beziehungen an – immer und nach allen Seiten. In Erfahrung gebracht wird in den Institutionen des kapitalistischen Internationalismus, auch bei albernen Resolutionen, wie sich die restlichen Souveräne zu den eigenen Vorhaben stellen; welche Vorbehalte und Hindernisse von ihnen zu gewärtigen sind, auf welchen Grad der Billigung und Unterstützung man rechnen kann. Und wenn einem Außenminister nach der Rede vor der Vollversammlung die Diskussion der Völkergemeinschaft egal ist, weil da wieder ein paar Entwicklungsländer unter Anrufung des Völkerrechts nach Gerechtigkeit seufzen – New York ist immer mal eine Reise wert. Dann benutzt man den UNO-Besuch für die bilateralen Kontakte, auf die es gerade ankommt – die benötigten Kontaktpersonen treiben sich da nämlich herum…
Die Leistungen der Diplomatie
Der Aufwand für das diplomatische Corps, für die Reisetätigkeit des Außenministers, für die Ausrichtung von Gipfeltreffen samt Gattinnen – er lohnt sich nicht. Er ist nämlich notwendig. Das Erkunden und Taxieren der Fähigkeiten anderer Nationen, der Test darauf, welchen Gebrauch sie von ihren Potenzen machen wollen, ist erforderlich, um den Einsatz der eigenen Machtmittel zu kalkulieren. Daß der Erfolg einer Nation nicht aus den Geschick erwächst, das Diplomaten bei der Handhabung des diplomatischen Codex und der UNO-Geschäftsordnung an den Tag legen, wissen die Kundschafter selbst am besten. Und diplomatische Erfolge sind ihnen bei allem Stolz als Leistungen vertraut, zu denen sie die Industrie und die Gewehrläufe ihres Vaterlandes befähigen. Die Übersetzung der nationalen Interessen in schieren Internationalismus ist wie jede Heuchelei eine Frage der Übung. Wenn sie beides für dasselbe halten, liegen sie sogar richtig.
[1] Zur Vergegenwärtigung der Funktion der Gewalt und ihrer Monopolisierung als Geburtshelfer aller Staatlichkeit liefert die „Weltgeschichte“ gerade in ihrer jüngeren Abteilung die schönsten Beispiele. Alle gelaufenen oder noch laufenden Projekte einer Staatsgründung machen nämlich – positiv wie negativ – deutlich, woran die ganze erstrebte (Eigen-)Staatlichkeit in jedem einzelnen Fall hängt. Es muß ja nicht immer – wie auf dem Balkan – gleich die positive Produktivkraft des Terrors sein, mit dem eine Partei im Bürgerkrieg die andere siegreich überzieht und damit die Machtfrage für sich entscheidet; aber immer ist es allein diese Entscheidung, ist es die praktische Erledigung der Konkurrenz um die Monopolisierung der Gewalt, die den Grundstein einer neuen Staatlichkeit legt und die aus einem bloßen Willen zur Herrschaft einen Staat macht, der aus eigener Machtvollkommenheit herrscht. Negativ ist dies an der Verfassung der zur Zeit auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion anzutreffenden staatlichen Neugründungen zu studieren. Die können für sich zwar wegen der besonderen Erbschaftsregelung, auf die sie sich beim Zerlegen der sowjetischen Staatsmacht einigten, allesamt Souveränität beanspruchen, selbige aber in keinem Fall so recht ausüben – weil eben der entscheidende Gründungsakt eines Staates, die Klärung der Machtfrage und die Etablierung eines gesicherten Gewaltmonopols, noch gar nicht vollzogen wurde.
[2] In den vielen
Grenzfragen
, die sie gegeneinander aufwerfen,
machen die Gewaltmonopolisten deutlich, wie schwer
ihnen allein ihre Ko-Existenz fällt. Schon die
Reichweite ihrer Gewalt, die banale räumliche
Ausdehnung des Staatsterritoriums, ist zwischen ihnen
alles andere als selbstverständlich. Die Frage, bis
wohin sich ihre Macht ausdehnen und behaupten
kann, fällt für sie damit zusammen, wen sie als
Macht, die der ihren Grenzen zieht, hinnehmen
müssen, steht also grundsätzlich polemisch gegen
alle zufälligen, historisch überkommenen oder wie auch
immer gesetzten Grenzen.
[3] Mit Verweis auf das zwischen Staaten waltende Prinzip, nur sich als höchste Gewalten, zwischen sich daher nur Fragen zu kennen, die solche des Streits zwischen Gewalten sind, erledigte Hegel die philanthropische Idylle eines „ewigen Friedens“. Der alte Philosoph störte sich an aller sachfremden Schönfärberei, weil seine Apologie der Gewalt eben ganz der Sache selbst galt: „Die Kantische Vorstellung eines ewigen Friedens durch einen Staatenbund, welcher jeden Streit schlichtete und als eine von jedem einzelnen Staate anerkannte Macht jede Mißhelligkeit beilegte und damit die Entscheidung durch Krieg unmöglich machte, setzt die Einstimmung der Staaten voraus, welche auf moralischen, religiösen oder welchen Gründen und Rücksichten, überhaupt immer auf besonderen souveränen Willen beruhte und dadurch mit Zufälligkeit behaftet bliebe… Der Streit der Staaten kann deswegen, insofern die besonderen Willen keine Übereinkunft finden, nur durch Krieg entschieden werden.“ (Grundlinien der Philosophie des Rechts, §§ 333 f.)
[4] Groß geworden sind die Konkurrenten ohnehin in einer Epoche ihres Imperialismus, die sie zum Zwecke ihrer Distanzierung von ihrem heutigen Treiben eigens so nennen, weil sie sich in der nur mit Gewalt die Sphären ihres exklusiven Zugriffs erobert hatten. Da haben sie gar nicht groß bei irgendwelchen Machthabern nachgefragt, ob die ihre heimische Produktion nicht auch aufs Geldverdienen umstellen und sich so dem einzigen Prinzip des Reichtums zur Verfügung stellen möchten, das sie gelten lassen: Sie haben ihr Expeditionskorps vorbeigeschickt, ihre Statthalter eingesetzt und sich aus ihren Kolonien einfach genommen, was für das Wachstum ihres Reichtums zu brauchen war.
[5] Daher sind neue
Staatsgründungen zuallererst darauf aus, von
ihresgleichen Anerkennung zu erfahren. In ihr wird
nämlich nicht bloß ein irgendwie gegebener Zustand der
Machtverteilung auf der Welt bestätigt,
sondern eine neue Lage geschaffen. Ohne den
förmlichen Akt ihrer Anerkennung wären die staatlichen
Zerfallsprodukte Jugoslawiens oder der UdSSR ewig
Gebilde
einer quasi un- bzw. vor-staatlichen Art
geblieben – erst als anerkannte Staaten sind sie
Subjekte, mit denen überhaupt politisch in Verkehr zu
treten geht.
[6] Wie kompliziert sich
zwischenstaatliche Beziehungen gestalten, wenn einer
der Beteiligten dem anderen dessen Anerkennung
verweigert und trotzdem Wege finden will, seinen Willen
ihm gegenüber geltend zu machen, hat die BRD mit ihrer
Konstruktion eines besonderen deutsch-deutschen
Verhältnisses
vorgeführt. Mit der Weigerung, die
DDR anzuerkennen, hat sich die BRD das Recht auf
gewaltsame Revision praktisch gültiger Grenzen
reserviert. Sie hat vom
Alleinvertretungsanspruch
in den 50er Jahren
über den Grundlagenvertrag
bis hin zum
Honecker-Besuch 1987 unbeirrt an ihrem Rechtsstandpunkt
festgehalten, daß ihre Hoheit für das
DDR-Territorium zuständig sei, es die DDR als
Staat folglich nicht gibt.
Deshalb durfte keine der Beziehungen, die man
gleichwohl mit diesem Staat wollte, die Form einer
sonst üblichen zwischenstaatlicher Normalität annehmen
bzw. als solche gewertet werden – von der DDR selbst
schon gleich nicht. Daß man solche Beziehungen
wollte, macht die andere Seite des Widerspruchs einer
Nichtanerkennung
aus: Es gab die DDR nun einmal
als nicht unbedeutenden Faktor des gegnerischen
Machtblocks, der vom Rest der Welt auch als dieser
behandelt wurde und auf den die BRD im eigenen Sinne
Einfluß gewinnen wollte. Für ihre Bemühungen um
gewünschte Einflußnahme hatte die BRD aber solange
keine Adresse, wie sie sich Beziehungen zur DDR
verweigerte. So kam die Ausnahmesituation von
Beziehungen ohne Anerkennung auf die Welt –
ein Kuriosum, das manchen ehemaligen Verhandlungsführer
auf beiden Seiten nachträglich zum Spion degradiert.
Warum die DDR sich auf das von der BRD ersonnene
Konstrukt von Beziehungen unterhalb der „Schwelle“ der
Anerkennung überhaupt eingelassen hat, steht auf einem
anderen Blatt.
[7] Der Vertrag der Anerkennung enthält ja nicht Einvernehmen schlechthin, sondern – sehr grundsätzlich und sehr beschränkt – Einvernehmen über die wechselseitige Respektierung der Gewalten; über alles, was die voneinander wollen, ist dann Einvernehmlichkeit erst herzustellen.
[8] Auf diese Unterscheidung zwischen einem „punktuellen Einverständnis“ einerseits und einer ausdrücklicher Anerkennung andererseits legen Staatsvertreter besonders dann viel wert, wenn sie sich mit Vertretern von Staaten zu kommunizieren veranlaßt sehen, mit denen sie außer Feindschaft nichts verbindet. So mußte nach dem Leichentausch zwischen Israel und der Hisbollah das Eingeständnis, der Austausch wäre ohne iranische „Vermittlung“ nicht zustandegekommen, sofort in das richtige Licht gerückt und diplomatisch vermeldet werden, daß damit keinesfalls irgendein Schritt hin zur Anerkennung einer „iranischen Rolle im Nahen Osten“ intendiert sei.
[9] Auch das hat schon
Hegel gewußt – und für ziemlich normal befunden: Das
Verhältnis von Staaten ist das von Selbständigkeiten,
die zwischen sich stipulieren, aber zugleich über
diesen Stipulationen stehen.
(Grundlinien der Philosophie des Rechts, §
330, Zusatz)
[10] Die Vorstellung, daß es sich bei diesem zwischenstaatlichen Akt um „Tausch“ handelt, entstammt nur dem Formalismus des Willensverhältnisses, in dem beide Seiten sich dazu bereit erklären, das jeweils Konzedierte als im Lichte des eigenen Staatsinteresses „gleichwertig“ mit dem Erlangten zu betrachten und zu behandeln. Es sind Hoheitsrechte, die Staaten sich wechselseitig gewähren, daher ist es völlig sachgerecht, wenn die Partner so scheinbar inkommensurable Dinge wie Wiedergutmachungszahlungen gegen die „Aufnahme von diplomatischen Beziehungen“ oder die Inspektion von Waffenfabriken gegen das Recht, Öl zu verkaufen, aufrechnen.
[11] Beim Vertragsabschluß von Dayton war der – öffentlich registrierte – unwillige Gesichtsausdruck der Vertragsparteien natürlich diplomatische Absicht. Die ganze Welt sollte den Vorbehalt sehen, unter dem sich die Kriegsgegner zur Einigkeit hatten erpressen lassen.
[12] Es sind also schon ganz besondere Umstände vonnöten, damit Staaten sich – wie im Maastricht-Vertrag – auf einen „Fahrplan“ einigen, von dem sie behaupten, mit ihm hätten sie sich selbst „die Hände gebunden“, sich also ihres souveränen Rechts zum Widerruf begeben. Daß dies nicht ganz die Wahrheit der Sache ist, ist ihren wechselseitigen Warnungen vor den Zerwürfnissen zu entnehmen, die auf den Tisch kommen könnten, wenn sie sich ihrem eigenen Beschluß von damals nicht weiterhin gemeinsam unterwerfen: So drücken die „europäischen Partner“ ihr Bewußtsein davon aus, wie grundsätzlich die Souveränitätsverzichte sind, die sie in Maastricht gemeinsam zur Verhandlungsmasse erklärt, auf die sie sich aber damit eben nicht geeinigt haben.
[13] Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, Art. 26
[14] Als die europäischen Nationen bindendes Recht und insofern für sie auch verbindlichen Rechtszustand gibt es dieses, wenn und insoweit die Mitglieder der Union supranational vereinbarte Verfahrensmodalitäten zu ihrem nationalen Recht gemacht, sich selbst auf diesem Wege also auch der supranationalen Rechtsbehörde in Brüssel unterstellt haben.
[15] Es gehe um
eine ‚grundsätzliche Korrektur der Politik für die
neuen Länder‘, erklärte Schommer. Es dürfe nicht
zugelassen werden, daß die Entscheidungen für den
Aufbau Ost in das Ermessen der EU-Kommission gestellt
werden.
(HB 31.7.96). Diese Stellungnahme ist
insofern – diplomatisch gesehen – eine Frechheit, als
Deutschland die höhere Obergrenze für die
Subventionierung der Ostländer extra in den
Maastricht-Vertrag hat hineinschreiben lassen, damit
aber auch die EU-Aufsicht darüber akzeptiert hat, ob
diese Subventionen aus dem erlaubten Grund erfolgen,
nämlich wg. „teilungsbedingter Nachteile“.
[16] Wiener Übereinkommen, Art. 31
[17] Eine wunderbare
Leistung der deutschen Kunst der Auslegung soll in
diesem Zusammenhang nicht vergessen werden. Zur
Einleitung der Entspannungspolitik
mit der UdSSR
kamen die Deutschen irgendwie nicht umhin, zur Frage
der Grenzen und damit zu Krieg & Frieden in Europa
Stellung zu nehmen. Die Russen hätten sich da gerne –
wenigstens vertraglich – ihren Frieden vor dem
deutschen Revanchismus zusichern lassen, und sind
entsprechend mit dem Antrag vorstellig geworden, die
Deutschen möchten doch die Grenzen in Europa
anerkennen
. Die weigerten sich, weil sie sich
ihres Rechts nicht begeben wollten, selbige zu
verändern, womit aber andererseits mit der
russischen Diplomatie nicht ins Geschäft zu kommen war.
Der erzielte Kompromiß bestand darin, daß die Deutschen
nichts anerkannten, sich aber schon dazu
verpflichteten, die territoriale Integrität aller
Staaten in Europa in ihren heutigen Grenzen
zu
achten und auch keine Gebietsansprüche gegen irgend
jemand
zu erheben. Pacta sunt servanda, und
deswegen wurde anläßlich der
Vertragsunterzeichnung
mit einem ganz kurzen
Brief zur deutschen Einheit
den lieben Russen
mitgeteilt, was genau die deutsche Seite im
unterzeichneten Vertrag unterschrieben hat: Sie beehrte
sich festzustellen, daß die konzedierte
Unverletzlichkeit
aller Grenzen in Europa
überhaupt nicht in Widerspruch dazu steht, daß
ihr politisches Ziel nach wie vor die deutsche
Einheit
, also die Annexion der DDR bleibt.
[18] So erfreut sich
das diplomatische Instrument des Ultimatums
,
flankiert von Verhandlungen „in letzter Minute“, großer
Beliebtheit als Mittel, die Dringlichkeit des eigenen
Anliegens ebenso zu betonen wie den Willen zur
Vereinbarung. Der Gegenseite wird die Zwangsläufigkeit,
mit der sie sich widrigenfalls Gegenmaßnahmen
einhandelt, ebenso verdeutlicht wie die ihr gebotene
Gelegenheit, sich zur Verständigung einzufinden.
Natürlich kann man Ultimaten auch verlängern.
Drohungen, auf die die andere Seite sich nicht einläßt,
sind nämlich auch irgendwie blöd, wenn man selbst an
der angedrohten Maßnahme eigentlich nicht interessiert
ist.
[19] Die zur
Charakterisierung der Ergebnisse der imperialistischen
Konkurrenz oft leichtfertig und in moralischer
Prätention hingesagte Vokabel Abhängigkeit
gilt
in der Sache gleichermaßen für unterlegene wie
siegreiche Nationen. Daß es in der Staatenwelt
verschiedene Rangstufen gibt, die Mächtigen auf der
einen und die Minderbemittelten auf der anderen Seite,
ist ein Sachverhalt, der durchaus auch auf die
Beziehungen abfärbt, die zwischen ihnen walten – nur
ist eben Abhängigkeit
nicht deren Begriff. Der
Versuch, den wenigen mächtigen mit Bezug auf die vielen
abhängigen
Staaten die Konkurrenzlage moralisch
zum Vorwurf gereichen zu lassen, blamiert sich denn
auch konsequent. Diese Mächtigen sind es nämlich
selbst, die auf die Abhängigkeit verweisen, in der
sie stehen – und aus der sie dann eine
Freiheit im Umgang mit allen Minderbemittelten
ableiten, die an Willkür grenzt. Das drückt der moderne
Titel der universellen Abhängigkeit aus, unter der
gerade die erfolgreichen imperialistischen Konkurrenten
so leiden: Globalisierung der Außenpolitik
nennen Nationen den Umstand, daß sie Dienste der ganzen
Welt für sich in Anspruch zu nehmen gewohnt sind,
insoweit von allen abhängig und pausenlos
damit befaßt sind, gegen alle zu bestehen.
[20] Spätestens hier,
wenn es zwischen Nationen um die Ermittlung des Stands
ihrer Beziehungen geht, wird die Diplomatie in all
ihrer Abstrusität wieder einfach und durchschaubar. Das
kommt daher, daß die Diplomatie zwar immer geheime
Chefsache zwischen Staaten ist, aber schon immer auch
das Bedürfnis hat und befriedigt, das Volk wenigstens
die Essenz wissen zu lassen, für die sie ihre
Winkelzüge unternimmt. Zu diesem Zweck tritt sie neben
sich und formuliert den Klartext des ganzen Karussells,
das sich zwischen kindischen Posen der Respektbezeugung
und Erpressung dreht: Sie schreitet zur Popularisierung
der jeweiligen Zwischenresultate in der Konkurrenz der
Mächte und gibt öffentlich bekannt, wie es um
die außenpolitische Saturiertheit des
Nationalinteresses bestellt ist. Sie macht sich an die
Bildung und Unterhaltung einer politischen
Volksmeinung, deren ganzer Inhalt der aktuelle Stand
aller Antworten auf die ewiggleiche Frage ist,
wo überall und vor allem von wem dem
Recht der Nation Hindernisse entgegengestellt werden.
Diese Einschwörung des Volkes auf eine stete, in guten
wie in schlechten Stunden zu bewahrende Anteilnahme an
den Angelegenheiten, die die Behauptung der eigenen
Nation gegen ihre Konkurrenten betreffen, ist
keineswegs ein Privileg totalitärer Staaten
.
Auch wenn bei denen diese Art von Volksaufklärung, die
zurecht immer nur Freunde und Gegner der eigenen Nation
namhaft macht, zur Begriffsbildung mit beigetragen hat:
Sie und die dafür nötige Öffentlichkeit
gehört
in jede Nation, in der auf die Führung des
Volkes Wert gelegt wird. Ob diese hohe Aufgabe von
einem Diktator und einem entsprechenden Staatsmonopol
auf Öffentlichkeitsarbeit
wahrgenommen wird,
oder ob sie demokratisch-arbeitsteilig von einer 4.
Gewalt
erledigt und jedes außenpolitische Treffen
gleich nach Abschluß hinsichtlich seiner nationalen
Bedeutung
und Tragweite
vor laufenden
Kameras ausgeleuchtet wird, ist dabei ganz ohne Belang.
Allerdings bereichern die demokratischen
Einrichtungen auf ihre Weise noch das Repertoire, mit
dem der diplomatische Dienst am nationalen Interesse
versehen wird. Eine Gewaltenteilung
gestattet es
nämlich, die nationale Sache, für die eine
Regierung ihre Politik macht, von ungefähr so
viel maßgeblichen Standpunkten aus zu vertreten, wie es
in der Demokratie Körperschaften gibt, die ihr auch
noch dienen. So gibt es den Standpunkt des für die
Nation Erforderlichen nicht nur so, wie er politisch
exekutiert wird, sondern auch noch als ein Vielfaches
von stets nur mehr oder weniger affirmativen
Bekenntnisses zu seiner politischen Exekution
– worüber neben der offiziellen Diplomatie die
Öffentlichkeit als Sprachrohr des
Nationalinteresses wichtig und von den Betreffenden mit
Aufmerksamkeit verfolgt wird. Die anderen
unabhängigen Gewalten
einer demokratisch
verfaßten Nation sind in diesem Sinne gleichfalls für
einen diplomatischen Auslandseinsatz brauchbar. Hinter
einem Haftbefehl für fremde Staatsregierungen steht
eben wirklich nicht der Kanzler der Republik, sondern
die Freiheit der Justiz
– die formuliert dann
einen nationalen Vorbehalt, den er
diplomatisch verwenden kann. Und wenn Absagen
höflich erteilt sein wollen, spricht die
Legislative
ihr Machtwort, und dieselben, die
das Gesetz machen, verweisen auf die bestehende
Gesetzeslage
, die anderes einfach nicht zuläßt.
Sogar das Volk – in der Demokratie ja
bekanntlich der Souverän – kommt zur Ehre, auf
der diplomatischen Bühne seinen Part zu spielen – als
Instanz, auf die sich diplomatisch berufen wird. Dann
ist wegen einer zuhause grassierenden
Volksmeinung
ein z. B. Nachgeben bei
irgendwelchen Verhandlungen schlicht unmöglich.
[21] Die
Notwendigkeit, über das grundsätzliche Urteil Bescheid
zu wissen, das die andere Macht über die beiderseitigen
Beziehungen hegt, verschafft den Missionen den
interessanten Auftrag, aus allen erdenklichen Umständen
die jeweils aktuelle Willenslage ihres Gastgeberlandes
zu erschnüffeln und diesbezüglich Bericht zu erstatten
– eine zivile, allseits gewollte und respektierte
Abteilung der Auslandsaufklärung
neben der
anderen, die darüber nicht überflüssig wird.
[22] Nichts alberner
daher als die Feststellung, aus einem G7-Treffen sei –
womöglich schon wieder
– nichts
herausgekommen
. Gerade die großen Mächte, die in
den Benutzungs- und Kontrollfragen einer ganzen
Weltwirtschaft voneinander abhängig sind und eben
deshalb dauernd aneinandergeraten, haben es nötig, sich
darüber zu verständigen, in welchem allgemeinen
Verhältnis Gegensatz und Vereinbarkeit zwischen ihnen
gerade stehen.